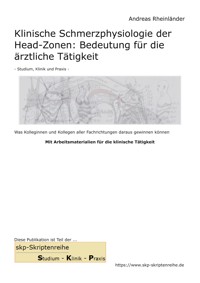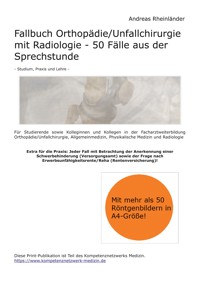Physiologie der Elektrolyte am Herzen - Funktion, Pathophysiologie und Pharmakologie E-Book
Andreas Rheinländer
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Physiologie, Anatomie und Pharmakologie des Herzens vermag selbst dickste Lehrbücher zu füllen, von der klinischen Kardiologie ganz zu schweigen. Allerdings gibt es praktisch keine Literatur zu den Elektrolyten und ihren spezifischen Funktionen und Wirkungen am Herzen. Daher ist es üblicherweise kaum möglich Fragen zu beantworten wie zum Beispiel: Wieso führt eine Hyper- und eine Hypokaliämie zur Tachyarrhythmie? Welche Rolle hat Chlorid am gesunden und am kranken Herzen? Hat das Herz ein Erregungsrückbildungssystem? Wie zeigen sich Störungen des Natrium- oder des Calciumspiegels im EKG? Welche Wirkung genau hat Magnesium auf das Herz? Wie erfolgt eigentlich die Erregungsleitung in den Vorhöfen? Wofür ist das Erkennen der J-Welle von Bedeutung? Diese und andere Fragen lassen sich mit Hilfe dieses Skriptes beantworten. Jedes Elekrolyt wird einzeln betrachtet, bezogen auf Physiologie, Pharmakologie und Pathophysiologie. Damit soll der fließende Übergang zwischen den Fachdisziplinen geschaffen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 46
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Grundlagen
Herzaktion, Rolle der Elektrolyte
- Arbeitsmyokard (Ruhemembranpotential und Erregungsausbreitung, Aktionspotential, Refraktärphase, Länge der Aktionspotentiale im Arbeitsmyokard der Vorhöfe und Kammern)
- Kardiomyozyten des Erregungsbildungssystems
EKG und Elektrolyte
- Spezifik des EKG
- Zustandekommen der EKG-Kurve
- Erregungsrückbildung im EKG
Kalium
- Subtypen von Kaliumkanälen, Funktion am Herzen
- Herzzyklus, EKG, Pathophysiologie und Pharmakologie
Natrium
- Funktion am Herzen, Herzzyklus, EKG
- Pathophysiologie und Pharmakologie
Calcium
- Funktion am Herzen
- Herzzyklus, EKG, Pathophysiologie und Pharmakologie
Magnesium
- Funktion am Herzen
- Herzzyklus, EKG, Pathophysiologie und Pharmakologie
Chlorid
- Bedeutung von Chloridkanälen
- Wirkung von Chlorikanälen, Funktion am Herzen
- Herzzyklus, EKG, Pathophysiologie und Pharmakologie
Erregungsleitung der Vorhöfe
- Fortleitung in den Vorhöfen, Erregungsleitung zwischen den Vorhöfen
Frühe Repolarisation
- Übersicht, Definition
Quellen (Auswahl und Korrespondenzhinweis)
Kontaktdaten:
Andreas Rheinländer
Kontakt über:
skp-Skriptenreihe
https://www.skp-skriptenreihe.de
Quelle des Titelbildes: Eigens erstellte Grafik.
Alle Rechte vorbehalten.
1. Auflage 01/2025
Urheberrecht
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie jedwede Form von Speicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme aller Art.
Haftung
Die medizinische Wissenschaft unterliegt ständigen Veränderungen. Diese werden aus Studien und Grundlagenforschung gewonnen. Dadurch können Informationen schnell an Aktualität verlieren. Für zahlreiche Sachverhalte liegen auch Untersuchungsdaten mit widersprüchlichen Ergebnissen vor. Der Inhalt dieses Buches wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Jede Leserin und jeder Leser ist angehalten alle hier dargebotenen Inhalte selbstständig nachzuprüfen und insbesondere in jedwedem klinischen oder wissenschaftlichen Kontext durch das Hinzuziehen weiterer Quellen zu prüfen. Eine Haftung für die Verwendung der hier dargebotenen Inhalte kann nicht übernommen werden. Aus wissenschaftlicher und berufsrechtlicher Sicht wäre der Verlass auf eine Einzelquelle ohnehin fahrlässig.
Vorwort
Die Physiologie, Anatomie und Pharmakologie des Herzens vermag selbst dickste Lehrbücher zu füllen, von der klinischen Kardiologie ganz zu schweigen.
Betrachtet man die zur Verfügung stehenden Quellen im Detail, so fällt auf, dass den Elektrolyten und ihren spezifischen Funktionen und Wirkungen am Herz häufig zum Teil keine Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Die vorliegende Arbeit möchte daran anknüpfen und diese Lücke füllen, indem den einzelnen Elektrolyten und ihren physiologischen, pharmakologischen und pathophysiologischen Wirkungen am Herzen ein besonderer Fokus zuteil wird.
Damit soll der fließende Übergang zwischen den einzelnen Disziplinen geschaffen werden.
Zu diesem Zwecke ist dieses Skript wie folgend aufgebaut:
- zur Einführung und zur gesonderten Verflechtung dienen die Abschnitte Grundlagen und Herzzyklus sowie Rolle der Elektrolyte
- allen Elektrolyten ist jeweils ein eigener Abschnitt gewidmet
- jede Abhandlung enthält eine Übersicht, beschreibt seine Funktion am Herzen, sowohl am Arbeitsmyokard wie auch am Erregungsbildungs- und -leitungssystem, im Rahmen des Herzzyklus, des EKG sowie als pharmakologischer Angriffspunkt, basierend auf den entsprechenden Pathophysiologien
Exkurse und Zusatzinformationen sind kursiv geschrieben und runden die jeweilige Themenbehandlung ab.
Grundlagen
Elektrolyte sind Stoffe, die in Lösungen oder Schmelzen elektrisch leitfähig sind, weil sie in Kationen und Anionen dissoziieren. In der Humanmedizin werden zwei Gruppen unterschieden. Zum einen ein- und zweiwertige Ionen der Alkali- und Erdalkalimetalle. Zum anderen Chlorid, Hydrogencarbonat ("Bikarbonat"), Phosphat, Protonen und Proteinanionen. Auch Sulfationen sowie organische Säuren können dazu gezählt werden.
Wenn im klinischen Sprachgebrauch von Elektrolyten ("Elektrolytbestimmung") gesprochen wird, sind häufig Natrium-, Kalium- und Calciumionen gemeint, wenngleich andere Ionen ebenso wichtig sind.
Elektrolyte sind lebensnotwendige physikochemische Bestandteile der intra- und extrazellulären Flüssigkeit. Der menschliche Körper besteht zu etwa 2/3 aus Wasser und wiederum etwa 2/3 des Wassers befinden sich im intrazellulären Raum.
Für eine durchschnittliche Person (junger Mann, 70 kg) lassen sich die Wasserräume über eine Potenzfunktion zur Basis 3 näherungsweise beschreiben:
- 30: 1 l transzelluläre Flüssigkeit (Liquor cerebrospinalis, Kammerwasser, Flüssigkeit in Gelenkhöhlen, Peritoneal-, Pleura- und Herzhöhlen)
- 31: 3 l Blutplasma
- 32: gerundet 10 l interstitielle Flüssigkeit
- 33: gerundet 30 l intrazelluläre Flüssigkeit
Die gesamte extrazelluläre Flüssigkeit ist von der wässrigen Phase des Blutplasmas abhängig. Dieser Umstand bedingt, dass Veränderungen des Blutplasmas sich auf alle Flüssigkeiten auswirken, bei denen es sich um Ultrafiltrate des Blutes handelt. Dazu gehören maßgeblich das Kammerwasser, der Liquor cerebrospinalis und die Flüssigkeit in der Peritonealhöhle, den beiden Pleurahöhlen und die des Herzbeutels.
Veränderungen der wässrigen Phase des Blutplasmas wirken sich auch auf die Zusammensetzung des Urins aus - abhängig vom Ausmaß der Veränderungen und der zeitnahen Endharnbildung.
Grundprinzip
Alle Elektrolyte finden sich sowohl intra- als auch extrazellulär in jeweils spezifischen Konzentrationen. Elektrolyte sind in ständiger Bewegung: von intra- nach extrazellulär und zurück. Dies erfolgt durch Kanäle und Transporter in der Zellmembran.
Ionenpumpen in der Zellmembran, allen voran die Natrium-Kalium-ATPase, sorgen unter Energieaufwand für die Erzeugung und Aufrechterhaltung eines Konzentrationsgradienten, was die Bewegung der Teilchen durch die Kanäle und Transporter bedingt.
Der aufgebaute Konzentrationsgradient wiederum kann physikalisch als Potentialdifferenz, d.h. als Spannung aufgefasst werden. Alle Körperzellen haben ein Ruhemembranpotential: eine bestimmte Spannung, welche sich aus den Gleichgewichtspotentialen aller beteiligten Ionensorten, die entsprechend ihrer Leitfähigkeit gewichtet werden, ergibt. Das Gleichgewichtspotential beschreibt die Spannung, bei dem die elektrische und chemische Triebkraft für ein Ion im Gleichgewicht ist.
Erregbare Zellen können ihr Membranpotential ändern und eine elektrische Erregung (Aktionspotential) erzeugen. Dazu zählen Nerven- und Muskelzellen.
Plasmaelektrolyte und Herzfunktion