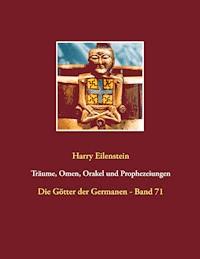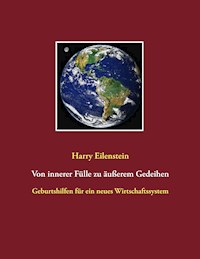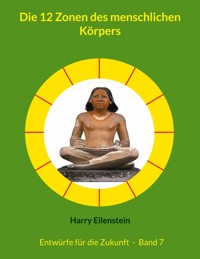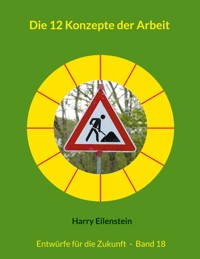Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die 12 Betrachtungsweisen der Sozialberufe" beschreibt die Vielfalt der Sozialberufe und zeigt, daß diese Berufe zwar nicht sonderlich geachtet sind, solange im eigenen Leben alles gut läuft, aber daß sie doch jeder braucht, wenn das eigene Leben schwierig wird. Hier besteht ein großes Entwicklungspotential bezüglich der Sichtweise auf diese Berufe und ihrer Wertschätzung und Förderung. Insbesondere die Grundlage aller Menschen in unserer Gesellschaft - Kindergarten, Schule, Ausbildung - wird derzeit in einem solchen Ausmaß vernachlässigt, daß dies nicht ohne gravierende Folgen bleiben kann. In den Büchern dieser Reihe werden die zwölf Tierkreiszeichen als Hilfsmittel verwendet, um das jeweilige Thema möglichst umfassend in zwölf Kapiteln aus den Blickwinkeln dieser zwölf verschiedenen Sichtweisen auf die Welt zu beschreiben. Dadurch wird eine ausgewogenere, umfassendere und tiefere Einsicht in das jeweilige Thema erlangt als es ohne solch ein Raster möglich wäre. Durch die Verwendung des Tierkreises als Forschungs-Hilfsmittel werden zum einen die gröbsten Einseitigkeiten in der Betrachtung vermieden und zum anderen werden durch dieses Vorgehen diese 12 Sichtweisen auch als organische Teile eines Ganzen deutlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsübersicht
Warum 12?
Was ist ein sozialer Beruf?
1. Direktheit
2. Besitz
3. Schulen
4. Kindergärten
5. Entfaltung
6. Pflege
7. Hilfe
8. Krisen
9. Förderung
10. Bewahrung
11. Gesellschaft
12. Gedeihen
Bücher von Harry Eilenstein
Englische Buch-Ausgaben
Warum 12?
Alle Bücher dieser Reihe haben genau 12 Kapitel – was sich ja auch in den Titeln dieser Bücher widerspiegelt. Warum?
In diesen Büchern wird der Tierkreis als Matrix von 12 verschiedenen Sichtweisen auf die Welt verwendet, um das Thema des Buches möglichst umfassend in 12 Kapiteln zu betrachten. Dadurch wird eine ausgewogenere, umfassendere und tiefere Einsicht in das jeweilige Thema erlangt als es ohne ein solches Raster, ohne eine solche Matrix möglich wäre.
Der Tierkreis wird in dieser Buch-Reihe als Forschungs-Hilfsmittel benutzt, durch das die Einseitigkeiten in der Betrachtung zumindest vermindert werden können. Weiterhin werden durch dieses Vorgehen diese 12 Sichtweisen auch als Ergänzungen zueinander, als organische Teile eines Ganzen deutlich.
Die Inspiration zu diesem Vorgehen stammt aus Hermann Hesses Roman „Das Glasperlenspiel“, für das er 1946 den Literatur-Nobelpreis erhielt. In diesem Roman beschreibt er die öffentlichen Darstellungen von Übersichten und Gesamtbetrachtungen, die mithilfe von verschiedenen allgemeinen Strukturen wie z.B. dem Ba Gua aus dem chinesischen Feng-Shui angefertigt und aufgeführt werden.
Diese Buch-Reihe ist ein Versuch, Hesse‘s Idee im ganz Kleinen konkret zu verwirklichen.
Die Blickwinkel der 12 Tierkreiszeichen sind:
Widder:
Spontaner
Stier:
Genießer
Zwilling:
Neugieriger
Krebs:
Familienmensch
Löwe:
Egozentriker
Jungfrau:
Handwerker
Waage:
Schöngeist
Skorpion:
Tiefgründiger
Schütze:
Idealist
Steinbock:
Realist
Wassermann:
Theoretiker
Fische:
Träumer
Was ist ein sozialer Beruf?
Intuitiv hat jeder eine Vorstellung davon, was ein sozialer Beruf ist, aber intuitive Vorstellungen sind nicht immer unbedingt bei allen Menschen genau gleich. Daher könnte es evtl. hilfreich sein, den Begriff „sozialer Beruf“ zunächst einmal genauer zu definieren.
Nun – ein sozialer Beruf hat irgendwas mit anderen Menschen zu tun … so was wie Krankenschwester … Doch mit dieser ein wenig ungenauen Definition ist auch der Steuerfahnder ein sozialer Beruf, da er ja ganz auf andere Menschen ausgerichtet ist, die den Staat betrügen. Und auch ein Soldat ist ganz auf andere Menschen ausgerichtet – um die Soldaten des feindlichen Staates zu töten. Doch das entspricht ja nicht so recht der landläufigen Vorstellung von einem sozialen Beruf.
Also vielleicht „helfender Beruf“? Eine Krankenschwester hilft schließlich anderen Menschen. Aber auch der Automechaniker in der Autowerkstatt hilft anderen Menschen, doch die Tätigkeit dieses Helfers würde wohl kaum jemand als „soziale Tätigkeit“ bezeichnen.
Man könnte es mit „auf das Wohlergehen anderer Menschen ausgerichtete Tätigkeit“ versuchen. Das beschreibt immerhin das Grundgefühl, das allgemein mit dem Begriff „sozialer Beruf“ verbunden ist. Das würde dann aber auch auf Polizisten, Staatsanwälte, Richter und Gefängniswärter zutreffen, da diese die Gemeinschaft vor Gewalttätern u.ä. schützen. Doch es ist mehr als nur ein wenig zweifelhaft, daß die Insassen von Gefängnissen zustimmen könnten, daß diese Berufe ebenfalls sozial sind.
Noch ein anderer Ansatz: Wie wäre es mit „auf hilflose Menschen ausgerichtete Tätigkeit“? Das ist zunächst einmal richtig, wenn man dabei an eine Krankenschwester denkt, doch auch der Lehrer ist unzweifelhaft ein sozialer Beruf. Aber kümmert sich ein Lehrer um „hilflose Menschen“? Diese Definition würde wohl kaum einem Schüler besonders gut gefallen …
Vielleicht „ein Beruf, über den sich andere freuen“? Dann wären auch der Möbelpacker und ein guter Bonbon-Erfinder soziale Berufe, was jedoch ein wenig seltsam klingt.
„Der etwas tut, was sich ein anderer wünscht“? Das trifft für die Krankenschwester zu, aber auch für eine Prostituierte – und das ist ein Beruf, bei dem man erst nach einigem Nachdenken darauf kommt, daß man ihn evtl. auch zu den sozialen Berufen zählen könnte.
Oder: „Ein sozialer Beruf ist ein Dienstleistungsberuf.“ Aber würde man bei einem Taxifahrer sagen, daß er einen sozialen Beruf ausübt, obwohl er offensichtlich ein Dienstleister ist? Und wie steht es mit dem freundlichen Herrn, der den eigenen PC und das eigene Handy repariert, wenn es mal wieder nicht mehr das tut, was man selber will. Das ist zwar ein Dienstleistung, aber so richtig sozial sieht das eigentlich nicht aus, und gibt es sogar das weitverbreitete Vorurteil, daß diese ganzen Programmierer und PC-Freaks eigentlich keine sonderlich stark ausgeprägte soziale Seite haben, sondern eher Eigenbrötler sind …
Nur noch ein letzter Versuch: „Soziale Berufe kümmern sich um das, was sozial wichtig ist“. Paßt das? Es paßt zwar – aber gibt es denn überhaupt irgendeinen Beruf, der nicht „sozial wichtig“ ist? Würde es diesen Beruf überhaupt geben können, wenn er nicht „sozial wichtig“ wäre, d.h. wenn die Gemeinschaft nicht bereit wäre, für diese Tätigkeit etwas zu zahlen? Wohl kaum …
Wie man sieht, kann man den Begriff „sozialer Beruf“ leicht von immer neuen Seiten her betrachten und diesen Begriff dabei immer weiter ausdehnen. Letztlich kommt man dabei vermutlich zu dem Schluß, daß jeder Beruf auch ein sozialer Beruf ist, da jeder Beruf auch Auswirkungen auf viele andere Menschen hat – selbst der Beruf des Straßenkehrers, des Bäckers und der Putzfrau. Doch wenn man einen Begriff so weit ausdehnt, daß er alles umfaßt, wird er weitgehend nutzlos, da er dann keine Unterscheidung mehr zu Dingen beinhaltet, die nicht zu diesem Begriff gehören.
Immerhin hat diese Betrachtung gezeigt, daß es bei „sozialen Berufen“ um die Wirkung der Tätigkeit auf die Gemeinschaft geht. Daher ist der naheliegende Gegenpol zu „sozialer Beruf“ so etwas in der Art wie „egoistischer Beruf“ oder „sachbezogener Beruf.“ Ein egoistischer Beruf wäre dann z.B. der Börsenmakler, der mit Spekulationen Geld verdienen will, was sicherlich keine soziale Tätigkeit ist, da er im Grunde nur den Gewinn abschöpft, den andere erwirtschaften. Ein sachbezogener Beruf wäre z.B. der Bomben-Entschärfer, wobei die vorübergehende Evakuierung des gesamten Umfeldes durchaus eine soziale Wirkung ist – und die Menschen, die da sicherheitshalber evakuiert werden, sind dem Bomben-Entschärfer sicherlich dankbar, daß er sein eigenes Leben riskiert, um die Sicherheit all dieser Menschen in ihrem Wohngebiet wiederherzustellen.
So richtig weit haben all diese Versuche, das Wesen der „sozialen Berufe“ zu definieren, noch nicht geführt, aber vielleicht ist dadurch immerhin eine etwas genauere intuitive Vorstellung darüber, was ein „sozialer Beruf“ ist, entstanden.
So ganz zufriedenstellend ist das jedoch alles noch nicht.
Es ist ein altbewährtes Mittel, daß man, wenn keine befriedigende Antwort auf eine Frage findet, die Richtung der Fragestellung ändert. Da der Versuch, den Begriff „sozialer Beruf“ klar und griffig zu definieren, offenbar nicht so einfach ist, könnte man stattdessen auch fragen, warum dieses Buch sich überhaupt mit diesen „sozialen Berufen“ beschäftigt. Vielleicht läßt sich ja auf diese Weise etwas mehr Klarheit schaffen.
Ein Grund für das Schreiben dieses Buches ist die Gegenüberstellung der egoistischen Grundeinstellung, mit der die Menschen immer erst einmal auf sich selber schauen, und der sozialen Grundeinstellung, bei der die Menschen immer erst einmal auf die Gemeinschaft schauen. Diese beiden Haltung durchziehen die gesamte Gesellschaft – z.B. als die liberalen Parteien, die die Freiheit des Einzelnen verteidigen, und die sozialen Parteien, die das Wohlergehen der gesamten Gemeinschaft anstreben. Es gibt also eine Berufsgruppe, die zu der sozialen Lebenseinstellung und Handlungsweise der Menschen gehört und eine Berufsgruppe, die zu der egoistischen Lebensweise der Menschen gehört: Als Beispiele kann man die bereits genannte Krankenschwester und den ebenfalls bereits genannten Börsenspekulanten nehmen. natürlich wird es dazwischen auch Mischformen geben, die zu verschiedenen Anteilen sowohl egoistisch als auch sozial sind.
Da es diese beiden gegensätzlichen Grundeinstellungen gibt, könnte es interessant sein, sich diese beiden Grundhaltungen und die zu ihnen gehörenden Berufe einmal genauer anzusehen. Wie stehen innerhalb der Gesellschaft? Was verdienen sie? Wie sind sie angesehen? Welches Image haben sie? Was geschieht, wenn eine der beiden Gruppen sehr klein und die andere sehr groß ist? Ist das in allen Ländern gleich?
Möglicherweise ergeben sich aus einer solchen Betrachtung ja Erkenntnisse, die zunächst einmal nicht offensichtlich gewesen sind, aber die dennoch wichtig werden können, wenn man sie erst einmal erfaßt hat.
Nun – das weiß man jedoch immer erst am Ende einer solchen Betrachtung … ob sie zu neuen Erkenntnissen geführt hat oder nicht. Aber wenn man solch eine Betrachtung erst gar nicht anstellt, weiß man natürlich auch nicht, ob man nicht vielleicht etwas Wesentliches übersehen hat.
1. Direktheit
das Prinzip
Wie handeln wir? Sind wir egoistisch oder sind wir hilfsbereit? … Das läßt sich nicht allgemein sagen, denn das hängt von der Situation ab, in der wir stehen:
Die Hilfsbereitschaft steigt, wenn etwas gleich vor uns geschieht – und sie sinkt, wenn etwas irgendwo fern in Afrika geschieht.
Die Hilfsbereitschaft steigt, wenn etwas ganz dringend ist wie der Brand eines Hauses in unserer Straße – sie sinkt, wenn irgendwo in New York ein Haus brennt.
Unsere Hilfsbereitschaft hängt also von unserer Nähe zum Ereignis und von unserer Betroffenheit ab. Das zeigt, daß Hilfsbereitschaft ein Instinkt ist: Wir sind hilfsbereit, wenn wir etwas sehen können und wenn es unsere Gefühle anspricht. Das bedeutet wiederum, daß unsere Hilfsbereitschaft für unser eigenes Überleben wichtig ist, denn sonst hätten wir Menschen keinen Hilfsbereitschafts-Instinkt entwickelt.
Wir sind also Herdentiere, d.h. wir brauchen den Schutz der Gemeinschaft und wir sorgen für den Schutz der Gemeinschaft. Unser Egoismus, der sich auf unser eigenes Wohlergehen ausrichtet, ist also in einen Altruismus eingebettet, der sich auf das Wohlergehen der Gemeinschaft ausrichtet, von der wir ein Teil sind.
Wir sind also am hilfsbereitesten, wenn es um unsere Familie, unsere Sippe, unser Dorf und evtl. noch um unser Land geht.
Dieser Instinkt hat sich bei den Säugetieren und bei den Vögeln entwickelt – er begann mit dem Brutpflegeinstinkt und hat sich dann auf die ganze Herde bzw. den Schwarm ausgeweitet.
Hilfsbereitschaft ist etwas, was spontan und emotional in Gang gesetzt wird, weil sie in den Instinkten verankert ist. Wir planen nicht, hilfsbereit zu sein, wir überlegen das auch nicht in jedem Fall neu, sondern wir reagieren einfach auf die Situation, die wir vor uns sehen – und rufen den Krankenwagen, wenn wir einen Unfall sehen.
Wir tun das, weil es richtig ist – weil uns unsere Instinkte sagen, daß das richtig ist … und weil wir instinktiv hoffen, daß auch andere uns helfen werden, wenn wir selber in Not geraten. Wir vertrauen instinktiv auf die Gemeinschaft – ganz egal, was wir bewußt denken.
zu wenig Hilfsbereitschaft
Es gibt zwar in jedem Menschen den Hilfsbreitschafts-Instinkt, aber er ist nicht in jedem Menschen gleich stark. Zudem kann die Ferne zu denen, die leiden, das Handeln aus Hilfsbereitschaft verhindern. Was interessiert mich ein Krieg, wenn er nur weit genug weg stattfindet? Doch wenn das Unglück – auch wenn es weit fort stattfindet – heftig genug ist wie z.B. ein Tsunami, dann erwacht dennoch durch die Bilder in den Nachrichten die Hilfsbereitschaft.
Die Menschen sind natürlich auch in der Lage, über die Welt nachzudenken und sich ein Weltbild zu erschaffen, an dem sie sich dann orientieren. Sie setzen sich zudem eine Grenze, bis zu der das Gefühl von „wir“ und das Gefühl von „dringend“ reicht. Wenn diese Grenze sehr eng gezogen wird – z.B. „meine Familie in Deutschland“ – dann wird ein großer Teil der Welt und ein großer Teil der Menschen zu „Fremden in der Fremde“, die völlig bedeutungslos sind – solange sie fern genug bleiben. Um sie braucht man sich dann nicht zu kümmern – sie sind ohne Bedeutung für mich, ihr Schicksal ist vollständig von meinem eigenen Schicksal getrennt, ihr Wohlergehen oder Leid hat keinen Einfluß auf mich.
Diese Abgrenzung kann zudem noch durch den Rivalitäts-Instinkt verstärkt werden. Die anderen wollen mir was wegnehmen? Das wollen wir doch erst mal sehen! Die anderen wollen mir was vorschreiben? Da haben sie sich aber geirrt!