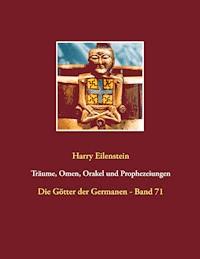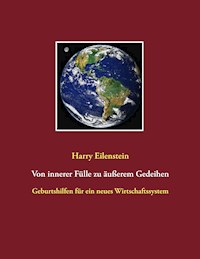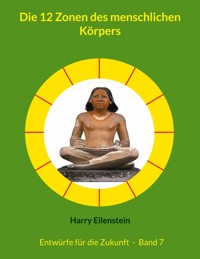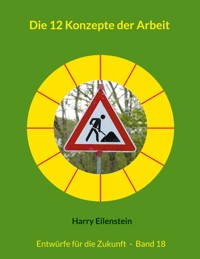Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Demokratien haben es zur Zeit - also 2025 - ein wenig schwer, wohingegen die Diktaturen im Vormarsch sind. Dabei sind manche Demokratien zum Glück noch immer Demokratien, aber werden in zunehmendem Maße von autokratischen Herrschern zu Pseudo-Demokratien oder Beinahe-Diktaturen umgebaut. Da liegt es nahe, sich einmal genauer anzuschauen, wo die Schwachpunkte der Demokratien liegen und was man unternehmen könnte, um diese Schwachpunkte zu heilen. Dabei fällt auf, daß die Art, wie derzeit in Demokratien gewählt wird, dem Sieger-Prinzip entspricht. Dadurch wird logischerweise auch die Sieger-Mentalität und folglich auch die Entstehung von Despoten gefördert - was jedoch ganz und gar nicht im Sinne des Erfinders ist. Es wird daher eine Weiterentwicklung der heutigen pubertären Konkurrenz-Demokratie zu einer erwachsen Kooperations-Demokratie gebraucht. In diesem Buch finden sich 12 konkrete Ansätze zu dieser Weiterentwicklung der Demokratien, durch die sie dann hoffentlich in der Lage sein werden, die derzeitigen Probleme der Menschheit zu lösen ... anstatt in das Pseudo-Königtum der Diktaturen zurückzufallen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsübersicht
Warum 12?
Teilnahme
Wohlstand
Meinungsfreiheit
Betroffenheit
Individualität
Sachkenntnis
Wahlen
Richtung
Regeln
Utopie
Volksherrschaft
Warum 12?
Alle Bücher dieser Reihe haben genau 12 Kapitel – was sich ja auch in den Titeln dieser Bücher widerspiegelt. Warum?
In diesen Büchern wird der Tierkreis als Matrix von 12 verschiedenen Sichtweisen auf die Welt verwendet, um das Thema des Buches möglichst umfassend in 12 Kapiteln zu betrachten. Dadurch wird eine ausgewogenere, umfassendere und tiefere Einsicht in das jeweilige Thema erlangt als es ohne ein solches Raster, ohne eine solche Matrix möglich wäre.
Der Tierkreis wird in dieser Buch-Reihe als Forschungs-Hilfsmittel benutzt, durch das die Einseitigkeiten in der Betrachtung zumindest vermindert werden können. Weiterhin werden durch dieses Vorgehen diese 12 Sichtweisen auch als Ergänzungen zueinander, als organische Teile eines Ganzen deutlich.
Die Inspiration zu diesem Vorgehen stammt aus Hermann Hesses Roman „Das Glasperlenspiel“, für das er 1946 den Literatur-Nobelpreis erhielt. In diesem Roman beschreibt er die öffentlichen Darstellungen von Übersichten und Gesamtbetrachtungen, die mithilfe von verschiedenen allgemeinen Strukturen wie z.B. dem Ba Gua aus dem chinesischen Feng-Shui angefertigt und aufgeführt werden.
Diese Buch-Reihe ist ein Versuch, Hesse‘s Idee im ganz Kleinen konkret zu verwirklichen.
Die Blickwinkel der 12 Tierkreiszeichen sind:
Widder:
Spontaner
Stier:
Genießer
Zwilling:
Neugieriger
Krebs:
Familienmensch
Löwe:
Egozentriker
Jungfrau:
Handwerker
Waage:
Schöngeist
Skorpion:
Tiefgründiger
Schütze:
Idealist
Steinbock:
Realist
Wassermann:
Theoretiker
Fische:
Träumer
1. Teilnahme
a) Prinzip: Eigeninitiative
Die Monarchien und die Diktaturen beruhen auf dem Prinzip des Gehorsams – die Demokratien beruhen auf Eigeninitiative. Die Einzelnen müssen in einer Demokratie für sich selber klären, was sie wollen, und können das dann durch die Wahl einer Partei zu der Richtschnur für das Verhalten der Regierung machen. Dasselbe gilt auch für die Wahl der Vertreter für das Land und für die Gemeinde. Die Gesamtheit der Einzelnen wählt aus, wer diese Gesamtheit auf welche Weise lenken soll.
Für dieses Prinzip der Wahlen, durch das der Wille der Einzelnen zu dem Willen der Gesamtheit zusammengefaßt wird, ist die Initiative der Einzelnen notwendig. Wer nicht wählen geht, hat auch keinen Einfluß darauf, wer gewählt wird und folglich anschließend regiert.
Allerdings werden zunächst nur Parteiprogramme und Personen gewählt – und es ist allgemein bekannt, daß vor der Wahl viel versprochen und nachher nicht ganz so viel auch gehalten wird. Und manchmal setzen die Gewählten auch etwas ganz anderes um als das, was sie zuvor gesagt haben. Man wählt also in erster Linie Personen und nicht ein bestimmtes Verhaltensmuster dieser Personen. Es gibt zwar auch ein Parteiprogramm oder ähnliches, aber auf dessen Umsetzung kann man sich verlassen.
Man legt bei einer Wahl also den eigenen, die Gemeinschaft gestaltenden Willen in die Hände der Gewählten. Um eine allzu große Eigenmächtigkeit der Gewählten zu verhindern, sind die Parteien eingeführt worden, die mit ihrem Parteiprogramm (idealerweise) den festen Rahmen für die Entscheidungen und das Handeln der Gewählten dieser Partei bilden.
Da die Gestaltungsmöglichkeiten des Wählers auf die meist vierjährliche Wahl einer Partei in Bund, Land und Gemeinde begrenzt ist, gibt es in manchen Demokratien die Möglichkeit von Volksentscheiden, die Abstimmungen zu bestimmten Themen ermöglichen sollen. Naturgemäß sind die gewählten Vertreter der Parteien nicht sonderlich erpicht darauf, daß Volksentscheide durchgeführt werden, da die Parteien lieber selber entscheiden als das Volk über ein Themen entscheiden zu lassen.
Schließlich können sich die Wähler auch noch zusammenschließen und eine neue Partei mit einem Programm gründen, daß ihren eigenen Zielen entspricht.
Der Einfluß des Einzelnen ist in einer Demokratie also recht begrenzt – aber es muß ja auch einen Mechanismus geben, durch den die vielen verschiedenen Willen der Einzelnen zu einer Handlung der Gemeinschaft gebündelt werden. Dieser Mechanismus sind in der Demokratie die Wahlen und die Parteien.
b) Schwäche: Eigenwerbung
Abgesehen von dem Umstand, daß sich der Einfluß der Einzelnen auf die Politik darauf beschränkt, daß man nur alle vier Jahre eine Partei wählen kann, hat das Prinzip der Wahl noch einen großen Nachteil: Es wird nicht der gewählt, der die besten Argumente oder gar die größte Weisheit hat, sondern es wird der gewählt, der sich selber am besten verkaufen kann und der am besten für sich selber werben kann.
Eine Wahl bzw. die Vorbereitung zu einer Wahl folgt also demselben Konkurrenz-Prinzip wie die freie Marktwirtschaft. Konkurrenz bedeutet Kampf um den größeren Anteil: den Marktanteil und den Wählerstimmenanteil.
Nun sind Kampf und Konkurrenz etwas, was in dem Menschen angelegt ist. Diese Fähigkeit ist notwendig um zu überleben – sie existiert auch schon auf der körperlichen Ebene als die weißen Blutkörperchen, die z.B. dafür sorgen, daß Bakterien im Blut abgetötet und Wunden verschlossen werden.
Das Kämpfen um den eigenen Vorteil ist ein Element, ohne das kein Lebewesen überleben kann – ohne Selbsterhaltungs-Instinkt keine Existenz … Das bedeutet, daß man diesen Kampf akzeptieren muß, aber daß dieser Kampf auf eine Weise kanalisiert werden muß, die dazu führt, daß am Ende etwas Gutes dabei herauskommt.
In der Wirtschaft hat dies dazu geführt, daß die freie Marktwirtschaft zur Sozialen Marktwirtschaft erweitert wurde: Der ungehemmte Egoismus der Freien Marktwirtschaft wurde durch den Blick auf die Gemeinschaft zur Sozialen Marktwirtschaft ergänzt. Wenn dem Egoismus der Blick auf das Ganze und auf das Gemeinwohl fehlt, entsteht die Gefahr von Revolten und die Gefahr der Gründung einer militärischen oder kommunistischen Diktatur.
Die Schwäche der Wahlen besteht darin, daß sie ein Kampf um das größte Stück Kuchen durch diejenigen ist, die gewählt werden wollen. Das führt dazu, daß sie das tun, was am wahrscheinlichsten dazu führt, daß sie gewählt werden. Dabei gehen oft zwei Dinge unter: 1. die sachliche Auseinandersetzung mit einem Thema, und 2. das Bewußtsein, daß die allermeisten Parteien eine gute Absicht haben.
Das Prinzip der Wahlen führt also dazu, daß ein Kampf zwischen den Parteien geführt wird – was leider in der Regel die Wirkung hat, daß wirklich informative oder gar tiefgründige Gespräche die Ausnahme sind, und es führt auch dazu, daß sich die Parteien gegenseitig schlecht machen, sich zu Feinden erklären oder Unvereinbarkeitsbeschlüsse fassen.
Wahlen neigen also dazu, die Parteien zu polarisieren, obwohl die Wahlen doch eigentlich dazu dienen sollten, den Willen der vielen Einzelnen zu einem Gesamtwillen zu koordinieren, der ein möglichst hohes Gesamtwohl in dem Staat erschafft. Wahlen sind auf jeden Fall besser als eine Diktatur, in der nur ein einziger alles bestimmt, aber Wahlen sind auch ein Verfahren, das die notwendige Kooperation einem Staat zunächst einmal eher behindert als fördert.
c) Heilmittel: Kooperation
Wie kann man nun diese Schwäche der Demokratien – die Destruktivität des reinen Konkurrenz-Prinzips – heilen? Wie lassen sich analog zu der Weiterentwicklung der Freien Marktwirtschaft zur Sozialen Marktwirtschaft die Wahlen zu „kooperativen Wahlen“ weiterentwickeln?
Der Wettstreit der Ansätze, Ideen und Strategien ist gut, denn bei einer Vielfalt von Vorschlägen kann das Beste ausgewählt werden. Allerdings ist die Annahme, daß ein einzelner dieser Vorschläge bereits das Beste ist, eher kurzsichtig und beruht auf dem „Sieger im Wettstreit“-Motiv. Dabei wäre des durchaus denkbar und sogar wahrscheinlich, daß ein Gemisch aus allen Vorschlägen, also ein Zusammenwirken von mehreren Vorschlägen die sinnvollste Lösung wäre.
Das Problem dabei ist, daß die Parteien auch selber einen „Überlebensinstinkt“ haben und sich gegen die anderen Parteien durchsetzen wollen. Das erschwert leider die Fähigkeit, auch Ideen aus anderen Parteien zu loben oder auch nur mit allen Parteien ein ruhiges, sachliches Gespräch über die bestmögliche Lösung zu führen.
Der Überlebensinstinkt der Parteien entspricht den Eigenschaften des Sternzeichens Widder – das Heilmittel dafür könnte daher der Gegenpol des Widders, also das Sternzeichen Waage sein. Das Prinzip der Waage ist die Kooperation. Das Heilmittel für den Kampf der Parteien während der Wahl und auch zwischen den Wahlen ist folglich die Erkenntnis der Notwendigkeit der Kooperation – die bedächtige, weitsichtige Kooperation der Waage ist das Heilmittel für den ungehemmten, kurzsichtigen Egoismus des Widders.
Es bleibt jedoch die Frage, wie man – nachdem man erkannt hat, daß das Eigenwohl im Rahmen des Gesamtwohls am besten gedeiht – einen tragfähigen Rahmen für „Konkurrenz im Rahmen der Kooperation“ erschaffen kann.
Wahrscheinlich kann das nicht durch einen Beschluß oder einen anderen formalen Akt erreicht werden. Es könnte sinnvoll sein, in einem Parlament in regelmäßigen Abständen z.B. über Grundwerte und Handlungsmöglichkeiten zu sprechen, also sich zusammenzusetzen, einander zuzuhören und zu schauen, was man als Konsens in Bezug auf die Ziele finden kann. Vermutlich wird es einige Zeit brauchen, bis alle oder zumindest die meisten in der Lage sind, bei solchen Gesprächen einmal den Parteien-Egoismus beiseite zu lassen und sich einfach einmal über die angestrebten Werte zu unterhalten.
Dabei sollte es üblich sein, auch zu fragen, welche Werte hinter den Werten stehen, die man zunächst einmal wahrnehmen kann. So hat z.B. das Schließen der Grenzen gegen Migranten die Angst vor Wohlstandsverlust und „Überfremdung“ als Grundlage, die wiederum die Frucht vor einem Identitätsverlust als Fundament hat. Diese Furcht wird wiederum dadurch gesteigert, daß die Globalisierung die Grenzen auf der Erde zunehmend auflöst. Die Notwendigkeit der Kooperation und die Vermischung der Kulturen löst natürlich den Reflex der Wahrung der eigenen Kultur aus, der schnell zu Fremdenfeindlichkeit werden kann.
Wenn man dann noch einen Schritt weitergeht und sich anschaut, daß sich die Globalisierung nicht rückgängig machen läßt, sondern angesichts der Klimaerwärmung, des Artensterbens, der Überbevölkerung, der Atombomben, des internationalen Handels usw. heute einfach eine Tatsache ist, dann kann man versuchen, die Globalisierung einzuordnen.
Man kann die Globalisierung als die bisher fünfte Phase der Geschichte ansehen:
Phase:
Die Menschen der Altsteinzeit lebten als Teil der Natur in der Natur. Das entspricht dem kleinen Baby.
Phase:
Die Menschen in der Jungsteinzeit haben einen Bereich der Natur durch Ackerbau und Viehzucht nach ihren Vorlieben gestaltet. Das entspricht dem Kleinkind, das Laufen und Sprechen gelernt hat.
Phase:
Die Menschen im Königtum haben alles auf den König, den Einen Gott und die „Wahrheit“ zentralisiert. Das entspricht dem Kind, daß gelernt hat, „Ich“ zu sagen.
Phase:
Die Menschen im Materialismus haben durch Wissenschaft, Erfindungen, Technik und Industrialisierung die Welt nach ihren Vorstellungen geformt. Das entspricht dem Jugendliche, der seine Kräfte erprobt und sich gegen andere durchsetzt.
Phase:
Die Menschen haben einen so großen Einfluß auf die Erde erlangt, daß sie gezwungen sind, miteinander zu kooperieren, um die Erde bewohnbar zu erhalten. Das entspricht dem Erwachsenen, der heiratet und eine Familie gründet und der nun sein eigenes Wohl in das Wohlergehen der Familie stellt.
Derartige Betrachtungen könnten dabei helfen, den Konkurrenzkampf zwischen den Parteien in einen übergeordneten Rahmen zu stellen. Wenn man sich durch solche Betrachtungen erst einmal über die Ziele einig geworden ist, wird es deutlich leichter, sich auch über die Wege zu diesem Ziel zu einigen.
Für die Einigkeit bei den Zielen ist es erstens notwendig, zu den Wurzeln dieser Ziele zurückzukehren, und zweitens, sowohl die derzeitige als auch die zukünftige Situation möglichst sachlich und klar zu betrachten.
Um zu solchen Gesprächen zwischen den Parteien zu gelangen, die gemeinsame Betrachtungen zur allgemeinen Lage sind, ist es notwendig, zumindest vorübergehend einmal das „Suggerieren durch Gefühlen“ beiseite zu stellen und das „Betrachten durch den Verstand“ zuzulassen.
In welcher Form solche gemeinsamen Betrachtungen ein Teil der parlamentarischen Routine und der Politik ganz allgemein werden können, ist noch unklar. Wahrscheinlich gibt es dafür auch viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist zunächst einmal vor allem, daß überhaupt in dem Wettstreit der Parteien ein Raum für derartige grundlegende Betrachtungen geschaffen wird.
d) Stärke: Eigeninitiative und Kooperation
Damit die Eigeninitiative – also die Wahl – zu einer Stärke der Demokratie werden kann, muß sie durch Kooperation ergänzt werden. Ein Staat ist ein Organismus – folglich sollten die Menschen in ihm organisch zusammenarbeiten.
Das erfordert zunächst einmal die Kenntnis möglichst aller grundlegender Ansichten und Richtungen in diesem Staat, denn man kann nur mit dem kooperieren oder gar zu einer Gemeinschaft/Gesellschaft zusammenwachsen, was man kennt.
Als nächstes erfordert die Koordination der Eigeninitiativen, daß man nicht nach dem schaut, was jemand tun will, sondern nach dem, was er erreichen will. Die Mittel, die jemand wählt, um an Ziel zu gelangen, können sehr verschieden sein – und man kann sich auch über Mittel und Wege heftig streiten. Doch wenn man erkannt hat, daß man dieselben Ziele anstrebt – oder zumindest kombinierbare Ziele – dann wird es deutlich einfacher, zusammenarbeiten. Der eine geht dann eben links herum zu seinem Ziel und der andere rechts herum zu demselben Ziel.
Wenn die Gleichheit der Ziele erkannt worden ist, lassen sich die verschiedenen Wege sinnvoll kombinieren: Jeder erhält seinen Platz in dem gemeinsamen Streben nach dem Ziel. Der eine ist Abbrucharbeiter, der andere Architekt, der dritte Buchhalter, der vierte Bankier usw. Wenn sie sich zusammentun und jeder das an seinem Ort macht, was er gut kann, wird daraus schließlich ein neues Haus werden.
Diese erwachsene Haltung, bei der jeder das anstrebt, was er will, und dafür das tut, was er gut kann – und das dann auch noch im Rahmen des Gesamtwohls tut – ist das, was allgemein gebraucht wird, um die Demokratie auf eine besseres Niveau zu bringen. Durch eine solche Haltung können die Menschen zu „Eltern der Erde“ werden, die die Erde als Lebensgrundlage für die Menschen bewahren.
Diese Haltung schließt den Egoismus keineswegs aus – ohne den Egoismus kann sich kein Lebewesen lebendig erhalten – aber der Egoismus muß weitsichtig werden, er muß die anderen und alle Zusammenhänge sehen und dadurch dann weise Entscheidungen treffen, die nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig und langfristig zu einem „guten Zustand“ führen. Es geht nicht darum, den Egoismus zu verdrängen oder dergleichen, sondern darum, den Egoismus dadurch effektiver zu machen, daß er die Gesamtlage und auch die anderen Menschen sieht und in seine Planung miteinbezieht.
Bisher sind wir Menschen damit noch nicht allzu weit gekommen – es verhungern noch immer jeden Tag 25.000 Menschen und die Kluft zwischen Arm und Reich ist riesig.
2. Wohlstand
a) Prinzip: Eigennutzen
Ein Grund für die Erfindung der Demokratie bei den Griechen um 500 v.Chr. und später dann ihre „Neu-Erfindung“ in der amerikanischen Verfassung von 1787 und in der französischen Revolution von 1789 war neben der Selbststimmung des Volkes die gerechtere Verteilung des Eigentums. Zuvor gehörte den Monarchen mehr oder weniger alles und sie waren die einzigen, die alles bestimmten. Die Demokratie hatte also auch den „Wohlstand für alle“ als Ziel.
Wenn niemand mehr der Untertan eines Königs oder gar der Sklave eines Herrn ist, sondern frei und eigenständig ist, kann jeder für sich selber sorgen und in seinem Leben die Nutzenmaximierung anstreben.
Zu dieser Nutzenmaximierung des Einzelnen ist viel geforscht worden. Wie bei Ökonomen üblich, werden die Erkenntnisse dieser Forschungen in möglichst viel Fremdworte verpackt. Trotzdem gibt es zumindest eine Erkenntnis, die es sich zu betrachten lohnt: die beiden „Gossen'schen Gesetze“:
Das