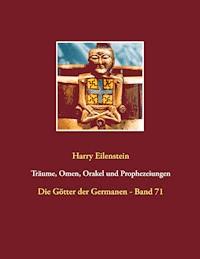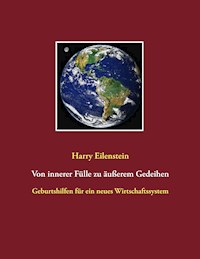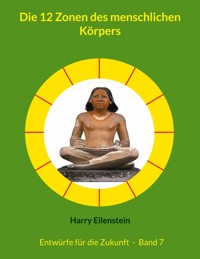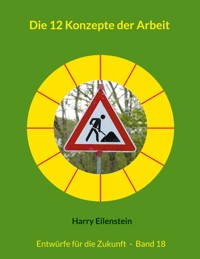Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die 12 Pfade zum Frieden" betrachtet die Geschichte und die Ursachen des Krieges sowie die möglichen Verhaltensweisen, die in Zukunft weitere Kriege verhindern können. Die zwölf Probleme, die Kriege auslösen und den Frieden verhindern können, sind Egoismus, Neid, Mißverständnisse, Abgrenzung, Größenwahn, Irrtümer, Konkurrenz, Aggression, Machtstreben, Rache, Ideologien und Religionen. Das, was daher als Heilmittel gebraucht wird, ist Selbsterhaltung, Großzügigkeit, Klärung, Gemeinschaft, Selbstliebe, Sachkundigkeit, Kooperation, Standfestigkeit, Zielstrebigkeit, Verzeihen, Toleranz und Weltliebe. In den Büchern dieser Reihe werden die zwölf Tierkreiszeichen als Hilfsmittel verwendet, um das jeweilige Thema möglichst umfassend in zwölf Kapiteln aus den Blickwinkeln dieser zwölf verschiedenen Sichtweisen auf die Welt zu beschreiben. Dadurch wird eine ausgewogenere, umfassendere und tiefere Einsicht in das jeweilige Thema erlangt als es ohne solch ein Raster möglich wäre. Durch die Verwendung des Tierkreises als Forschungs-Hilfsmittel werden zum einen die gröbsten Einseitigkeiten in der Betrachtung vermieden und zum anderen werden durch dieses Vorgehen diese 12 Sichtweisen auch als organische Teile eines Ganzen deutlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 63
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsübersicht
Warum 12?
1. Egoismus
2. Besitz
3. Gespräche
4. Abgrenzung
5. Individualität
6. Regierungssystem
7. Kooperation
8. Aggression
9. Machtstreben
10. Geschichte
11. Gemeinschaft
12. Menschheit
Bücher von Harry Eilenstein
Warum 12?
Alle Bücher dieser Reihe haben genau 12 Kapitel – was sich ja auch in den Titeln dieser Bücher widerspiegelt. Warum?
In diesen Büchern wird der Tierkreis als Matrix von 12 verschiedenen Sichtweisen auf die Welt verwendet, um das Thema des Buches möglichst umfassend in 12 Kapiteln zu betrachten. Dadurch wird eine ausgewogenere, umfassendere und tiefere Einsicht in das jeweilige Thema erlangt als es ohne ein solches Raster, ohne eine solche Matrix möglich wäre.
Der Tierkreis wird in dieser Buch-Reihe als Forschungs-Hilfsmittel benutzt, durch das die Einseitigkeiten in der Betrachtung zumindest vermindert werden können. Weiterhin werden durch dieses Vorgehen diese 12 Sichtweisen auch als Ergänzungen zueinander, als organische Teile eines Ganzen deutlich.
Die Inspiration zu diesem Vorgehen stammt aus Hermann Hesses Roman „Das Glasperlenspiel“, für das er 1946 den Literatur-Nobelpreis erhielt. In diesem Roman beschreibt er die öffentlichen Darstellungen von Übersichten und Gesamtbetrachtungen, die mithilfe von verschiedenen allgemeinen Strukturen wie z.B. dem Ba Gua aus dem chinesischen Feng-Shui angefertigt und aufgeführt werden.
Diese Buch-Reihe ist ein Versuch, Hesse‘s Idee im ganz Kleinen konkret zu verwirklichen.
Die Blickwinkel der 12 Tierkreiszeichen sind:
Widder:
Spontaner
Stier:
Genießer
Zwilling:
Neugieriger
Krebs:
Familienmensch
Löwe:
Egozentriker
Jungfrau:
Handwerker
Waage:
Schöngeist
Skorpion:
Tiefgründiger
Schütze:
Idealist
Steinbock:
Realist
Wassermann:
Theoretiker
Fische:
Träumer
1. Egoismus
Was ist die Grundlage für Aggression? Natürlich ist es der Streit, die verschiedenen Meinungen, die Wut, der Neid – aber was ist die tiefste Wurzel der Aggression?
Die Aggression, das Kämpfen, das Siegenwollen ist ein Aspekt der Selbst-erhaltung, also des fundamentalen Egoismus. Was nicht die Fähigkeit zur Selbsterhaltung hat, wird sich nicht selbst erhalten können und zu existieren aufhören. Daher ist der Egoismus nicht nur eine unvermeidbare, sondern sogar eine notwendige Eigenschaft von allem, was existiert – einschließlich des Menschen. Und in Konkurrenz-Situationen wird dieser Egoismus schnell zu Streit.
Es ist auch auffällig, wie selten Demokratien Kriege beginnen – es sind in der Regel autokratische Herrscher oder Diktatoren, die einen Krieg anfangen. Demokratien mit einer starken Stellung des Präsidenten wie in den USA oder in Frankreich stehen in der Häufigkeit der Kriegseröffnung zwischen Diktatoren und Demokratien. Die Demokratie mit ihrer Ausrichtung auf die Gemeinschaft, den Konsens und die Solidarität ist also friedlicher als die Diktatur mit ihrer Ausrichtung auf den Diktator, die Macht und den Egoismus.
Der fundamentale Egoismus und die sich von ihm ableitende Selbsterhaltung sind natürlich etwas, das man niemandem vorwerfen kann – selbst die Rechtsprechung gesteht jedem die Selbstverteidigung, also das Handeln aus Notwehr zu. In derselben Weise wird jedem Volk die Verteidigung gegen einen angreifenden Staat zugestanden.
Da der Verteidiger in der öffentlichen Meinung eine weitaus bessere Stellung hat als der Angreifer, strebt jeder in einen Krieg verwickelte Staatsführer stets danach, sich als den Verteidiger und den anderen als den Angreifer darzustellen – als „wir sind die Guten“ und „die anderen sind die Bösen“.
Dieses Vorgehen ist sowohl nach innen auf die eigene Bevölkerung hin als auch nach außen zu den anderen Staaten hin wichtig. Wenn Putin seinen Angriff auf die Ukraine nicht nach innen hin als einen Kampf gegen das „Nazi-Regime“ in der Ukraine und als eine notwendige Fortführung des Zweiten Weltkrieges darstellen würde – und dies nicht sogar in den Schulbüchern so verankern ließe – wäre die Bevölkerung Russlands gegen diesen Krieg. Andererseits ist dieser Krieg so offensichtlich ein russischer Angriffskrieg, dass die Staatengemeinschaft zu der Ukraine hält und sie unterstützt.
Diejenigen, die prinzipiell gegen Krieg sind, haben zwar recht, aber auch ein großes Problem. Wehrdienstverweigerer in der BRD haben oft den Satz „Es lohnt sich dafür zu kämpfen, nicht kämpfen zu müssen. “ zu hören bekommen. Damit war gemeint, dass es sich lohnt, die BRD mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, weil in der BRD niemand gezwungen werden darf, als Soldat zu dienen.
Das ist gegenüber einem Pazifisten eine zwar fast schon zynische Aussage, aber sie hat leider auch einen wahren Kern. Was soll man tun – individuell und kollektiv – wenn man angegriffen wird und im drastischsten Fall Sklaverei oder Tod drohen? Die klassische Argumentation der Wehrdienstverweigerer war (mich einbeschlossen) war, dass man die Ursachen der Kriege – also vor allem die materielle Not – auflösen muss bevor überhaupt ein Krieg ausbricht. Das ist zwar auch wieder richtig, aber es ist fraglich, ob das ausreicht.
Schließlich gibt es nicht nur Kriege, die aus einer materiellen Not heraus begonnen werden, sondern auch Kriege, deren Ursache konkurrierende Weltanschauungen, Wirtschaftssysteme und Religionen sind – oder ganz einfach der Machthunger des Staatsführers.
Das Bestreben, durch die Auflösung ihrer materiellen Ursachen alle Kriege zu verhindern, wird folglich die Anzahl der Kriege zwar reduzieren, aber nicht vollständig verhindern können.
Was tun?
Es liegt nahe, das Waffenarsenal der Staaten drastisch zu reduzieren, aber ein restloser Abbau aller Waffen würde es einem aggressiven Staat, der heimlich aufgerüstet hat, leicht machen, im Extremfall zum Weltherrscher zu werden.
Die Abschaffung der Wehrpflicht ist ein Schritt, der den Pazifisten entgegenkommt, aber der das Problem des Krieges leider nur dann lösen würde, wenn alle Menschen Pazifisten werden würden. Dazu gab es auch mal einen Spruch: „Stell Dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin …“ Leider sind wir kollektiv noch nicht so weit, dass sich alle Menschen geschlossen weigern würden, in den Krieg zu ziehen.
Ein anderer Ansatz zur Lösung dieses Problems findet sich bei den Buddhisten – in den tibetischen Klöstern und in China in den Shaolin-Klöstern. In den tibetischen Klöstern wird die Verteidigung mit Stöcken gelehrt und in den Shaolin-Klöstern die Verteidigung mit Hand und Fuß. In beiden Fällen können sich die Buddhisten trotz ihrer Friedfertigkeit verteidigen, aber fügen dem Angreifer keinen dauerhaften Schaden zu. Leider funktioniert diese Methode nur im Nahkampf gegen einen Einzelnen, der zudem keine Schusswaffe benutzt. Gegen Schusswaffen, gegen ein Heer oder gar ein Flugzeug, das eine Bombe fallen lässt, ist diese Methode ungeeignet.
Schließlich gibt es noch die Christus-Methode: „Wenn Dich jemand auf Deine rechte Backe schlägt, halte ihm auch noch die andere hin.“ In der Begegnung mit einem einzelnen Aggressor funktioniert diese Methode – man kann einen Angreifer dadurch völlig Verwirrung und wieder zur Besinnung bringen, indem man nach dem ersten Schlag einfach ruhig stehen bleibt und den Angreifer gelassen anschaut – das beruht auf eigener Erfahrung. Gegen eine Gruppe von Angreifern ist die Methode schon weitaus schwieriger durchzuführen und bei Kämpfen zwischen zwei Gruppen oder in einem Krieg ist sie fast aussichtslos.
Allerdings hat z.B. der zypriotische Heiler Daskalos während der Zypern-Krise, als 1974 die türkische Armee Zypern erobern wollte, in der Hauptstadt Nikosia, in der er für die Verteidigung eines Stadtteils zuständig war, mit dem türkischen Anführer in diesem Stadtteil einen eigenmächtigen Waffenstillstand abgeschlossen, sodass in diesem Teil der zypriotischen Hauptstadt kein einziger Mensch in diesem Krieg gestorben ist.
Es ist allerdings fraglich, dass dieses Verfahren überall angewendet werden kann, da dafür zwei Heerführer notwendig sind, die sehr eigenständig und couragiert sind und denen die Menschenleben deutlich wichtiger als die Befehle ihrer Vorgesetzten sind.
Ist das Vermeiden von Kriegen somit weitgehend aussichtslos?
Nicht ganz. Da die Kriege auf Aggression beruhen und die Aggression letztlich ein Ausdruck des Egoismus sind, der das eigene Überleben sichert, kann man diesen Egoismus als Ansatz für die Friedenssicherung benutzen.