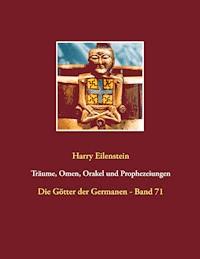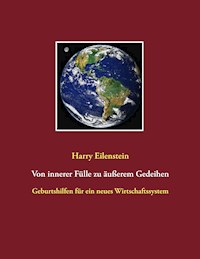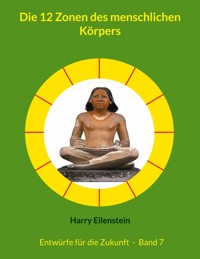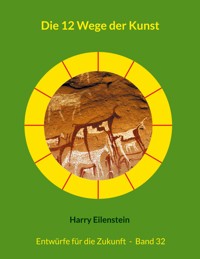
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die 12 Wege der Kunst" stellt die Entwicklung, die Vielfalt und die Wirkungen der verschiedenen Künste wie Malerei, Musik, Tanz, Bildhauerei, Lyrik usw. dar. Diese Entwicklung wird in der Folge der fünf großen bisherigen Epochen Altsteinzeit, Jungsteinzeit, Königtum, Materialismus und Globalisierung betrachtet. Dieses Buch beschränkt sich allerdings nicht auf eine rein kunstgeschichtliche Betrachtung, sondern ist auch ein Überblick über die Kreativität, die Hilfsmittel, die Stile, die Kultur, den Selbstausdruck, die Techniken, die Schönheit, den Ausdruck, die Ziele, die Funktion in der Öffentlichkeit, die Utopie und die Weiterentwicklung der Urbilder. Diese Betrachtung ist unter anderem auch eine Beschreibung der allgemeinen Motivationen und Vorgehensweisen der Menschen. In den Büchern dieser Reihe werden die zwölf Tierkreiszeichen als Hilfsmittel verwendet, um das jeweilige Thema möglichst umfassend in zwölf Kapiteln aus den Blickwinkeln dieser zwölf verschiedenen Sichtweisen auf die Welt zu beschreiben. Dadurch wird eine ausgewogenere, umfassendere und tiefere Einsicht in das jeweilige Thema erlangt als es ohne solch ein Raster möglich wäre. Durch die Verwendung des Tierkreises als Forschungs-Hilfsmittel werden zum einen die gröbsten Einseitigkeiten in der Betrachtung vermieden und zum anderen werden durch dieses Vorgehen diese 12 Sichtweisen auch als organische Teile eines Ganzen deutlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsübersicht
Warum 12?
1. Kreativität
2. Hilfsmittel
3. Stile
4. Kultur
5. Selbstausdruck
6. Techniken
7. Schönheit
8. Ausdruck
9. Ziele
10. Öffentlichkeit
11. Utopie
12. Urbilder
Warum 12?
Alle Bücher dieser Reihe haben genau 12 Kapitel – was sich ja auch in den Titeln dieser Bücher widerspiegelt. Warum?
In diesen Büchern wird der Tierkreis als Matrix von 12 verschiedenen Sichtweisen auf die Welt verwendet, um das Thema des Buches möglichst umfassend in 12 Kapiteln zu betrachten. Dadurch wird eine ausgewogenere, umfassendere und tiefere Einsicht in das jeweilige Thema erlangt als es ohne ein solches Raster, ohne eine solche Matrix möglich wäre.
Der Tierkreis wird in dieser Buch-Reihe als Forschungs-Hilfsmittel benutzt, durch das die Einseitigkeiten in der Betrachtung zumindest vermindert werden können. Weiterhin werden durch dieses Vorgehen diese 12 Sichtweisen auch als Ergänzungen zueinander, als organische Teile eines Ganzen deutlich.
Die Inspiration zu diesem Vorgehen stammt aus Hermann Hesses Roman „Das Glasperlenspiel“, für das er 1946 den Literatur-Nobelpreis erhielt. In diesem Roman beschreibt er die öffentlichen Darstellungen von Übersichten und Gesamtbetrachtungen, die mithilfe von verschiedenen allgemeinen Strukturen wie z.B. dem Ba Gua aus dem chinesischen Feng-Shui angefertigt und aufgeführt werden.
Diese Buch-Reihe ist ein Versuch, Hesse‘s Idee im ganz Kleinen konkret zu verwirklichen.
Die Blickwinkel der 12 Tierkreiszeichen sind:
Widder:
Spontaner
Stier:
Genießer
Zwilling:
Neugieriger
Krebs:
Familienmensch
Löwe:
Egozentriker
Jungfrau:
Handwerker
Waage:
Schöngeist
Skorpion:
Tiefgründiger
Schütze:
Idealist
Steinbock:
Realist
Wassermann:
Theoretiker
Fische:
Träumer
1. Kreativität
Warum eigentlich Kunst? Wozu ein Hammer gut ist, ist klar – und auch, wozu ein Brot gut ist. Aber Kunst? Was bringt Menschen dazu, Kunst zu machen? Und dazu noch so eine Vielfalt an Kunst: Malerei, Bildhauerei, Musik, Dichtkunst, Tanz, Schauspiel, Körperbemalung, Stickerei, Schmuck und noch mehr …
Der Kunst muss ein Grundbedürfnis zugrunde liegen, denn sonst könnte sich nicht über Jahrtausende hinweg und bei allen Völkern eine solche Vielfalt an Kunst entwickelt haben. Aber was ist dieser Ansporn? Die Motivation ist klar, wenn man mit dem Hammer das Dach repariert oder wenn man ein Brot backt, wenn man hungrig ist: Dem Leib geht es anschließend besser.
Doch worin liegt der Vorteil von Kunst? Wo hat die Kunst ihren Ursprung? Von wo geht sie aus? Bei dem Dach, durch das es reinregnet, und bei dem Magen, der laut knurrt, ist die Motivation sofort ersichtlich – es fehlt Schutz und es fehlt Nahrung. Doch warum Kunst?
Was ist Kunst eigentlich, wenn sie fertig ist? Wenn das Dach mithilfe von Hammer, Brettern und Nägeln wieder dicht ist, entsteht Schutz, und wenn man das Brot gegessen hat, ist man satt. Doch was ist, wenn das Bild fertig ist, wenn das Gedicht geschrieben ist, wenn die Skulptur vor einem steht, wenn der Tanz zu Ende ist, wenn das Lied gesungen worden ist? Was ist dann da, was vorher nicht da war?
Das ist ein Gefühl. Und bei der Kunst, die einem Menschen wirklich wichtig wird, ist es auch ein Wiedererkennen von etwas, was man schon kennt oder zumindest ahnt. Das bedeutet, dass Kunst etwas darstellt, was vorher ohne Darstellung war, was die Menschen nur in sich getragen haben, aber was sie noch nicht im Außen als Geschichte, Gedicht, Lied, Bild, Film, Skulptur, Tanz, Stickerei oder auf sonst eine Weise haben sehen können.
Kunst macht also das Innere des Menschen sichtbar. Kunst ist ein Spiegel des Inneren des Menschen. Kunst ist daher auch ein Hilfsmittel bei der Selbsterkenntnis. Und das, was man landläufig „große Kunst“ nennt, ist das, was Dinge darstellt, die in vielen Menschen etwas anklingen lässt – die „große Kunst“ erinnert viele Menschen an etwas, was sie schon geahnt oder gekannt haben.
Die Kunst macht das Unterbewusstsein bewusst, sie holt die Bilder aus den Träumen der Menschen in die materielle Welt, so dass man diese inneren Bilder wachbewusst ansehen kann.
Offensichtlich ist diese Form der Selbsterkenntnis – oder bei der „großen Kunst“ vielleicht sogar der Menschen-Erkenntnis – ein Grundbedürfnis der Menschen. Kunst kann helfen, die Antworten auf die beiden Fragen „Wer bin ich?“ und „Was sind wir Menschen?“ zu finden.
Zum einen können wir uns Kunstwerke ansehen oder anhören oder auf andere Weise erleben, die andere Menschen erschaffen haben. Zum anderen können wir auch selber künstlerisch tätig werden und selber etwas darstellen, was wir ahnen oder gespürt haben oder im Traum gesehen haben.
Es hat offenbar etwas tief Befriedigendes, wenn man in einem Film ein eigenes Problem dargestellt und gelöst sieht, wenn man in einem Bild ein eigenes Meditations-Erlebnis dargestellt findet, wenn man in einem Musikstück eine Stimmung wiederfindet, die man nur zu gut kennt. Zum einen fühlt man sich dadurch verstanden, zum anderen wird dadurch deutlich, dass auch noch andere solche Gefühle und Erlebnisse gehabt haben, und drittens findet man in diesen künstlerischen Darstellungen manchmal auch Lösungen oder zumindest Lösungsansätze oder hilfreiche Einstellungen zu einem bestimmten Problem. In dieser Hinsicht ist Kunst den Weisheitslehren wie z.B. dem Tao Tê King oder einer Psychotherapie recht ähnlich: Die Kunst, die Weisheitslehren und die Psychotherapien fördern alle drei die Selbsterkenntnis und lassen Wege zu einem besseren und erfüllteren Leben deutlich werden.
Die Kunst hat also durchaus einen ganz konkreten Nutzen – nur bezieht sich dieser Nutzen nicht auf den Leib, sondern auf die Psyche, auf das Gemüt, auf das Bewusstsein. Die Kunst ist für die Psyche das, was der Hammer und die gesamte Architektur sowie das Brot und die gesamte Kochkunst für den Leib sind.
Die Kreativität, die zur Entstehung von Kunst führt, entsteht also aus dem Drang der Psyche nach Selbsterkenntnis und nach Heilung und nach Wachstum und nach dem Erlangen eines erfüllten Lebens. Der künstlerische Selbstausdruck ist folglich eine ausgesprochen wertvolle Angelegenheit, die man bei allen Kindern – und wenn sie es als Kind nicht gelernt haben sollten – auch bei allen Erwachsenen fördern sollte.
2. Hilfsmittel
In der Kunst wird eine große Menge an Hilfsmitteln verwendet, die alle irgendwann einmal erfunden worden sind. Diese Hilfsmittel sind im Laufe der Zeit auch ständig weiterentwickelt und auf immer neue Weisen verwendet worden. Daher kann ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Kunst hilfreich sein, um all die Möglichkeiten der Kunst besser einschätzen zu können.
a) Dichtkunst
Die Formen der Dichtkunst ergeben sich aus der Logik, der Sprache und dem Weltbild der jeweiligen Epoche, wobei zu diesem Weltbild natürlich auch die Magie und die Religion gehören.
Vermutlich kann man in der Altsteinzeit dieser Epoche noch nicht von einer Dichtkunst sprechen – es sei denn, dass es Menschen gegeben hat, die ein besonderes Talent dafür gehabt haben, mithilfe von zwei Substantiven treffend Menschen, Dinge und Situationen zu beschreiben.
Diese frühesten „Dichter“ hätten dann nicht nur solche Begriffe wie „Panther-Mann“, „Kuh-Frau“ und „Vogel-Seele“ zur Verfügung gehabt, sondern könnten auch kreativere Kombinationen erschaffen haben wie „Baldrian-Bruder“ für einen Bruder, der so bitter und mürrisch und einengend wie Baldrian ist, „Honig-Frau“ für eine Geliebte, „Sonnen-Haar“ für einen blonden Menschen usw.
Das wäre eine sehr schlichte, aber auch sehr bildhafte und anschauliche Form der Dichtkunst gewesen. Ob es sie tatsächlich gegeben hat, weiß man natürlich nicht, aber da es alle Voraussetzungen dafür gegeben hat und man auch noch heute fast jede derartige Wortschöpfung mühelos verstehen kann, ist es ausgesprochen wahrscheinlich, dass es auch schon in der Altsteinzeit solche Wortschöpfungs-Dichter gegeben haben wird.
Der Anfang der Sprache werden „Worte für Dinge“, also Substantive gewesen sein – Verben und Adjektive, die ja deutlich abstrakter als Substantive sind, werden erst später dazugekommen sein.
Das Prinzip der Analogie, das sich in der Sprache als Grammatik zeigt, ermöglichte in der Jungsteinzeit ganz neue Formen der Dichtkunst. Zum einen sind damals Sätze möglich geworden, die die Darstellung komplexerer Zusammenhänge ermöglichten, und zum anderen entstand durch das Denken in Analogien auch die Möglichkeit, analoge Sätze zu erschaffen.
Dadurch sind gleich drei Dinge entstanden: das Versmaß, der grammatische Reim und der inhaltliche Reim.
Das Versmaß wird anfangs vermutlich einfach der Wechsel zwischen einer betonten und einer unbetonten Silbe gewesen sein oder eine festgelegte Anzahl an betonten Silben pro Zeile. Das passt auch gut zu den damals noch recht einfachen, kurzen Worten (siehe das Kapitel „Sprache“).
Der grammatische Reim besteht darin, dass zwei Sätze aufeinander folgen, die dieselbe Anzahl von Worten haben und die auch denselben grammatischen Aufbau haben.
Schließlich gibt es noch den inhaltlichen Reim, bei dem in zwei aufeinander folgenden Zeilen mit grammatischem Reim exakt dieselbe Aussage steht.
In der Regel wird das Versmaß mit dem grammatischen oder inhaltlichen Reim kombiniert. Diese Formen der Dichtkunst finden sich z.B. noch in den frühen Dichtungen von Sumer und Ägypten oder in den Zaubersprüchen der Germanen („galdr-lag“).
Ein Beispiel für einen grammatischen Reim bei einem Zauberspruch ist:
Das Wasser tropft aus dieser Schale –
Der Regen rinnt aus dieser Wolke.
Diese beiden Verse illustrieren zudem das Prinzip des Analogie-Zaubers: Das Ausgießen von Wasser bewirkt das Regnen. Diese Reimform zeigt deutlich einen logischen Zusammenhang ohne dass sie die heute dafür notwendigen logischen Partikel „wenn … dann …“ zu verwenden braucht. Der grammatische Reim übernimmt also die Funktion von logischen Partikeln im Satzbau.
Ein Beispiel für einen inhaltlichen Reim ist:
Der Pharao ist wie ein Löwe in der Wüste,
Der König ist wie ein Panther in der Steppe.
Da die Verdopplung in den frühen Sprachen wie in den heutigen Pidgin- und Kreolen-Sprachen eine Möglichkeit ist, einen Plural oder einen Superlativ zu bilden, wird der Pharao durch diese Verse auch als der Stärkste (Superlativ) dargestellt. Eine dritte Verwendung der Verdopplung eines Wortes ist die Schaffung eines Substantivs aus einem Verb oder Adjektiv. In Altägyptischen hat z.B. „(w)ben“ die Bedeutung „aufsteigen, aufgehen der Sonne“. Daher ist „benu“ der Phönix, d.h. die am Morgen aufgehende, wiedergeborene Sonne, und „benben“ bezeichnete die vergoldete Spitze der Pyramiden, d.h. die aufgehende Sonne, die ein Symbol der Wiedergeburt gewesen ist.
Der Inhalt dieser Dichtungen werden zu einem großen Teil die Kult-Texte und die Geschichte des Stammes gewesen sein. Auch die frühesten erhaltenen Dichtungen haben bei fast allen Völkern diese beiden Bereiche zum Thema.
Im Königtum ist das Formular erfunden worden, mit dessen Hilfe einzelne Aspekte der großen Vielfalt erfasst werden konnten: die Anzahl der Bewohner eines Dorfes, die Größe der Felder dieses Dorfes, die Anzahl der Rinder in diesem Dorf usw.