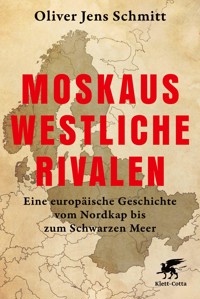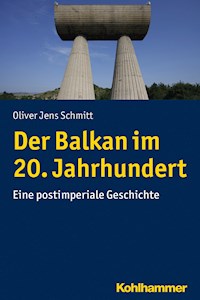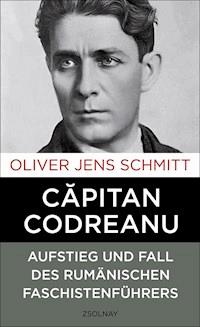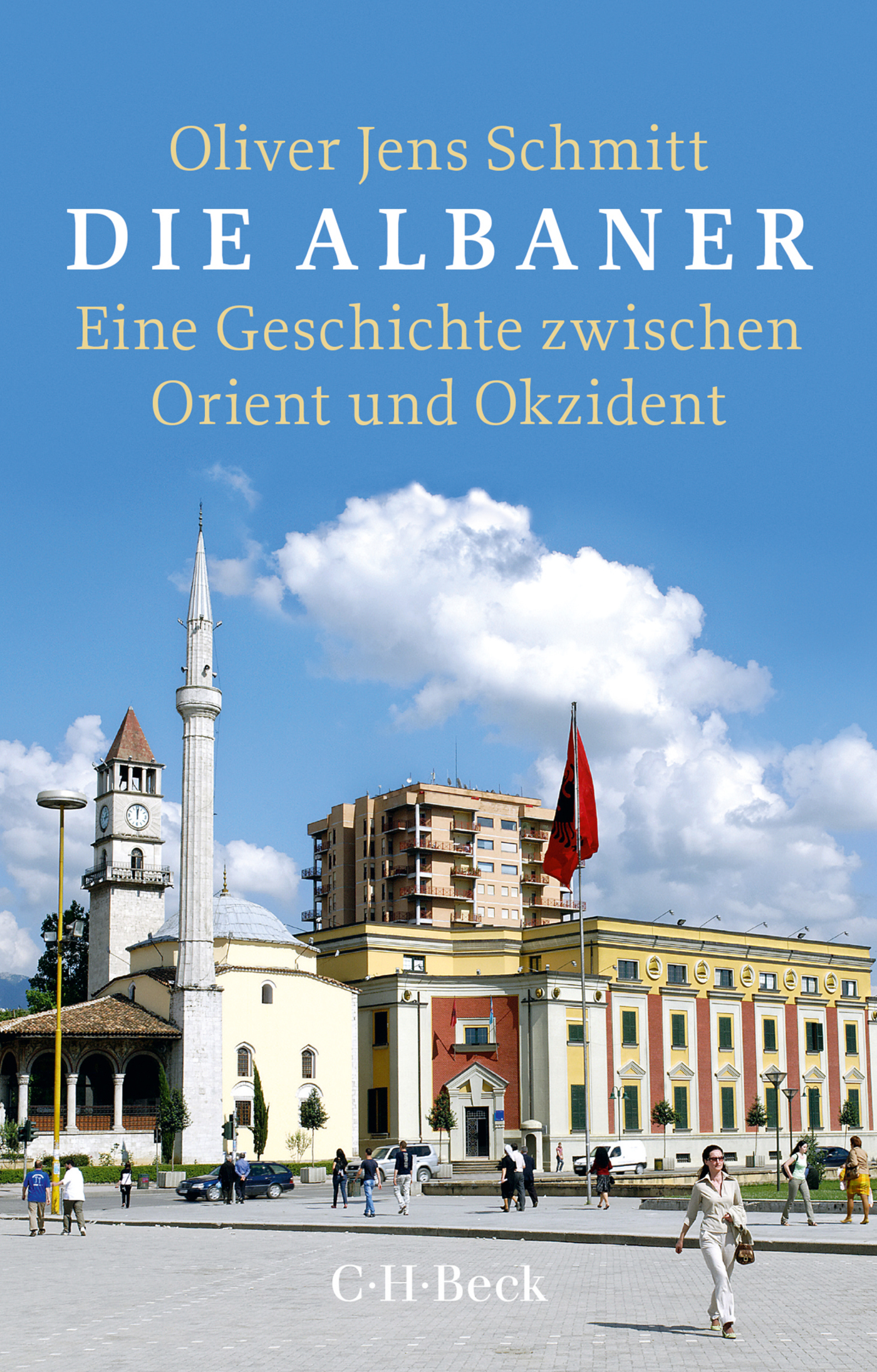
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit dem Kosovokrieg und der späteren Unabhängigkeit des Kosovo beschäftigt die „albanische Frage“ die europäische Politik. 1912 entstand, nach dem Ende des Osmanischen Reiches, der albanische Staat. Doch umfasst er nur gut die Hälfte aller Albaner, die das größte muslimische Volk Europas sind. Erstmals schildert das vorliegende Buch die Geschichte aller Albaner in Südosteuropa, in Albanien, aber auch in Kosovo, Makedonien, Montenegro und Griechenland. Viele Jahre war Albanien unter dem Diktator Enver Hoxha von aller Welt isoliert. Seit 2008 gibt es mit Albanien und Kosovo zwei albanische Staaten, die beide mit schweren politischen und wirtschaftlichen Problemen kämpfen. Die Albaner stellen sich heute zunehmend die Frage, wohin sie gehören: zum islamischen Orient oder zum europäischen Okzident?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Oliver Jens Schmitt
Die Albaner
Eine Geschichte zwischenOrient und Okzident
Verlag C.H.Beck
Zum Buch
Die «albanische Frage»; die Zukunft des Kosovo, beschäftigt die europäische Politik. Warum kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen? Welche Rolle spielt dabei der albanische Staat, der 1912 nach Ende des Osmanischen Reiches entstanden ist, aber nur gut die Hälfte aller Albaner umfaßt? Und welche Bedeutung hat die Tatsache, dass die Albaner das größte mehrheitlich muslimische Volk Europas sind? Erstmals schildert das vorliegende Buch die Geschichte aller Albaner in Südosteuropa, in Albanien, aber auch in Kosovo, Makedonien, Montenegro und Griechenland. Viele Jahre war Albanien unter dem Diktator Enver Hoxha von aller Welt isoliert. Seit 2008 gibt es mit Albanien und Kosovo zwei albanische Staaten, die beide mit schweren politischen und wirtschaftlichen Problemen kämpfen. Die Albaner stellen sich heute zunehmend die Frage, wohin sie gehören: zum islamischen Orient oder zum europäischen Okzident?
Über den Autor
Oliver Jens Schmitt ist Professor für Geschichte Südosteuropas an der Universität Wien.
Inhalt
Vorbemerkung
Grundlagen der albanischen Geschichte
Wann beginnt die Geschichte der Albaner?
Die Periodisierung der albanischen Geschichte
Albaner oder Skipetaren?
Albanische Geschichte im Raum: Kontraktion oder variable Größe?
«Albanien» als Raumbegriff – oder wie heißt das Land, in dem Albaner siedeln?
Albanische Geschichte außerhalb «Albaniens»
Der natürliche Rahmen albanischer Geschichte
Albanische Geschichte in einem mehrfachen Grenzraum
Die albanische Sprache als Spiegel der albanischen Geschichte
Alteingesessene oder Zuwanderer?
Albaner, Slawen und Byzantiner im frühen Mittelalter
Slawische Herrschaftsbildung im südwestlichen Balkan
Die albanisch-slawische Symbiose im Mittelalter
Herrschaft und Politik in der albanischen Geschichte
Die Entfaltung albanischer Geschichte im byzantinischen Herrschafts- und Kulturraum
Die «große Zeit»
Die Herrschaft der Sultane
Treue Diener ihrer Herren? Muslimische Albaner im Osmanenreich
Machtmenschen im osmanischen Arnavud-ili
Die Osmanen und die Berge
Ein sich modernisierender Staat und die Grenzen seiner Macht
Gesellschaft und Lebenswelten
Gemeinschaft und Verwandtschaft
Fis und Fara – Stämme und Verwandtschaftsverbände
Ehre und Gastrecht – das albanische Gewohnheitsrecht
Gesellschaft und Lebenswelten der Ebenen
Mit Frang Bardhi in der nordalbanischen Dorfwelt
Die Entstehung des Großgrundbesitzes
Städtische Lebenswelten
Mit Evliya Çelebi durch Arnavud-ili
Lebenswelten des Glaubens
Lebenswelten der Orthodoxie
Die enge Welt der albanischen Katholiken
Wie die Albaner eine mehrheitlich muslimische Gesellschaft wurden
Zwischen Umma und muslimischem Westbalkan: muslimische Lebenswelten
«Das Land der Derwische»
Religiöse Mischformen
Religiöse Harmonie oder gespanntes Nebeneinander?
Albanische Geschichte als Migrationsgeschichte (bis um 1900)
Auf geradem Weg zur Nation?
Staat und Nation (1912–1945)
Die kurze Vereinigung: die Achsenmächte und «Großalbanien» im Zweiten Weltkrieg
Zwei Wege in den Kommunismus
Was war den Albanern beidseits der Berge gemeinsam, was unterschied sie?
Epilog: Zwei albanische Staaten – transterritoriale Gesellschaften: eine Bilanz (2017)
Hinweise auf weiterführende Literatur
Zur Aussprache des Albanischen
Karte
Vorbemerkung
Die «albanische Frage» beschäftigt Medien und Politik seit Jahren. Albaner sind als Zuwanderer in vielen europäischen Ländern eine soziale Realität. Dennoch ist über albanische Geschichte wenig bekannt, und dies einer sehr langen Forschungstradition gerade im deutschsprachigen Raum zum Trotz. Was strebt die vorliegende «Geschichte der Albaner» an – und was leistet sie nicht? Der Leser soll kein umfassendes Handbuchwissen erhalten, auch keine ausführliche Analyse der jüngsten Zeitgeschichte, denn diese ist in zahlreichen neueren Untersuchungen leicht zugänglich. Ziel des Buches ist es vielmehr, wesentliche Entwicklungen in Herrschaft, Gesellschaft und Kultur nachzuzeichnen; albanische Geschichte in einem balkanischen, europäischen und auch nahöstlichen Rahmen zu verorten; nicht zuletzt auch durch einige Fallbeispiele die Vielfalt und den Reichtum albanischer Geschichte erlesbar zu machen. Deutung steht so neben bewusst stärker erzählenden Passagen. Die Knappheit des Raums führt den Text bisweilen in die Nähe eines historischen Essays. Der Verfasser hofft, dass eine klare Linienführung in der Deutung die notgedrungene Konzentration auf das Wesentlichste ausgleicht. Die im Titel verwendeten Begriffe «Orient» und «Okzident» sind nicht essenzialistisch zu verstehen – sie deuten ein Spannungsfeld an, in dem sich die albanische Geschichte bis heute bewegt.
Viele Teile der albanischen Geschichte sind in ihrer Interpretation umstritten. Daher werden in einigen Kapiteln Methoden und Argumente der Forschung vorgestellt und weniger vermeintlich sicheres Wissen.
Die verlegerische Konzeption sieht keinen Anmerkungsapparat und nur eine Kurzbibliographie vor. Daher seien an dieser Stelle die Namen von Gelehrten genannt, auf deren Werken die Darstellung wesentlich aufbaut: Peter Bartl, Nuri Bexheti, Kasem Biçoku, Martin Camaj, Zekerija Cana, Egin Ceka, Neritan Ceka, Nathalie Clayer, Konrad Clewing, Krisztián Csaplár-Degovics, Bardhyl Demiraj, Engelbert Deusch, Alain Ducellier, Ferid Duka, Dritan Egro, Robert Elsie, Cecilie Endresen, Winfried Fiedler, Bernd J. Fischer, Iljaz Fishta, Eva Anne Frantz, Konstantinos Giakoumis, Armin Hetzer, Enver Hoxhaj, Ylber Hysa, Hivzi Islami, Rexhep Ismajli, Titos Jochalas, Lumnije Jusufi, Thede Kahl, Hasan Kaleshi, Karl Kaser, Machiel Kiel, Ardian Klosi, Markus Koller, Hans-Jürgen Kornrumpf, Georgia Kretsi, Maximilian Lambertz, Fatos Lubonja, Noel Malcolm, Joachim Matzinger, Beqir Meta, Etleva Nallbani, Hubert Neuwirth, Markus W. E. Peters, Robert Pichler, Arshi Pipa, Alexandre Popovic, Selami Pulaha, Artan Puto, Gilles de Rapper, Skënder Rizaj, Michel Roux, Michael Schmidt-Neke, Gottfried Schramm, Stefanie Schwandner-Sievers, Spiro Shkurti, Georg Stadtmüller, Isabel Ströhle, Milan von Šufflay, Enis Sulstarova, Muhamet Tërnava, Bernhard Tönnes, Michael Ursinus, Ardian Vehbiu, Xhelal Ylli.
Nathalie Clayer, Konrad Clewing, Krisztián Csaplár-Degovics, Eva Anne Frantz, Idrit Idrizi, Lumnije Jusufi, Ardian Klosi, Markus Koller, Stefanie Schwandner-Sievers, Hansfrieder Vogel und Ioannis Zelepos gaben viele wichtige Hinweise. Michaela Strauss hat das Manuskript sorgfältig bearbeitet.
Alle Deutungen sowie Fehler liegen in der Verantwortung des Verfassers.
Verwendet werden heutige offizielle Ortsnamen. Je nach Sinnzusammenhang erscheinen auch ältere Formen wie Monastir für Bitola.
Gewidmet ist das Buch jenen albanischen Lesern, die eigenständig ihre reiche Geschichte in einem südost- und gesamteuropäischen Zusammenhang erkunden möchten.
Wien, im Oktober 2011
Oliver Jens Schmitt
Grundlagen der albanischen Geschichte
Zwei Wege bieten sich im Wesentlichen an, eine Geschichte der Albaner zu schreiben: zum einen die Geschichte einer Ethnie, die seit dem Altertum besteht, sich von dem antiken Volk der Illyrer herleitet und nach vergeblichen Versuchen der Herrschaftsbildung und nach jahrhundertelanger Fremdherrschaft im Jahre 1912 staatliche Eigenständigkeit erlangte, wobei mit Kosovo ein Jahrhundert danach (2008) ein zweiter albanischer Staat entstand. Zum anderen: eine albanische Geschichte als Balkangeschichte, in der sich wie in einem Brennglas die sprachliche, kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt und Zerklüftung einer europäischen Großregion beschreiben lassen.
Die erste Variante herrscht in den albanischen Gesellschaften auf dem Balkan, in Albanien, Kosovo und in Makedonien, vor. Dies ist nichts Außergewöhnliches, denn die südosteuropäischen Nachbarstaaten betrachten ihre Vergangenheit in derselben Weise. Das albanische Geschichtsbild und die albanische nationale Identität sind stark in Abgrenzung von den Nachbarvölkern, v.a. von Griechen, Serben und Montenegrinern, entstanden und haben deren Denkmuster meist spiegelbildlich übernommen. Sowenig die Albaner auf dem Balkan eine Ausnahme bilden, so wenig fallen balkanische nationale Geschichtsdeutungen aus einem gesamteuropäischen Vergleichsrahmen. Was seit dem 19. Jh. an Vorstellungen von Nation und Abstammung im westlichen und mittleren Europa entworfen worden ist, lebt heute auf dem Balkan nur bisweilen stärker fort als anderswo auf unserem Kontinent. Das zweite Konzept, albanische Geschichte als Balkangeschichte, folgt der außerhalb des Balkans in der Wissenschaft vorherrschenden Auffassung, dass die Geschichte einer Region mit jungen modernen Staatsgründungen – Serbien wurde 1815 autonom, Griechenland als erster Staat erst 1830 souverän – und einer auch durch Massenvertreibungen und -aussiedlungen bis heute nicht ganz zerstörten kleinräumigen ethnischen und religiösen Vielfalt nicht als Aneinanderreihung von Staats- und Volksgeschichten geschrieben werden könne. Verstärkt wird diese Auffassung durch die vielfältigen Formen kultureller, religiöser und gesellschaftlicher Symbiose und Verflechtung, durch bis heute von den staatlichen Nationalismen nicht verwischte Gemeinsamkeiten, von sprachlichen Strukturen und Wortschatz bis hin zu Küche und Musikgeschmack; ja selbst die Denkmuster des Nationalismus gleichen sich in der Region in auffallender Weise.
Der kroatische Historiker Milan von Šufflay entwickelte im ersten Drittel des 20. Jh.s die These, die Albaner bildeten die «Monade des Balkans», da sich in ihrer Geschichte die gesamte balkanische Geschichte seit dem Altertum mit ihren altbalkanischen, griechischen, romanischen, slawischen und osmanisch-türkischen Elementen gleichsam im Kleinen bündele. Katholisches und orthodoxes Christentum, der sunnitische Islam und eine Fülle von Derwischorden kamen hier zusammen, in einer Grenzregion zwischen der byzantinisch-osmanischen Balkanwelt und dem romanischen – lange venezianischen – Adriaraum. Als zweite These entwarf Šufflay die «serbisch-albanische Symbiose» – für Nationalisten beider Seiten heute unvorstellbar, dennoch von den Quellen besonders für das Mittelalter gut belegt.
Albanische Geschichte als Balkangeschichte zeichnet gesellschaftliche und kulturelle Überschneidungen nach, zwischen Albanern und Griechen, Südslawen, Balkanromanen, Türken, aber auch Italienern, Roma und den sehr kleinen jüdischen Gemeinden. Damit wird albanische Geschichte aber nicht gleichsam in einer Erzählung von Multiethnizität aufgelöst. Denn ein solches Denkmuster, abgesehen davon, dass es inhaltlich nicht zutrifft, weist auf dem Balkan auch eine politische Dimension auf: Seit dem 19. Jh. sprechen Nationalisten vornehmlich in Griechenland und Serbien den Albanern eine eigene Geschichte ab und betrachten sie entweder als kulturloses Barbarenvolk, das erobert und zivilisiert werden müsse, oder aber als Teil der eigenen Nation, da alle orthodoxen Albaner «eigentlich» wegen ihres Glaubens Griechen seien, die muslimischen Albaner im Kosovo «eigentlich» Serben, die islamisiert und albanisiert worden seien. Aus Furcht vor derartigen Ansprüchen bestreiten albanische Historiker mehrfache Identitäten und jede kulturelle Uneindeutigkeit. Der außenstehende Betrachter darf weder nationalistischen Denkmustern folgen noch Rücksicht auf nationale Empfindlichkeiten nehmen, ein Versuch, der leichter zu formulieren als in der Forschung umzusetzen ist angesichts der auch heute noch äußerst starken Emotionalität im Umgang mit Balkangeschichte.
Was ein Albaner ist, wurde und wird wie bei anderen ethnischen Gemeinschaften immer wieder aufs Neue verhandelt. Der Einfachheit halber wird in dieser Darstellung die Bezeichnung «Albaner» verwendet, auch wenn diese ihren Sinngehalt über die Jahrhunderte stark veränderte: vom Sprecher der albanischen Sprache, die durch ihre Eigenart schon mittelalterlichen Beobachtern auffiel und von Albanern selbst als Zeichen der Unterscheidung, bisweilen gewiss auch der Abgrenzung gegenüber ihren wichtigsten Nachbarn, Griechen und Südslawen, verwendet wurde – bis hin zum Repräsentanten der gegenwärtigen albanischen Gesellschaften mit ihrer ausgeprägten ethnonationalen Identität; eine Entwicklung, die nicht geradlinig oder gar bruchlos verlief.
Albanische Geschichte bildet in einem balkan-, aber auch europageschichtlichen Vergleich keinen Ausnahmefall – griechische, bulgarische, serbische Geschichte sind ebenfalls als Balkangeschichte zu schreiben, auch wenn die Albaner im Vergleich zu diesen Völkern vor 1912 keine längere Herrschaftsbildung und keine eigene Kirchenorganisation besessen haben. Albanische Geschichte, dies ist eine Grundthese dieses Buches, ist «normaler», d.h. weniger exzeptionell, als Albaner sie wahrnehmen, aber auch weniger «exotisch», als Nachbarn und Außenstehende oft meinen. Die Einbettung in breitere Zusammenhänge wird zeigen, dass die Suche nach nationalen Spezifika rasch ins Leere geht, sobald der Blick etwas weiter schweift.
Das Nachdenken über albanische Geschichte ist alt. Schon lange bevor (ab 1945) albanische Forschungseinrichtungen geschaffen wurden, haben abendländische Gelehrte Theorien zu Herkunft und Sprache dieses Balkanvolkes aufgestellt – der Erste war niemand Geringerer als Gottfried Wilhelm Leibniz. Zugespitzt, aber kaum übertrieben, darf man behaupten, dass albanische Geschichte bis weit in das 19. Jh. eine Domäne deutschsprachiger Gelehrter war. Kaum einem von ihnen gelang es aber, die Grundfragen der albanischen Geschichte so klar zu erfassen wie dem großen Historiker und Publizisten Jakob Philipp Fallmerayer (1790–1861), der vor 150 Jahren folgende Beobachtungen anstellte: Es gebe im südwestlichen Balkan ein Volk, dessen Sprache mit keinem der Nachbarn Ähnlichkeit aufweise. Dieses Volk nenne sich selbst «Schkjipetar» (alb. Shqiptar), sein Land «Schkjiperia» (alb. Shqipëria); es werde aber von Außenstehenden «Albaner», «Arbaniten» oder «Albanesen» genannt, sein Siedlungsraum «Albania», «Arbania» oder «Arbënia». Es lebe in den antiken Landschaften Illyria und Epirus, zwischen dem Shkodrasee im Norden und dem Ambrakischen Golf im Süden. In der Antike erscheine sein Name ein einziges Mal in der Bezeichnung einer Stadt (Albanópolis) und eines Gebirges (griech. Albanón óros, Albanergebirge). Quellenmäßig bezeugt seien die Albaner erst seit dem 11. Jh.; als praktisch handelnde Gruppe träten sie im 14. Jh. in Erscheinung, als sie nach Griechenland einwanderten. Sie zerfielen in zwei Dialektgruppen, die Gegen im Norden des Flusses Shkumbin und die Tosken südlich davon. Sie hätten niemals eine politische Einheit gebildet. Albaner siedelten in ihrem engeren Siedlungsgebiet vermischt mit anderen Völkern, aber auch verstreut in anderen Teilen des Balkans. Als Eroberer und Siedler seien sie im späten Mittelalter nach Griechenland und Unteritalien gelangt. Sie seien kein «Kulturvolk», hätten «auf geistigem Gebiet während einer Jahrtausende füllenden Existenz auch nicht das geringste geleistet und den lebendigen Beweis geliefert, dass ein Volk, wenn es sich nur den allgemeinen Bedingungen menschlicher Gesittung unterwirft, dabei mannhaft und streitbar ist, auch ohne Wissenschaft, ohne Kunst und sogar ohne ABC leben und seine Urkraft selbst inmitten hoch gebildeter Nationen ungeschmälert bewahren kann».
Fallmerayer fasst seine Grundüberlegungen zur albanischen Geschichte in Sätzen zusammen, die heute in ihrer apodiktischen Form wohl befremden mögen: «Die Albanesen huldigen überall dem Stillstand, dem Maass der Selbstbeschränkung und dem stöckigsten Conservatismus, wie ihn nur der wie bewegungslose, in sich selbst erstarrte Orient versteht. Die Albanesen, wo immer sie ihr Naturell frei entfalten können, sind überall selbstsüchtige, meuterische, unzuverlässige und selbst als Christen grausame, dagegen aber rührige, unerschrockene, sparsame und hartknochige Handarbeiter, Schiffer, Bauern und Soldaten, denen man nicht mit allgemeinen Ideen, mit Gefühlspolitik, mit zünftiger Weisheit und mit philosophischen Weltbeglückungstheorien kommen darf. Das Verlangen, irgendeine verlässige Kunde über die eigene nationale Vergangenheit zu erfahren, ward in Albanien bis auf den heutigen Tag noch von niemand empfunden. Weder in der Politik noch in der Wissenschaft hatte dieses Volk je einen gemeinsamen Gedanken, und es scheint auch nicht, dass den Albanern über den beschränkten Horizont der Familie und des Clans, des Privaterwerbs, des Eigennutzes, der Gehässigkeit und der Rache hinaus zu dringen je das Bedürfnis angewandelt hat. Albanien ist die Heimat der kurzen Gedanken, das Vorratshaus physischer Kraft, das Land, welches freiwillig weder sich selbst noch anderen gehorchen will; Albanien ist das Element, welches stets verneint und bei welchem Anarchie und Gesetzlosigkeit gleichsam die Seele und der Lebensodem ist.»
Fallmerayers Thesen erscheinen auf den ersten Blick als klassisches Beispiel von «Orientalismus», der Exotisierung eines Volkes; er stellt dessen Eigenschaften als essenziell hin, als absolut. Wären sie in Albanien besser bekannt, hätten sie ihm wohl jene lang andauernde Ablehnung eingetragen, die in Griechenland seine Lehrmeinung von der slawisch-albanischen Abstammung der Neugriechen ausgelöst hatte. Fallmerayer schrieb um 1860, als die osmanischen Reformen (Tanzimat), denen er große Sympathie entgegenbrachte, auch am Widerstand konservativer albanischer Muslime zu scheitern drohten. Er benannte Grundfragen der albanischen Geschichte, die die Forschung auch heute noch beschäftigen. Eines schien ihm jedoch eine Selbstverständlichkeit: dass die Albaner auf dem Balkan als Ganzes zu betrachten seien. Der Balkankrieg von 1912 hat zwar einen unabhängigen albanischen Staat hervorgebracht, doch wurden rund die Hälfte der Albaner und ihre Siedlungsgebiete v.a. Serbien, aber auch Griechenland und Montenegro zugeschlagen. Im 20. Jh. nahmen die Albaner inner- und außerhalb des Nationalstaates unterschiedliche Wege. Die Geschichtsschreibung folgte aus unterschiedlichen Gründen den jungen Staatsgrenzen und zerriss damit alte Zusammenhänge. Nicht eine Geschichte Albaniens oder des Kosovo soll im Folgenden versucht werden, sondern eine Geschichte aller Albaner in ihren balkanischen und gesamteuropäischen Zusammenhängen.
Wann beginnt die Geschichte der Albaner?
In albanischer Perspektive ist die Antwort auf diese Frage klar: Die Albaner sind das älteste Volk Europas, mit ihnen hebt gleichsam europäische Geschichte an. In dieser Sicht ist albanische Geschichte Volksgeschichte, und diese ist eng an die albanische Sprache gebunden. Vor dem Spätmittelalter hat sich kein Albaner in überlieferter Form zu seiner eigenen Gruppe geäußert; vor dem 16. Jh. sind keine längeren albanischen Texte erhalten – das erste albanische Buch, die Übersetzung eines katholischen Messbuchs durch Gjon Buzuku (1555), ist nur in einem einzigen Exemplar überliefert. Vor 1912 hat es keinen albanischen Staat und keine einheitliche politische Geschichte der Albaner gegeben. Da sie diese Tatsachen im Vergleich mit den Nachbarn auf dem Balkan als Defizite empfanden, entwickelten albanische Nationalisten die Vorstellung einer illyrisch-albanischen Kontinuität von Volk und Sprache, die heute als unhinterfragte, aber auch unhinterfragbare Wahrheit gilt. Im europageschichtlichen Vergleich fallen Parallelen zu einem anderen nichtromanisierten alteuropäischen Volk auf, den Basken, deren Geschichte bis in die Frühe Neuzeit nur aufgrund von Zeugnissen Außenstehender zu schreiben ist, deren Sprache erstmals 1545 für ein Buch verwendet wurde, deren Herkunft ungeklärt und ideologisch umstritten ist und deren Nationalismus in Abgrenzung zu Nachbarn, die kulturell und politisch als überlegen empfunden werden, auf dem Alter der Sprache und der Ansiedlung beruht.
Die außeralbanische Forschung versucht, in der Kontinuitätsfrage einen differenzierten Zugang einzunehmen. Die antike Geschichte der Albaner ist mehr ein Forschungsproblem als ein Gegenstand gesicherten Wissens. Zwar ist es möglich, die antike Geschichte des heutigen Siedlungsgebiets der Albaner darzustellen, also die Geschichte der Illyrer und ihres Zusammenlebens mit neu gegründeten griechischen Städten an der Küste (seit dem 7. Jh. v. Chr.) und römischen Eroberern (seit dem 3. Jh. v. Chr.), doch muss dies unter dem Vorbehalt geschehen, dass die Kontinuitätsthese nicht gesichert ist. Unüblich ist dieses Vorgehen nicht: Man denke an die Einbeziehung antiker Völker wie der Kelten oder sogar jungsteinzeitlicher Bevölkerung in immer noch gängige Darstellungen im westlichen Europa. Im albanischen Falle stellt jede zeitliche Gliederung der Darstellung eine Stellungnahme in der politisch hochumstrittenen Kontinuitätsdebatte dar. Beginnt sie mit dem Altertum, wird zumindest unausgesprochen jene illyrisch–albanische Kontinuität angenommen. Setzt sie erst mit dem Auftreten der Albaner in den schriftlichen Quellen (11. Jh.) ein, erscheinen die Albaner im Vergleich zu Griechen, Balkanromanen und Südslawen als «junges» Volk auf dem Balkan.
Der Forschungsstand zur Kontinuitätsfrage wird noch ausführlich geschildert. Die vorliegende Darstellung geht von der Überlegung aus, dass die heutigen Albaner von einem altbalkanischen Volk abstammen, d.h. einem Volk, das bereits vor der römischen Herrschaft auf dem Balkan ansässig war. Ob es sich dabei nun um die Illyrer, ein weiteres namentlich bekanntes oder gar ein mit Namen nicht belegtes Volk handelt, ist zumindest in unserem Zusammenhang – nicht aber für die Albaner selbst und ihre südosteuropäischen Nachbarn! – von zweitrangiger Bedeutung. Da linguistische Forschungen das Albanische in die vorchristliche Antike zurückführen, nimmt albanische Geschichte nicht erst mit den Quellenbelegen byzantinischer Geschichtsschreiber des Hochmittelalters ihren Anfang. Daraus folgt zweierlei: Die römische Herrschaft auf dem Balkan bildet den geschichtlichen Rahmen für die Vorfahren der Albaner; unsere Darstellung berücksichtigt denn auch das Altertum, legt aber einen besonderen Schwerpunkt auf die Schilderung der aktuellen Forschungsdiskussion um die Kontinuitätsthese.
Die Periodisierung der albanischen Geschichte
Ist der Beginn der albanischen Geschichte also nicht gerade leicht zu bestimmen, bereitet der Endpunkt, die unmittelbare Gegenwart, keine derartigen methodischen Schwierigkeiten. Dies gilt aber nicht für die Gliederung nach Epochen. Die «Historia e popullit shqiptar», die eben abgeschlossene offiziöse «Geschichte des albanischen Volkes» der Albanischen Akademie der Wissenschaften, teilt ihre vier Bände folgendermaßen auf: Der erste Band reicht vom Altertum bis ca. 1830, bis zu den Anfängen der osmanischen Reformperiode (Tanzimat), v.a. aber den ersten Anzeichen der albanischen Nationalbewegung; Band 2 behandelt die albanische Nationalbewegung bis zur Gründung des albanischen Staates (1830–1912); Band 3 beschreibt die Geschichte des albanischen Nationalstaates bis zur Invasion durch das faschistische Italien im Jahr 1939; Band 4 schließlich geht bis zum Sturz des Kommunismus (1990/92). Kosovo wird dabei gleichsam als Anhang, weniger als integraler Teil behandelt.
Diese ungleichmäßige Verteilung des Stoffes folgt der Gliederung der Nationalgeschichte nach vier Säulen, die von den kommunistischen Parteihistorikern nach 1945 entwickelt worden sind. Sie stützen sich ihrerseits auf ältere, gegen Ende des 19. Jh.s entstandene Denkmuster: 1) die antiken Illyrer; 2) die mittelalterliche Staatsbildung unter dem Nationalhelden Skanderbeg (1405–1468); 3) die sog. Wiedergeburt (Rilindja) im 19. Jh.; 4) die Staatsbildung im Jahre 1912 und ihre Vollendung im 20. Jh., auf die die ganze albanische Geschichte in einem teleologischen Prozess zuläuft. Aus der europäischen Geschichte haben albanische Historiker die Epochen des Altertums und des Mittelalters übernommen. Die für West- und Mitteleuropa gebräuchlichen Begriffe Frühe Neuzeit und Neuzeit lassen sich für die lange Periode der osmanischen Herrschaft (ca. 1385–1912) hingegen kaum anwenden – was freilich auch weder albanische noch auswärtige Forscher tun. Die beinahe fünfeinhalb Jahrhunderte der osmanischen Herrschaft prägen die albanischen Gesellschaften bis heute, werden aber in der albanischen Geschichtsdarstellung stiefmütterlich, oft sogar negativ behandelt. Mit der osmanischen Eroberung nimmt der albanische Siedlungsraum in der Tat einen eigenen Weg – die osmanische Herrschaft ist als eigene Geschichtsepoche aufzufassen, die zwar nach Phasen unterschiedlicher Herrschaftsdichte untergliedert, doch nicht in Bezug zu abendländischen Entwicklungen der Frühen Neuzeit und der Neuzeit gebracht werden kann, wie Humanismus, Medienrevolution des Buchdrucks, Reformation, Gegenreformation, Barock, Aufklärung, Industrialisierung. Die albanischen Gesellschaften des 20. Jh.s lassen sich in vielen Bereichen als postosmanisch beschreiben, da der albanische Siedlungsraum erst vor einem Jahrhundert aus der osmanischen Herrschaft entlassen worden ist. Ohne eine genaue Beschreibung der osmanischen Periode ist ein Verständnis der heutigen albanischen Gesellschaften nicht möglich. Die vorliegende Darstellung legt daher ihren Schwerpunkt auf eine Vormoderne, die bis tief in die Zwischenkriegsgeschichte reicht. So werden Strukturen und Tiefenströmungen der albanischen Geschichte fassbar, die einem auf die jüngste Vergangenheit verkürzten Blick entgehen.
Albaner oder Skipetaren?
Die meisten Albaner nennen sich heute «shqiptar». Mit Ausnahme des Serbischen, wo der Begriff «šiptar» äußerst abfällig verwendet wird (korrekt spricht man von «albanac»), bezeichnen aber alle Nachbarvölker die Albaner mit einem Begriff, der den Stamm «alb» oder «arb» aufweist. Auch die im Spätmittelalter nach Griechenland und Unteritalien ausgewanderten Albaner bezeichnen sich nicht als «shqiptar», sondern als «Arvaniten» bzw. «Arbëresh». Wie ist diese Erscheinung zu erklären? Im Mittelalter kannten die Albaner als Volksnamen für sich selbst nur den Begriff «arbër», ihren Siedlungsraum nannten sie «Arbëria» oder «Arbënia». Dieser Name leitet sich von dem in der Antike wenig belegten Stammesnamen der «Albanoí» ab. Ob und wie die Albaner ihn von einem anderen Ethnikum angenommen haben, ist unklar. Einzigartig wäre eine derartige Aneignung eines alten Volks- bzw. Raumnamens nicht. Deutsche Siedler haben im Hochmittelalter den Namen der von ihnen unterworfenen Prussen angenommen (Preußen).
Während man die Herkunft des Volksnamens Albaner kaum klären kann, stehen für den Wechsel von «arbër» zu «shqiptar» einige wenige Schriftquellen zur Verfügung. Die Ablegung des alten Volksnamens erfolgte sehr spät, um 1700, und stellt zumindest unter diesem Gesichtspunkt eine europäische Auffälligkeit dar. Warum nimmt eine große Gruppe einen neuen Namen an? Die albanische Gesellschaft war von der osmanischen Eroberung, die ein Jahrhundert (1385–ca. 1500) gedauert und in Teilregionen schwerste Verwüstungen und Bevölkerungsverluste mit sich gebracht hatte, in ihren Grundfesten erschüttert worden. Im 16. und besonders im 17. Jh. waren viele Albaner zum Islam übergetreten. Der Name «arbër» war eng mit der mittelalterlichen christlichen Kultur verbunden, die durch den Islam beiseitegedrängt wurde. Die islamisierten Albaner als Träger osmanischer Macht auf dem Balkan vermieden zunehmend einen Namen, der an die christliche Vergangenheit erinnerte. Der Begriff «shqiptar» (wohl von dem Verb «shqiptoj», «sich verständlich ausdrücken») breitete sich im geschlossenen Sprachgebiet auf dem Balkan allmählich – wohl im 18. Jh. – auch auf albanische Christen aus und diente zur Abgrenzung von Anderssprachigen. Er erfasste aber nicht jene albanischen Gemeinschaften außerhalb des Kernsiedlungsgebietes, d.h. in Griechenland und Süditalien. Die umwohnenden Völker haben – mit Ausnahme der eng mit den «shqiptar» verwobenen Serben – den Namenswechsel nicht nachvollzogen, sieht man von altmodischen Ausdrücken wie «Skipetar» (bekannt v.a. durch Karl Mays «Durch das Land der Skipetaren») einmal ab. Kein anderes europäisches Volk der Neuzeit hat auf einen tiefen kulturellen Schock eine derart radikale Identitätsänderung vollzogen: «Shqiptar» verlieh der völligen Umorientierung der albanischen Gesellschaft Ausdruck, die bis 1912 in ihrer übergroßen Mehrheit nach Istanbul, der Hauptstadt des Osmanischen Reiches, blickte.