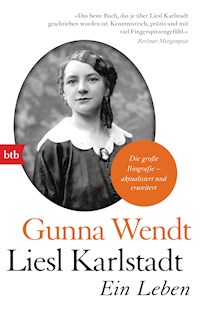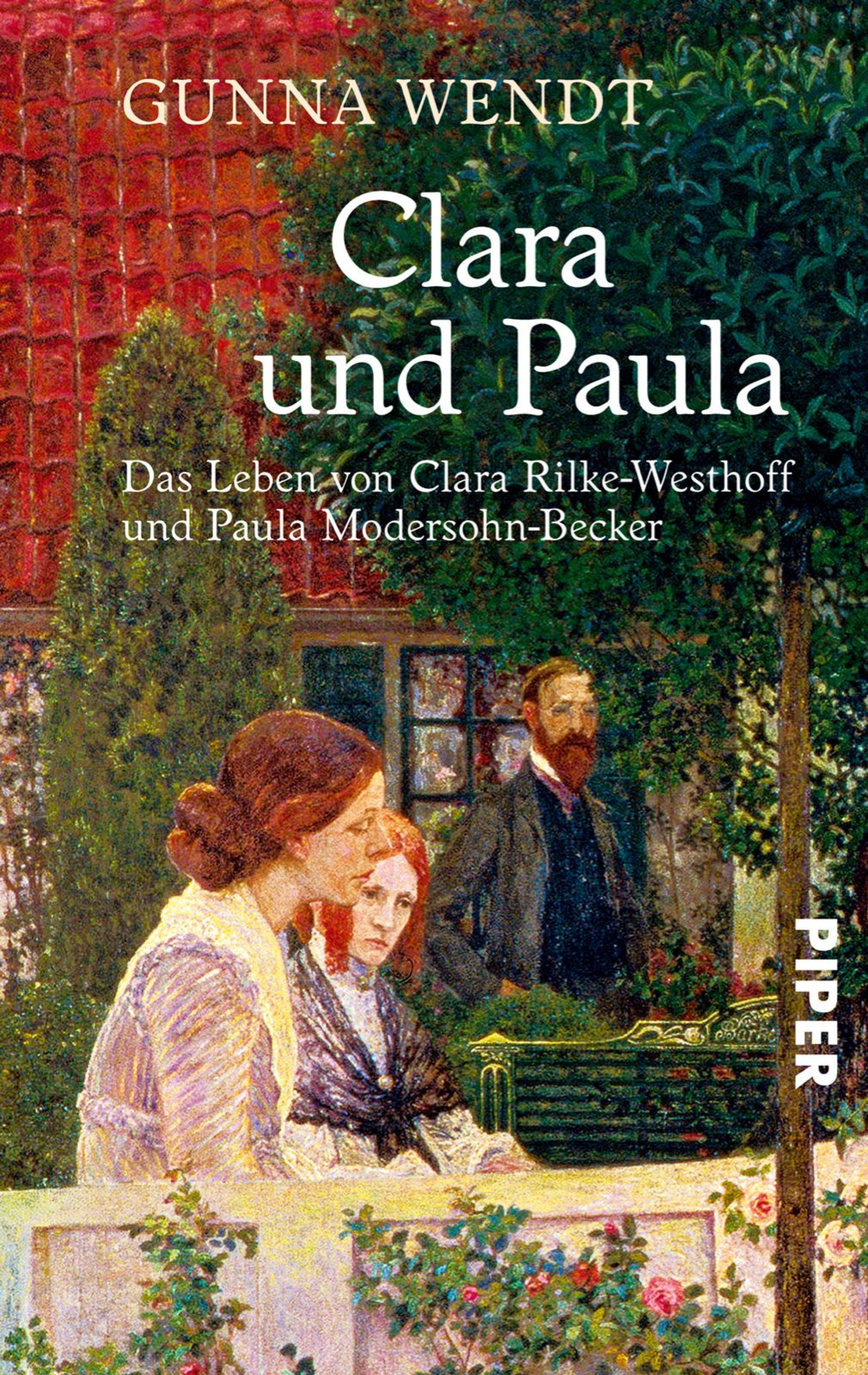12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine schillernde Dynastie in den Wirren ihrer Zeit. Als Carl Bechstein Mitte des 19. Jahrhunderts ein Liszt-Klavierkonzert besucht, wird er Zeuge, wie der Furor des Pianisten den Flügel nach und nach in seine Einzelteile zerlegt. Von da an ist es das Ziel des jungen Klavierbauers, Instrumente zu erschaffen, die das gesamte Spektrum von lyrischen bis dramatischen Tonfolgen bewältigen. Es wird der Beginn eines märchenhaften Aufstiegs. Doch es folgt auch ein dunkles Kapitel: Eine Schwiegertochter Carls, Helene, ist eine frühe Verehrerin Adolf Hitlers. Sie führt ihn in ihren einflussreichen Berliner Salon ein und fördert seinen Aufstieg in der Reichshauptstadt entscheidend. Die wechselvollen Geschicke dieser bedeutenden Familie erschließt zugleich anschaulich ein zuweilen provokantes Kapitel deutscher Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Eine schillernde Dynastie in den Wirren ihrer Zeit
Als Carl Bechstein Mitte des 19. Jahrhunderts ein Liszt-Klavierkonzert besucht, wird er Zeuge, wie der Furor des Pianisten den Flügel nach und nach in seine Einzelteile zerlegt. Von da an ist es das Ziel des jungen Klavierbauers, Instrumente zu erschaffen, die das gesamte Spektrum von lyrischen bis dramatischen Tonfolgen bewältigen. Es wird der Beginn eines märchenhaften Aufstiegs. Doch es folgt auch ein dunkles Kapitel: Eine Schwiegertochter Carls, Helene, ist eine frühe Verehrerin Adolf Hitlers. Sie führt ihn in ihren einflussreichen Berliner Salon ein und fördert seinen Aufstieg in der Reichshauptstadt entscheidend.
Die wechselvollen Geschicke dieser bedeutenden Familie erschließen zugleich anschaulich ein zuweilen provokantes Kapitel deutscher Geschichte.
Gunna Wendt
Die Bechsteins
Eine Familiengeschichte
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Bechstein und Bechstein
Bechstein – mehr als ein Klavier
Von einem, der auszog, das Glück zu suchen
Revolutions- und Flügeljahre
Künstler und Revolutionäre
In kreativer Balance
Intermezzo 1: Denys Proshayev – Denken mit den Fingern
Lisztomanie
Intermezzo 2: Kit Armstrong – Klänge, die man nicht vergisst
Selfmademan in Berlin
Klaviermagie
Intermezzo 3: Moritz Eggert – Ein Flügel ist ein Flügel
Klavierfieber
Intermezzo 4: Gerrit Zitterbart – Fünf Flügel mit Persönlichkeit
Tusculum in Erkner
Frauenklavierfieber
Intermezzo 5: Ulrike Haage – Reichlich weiblich
Brieffreunde
Wagner, München und der König
Der Beflügler
Das Erbe
Vier Jahreszeiten
Unterweisungen im Salon
Die Weggefährtinnen
Von Landsberg nach Bayreuth
Bechstein gegen Bechstein
Obersalzberg
Ein mutiger Aufbruch
Familiengeschichten
Anhang
Quellen
Dank
Bildnachweis
Über Gunna Wendt
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Bechstein und Bechstein
Ich ging noch nicht zur Schule, als ich zum ersten Mal auf den Namen Bechstein stieß – und das gleich zweimal zur selben Zeit: als Aufschrift auf einem Klavier und als Name eines Verfassers von Märchen und Sagen, die ich vorgelesen bekam, zuerst von meiner Tante und später von meiner Freundin Sybille. Sie war fünf Jahre älter als ich. Als wir uns kennenlernten, konnte sie längst lesen, worum ich sie beneidete. Ihre Familie gehörte nicht zu den Alteingesessenen im Dorf, sondern zu den Flüchtlingen, denen nach dem Zweiten Weltkrieg überall auf dem Land Wohnungen zugewiesen wurden. Die Familie bestand aus meiner Freundin, ihrer viel älteren Schwester und ihrer Mutter – alleinerziehend, von irgendwo »aus dem Osten« kommend. Woher genau sie stammten und warum sie sich gerade in unserem kleinen Dorf angesiedelt hatten, weiß ich nicht mehr. Auch nicht, wo sie vorher gelebt hatten. Eine Zwischenstation war Hannover gewesen. Dort arbeitete Sybilles Schwester, wohnte zur Untermiete und kam immer nur am Wochenende in die kleine Wohnung.
Wenn ein Kind von fünf Jahren eine fremde Wohnung betritt, ist dort alles neu und selbstverständlich zugleich. Mir kam es damals nicht ärmlich vor, wie Sybille und ihre Mutter lebten. Im Gegenteil, sie besaßen ein großes schönes Radio mit Leuchtschrift, auf dem viel mehr Sender zu finden waren als auf unserem. Wenn Sybilles Mutter nicht gerade die Nachrichten eingeschaltet hatte, was sie regelmäßig tat, hörte sie Musik. Klassische Musik. Nie Gesang, fast immer Klavier. Und in dem kleinen Flur, der die Wohnküche vom Schlafzimmer, in dem es drei Betten gab, trennte, stand ein Klavier. Als ich zu Hause davon erzählte, wollte man mir nicht glauben. Auch nicht, dass Sybille Klavierunterricht nahm und für mein Empfinden wunderschön spielte. Da konnten die Nachbarn noch so sehr klopfen, wenn sie übte, und ihr Missfallen über den Lärm äußern. Als Sybille sich einmal weigerte, mir etwas vorzuspielen, weil die Nachbarn mit ihr geschimpft hatten, wurde ich so wütend, dass ich die Treppe hinunterlief, klingelte und, lauthals und mit dem Fuß aufstampfend, meinem Zorn freien Lauf ließ. Der Ausbruch des fünfjährigen erbosten Kindes wirkte: Eine Zeitlang ließen sie Sybille in Ruhe.
Auf dem Klavier stand ein Schriftzug mit einer kleinen Krone. »Bechstein«, las mir Sybille vor – das sei die Marke des Instruments. Fast zur selben Zeit entschied meine Tante, von »Grimms Märchen«, die ich auswendig kannte, auf »Bechsteins Märchen und Sagen« umzusteigen. Das dicke Buch enthielt viele Zeichnungen, die mich sofort in ihren Bann zogen. Vor manchen hatte ich Angst. Meine Tante hatte mir den Unterschied von Sagen und Märchen erklärt, daher wusste ich, dass Sagen einen Wahrheitsgehalt hatten und nicht nur ausgedacht waren. Rübezahl zum Beispiel: Sybilles Mutter hatte uns von diesem launischen Berggeist aus ihrer Heimat erzählt, der den Menschen manchmal half und Gutes tat, sie jedoch ein andermal an der Nase herumführte und sogar streng bestrafte. In Bechsteins Märchen-und-Sagen-Buch sah man ihn nur von der Seite, das Gesicht abgewandt, zielstrebig des Weges schreitend – mit rotem Bart, kräftigen nackten Beinen und einer schweren Keule über der Schulter. Es gab im Buch auch noch einen anderen Riesen mit rundem grimmigem Gesicht und rotem Haar, das in seinen ebenso roten Bart überging. Er war so groß, dass er, auf ein Hausdach gelehnt, ins Dorf hineinschaute – unbemerkt von seinen Bewohnern.
Das kleine Mädchen, das auf dem Cover des Buches abgebildet war, blickte ebenfalls in eine Miniaturwelt, wurde jedoch von deren Einwohnern wahrgenommen. Mit weitgeöffneten Armen betrachtete sie das Treiben der Däumlinge und Däumelinchen. Mit ihren blonden Zöpfen sah sie Sybille so ähnlich, als habe diese der Zeichnerin Modell gesessen. Weil das Buch zu Hause an seinem Platz bleiben musste, löste ich einfach den Umschlag ab, steckte ihn ein und zeigte ihn Sybille. In meiner Erinnerung war es der Tag, als sie mir verriet, dass der Schriftzug auf dem Klavier »Bechstein« lautete. Seither ist all das eng miteinander verbunden: die Märchen und Sagen Ludwig Bechsteins mit Wahrheitsgehalt, das Klavier von Bechstein mit der kleinen Krone und Sybille, die eines Tages nicht mehr da war. Während ich mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren war, hatte sie mit ihrer Mutter das Dorf verlassen. Keiner wusste genau, wo sie hingegangen waren. Kurz danach kam ich in die Schule und konnte bald selber lesen und schreiben. Da war ich wütend auf Sybille. Warum hatte sie sich nie bei mir gemeldet – ich hätte ihr so gern geschrieben. In meinen Träumen tauchte sie noch lange auf als das kleine blonde Mädchen vom Cover der Märchensammlung, das in einem schäbigen Hausflur auf einem prächtigen gekrönten Klavier für mich spielt.
Bechstein – mehr als ein Klavier
Als Ideal schwebt mir vor, wenn ich über einem Autor sitze, nichts zu schreiben, was ihn traurig machen könnte. Man sollte an den Autor denken, über den man schreibt. Man sollte so fest an ihn denken, dass er kein Objekt mehr sein kann und man selbst sich nicht mehr mit ihm identifizieren kann. Zu vermeiden ist eine zweifache Schändlichkeit: das Gelehrtenhafte und das Familiäre. Man sollte dem jeweiligen Autor ein wenig von der Freude, der Kraft, dem politischen und amourösen Leben zurückgeben, die er selbst sich auszudenken und zu vermitteln vermochte.
Gilles Deleuze/Claire Parnet
Dialoge
Während meiner Arbeit an diesem Buch haben mich Gilles Deleuzes Sätze begleitet wie so oft bei meinen Biographien. Natürlich musste ich das Wort »Autor« jeweils ersetzen, denn es waren nicht immer Schriftsteller, über die ich geschrieben habe. Diesmal ist es eine ganze Familie – noch dazu eine der besonderen Art. Doch den Anfang macht auch hier ein Einzelner: Carl Bechstein, der Klavierbauer, Firmengründer und Patriarch. Was ihn auszeichnet, ist die Zurückhaltung, wenn es um seine eigene Person geht. Sie steht in deutlichem Gegensatz zu seiner Begeisterung für seine Arbeit und deren Produkte: die Instrumente, die er schuf und von Anfang an auf professionelle und moderne Art und Weise vermarktete. Im Vordergrund standen für ihn stets das Klavier und die Musik. Treffend wurde er von seinem Freund Hans von Bülow als »Beflügler« bezeichnet. Er beflügelte die Welt – indem er Instrumente baute und indem er der Welt zeigte, dass ein Leben ohne Musik nicht nur wertlos, sondern sinnlos war.
Seine Lebensgeschichte führt in das Revolutionsjahr 1848, in die glanzvollen europäischen Metropolen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in denen ein Klavierfieber ausgebrochen war – nach Berlin, Paris, London. Zu seinen – künstlerischen – Weggefährten und Gesprächspartnern: Hans von Bülow, Richard Wagner, Franz Liszt, die als schillernde Gestalten die damalige Musikwelt, in der sich der bodenständige Carl Bechstein geschickt, aber nicht als Frontmann bewegte, greifbar machen. Und zeigt den märchenhaften Aufstieg eines Unternehmers, der seine Familie wie seine Firma mit viel Zuneigung und Persönlichkeit prägte und förderte, während sich die Institution Familie und die Rolle der Frauen wandelte, was sich nicht zuletzt in einem weiteren wichtigen Protagonisten spiegelt: dem Klavier als Kulturgut der deutschen Gesellschaft.
Doch es gibt auch ein dunkles Kapitel in der Lebens- und Wirkungsgeschichte der Dynastie: Carls Schwiegertochter Helene war eine frühe Verehrerin Adolf Hitlers. Sie führte ihn in ihren einflussreichen Berliner Salon ein und förderte seinen Aufstieg in der Reichshauptstadt entscheidend. Ihr Engagement schadete der Firma, als die zweite Generation das Unternehmen leitete, und die Entnazifizierung verzögerte den Wiederaufbau.
Ende der 1960er Jahre aber begann eine neue Ära, deren nachhaltigen Erfolg uns die großen Stars des 20. und 21. Jahrhunderts eindrücklich vor Augen führen: Freddie Mercury spielte die Aufnahmen für das Queen-Album »A Night at the Opera« auf einem Bechstein-Flügel, die Beatles nahmen »Hey Jude« und viele Songs ihres »White Album« auf einem Bechstein-Flügel auf. Bob Dylan setzte sich in Martin Scorceses Film »No Direction Home« an ein Bechstein-Klavier, um seine »Ballad of a Thin Man« zu begleiten. David Bowie, Elton John, Chick Corea, Joni Mitchell, Annie Lennox, Billie Joel schwärmten von Bechstein wie seinerzeit Franz Liszt, Hans von Bülow, Claude Debussy und Ferruccio Busoni. Und auch die heutigen Stars schätzen den Bechstein-Flügel, wie ich in fünf Interviews mit großen zeitgenössischen Pianisten erfahren durfte.
Die Geschichte dieser schillernden Dynastie, deren Klavierbaukunst die Musikwelt bis heute nachhaltig prägt, spiegelt nicht nur die Wirren ihrer Zeit, sondern reicht direkt bis in die Gegenwart.
Von einem, der auszog, das Glück zu suchen
Carl Bechstein, der als Klavierbauer und Gründer der Berliner Pianoforte-Fabrik C. Bechstein Geschichte schrieb, könnte eine Figur aus der Feder seines Verwandten, des Märchen- und Sagen-Sammlers Ludwig Bechstein, sein. Die beiden Männer, deren Altersunterschied 25 Jahre betrug, waren allerdings nur entfernt miteinander verwandt: Carls Vater und Ludwig waren Cousins. Ob sich Carl und Ludwig je begegnet sind, ist nicht bekannt.
Beliebter Protagonist zahlreicher Märchen und Mythen ist ein junger Mann – damals nannte man ihn Jüngling –, der sein Elternhaus, seine vertraute Umgebung, seine Heimat verlässt, um die Welt, das Leben und vor allem sich selbst kennenzulernen. Erzählt wird von seinen unterschiedlichen Erfahrungen und den Abenteuern, die er zu bestehen hat. Dieses Motiv des Glückssuchers taucht nicht nur in den Märchen aus aller Welt auf, sondern hat darüber hinaus ein ganzes literarisches Genre begründet: den Entwicklungsroman. Als solcher könnte die Lebensgeschichte des Klavierbauers Carl Bechstein zu lesen sein, den sein Weg schon früh von zu Hause fort in die Metropolen Europas führte.
1 Carl Bechsteins Geburtshaus in Gotha
Er wurde als Friedrich Carl Wilhelm Bechstein am 1. Juni 1826 in der Siebleberstraße in Gotha geboren. Im Geburts- und Taufregister der Kirche St. Margareten heißt es: »Carl Friedrich Wilhelm, 3. Kind, erster Sohn des weiland Herrn Friedrich Wilhelm August Bechstein, Bürgers und Friseurs hier, und dessen Ehefrau, weiland Christiane Ernestine Auguste, geborene Reißing, ist den ersten Juni, früh vier Uhr 1826 geboren und am achten Juni desselben Jahres getauft.«
In der Ahnenliste der Familie Bechstein findet man Berufe wie Hoffriseur und Perückenmacher, Schullehrer, Bäcker, Anspänner, Schäfer, Lakai, Tischler, Lehrer, Schmied, Tagelöhner, Schlosser, Fuhrmann, Müller. Carls Vorfahren stammen aus der Gegend zwischen Erfurt und Eisenach, die damals zum Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg gehörte. »Am Fuße des Inselberges in den Dörfern Laucha und Langenhain und in den Städten Waltershausen und Ohrdruf sitzen die Bechsteins als Ackerbauern und Handwerker seit mehreren Jahrhunderten. Alle sind ausgezeichnet durch einen hohen Grad von Intelligenz, einen ernsten Sinn und das Streben, sich emporzuarbeiten. Angeboren ist ihnen ein außerordentliches musikalisches Talent, und dies wurde die Veranlassung, dass viele von ihnen den Lehrerberuf ergriffen«, schreibt der Studienrat Max Berbig am 27. Mai 1926 im Gothaischen Tageblatt anlässlich des 100. Geburtstags von Carl Bechstein. In diesem Landstrich zwischen Unstrut und Thüringer Wald war auch die wohl bedeutendste deutsche Musikerdynastie, die Familie Bach, beheimatet. So wurde der Urururgroßvater Johann Sebastian Bachs, Hans Bach, 1550 in Wechmar geboren.
Auch Ludwig, der Spross der anderen Bechstein-Familie, der ein Werk hinterlässt, das bis heute präsent ist, hatte sowohl literarische als auch pädagogische Ambitionen. Er wollte zur Förderung der nationalen Einheit Deutschlands beitragen, indem er identitätsstiftende Mythen sammelte, darunter auch die Sage »Vom edlen Ritter Tannhäuser«, die Richard Wagner in den 1840er Jahren zu einer seiner bekanntesten Opern inspirierte. Ludwig Bechstein wurde am 24. November 1801 in Weimar als unehelicher Sohn der Johanna Carolina Dorothea Bechstein und des französischen Emigranten Louis Hubert Dupontreau geboren. Zunächst trug er den Namen Louis Dupontreau. »Ich war ein armes Kind, das keinen Vater hatte, und das die Mutter in zartester Jugend in Miethlingshände gab«, berichtet Ludwig Bechstein in seiner unvollendeten autobiografischen Skizze »Summa Summarum«, die im Tonfall an die von ihm herausgegebenen Märchen und Sagen angelehnt ist.
2 Ludwig Bechstein, Zeichnung von Ferdinand Diez, 1843
Nachdem ihn sein Onkel Johann Matthäus Bechstein 1810 adoptiert hatte, erhielt er auch dessen Namen und hieß von nun an Ludwig Bechstein. Er absolvierte eine Apothekerlehre und studierte anschließend mit einem Stipendium des Herzogs Bernhard von Sachsen-Meiningen Geschichte, Philosophie und Literatur – zunächst in Leipzig und ab 1830 in München. Anschließend bekam er eine Anstellung als Bibliothekar und später als Archivar in Meiningen. Er war zu Lebzeiten ein vielgelesener Autor von Balladen, Novellen, Erzählungen und historischen Romanen. Sein Nachlass umfasst rund 20000 Manuskriptseiten. Er starb am 14. Mai 1860 in Meiningen, erlebte also den Aufstieg seines entfernten Verwandten zum führenden Klavierbauer seiner Zeit nicht mehr.
Zurück zu Carls direkten Vorfahren: Sein Großvater, Dieter Johann Christoph Bechstein, stand über zwanzig Jahre lang als Kammerdiener im Dienst des Prinzen August von Sachsen-Gotha-Altenburg. In seine Zuständigkeit fiel auch die »Pflege der Musik«. Er war vielseitig gebildet und trat, nachdem er den Fürstenhof verlassen hatte, eine Anstellung als Lehrer in Laucha an, die er zehn Jahre lang, bis zu seinem Tod, innehatte. Am 10. August 1789 wurde sein Sohn Friedrich Wilhelm August geboren, Carl Bechsteins Vater. Bereits im Alter von 14 Jahren musste dieser sein Elternhaus verlassen und selbst für seinen Unterhalt aufkommen – das Schicksal der Söhne kinderreicher Familien der unteren Schichten. Er arbeitete als selbständiger Friseur und Perückenmacher und konnte schließlich in der Siebleber Straße in Gotha ein eigenes Geschäft eröffnen. Doch sein Beruf erfüllte ihn nicht. Wann immer er konnte, spielte er auf seinem Spinett. Er war ein großer Bewunderer Mozarts und Beethovens und gab die Liebe zur Musik an seine Kinder weiter: an die 1822 geborene Cäcilie, die 1824 geborene Emilie und den 1826 geborenen Carl. Die vorerst glückliche Kindheit der drei Geschwister nahm bald ein zunächst schleichendes, später gewaltsames Ende: Kurze Zeit nach Carls Geburt erkrankte der Vater und starb 1831 mit 42 Jahren. Da war Carl fünf Jahre alt. Es muss für die Familie schlimm gewesen sein, hilflos mit anzusehen, wie der einst so unternehmungslustige Ehemann und Vater immer schwächer wurde. Man kann davon ausgehen, dass Carl ihn nur als kranken Mann gekannt hat, der sich nicht um ihn kümmern konnte, so dass er nahezu vaterlos aufwuchs.
Drei Jahre später heiratete die Mutter, Christine Ernestine Auguste Bechstein – sie war die Tochter des herzoglichen Kaffeekochs Reißing –, einen langjährigen Freund des Hauses, den Lehrer und Kantor Agthe aus Dietzendorf. Dessen Vorname wird nirgends genannt, stattdessen wird sein Nachname, wie es damals üblich war, mit der Amtsbezeichnung Kantor kombiniert. Zu den Aufgaben eines Kantors gehörten das Orgelspiel im Gottesdienst, die Leitung des Kirchen-, Kinder- und Posaunenchors sowie anderer Musikgruppen. Er war für alles, was die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes betraf, zuständig. Seine Ausbildung bestand in einem Kirchenmusikstudium; er war oft gleichzeitig der Lehrer der Gemeinde. Einige Kantoren sind als Komponisten berühmt geworden, allen voran Johann Sebastian Bach, der von 1723 bis zu seinem Tod im Jahre 1750 als Thomaskantor in Leipzig tätig war.
Carl Bechsteins Mutter, die sich von der Eheschließung mit Kantor Agthe eine Erleichterung ihrer familiären Situation erhofft hatte, wurde bald enttäuscht. Ihr neuer Ehemann war pedantisch und jähzornig. Unter seinen Wutausbrüchen hatte nicht nur die junge Witwe, sondern die ganze Familie zu leiden. Der Stiefvater erwies sich als Tyrann. Im Märchen gehört die böse Stiefmutter zur Standardbesetzung, während der böse Stiefvater so gut wie nie vorkommt – auch bei Ludwig Bechstein nicht. Immer ist es die neue Mutter, die die fremden Kinder schlecht behandelt und das vor dem leiblichen Vater zu verbergen sucht. Für Carl war Kantor Agthe die erste Vaterfigur, mit der er sich auseinandersetzen musste. Im Märchen seines Lebens spielte Agthe sowohl die Rolle des Unterdrückers als auch die des Unterstützers. Sein Verhältnis zu ihm war von Anfang an ambivalent. Als professioneller Musiker und großer Musikliebhaber erkannte der Kantor früh die Begabung seines Stiefsohns und förderte sie, so gut er konnte. Carl war sich darüber im Klaren, dass er seine musikalische Ausbildung dem Stiefvater zu verdanken hatte, was aus den wenigen Aussagen hervorgeht, die von ihm übermittelt sind. Agthe war besonders beeindruckt von Carls hervorragendem Gehör und übernahm die Unterrichtung im Klavier-, Geigen- und Cellospiel. Er hielt seinen Zögling zur Ernsthaftigkeit im Üben an und unterstützte ihn mit einer Mischung aus Begeisterung und Strenge mit gelegentlichen heftigen Schlägen. Die damalige Kindererziehung war autoritär und stand ganz im Zeichen des Gehorsams gegenüber den Eltern und anderen Erziehungsberechtigten. In allen gesellschaftlichen Schichten, den untersten wie den höchsten, gaben die Erwachsenen den Ton an, Kinder zählten nicht. Es bestand eine Kluft zwischen der Welt der Erwachsenen und der Welt der Kinder, und wenn sie zusammenfanden, dominierten die Eltern. In dieser Hinsicht bildete die Familie Bechstein-Agthe jedoch eine Ausnahme: Carl, seine Schwestern und die Mutter waren durch die schweren Zeiten, die sie während der Krankheit des Vaters gemeinsam durchlebt hatten, eng miteinander verbunden. Besonders zwischen Mutter und Sohn hatte sich eine symbiotische Beziehung entwickelt: Carl war ihr Jüngster, der beschützt werden und dem sie den Vater ersetzen musste. Für ihn war sie Mutter und Vater zugleich. Wenn er das Wort Eltern benutzte, meinte er seine Mutter. Dieser zeitlebens bestehenden Nähe gegenüber war der Stiefvater machtlos. Weil es ihm nicht gelang, in diese enge Verbindung einzudringen, übertrieb er die Erziehungsmaßnahmen, etwa das unbedingte Redeverbot bei Tisch. Gerade sitzen, manierlich essen, alles essen und vor allem alles aufessen lautete die Devise. Wer die Gebote nicht befolgte, wurde als Übeltäter an den Katzentisch oder ins Kinderzimmer verbannt. Oft gab es Prügel. Die Ohrfeige für harmlose Vergehen war üblich, beinahe selbstverständlich. Ab und zu wurden die Mahlzeiten von Agthe zu Unterrichtskontrollen umfunktioniert. Dann prüfte er, was die Kinder in der Schule gelernt hatten. Ungefragt durften sie bei Tisch nicht sprechen, wohl aber, wenn der Stiefvater sie examinierte: Dann mussten sie Rede und Antwort stehen.
Damals waren Zärtlichkeiten unter männlichen Familienmitgliedern wie unter Männern überhaupt verpönt, der Umgangston war rau, kühl, distanziert. Und Agthe übertrieb dieses Verhalten noch, wenn er die Rolle des Familienoberhaupts spielte, dessen Pflicht es war, den Sohn oder Stiefsohn zu männlichem Verhalten zu erziehen. Männlichkeit war das Ideal, dem die Kindlichkeit untergeordnet wurde – ein Ideal, das in allen gesellschaftlichen Schichten bestimmend war.
Der Unterschied zu den gehobenen Kreisen war marginal. Dort waren die Wohnungen eleganter, die Kinderzimmer üppiger ausgestattet, die Mahlzeiten erlesener und die Ausbildungsmöglichkeiten differenzierter, doch die Ziele und Prinzipien waren die gleichen: Unterordnung unter die Autorität, absoluter Gehorsam, Pflichtbewusstsein, Bildung – am besten ein voller Stundenplan.
So berichtet der Historiker Karl Theodor von Heigel 1893 über die Erziehung Ludwigs II. und seines Bruders Otto: »Man ließ die Prinzen niemals ohne Aufsicht; sie mussten früh aufstehen, fleißig lernen, bekamen schmale Kost und wurden unnachsichtig bestraft, wenn sie Strafe verdienten.« Körperliche Züchtigungen waren auch hier an der Tagesordnung. Ludwig II., der Märchenkönig, dem Carl Bechstein viele Jahre später einen Flügel schenkte, charakterisierte das Verhältnis zu seinem Vater, König Maximilian II., als kühl und distanziert: »Meine Kindheit war eine Kette demütigender Peinigungen. Ich war gezwungen, mich dem Willen von plumpen, gefühllosen Lehrern zu unterwerfen. Was ich lernen sollte, erschien mir albern, dumpf und wertlos.«
Für Bauernkinder, Mädchen wie Jungen, war es damals üblich, früh auf dem Hof und auf dem Feld mitzuarbeiten. Regelmäßige Landarbeit war an der Tagesordnung, regelmäßiger Schulbesuch die Ausnahme. Auch hier wurden harte körperliche Strafen verhängt, wenn die Arbeit nicht zur Zufriedenheit ausgeführt wurde. Kinderarbeit war eine Selbstverständlichkeit, auch in den Arbeiterfamilien war sie üblich. Erst 1903 wurde das Deutsche Kinderschutzgesetz wirksam, das verbot, Kinder unter zwölf Jahren arbeiten zu lassen.
In den Lehrer- und Handwerkerfamilien, zu denen die Familie Bechstein-Agthe zählte, bestand ein großer Unterschied in der Erziehung der Geschlechter. Während die Mädchen im Haushalt helfen mussten und so in die Rolle der Hausfrau hineinwachsen sollten, wurden die Jungen sich selbst überlassen, bis sie alt genug waren, eine Lehre anzutreten. Wenn sie nicht bei ihrem Vater lernten, verließen sie ihr Elternhaus und waren im Haushalt des ausbildenden Handwerksmeisters dessen Befehlsgewalt unterstellt. Auch hier gehörten Prügel zum normalen Arbeitsalltag. Gehorsam, Fleiß und Leistung wurden gefordert und honoriert, jegliche Abweichung oder Verweigerung rigoros geahndet.
Carl Bechstein hatte schon früh erkannt, dass er mit Widerstand und Auflehnung gegen autoritäre Übermacht – weder gegen die des Stiefvaters noch gegen die des späteren Lehrherrn – nichts ausrichten würde, und entschloss sich, das Beste aus seiner jeweiligen Lebenssituation zu machen. Im Haus des Kantors Agthe war es das vielfältige kulturelle Angebot, das ihn mit der Freudlosigkeit des täglichen Umgangs versöhnte. »Außer der Pflege der Musik war er sodann ein nimmermüder Leser«, heißt es in einem zeitgenössischen Bericht. »Die kleine Bibliothek seines Stiefvaters studierte er immer aufs Neue durch – Wissensdurst war ein Charakterzug aller Bechsteins.« Carl hatte die Bildung als Fluchtlinie für sich entdeckt. Bildung war Voraussetzung für Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Sie würde ihn befreien und ihm neue Wege weisen, an die er sonst womöglich nie gedacht hätte. Was er sich selbst angeeignet und erarbeitet hatte, konnte ihm keiner nehmen – das hatte er aus einem der Bücher Agthes gelernt, das er mehrfach gelesen hatte: 1838/39 war die deutsche Übersetzung von Charles Dickens’ »Oliver Twist« erschienen und erfreute sich nicht nur bei dem jungen Carl großer Beliebtheit. Neben diesen Vernunftgründen war es vor allem die Neugier, die ihn antrieb. Er war einfach neugierig auf die Welt mit ihren großen und kleinen Wundern. Davon nur zu lesen reichte ihm nicht. Was es außerhalb seiner unmittelbaren Umgebung gab, das zu erforschen war sein Ziel.
3 Der junge Carl Bechstein
Carl Schwestern wollten so schnell wie möglich das (stief-)väterliche Haus in Dietzendorf verlassen, was für eine junge Frau zur damaligen Zeit nur durch Heirat möglich war. Emilie verlobte sich bei der erstbesten Gelegenheit, die sich ihr bot. Ihr Auserwählter war der Klavierbauer Johann Gleitz, der in Erfurt ein Geschäft betrieb. Agthe ergriff sofort die Chance, seinen musikalischen Stiefsohn professionell ausbilden zu lassen. Er entschied, Carl nach der Konfirmation zu seinem zukünftigen Schwager – Johann und Emilie heirateten 1844 – in die Lehre zu schicken. Die Lehre in einem Handwerksbetrieb war für den Auszubildenden damit verbunden, im Haus des Lehrherrn zu wohnen – bei freier Kost und Logis. Wie die meisten Familienoberhäupter war auch Agthe froh, auf diese Weise einen Esser weniger durchfüttern zu müssen, auch wenn im Vordergrund sein Wunsch stand, die musikalische Begabung des Stiefsohns zu fördern. Dass sich dieses Anliegen mit einem angesehenen Handwerksberuf verbinden ließ, empfand er als großes Glück. Wusste er doch nur zu gut um die Unsicherheit eines Lebens als Berufsmusiker, weshalb er die Laufbahn eines Kantors und Lehrers eingeschlagen hatte. Sie garantierte ihm zwar eine gewisse Sicherheit, ließ aber seine musikalischen Fähigkeiten stagnieren, Monotonie und Langeweile machten sich breit. Der Beruf eines Klavierbauers schien ihm plötzlich verlockend: die ideale Verbindung zwischen Kunst und Handwerk. Das Schicksal schien es gut mit Carl zu meinen.
1840, im Alter von 14 Jahren, begann Carl die Ausbildung bei Johann Gleitz in der Erfurter Johannesstraße. Kurz vorher war er konfirmiert worden. Die Konfirmation bedeutete einen wichtigen Einschnitt im Leben eines jungen Menschen, den Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenleben. Ziemlich abrupt änderte sich die Kleidung: Stehkragen, Frack, schwarze Schuhe, schwarzseidene Strümpfe, Glacéhandschuhe, Zylinder waren bei festlichen Anlässen üblich. Vor allem aber bedeutete das Ende der Kindheit den Eintritt in die Arbeitswelt. Der Arbeitsalltag begann für Carl früh um 5 Uhr und dauerte bis 19 Uhr, dabei wurde kein Unterschied gemacht zwischen den Lehrlingen und den ausgebildeten Fachkräften. Die Entlohnung bestand in einem kargen Taschengeld.
Johann Gleitz stammte aus einer angesehenen Familie und hatte sich durch seinen Fleiß einen guten Namen als Klavierbauer erworben. Allerdings war er dem Alkohol verfallen, und die Familie hatte unter seiner Trunksucht zu leiden. Unzuverlässigkeit, Launenhaftigkeit, Labilität waren die Charakterzüge, mit denen sich seine Umgebung konfrontiert sah. Carl und seine Schwester waren also vom Regen in die Traufe gekommen: dem einen Tyrannen entronnen, um nun die Launen des anderen zu ertragen.
Doch Carl hatte längst Übung im Umgang mit gewalttätigen Autoritätspersonen. Das Leben im Haus des Stiefvaters war eine harte Schule gewesen, aus der er gestärkt hervorgegangen war. Sein oberstes Ziel war es gewesen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Dabei war ihm der Londoner Waisenjunge Oliver Twist immer wieder ein Vorbild, der sich unter widrigsten Umständen behauptet – dagegen war Carls eigenes Leben nahezu rosig gewesen. Er bewunderte den Jungen grenzenlos. Zwar hätte er sich manchmal anders verhalten, aber trotzdem diente ihm dieser als Vorbild in Sachen Widerstandskraft. Er handelt nicht als »lonesome hero«, sondern als aktives kommunikatives Mitglied der Gesellschaft, das allen negativen Erfahrungen zum Trotz das Vertrauen in die Menschen nicht verloren hat. Dabei lässt ihn seine Menschenkenntnis so manches Mal im Stich – in diesem Punkt nahm sich Carl vor, an sich zu arbeiten, und bemühte sich um eine möglichst gerechte und differenzierte Einschätzung der Menschen, die ihm begegneten. Wichtig war ihm, dass er sich zu keinem Zeitpunkt als passives Objekt oder gar Opfer fühlte, sondern immer als Mitgestalter einer Beziehung oder Situation.
Auf diese Weise entwickelte er eigene Strategien, um sich vor der Willkür und Unberechenbarkeit seines Schwagers und Lehrherrn zu schützen. Er wahrte Distanz zu ihm, versuchte Verständnis für ihn aufzubringen, ergriff die Chance, von ihm zu lernen, und konzentrierte sich vor allem auf sich selbst. In Abendkursen an einer Handwerkerschule bildete er sich zusätzlich weiter und verbrachte die Wochenenden bei seiner geliebten Mutter in Dietzendorf, die ihm gerade in dieser Zeit den notwendigen Halt bot – und umgekehrt. Was ihr der zweite Ehemann nicht geben konnte – Liebe und Verständnis –, wurde ihr von ihrem Sohn zuteil. Ihr zuliebe stand er die unerfreuliche Lehrzeit durch. Doch nach ihrem Tod im Jahr 1844 gab es für ihn keinen Grund mehr, in Erfurt zu bleiben. Er ging nach Dresden und nahm eine Stelle bei der renommierten Pianofabrik Pleyel an, einer Dependance der in Paris ansässigen Firma. Damit begannen seine Wanderjahre, von denen er hoffte, die negativen Erlebnisse und Erfahrungen hinter sich lassen zu können – ganz wie Goethes Wilhelm Meister, der den Vorsatz formulierte, er wolle bei seiner Wanderung in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sein. Wie dieser und die anderen Helden der Entwicklungsromane, die er gelesen hatte, wollte Carl sich selbst kennenlernen und ausprobieren, worin seine Fähigkeiten bestanden. Die eigene Selbstfindung stand im Vordergrund, von Karriere war nicht die Rede. Sein Ziel: »Mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend an mein Wunsch und meine Absicht.« Dass ihm das Glück nicht in den Schoß fallen würde, wusste Carl Bechstein genauso gut wie Goethes Wilhelm Meister: »Jeder hat sein eigen Glück unter den Händen, wie der Künstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen; nur die Fähigkeit dazu wird uns angeboren, sie will gelernt und sorgfältig ausgeübt sein.«
Im Revolutionsjahr 1848 trat Carl Bechstein seine erste Anstellung in der Firma des Klavierbauers Gottfried Perau am zentral gelegenen Hausvogteiplatz in Berlin an und wurde schon im selben Jahr Werkstattleiter – ein bemerkenswerter Aufstieg des erst 22-Jährigen, der zeigt, wie ernst er es mit seiner Ausbildung genommen hatte. Die Firma Perau genoss einen guten Ruf, sie galt als solide, wenn auch nicht unbedingt als experimentierfreudig, schien aber doch Neuerungen gegenüber aufgeschlossen, sonst hätte sie vermutlich keinem so jungen Mann eine derart verantwortungsvolle Aufgabe übertragen.
Kein Geringerer als Franz Liszt hatte Gottfried Perau am 1. April 1844 aus Hannover geschrieben: »Ich danke Ihnen, lieber Herr Perau, für die ausgezeichneten Instrumente, die Sie mir allseitig zu meinen Concerten geliefert haben, hiermit schriftlich, da ich nicht mehr die Freude hatte Sie persönlich zu sehen. Nochmals besten Dank, da alle Ihre Instrumente zu meiner ganzen Zufriedenheit waren.«
War es sein Instinkt, der Carl an diesen Platz geleitet hatte, oder einfach das Zusammentreffen glücklicher Umstände? In jedem Fall trug sein gesundes Selbstvertrauen dazu bei. Es ließ ihn auch nicht um jeden Preis an dem Platz verharren, an dem er das bekam, was er vorher – sowohl zu Hause als auch bei seinem Lehrherrn – vermisst hatte: Anerkennung. Zwar hatte er gespürt, dass beide, Agthe und Gleitz, ihn schätzten, manchmal sogar bewunderten, aber sie hatten stets vermieden, es ihm deutlich zu zeigen. Bescheidenheit galt als Tugend, Stolz als negative Charaktereigenschaft. Wie für jeden Menschen war Anerkennung wichtig für ihn und seine Entwicklung, aber sie führte nicht zu Selbstzufriedenheit und Stillstand, auch nicht zu einer engen Bindung an Gottfried Perau, von dem er sie erstmals offen erfuhr. Im Gegenteil: Sie erzeugte bei ihm so viel Selbstvertrauen, dass er sich hinauswagte. Sie war der sichere Hafen, von dem aus er Expeditionen unternehmen konnte. Sie verlieh ihm Mut.
Perau hätte es gern gesehen, wenn Carl Bechstein in seiner Firma geblieben wäre, denn er schätzte den jungen Mann, der in hohem Maße über Musikalität, Sensibilität und zugleich handwerkliches Geschick verfügte, genau die – seltene – Mischung, die ihn für den Beruf des Klavierbauers prädestinierte. Doch Carl wollte mehr: mehr lernen und mehr von der Welt sehen. Für die Sesshaftigkeit fühlte er sich noch zu jung.
In Ludwig Bechsteins Märchen findet sich diese Haltung häufig wieder, da sind zum Beispiel »Die vier klugen Gesellen«. Zufällig haben sie sich unterwegs getroffen: ein Königssohn, ein Edelmann, ein Kaufmann und ein Handarbeiter. Da allen vieren das Geld ausgegangen ist und sie nicht mehr besitzen als das, was sie am Leibe tragen, unterscheiden sie sich kaum noch voneinander. Der Gegensatz von Arm und Reich spielt plötzlich keine Rolle mehr. Alle vier haben Hunger und wissen nicht, wo sie etwas zu essen herbekommen können. Der Königssohn ist der Ansicht: »Wir mögen ratschlagen, wie wir wollen, so geht es doch allein den Weg, den Gott geordnet hat, und wer an Gott hängt mit getreuer Hoffnung, der wird nicht verlassen.« Der Edelmann zeigt Selbstbewusstsein: »Eine kräftige wohlgestalte Jugend ist noch mehr wert.« Der Kaufmann wird konkreter: »Vorsichtigkeit mit Vernunft gepaart geht über alles.« Der Handarbeiter, der auf Wanderschaft ist, ergänzt: »Sorgsamkeit mit Übung ist das Beste.« Das Gottvertrauen des Königssohns wird nicht enttäuscht. Er besteigt den Thron und sorgt dafür, dass seine drei treuen Gefährten angemessen belohnt werden. Ende gut, alles gut: »Den Edelmann machte er zu einem Herrn am Hofe, den Kaufmann setzte er über die Einkünfte des Reiches, und den Handarbeiter machte er zum Oberaufseher der Gewerbe, und so war durch Verstand, Vernunft, Klugheit und Gottvertrauen ihrer aller Glück begründet«, lautet der Schluss des Märchens. Für Carl Bechstein stand der weitere Lebensweg noch weit offen.
Im Herbst 1849 verließ Carl Bechstein Berlin, ging zunächst nach London und kurze Zeit später nach Paris. In diesen beiden Städten waren die Weltmarken des Klavierbaus ansässig: Broadwood und Érard. Bereits in Dresden hatte er Französisch gelernt, jede freie Minute genutzt, sich die fremde Sprache des Landes anzueignen, in dem er seine Zukunft sah. Die Firma Érard, die mittlerweile von Pierre Érard, dem Neffen des legendären Klavierbauers und Firmengründers Sébastien Érard, geführt wurde, baute die Instrumente, die von der Crème de la Crème der Pianisten bevorzugt wurden. Érard war damals Kult – weit über die Musikszene hinaus – und fand sogar Eingang in die Literatur, etwa in die Glosse »Der verrückt gewordene Flügel« des Komponisten und Musikessayisten Hector Berlioz. Sébastien Érard war 1752 in Straßburg als Sebastian Ehrhardt geboren worden. Zu Weltruhm gelangte das Unternehmen erst nach seinem Tod, Mitte des 19. Jahrhunderts. Zunächst versuchte er sich als Harfenbauer, zeigte großes Talent und wurde von einer reichen Aristokratin gefördert. Sie richtete ihm eine Werkstatt in ihrer Villa ein und verhalf ihm zu einer königlichen Sondergenehmigung, mit der er auch ohne klassische Ausbildung und trotz erheblichen Widerstands seiner Kollegen ein Geschäft eröffnen konnte. Mit der Erfindung der Doppelpedalmechanik sorgte er dafür, dass die Harfe eine Renaissance erlebte. Hector Berlioz war einer der Komponisten, die in ihren Werken die neuen Möglichkeiten des Instruments ausschöpften.
Das Unternehmen Érard wuchs, Sébastien erfuhr Unterstützung durch seinen älteren Bruder Jean-Baptiste. Während der Französischen Revolution verließ Sébastien Érard Frankreich, ging nach London, wo er eine weitere Fabrik für den Bau von Harfen und Klavieren eröffnete und so reich wurde, dass er sich in Paris am Bois de Boulogne ein Schloss kaufen konnte. Nach seinem Tod im Jahr 1831 übernahm sein Neffe Pierre, der Sohn seines älteren Bruders, die Leitung des Unternehmens.
Sébastien Érards Weltruhm gründete auf der Erfindung des »double échappement«, der doppelten Repetition am Hammerklavier, einem Meilenstein in der Entwicklung des Instruments und einer der wichtigsten Neuerungen der Klavierbaugeschichte. Sie ermöglicht eine viel schnellere Anschlagswiederholung, die das Spiel der Pianisten veränderte und die Komponisten inspirierte. 1803 schenkte Érard Ludwig van Beethoven einen seiner Flügel. Das Instrument befindet sich heute im Oberösterreichischen Landesmuseum in Linz. Unter den Pianisten war es besonders der junge Franz Liszt, der von den neuen Möglichkeiten fasziniert war und sie bei seinen Konzerten nutzte. Damals, im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, hatte er begonnen, auf Tournee zu gehen und nebenbei für Érard zu werben – was bewirkte, dass der bis dahin führende englische Klavierbauer John Broadwood & Sons entthront und von Érard abgelöst wurde.
Carl Bechsteins Lehrmeister in Paris waren der aus Sarstedt bei Hannover stammende Jean-Henri (Johann-Heinrich) Pape und der Elsässer Jean-Georges Kriegelstein. Beide ergänzten sich hervorragend: Pape war ein großer Erneuerer und Erfinder, 120 Patente hatte er angemeldet. Von Kriegelstein konnte Carl viel über moderne Unternehmenspolitik und Geschäftspraktiken lernen, was ihm sein Lehrmeister Gleitz nicht beigebracht und auch Perau ihn nur ansatzweise gelehrt hatte. Carl begriff sofort, wie wichtig diese Fächer für seine Zukunft waren, und ließ sich gern darin unterrichten. Damals wurde schon deutlich, dass er sich weniger als Künstler, sondern mehr als Handwerker und Geschäftsmann verstand.
Nach drei Jahren Lehr- und Wanderzeit kehrte er zurück nach Berlin und wurde 1852 Geschäftsführer bei Perau. Doch kurze Zeit später zog es ihn erneut nach Paris, wo er Werkführer bei Kriegelstein wurde, allerdings kam er schon nach wenigen Monaten wieder zu Perau, diesmal nicht »nur« als Geschäftsführer, sondern mit der Erlaubnis, sich parallel dazu eine eigene Werkstatt aufzubauen. Sie war in Berlin-Mitte in der Behrenstraße 56 gelegen, eine Etage über dem Magazin von Perau, und sollte den Grundstein seiner zukünftigen Firma bilden.
Revolutions- und Flügeljahre
Am 1. Oktober 1853 gründete Carl Bechstein in Berlin seine erste eigene Werkstatt. Ein mutiger Entschluss – er war zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt. Dass Berlin genau der richtig Ort für ihn war, hatte er sofort gespürt: eine Stadt des Aufbruchs, der Veränderung, in der jeder nach seiner Façon selig werden konnte. Tradition spielte eine untergeordnete Rolle, Berlin war beweglich und bewegte sich.