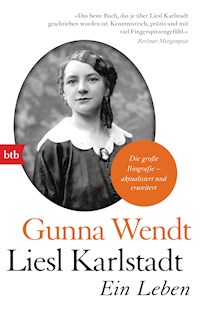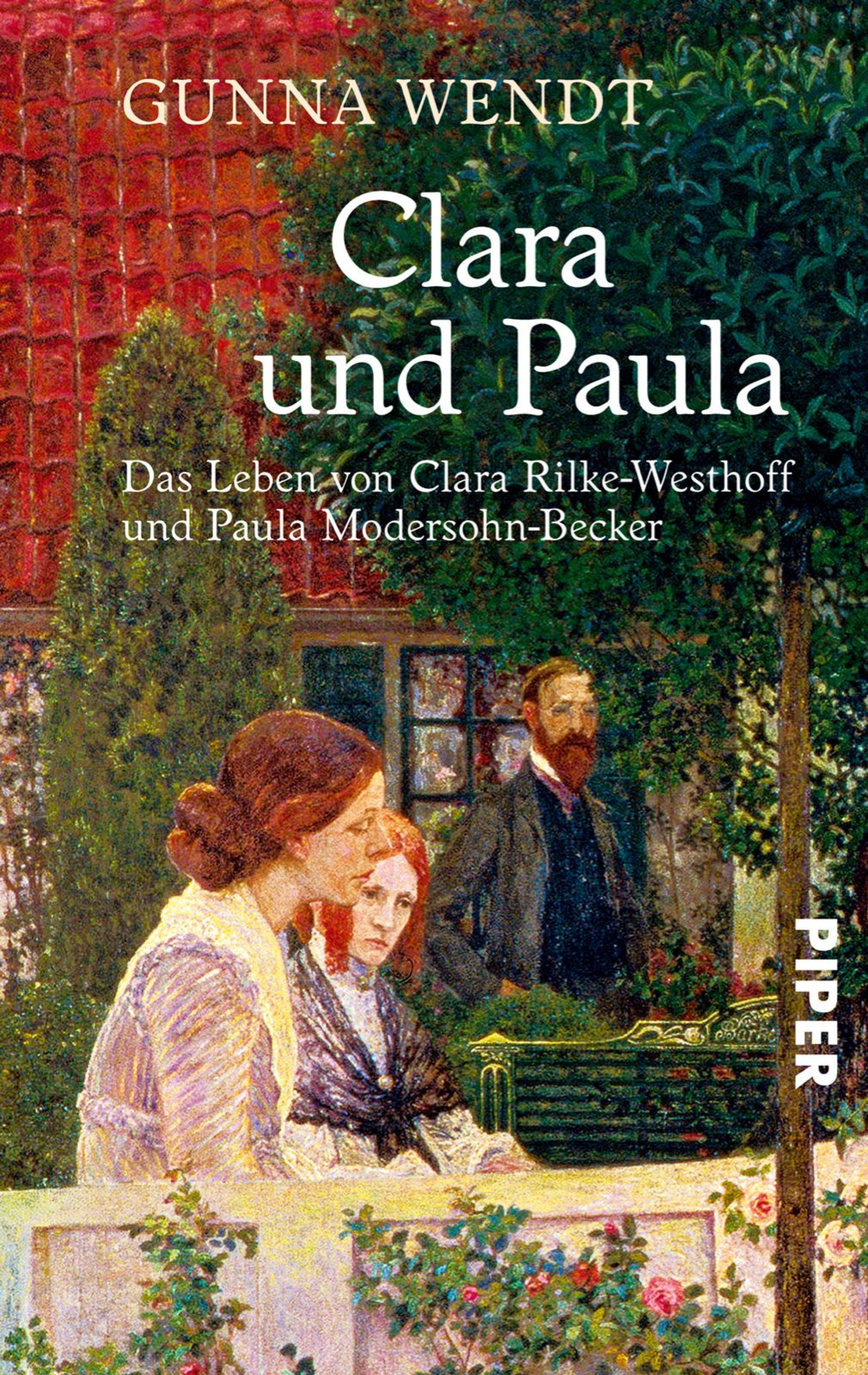17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Beziehung zu einer Schwester gehört zu den intensivsten Bindungen im Leben – sie kann fundamentalen Halt, aber auch viel Zündstoff bieten. So war für Simone de Beauvoir ihre Schwester Hélène Komplizin und Untertanin zugleich, und Liesl Karlstadt fand nach schwerer Krise nur mit Hilfe ihrer Schwester zurück in den Alltag. Sisi, die Kaiserin von Österreich, und ihre Schwester Néné verständigten sich auf Englisch, ihrer Schwesternsprache, die sonst niemand in ihrer Umgebung verstand, und dass die disziplinierte Queen Elizabeth und die rebellische Prinzessin Margaret nicht immer einer Meinung waren, ist nicht erst seit »The Crown« bekannt. Über Schwestern weiß Gunna Wendt allerhand zu erzählen, sowohl Spannendes und Skandalöses als auch Bewegendes und Unterhaltsames. Mit stimmungsvollen Farbillustrationen von Hannah Kolling. Mit Porträts u. a. von Liesl Karlstadt & Amalie Wellano – Zarin Alexandra & Großfürstin Elisabeth – Queen Elizabeth & Princess Margaret – Elsa Triolet & Lilja Brik – Simone & Hélène de Beauvoir – Virginia Woolf & Vanessa Bell – Anne, Charlotte & Emily Brontë – Else & Frieda von Richthofen – Annette & Jenny von Droste-Hülshoff – Gudrun & Christiane Ensslin – Sisi & Néné – Lilo & Corinne Pulver – Sophie Scholl & Inge Aicher-Scholl – Caroline von Wolzogen & Charlotte von Schiller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gunna Wendt
»Waren wir doch Teile voneinander«
Geschichten von berühmten Schwestern
Reclam
Für meine Schwester Tina
2022 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung und Illustrationen: Hannah Kolling, Kuzin & Kolling, Büro für Gestaltung
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962083-1
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011381-3
www.reclam.de
Inhalt
Im Licht und Schatten der Öffentlichkeit
Beste Freundin und Herzensheimat
Caroline und Charlotte von Lengefeld
Annette und Jenny von Droste-Hülshoff
Charlotte, Emily und Anne Brontë
Sisi und Néné – Kaiserin Elisabeth und Prinzessin Helene
Virginia Woolf und Vanessa Bell
Alix und Ella – Zarin Alexandra und Großfürstin Elisabeth
Else und Frieda von Richthofen
Lilja Brik und Elsa Triolet
Liesl Karlstadt und Amalie Wellano
Simone und Hélène de Beauvoir
Sophie Scholl und Inge Aicher-Scholl
Königin Elisabeth II. und Prinzessin Margar
Liselotte und Corinne Pulver
Gudrun und Christiane Ensslin
Auch Brüder brauchen starke Schwestern
Nannerl und Wolfgang Amadeus Mozart
Erika und Klaus Mann
Literaturhinweise
Filme
Dank
Sieh, wie sie dieselben Möglichkeiten
anders an sich tragen und verstehn,
so als sähe man verschiedne Zeiten
durch zwei gleiche Zimmer gehn.
Jede meint die andere zu stützen,
während sie doch müde an ihr ruht;
und sie können nicht einander nützen,
denn sie legen Blut auf Blut,
wenn sie sich wie früher sanft berühren
und versuchen, die Allee entlang
sich geführt zu fühlen und zu führen:
Ach, sie haben nicht denselben Gang.
Vorwort
Im Licht und Schatten der Öffentlichkeit
Schneeweißchen und Rosenrot ist der Titel eines Märchens der Brüder Grimm über zwei ungleiche Schwestern, von denen die eine gerne in den Wiesen und Feldern herumspringt, während die andere lieber zu Hause bleibt und der Mutter etwas vorliest. »Die beiden Kinder hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, sooft sie zusammen ausgingen; und wenn Schneeweißchen sagte: ›Wir wollen uns nicht verlassen‹, so antwortete Rosenrot: ›Solange wir leben nicht‹.«
Doch irgendwann wird es dazu kommen, dass Schwestern das Ideal von der lebenslangen Gemeinsamkeit aufgeben, eigene Wege gehen und vielleicht den Verlust beklagen, den die Befreiung mit sich bringt. So wie die Schriftstellerin Virginia Woolf: »Wenn du nicht da bist, verschwindet die Farbe aus dem Leben, wie Wasser aus einem Schwamm; und ich existiere nur noch, trocken und staubig«, schreibt sie an Vanessa Bell, ihre drei Jahre ältere Schwester, und liefert damit eine der ungewöhnlichsten Liebeserklärungen, die in diesem Buch enthalten ist. Doch mag die Liebe auch noch so groß sein, fast immer ist Rivalität mit im Spiel, wenn es um das Verhältnis von Schwestern untereinander geht. Das Besondere: So sehr zwei Schwestern auch miteinander konkurrieren, die tiefe schwesterliche Zuneigung bleibt davon unberührt. Die hier versammelten Porträts laden dazu ein, die Beziehung zwischen Schwestern in all ihren Variationen zu entdecken.
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der jeweils unbekannteren der beiden Schwestern. Eine davon ist Hélène de Beauvoir. »Meine lebhafteste Erinnerung, die erste Erinnerung, die sich unbewusst einschreibt, ist meine Schwester«, bekennt Simone de Beauvoirs jüngere Schwester. »Sie war unbestritten am wichtigsten, und ich habe mich immer an sie gehalten.« Doch die Jüngere war für die Ältere nicht weniger wichtig. »Ich hatte eine Gefährtin, meine Schwester, deren Rolle in meinem Dasein beträchtlich wurde, als ich etwa sechs Jahre alt war«, so Simone de Beauvoir. »Dank meiner Schwester – meiner Komplizin, meiner Untertanin, meinem Geschöpf – bestätigte ich mein unabhängiges Selbst.« Es sollte eine Weile dauern, bis sich die Jüngere aus dem Schatten der Älteren löst und ihren eigenen Weg einschlägt, doch später wird sie verkünden: »Feministin war ich lange vor meiner Schwester.« Eine ebenso mutige wie überraschende Aussage, wenn man bedenkt, dass sie sich auf eine Ikone der Frauenbewegung bezieht, deren 1949 erschienenes Werk Le Deuxième Sexe für Generationen von Frauen Aufklärung, Orientierung und Ermutigung bedeutete.
Voilà: 14 Schwesternpaare aus verschiedenen Zeiten und Epochen – und dazu zwei Schwestern, die mit ihren Brüdern eng verbunden waren. Manchmal steht eine Schwester so stark im Schatten der anderen, dass man kaum von ihrer Existenz weiß; manchmal stehen beide Schwestern im Licht der Öffentlichkeit und sind gleich präsent. Meist leben sie an verschiedenen Orten und sind in unterschiedlichen Bereichen tätig. Jede Beziehung ist einzigartig und unersetzbar. Schöner als Elsa Triolet in einem Brief an ihre Schwester Lilja Brik lässt es sich wohl nicht ausdrücken: »Ich stelle mir vor, Du würdest durch eine andere Lilja ausgetauscht, eine neue, von der es heißt: hundertmal besser! Ich will aber nun mal keine bessere, ich liebe diese.«
Gunna Wendt
Beste Freundin und Herzensheimat
Zwei Schwestern und ihr geliebter Dichter – Caroline und Charlotte von Lengefeld
Caroline und Charlotte von Lengefeld
»Dass Sie und Caroline so gut zusammenstimmen, freut mich sehr; es ist überhaupt selten, dass Schwestern, die von früher Kindheit an in so viele Kollisionen kommen, bei entwickeltem Charakter einander etwas sind«, schrieb Friedrich Schiller 1788 an Charlotte von Lengefeld.
Charlotte, geboren 1766, war die jüngere Tochter von Carl Christoph von Lengefeld, Oberforstmeister am Hof von Schwarzburg-Rudolstadt, und seiner Frau Luise, geborene von Wurmb. Charlotte wuchs zusammen mit ihrer älteren Schwester Caroline, geboren 1763, auf dem Heißenhof in Rudolstadt auf. Diese empfand das Leben in der »rückständigen« Kleinstadt als »tot und langweilig«. Jeder Tag sei wie der andere gewesen, Treffen mit Verwandten oder Bekannten, bei denen nur über Belanglosigkeiten gesprochen wurde, bildeten die einzige Abwechslung. Charlotte hingegen fühlte sich wohl in ihrem beschaulichen Zuhause. Stundenlang habe sie am Fenster gestanden und bei Glockengeläut in den Himmel geschaut, erinnerte sie sich. »Mein Horizont war frei. In der Ferne sahen wir schöne Berge und ein altes Schloss auf dem Berge liegen, das oft das Ziel meiner Wünsche war.«
Den beiden Mädchen wurde eine fundierte und außerordentlich vielseitige Ausbildung zuteil, was Charlotte allerdings nicht besonders motivierte. »Ich lernte nicht gern«, gesteht sie in ihren Erinnerungen aus den Kinderjahren. Darin schildert sie ihren gewöhnlichen Tagesablauf: Schon früh am Morgen begann der Unterricht, den sie nicht mochte. Weder Schreiben noch Zeichnen noch Französischlernen interessierte sie. Doch am »allerunangenehmsten« war ihr die Tanzstunde. Sie konnte kaum erwarten, dass es Mittag wurde. Beim Essen im Kreis der Familie war der Vater der Mittelpunkt, der immer auch einige seiner ehemaligen Jagdfreunde einlud. Da er schon früh einen Schlaganfall erlitten hatte, konnte er das Haus nicht mehr ohne fremde Hilfe verlassen. Umso mehr freute er sich über die Berichte der Jäger. Charlotte liebte es, ihrem Vater zuzuhören, wenn er über seine Liebe zum Wald sprach. »Alles war ihm wichtig, jeder neuerworbene Baum vergrößerte sein Interesse.«
Nach dem Mittagessen wurde der Unterricht fortgeführt: Zuerst vom Geographielehrer, auf ihn folgte der »französische Sprachmeister«, dazwischen wurden Zeitungen gelesen und Briefe geschrieben. Dann endlich hatten die Mädchen frei. Bei schönem Wetter hielten sie sich im Garten auf, bei schlechtem zogen sie sich ins Haus zurück. Charlotte schaute gerne zu, wenn ihre ältere Schwester und eine Cousine, die mit im Haus lebte, »eine Art dialogisierter Romane« zum Besten gaben. Abwechselnd schlüpften sie in die Heldinnenrolle und spielten ihrem kleinen Publikum vor, was sie erlebt hatten. Diese Form der Darstellung übte einen »unendlichen Reiz« auf Charlotte aus. »Ich saß dabei und hörte alles an und war begierig, wie es enden würde. Wie alle Romane und Theaterstücke, so endete sich dieses auch immer mit einer Heirat.«
Das Abendessen wurde wieder gemeinsam mit den Eltern eingenommen. »Die Mädchen im Hause wurden versammelt; die Cousine las einen Abendsegen; es wurde ein geistliches Lied gesungen; die gute Mutter segnete ihre Kinder ein, und so gingen wir gläubig zur Ruhe und erwarteten den anderen Morgen, um wieder so zu leben.«
Obwohl sie unter der Eintönigkeit litt, wusste Caroline die gute Ausbildung, die man ihr und ihrer Schwester zu Hause angedeihen ließ und die sie vor allem dem weitblickenden Vater verdankten, zu schätzen – genau wie die Nähe zur Kultur: Das Naturalienkabinett in Ludwigsburg, die Bibliothek in der Heidecksburg und das Sommertheater im Schlossgarten waren gut zu erreichen.
Im Herbst 1775 starb der Vater an den Folgen eines weiteren Schlaganfalls. Seine beiden Töchter waren sich einig, dass er sie mit »seiner klaren und weiten Weltansicht« zum Selbstdenken angeregt hatte – das war sein Vermächtnis. »Die Welt, die wir uns hinter unsern blauen Bergen dichteten, gewann im Lichtblick seines Verstandes feste Umrisse. Wir lernten zeitig fühlen, was wir suchen sollten«, heißt es in Charlottes Erinnerungen, die mit dem Tod des Vaters enden. Caroline betonte hingegen ihre eigene Bedeutung für das Gedenken an den Verstorbenen: »Der Tod entriss uns den Trefflichen, als ich dreizehn Jahre alt war; die jüngere Schwester nahm aus meinem reiferen Anschauungsvermögen die Züge seines Bildes auf, das sich ihr unmittelbar noch nicht hatte einprägen können.«
Carolines Selbstbewusstsein schloss jedoch Selbstkritik nicht aus. So fragte sie sich in ihren Aufzeichnungen: »Wenn alle Menschen so schnell von einer Empfindung zu andren übergehen als ich – welch ein unzuverlässiges Wesen ist da der Mensch?« Um ihren Phantasien nicht hilflos ausgeliefert zu sein, suchte sie nach einem festen Halt. Der Vater, der ihr diesen zumindest zeitweise geboten hatte, war nun nicht mehr da, die Mutter hatte wenig Verständnis für das Denken und Verhalten ihrer ältesten Tochter – die beiden Frauen waren einfach zu verschieden –, und Charlotte war zu jung. Mit ihren existentiellen Fragen, von denen Caroline sich bedrängt fühlte, blieb sie daher allein, wie ihren Aufzeichnungen zu entnehmen ist. Sie fühlte sich oft als Außenseiterin. So erzeugte zum Beispiel das überwältigende Naturereignis des Rheinfalls bei Schaffhausen in ihrer Seele nicht das nachhaltige Staunen, das sie erwartet hatte und bei den anderen Reisenden zu entdecken glaubte. »Ich war so trunken von dem herrlichen Anblick, dass ich, als ich eine Viertelstunde von demselben weg war, kein deutliches Bild mehr davon in meiner Einbildungskraft hatte«, wunderte sie sich. Es ist die Flüchtigkeit ihrer Wahrnehmungen und ihrer Gefühle, die sie ein Leben lang irritieren und von anderen Menschen isolieren sollte. Vielleicht war es diese Erfahrung, die sie an ihrem Lebensende das Fazit ziehen ließ: »Es lag ein unversiegbarer Quell der Heiterkeit, der Freude am Dasein in mir; ich hätte eins der glücklichsten Wesen werden können, und wurde sehr unglücklich.«
Zu dem emotionalen Schmerz, den der frühe Tod des Vaters den beiden Schwestern und ihrer Mutter zugefügt hatte, gesellten sich bald handfeste finanzielle Probleme, die sich durch die Verlobung der erst 16-jährigen Caroline mit dem wohlhabenden Rudolstädter Regierungsrat Friedrich Wilhelm Ludwig von Beulwitz lösen ließen. Er war acht Jahre älter als sie und sehr wohlhabend. Sie liebte ihn nicht, ließ sich jedoch ihrer Mutter zuliebe auf die Verbindung ein. Fünf Jahre später, als sie das passende Alter erreicht hatte, fand die Hochzeit statt.
Von Anfang an wusste Caroline, dass sie den falschen Mann geheiratet hatte. Es war nicht seine Schuld, sie hatte ihm nichts vorzuwerfen und charakterisierte ihn als ehrlich, edel und verständnisvoll. Doch sein Lebensentwurf stimmte in gar keiner Hinsicht mit ihrem überein. Ein häusliches Leben im Wohlstand war ihr zu wenig. Sie träumte davon, einen Salon zu führen, in dem sich illustre Gäste zum intellektuell anspruchsvollen Gespräch trafen.
Weiterhin wohnte sie in Rudolstadt eng mit ihrer Mutter und ihrer Schwester zusammen – ihre Häuser grenzten aneinander. Die beiden Schwestern sahen sich nach wie vor häufig. Sie besuchten die Naturaliensammlung, das Kupferstichkabinett und die Bibliothek, wo sie Bücher ausliehen, sie gemeinsam lasen und besprachen. »Oft erschienen wir uns selbst als verwünschte Prinzessinnen«, erinnert sie sich in ihrer Schiller-Biografie Schillers Leben (1830), »auf Erlösung aus dieser Einförmigkeit hoffend.« Besonders trostlos waren die Wintermonate.
Einer der wenigen Auswege aus der Gleichförmigkeit war die Korrespondenz mit ihrem Cousin Wilhelm von Wolzogen. Doch es sollte einige Jahre dauern, bis dieser mit einem Freund zu Besuch kommen und das Leben der beiden Schwestern radikal verändern würde.
An einem trüben Wintertag im Dezember 1787 trafen zwei bis zur Unkenntlichkeit in Mäntel eingehüllte Reiter in Rudolstadt ein. Den Schwestern erschienen beide fremd, so Caroline, dann entdeckten sie in einem der beiden Vermummten aber Wilhelm von Wolzogen, der ihnen seinen Schulfreund vorstellte: den Dichter Friedrich Schiller.
Von Anfang an war die Anziehung zwischen Caroline, Charlotte und Schiller eine gegenseitige: Er verliebte sich in beide Schwestern, und sie sich in ihn. »Ihre beiderseitige gute Harmonie ist ein schöner Genuss für mich, weil ich Sie in meinem Herzen vereinige, wie Sie sich selbst vereinigt haben«, sollte er später Charlotte gestehen.
Bereits im nächsten Jahr folgte er Charlottes Einladung, eine Weile bei ihnen auf dem Land zu leben und zu arbeiten. Sie besorgte ihm eine Wohnung im Nachbarort Volkstedt – und Schiller fühlte sich wohl: »Es war ein gar lieblicher, vertraulicher Abend, der mir für diesen Sommer die schönsten Hoffnungen gibt«, schrieb er am 26. Mai 1788 an Charlotte. »Mehr solche Abende und in so lieber Gesellschaft – mehr verlange ich nicht.« In einem Brief an seinen Freund, den Schriftsteller Christian Gottfried Körner, vermutete er, dass ihm die »Trennung von diesem Hause« schwerfallen werde, weil er »durch keine leidenschaftliche Heftigkeit, sondern durch eine ruhige Anhänglichkeit«, die sich nach und nach entwickelt habe, daran gebunden sei. »Mutter und Töchter sind mir gleich lieb und wert geworden und ich bin es ihnen auch.«
Um ihnen noch näher zu sein, zog Schiller im August von Volkstedt nach Rudolstadt. Erst im November reiste er zurück nach Weimar und meldete sich umgehend bei den Schwestern mit den Worten: »Ich kann mir nicht einbilden, dass alle diese schönen seelenvollen Abende, die ich bei Ihnen genoss, dahin sein sollen; dass ich nicht mehr wie diesen Sommer meine Papiere weglege, Feierabend mache, und nun hingehe, mit Ihnen mein Leben zu genießen.« Körner erklärte er rückblickend, er habe im letzten Sommer bei den Schwestern in Rudolstadt »Herzlichkeit, Feinheit und Delikatesse, Freiheit von Vorurteilen« erfahren sowie sehr viel Sinn für das, was ihm lieb und teuer sei. Es habe ihm gutgetan, mit Menschen zusammen zu sein, »denen die Freiheit des andern heilig ist.«
Im August 1789 schlug Caroline Schiller vor, ihre Schwester zu heiraten. Sie hatte erkannt, dass Schiller Charlotte favorisierte, und ermutigte ihn, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Auf diese Weise ließe sich ein Zusammenleben zu dritt am besten realisieren. Schließlich hatten sie in diesem Sommer viel Zeit miteinander verbracht und sich dabei sehr glücklich gefühlt. Sowohl Schiller als auch Charlotte erklärten sich einverstanden. Auch nach der Verlobung fuhr er fort, beiden Schwestern zu schreiben. Er versicherte Charlotte, dass seine Liebe zu Caroline ihr nichts von seiner Liebe nehme; die ältere Schwester, schreibt er, »habe zwar mehr Empfindungen in mir zur Sprache gebracht als Du, meine Lotte – aber ich wünschte nicht um alles, … dass Du anders wärest als Du bist. Was Caroline vor Dir voraus hat, musst Du von mir empfangen; Deine Seele muss sich in meiner Liebe entfalten, und mein Geschöpf musst Du sein …«
Schiller fand es verlockend, sich nicht auf einen einzigen Menschen beschränken zu müssen, sondern jeder der beiden Schwestern liebend gerecht zu werden. Sie sollten sich nicht als Rivalinnen verstehen, sondern als um ihrer selbst willen Geliebte. Dabei konnte er verschiedene Facetten seiner Persönlichkeit ausleben. Wenn er an Charlotte schrieb, wählte er andere Worte als bei Caroline. Nicht selten wandte er sich an beide:
Möchten Sie, oder möchte vielmehr das Schicksal Sie beide nie weit auseinanderführen, wenn es möglich ist. Es ist gar niederschlagend für mich, wenn ich Sie mir getrennt denke, weil ich dann immer eine, wo nicht beide, entbehren müsste. Auch Sie würden einander sehr fehlen und nicht mehr ersetzen.
Die Gleichzeitigkeit war ein wichtiges Element dieses ungewöhnlichen Dreierbundes. Niemand wurde bevorzugt, Wertungen fanden nicht statt. Schiller betonte, »dass ich dem andern nicht entziehe, was ich dem einen bin. Frei und sicher bewegt sich meine Seele unter Euch – und immer liebevoller kommt sie von einem zu dem andern zurück.« Sich selbst verstand er als »Stern, der nur verschieden widerscheint aus verschiedenen Spiegeln«.
Verschieden waren auch die Liebeserklärungen der beiden Schwestern an ihn: »Mögen Sie immer gute und frohe Geister umschweben und die Welt in einen schönen Glanz sie einhüllen lieber Freund«, wünschte Charlotte. »Ich möchte Ihnen gern sagen, wie lieb mir Ihre Freundschaft ist und wie sie meine Freuden erhöht. Aber ich hoffe, Sie fühlen es ohne Worte. Sie wissen, dass ich wenig Worte finden kann, meine Gefühle zu erklären, und sie andern deutlich zu machen.« Dennoch hoffe sie, dass er so oft wie möglich von sich hören ließe, damit ihr der »Gang seines Geistes« nicht fremd werde und sie ihm folgen könne.
»Ach, ich kenne keinen Ersatz für das, was Sie meinem Leben gegeben haben«, schwärmte Caroline. »So frei und lebendig existierte mein Geist vor Ihnen. So wie Sie hat es noch niemand verstanden, die Saiten meines innersten Wesens zu rühren – bis zu Tränen hat es mich oft bewegt, mit welcher Zartheit Sie meine Seele in trüben Momenten gepflegt, getragen haben.«
Immer wieder beschwört Schiller in seinen Briefen an die Schwestern ihren Dreierbund:
Meine Seele ist jetzt gar oft mit den Szenen der Zukunft beschäftigt; unser Leben hat angefangen, ich schreibe vielleicht auch, wie jetzt, aber ich weiß euch in meinem Zimmer, Du, Caroline, bist am Klavier und Lottchen arbeitet neben Dir, und aus dem Spiegel, der mir gegenüber hängt, seh ich euch beide.
Nun galt es, die Mutter der beiden angebeteten Schwestern zu informieren und um ihre Genehmigung zu bitten. Wie schon bei der Aufforderung an Schiller, um Charlottes Hand anzuhalten, ergriff auch diesmal Caroline die Initiative. Ihre Mutter zeigte sich »erschüttert.« Die Überraschung sei groß gewesen und habe sie sprachlos werden lassen, so dass sie zu keiner Antwort fähig gewesen sei. Doch nach kurzer Überlegung hatte sie zugestimmt, nicht ohne sich bei ihrem zukünftigen Schwiegersohn nach seinen finanziellen Verhältnissen zu erkundigen. Er hatte zwar vor kurzem bereits eine Professur in Jena erhalten, doch diese war nicht dotiert. Als ihm vom Herzog von Weimar allerdings ein festes Gehalt versprochen und vom Herzog von Sachsen-Meiningen der Titel eines Hofrats erteilt wurde, war der letzte Hinderungsgrund aus dem Weg geräumt. Am 22. Februar 1790 wurden Charlotte und Schiller in der Dorfkirche von Wenigenjena im Beisein von Charlottes Mutter und Schwester getraut. Sie feierten das Ereignis zu viert in Schillers Wohnung.
Im Jahr nach der Hochzeit erkrankte Schiller schwer an einer Lungenentzündung, zu der noch eine Rippenfellvereiterung und eine Bauchfellentzündung kamen. Er sollte nie wieder ganz gesund werden.
1793 wurde das erste Kind, Karl, geboren. Es folgten 1796 Ernst, 1799 Caroline and 1804 Emilie. Nach der Geburt der kleinen Caroline wurde Charlotte schwer krank: Nervenfieber mit Wahnvorstellungen, Delirien und Apathie. Außer ihrer Mutter und ihrem Ehemann wollte sie niemanden sehen – überraschenderweise auch nicht ihre Schwester.
Caroline trennte sich 1794 von Beulwitz. Anstatt sich scheiden zu lassen, wurden sie nach 10-jähriger ›ehelicher Unverträglichkeit‹ in den Stand der Ehelosigkeit zurückversetzt. Das eröffnete beiden die Möglichkeit, ohne Probleme eine neue offizielle Verbindung einzugehen. Caroline tat das noch im selben Jahr: Sie heiratete Wilhelm von Wolzogen, mit dem sie sich seit ihrer Jugend eng verbunden fühlte. Schiller äußerte sich abfällig darüber. Er fand die Eheschließung seines Freundes mit seiner Schwägerin übereilt, so dass er sich nicht imstande fühlte, ihr seinen Segen zu geben. Vor allem vermisste er bei ihr den Wunsch, ihren Ehemann glücklich zu machen, was er für die erste Pflicht einer Ehefrau hielt. Darüber hinaus bemängelte er Carolines Unbeständigkeit und Flatterhaftigkeit. Auch Charlotte missbilligte den Lebenswandel ihrer älteren Schwester: »Sie liebte so oft, und doch nie recht; denn wahre Liebe ist ewig wie das Wesen, aus dem sie entspringt. Und eben, weil sie nicht liebte, sucht immer das Herz noch einmal die Sehnsucht zu stillen.«
1795 brachte Caroline ihren Sohn Adolph zur Welt und gab ihn in die Obhut einer Pflegestelle. Erst als Wilhelm durch Vermittlung Schillers als Kammerherr und Kammerrat in Sachsen-Weimarische Dienste trat, nahmen er und Caroline ihren Sohn wieder zu sich. Sowohl der tatsächliche Geburtstermin Adolphs als auch die Vaterschaft warfen Fragen auf und boten Anlass zu verschiedenen Mutmaßungen, die Caroline souverän aus dem Weg räumte. Weimar wurde zu ihrem Lebensmittelpunkt, sie tauchte in das vielfältige kulturelle und gesellschaftliche Leben der Stadt ein, hatte einige Affären und begann zu schreiben. Schiller veröffentlichte 1796 ihren Roman Agnes von Lilien in seiner Zeitschrift Die Horen als Fortsetzungsroman. Anonym – so dass das Rätselraten begann. Sogar Goethe wurde als Autor vermutet, da man in diesem Bildungsroman einer Frau Parallelen zu seinem Wilhelm Meister (1795/96) zu entdecken glaubte. Goethe sah keinen Grund, die Autorenschaft zu dementieren, sondern bat Schiller in einem Brief vom Dezember 1796: »Lassen Sie mir so lange als möglich die Ehre, als Verfasser der Agnes zu gelten.« Das tat er nicht von ungefähr: Der Roman war ein großer Erfolg.
Bis zu Wilhelms Tod im Oktober 1809 lebte Caroline mit ihm zusammen. Sie war eine hervorragende Gastgeberin, führte den Haushalt vorbildlich und pflegte ihren Mann während seiner schweren Krankheit, die ihn 1807 ereilt hatte. Wilhelm wusste das zu schätzen. Für ihn war sie »einer der schönsten Charaktere«, die er in seinem Leben kennengelernt hatte:
[…] so viel Geist, mit so unendlich großer Sanftmut; so viel herzliche Liebe mit solchem Drang nach hohen Gegenständen; so unbegreiflich einfach, und doch so viel umfassend; eine gute Hausfrau, eine zärtliche Mutter, und doch Schöpferin von Welten, die ihre schöne Phantasie in solcher Harmonie ordnet.
Ob Caroline diese Liebeserklärung jemals zu Ohren gekommen ist, ist nicht bekannt. Er hatte sie einem Freund anvertraut und mit dem Satz geendet: »Ich kann Ihnen nicht beschreiben, lieber Freund, wie unendlich glücklich ich die Jahre war, die ich mit dieser ausgezeichneten Frau verlebte.«
Vier Jahre vor Wilhelm, am 9. Mai 1805, starb Friedrich Schiller im Alter von 45 Jahren an einer Lungenentzündung. Seinem Tod war mehr als ein Jahrzehnt der Krankheit vorausgegangen. In ihrem Buch Schillers Leben, verfaßt aus Erinnerungen der Familie, seinen eigenen Briefen und den Nachrichten seines Freundes Körner widmete Caroline den letzten Lebensjahren ihres Schwagers und seinem Tod ein umfangreiches Kapitel. Dass sein Leben kurz sein würde, habe er geahnt und zum Schluss eine »große Sehnsucht nach mannigfacher Weltanschauung auf Reisen« gehabt, die sie und ihre Schwester durch intensives Pläneschmieden zu stillen versucht hatten. Am liebsten sei es ihm gewesen, nur sie und ihre Schwester um sich herum zu haben. Die letzten an sie gerichteten Worte waren die Antwort auf ihre Frage, wie es ihm gehe: »Immer besser, immer heitrer.« Ihrer Schwester habe er die Hand gedrückt, bevor er sanft entschlief.
Mehr oder weniger indirekt betonten sowohl Charlotte als auch Caroline weiterhin die Exklusivität ihrer Beziehung zu dem geliebten Verstorbenen. Niemand habe wie sie »den ganzen Reichtum seines Herzens« gekannt, versicherte Charlotte; und Caroline berichtete, er sei ihr so lebendig in ihren Träumen erschienen, dass sie an eine Erscheinung glaubte. Sie beendete die Schilderung ihres Traumes mit der Feststellung: »Der Tod Schillers war das erste tiefe Unglück in meinem Leben, u. seitdem brach eine Verkettung unglücklichen Geschicks auf mich ein.« Offensichtlich war es Schiller gelungen, jeder von ihnen ein Gefühl der Einzigartigkeit zu vermitteln, so dass Rivalität, wenn sie einmal zwischen den Schwestern auftauchte, schon im Keim erstickt wurde. Auch in der Trauer konzentrierte sich jede auf sich selbst und machte der anderen keine Vorwürfe.
Schillers Leben veröffentlichte Caroline 25 Jahre nach Schillers Tod. Ihre Schwester erlebte die Publikation nicht mehr. Charlotte starb am 9. Juli 1826 nach einer Augenoperation im Alter von 59 Jahren – einer der vielen schweren Schicksalsschläge, die Caroline zu verkraften hatte. Zuvor hatte sie nicht nur Friedrich Schiller und ihren Ehemann, sondern auch ihren Sohn (1825) und eine Vielzahl enger Freunde verloren, so dass sie irgendwann klagte, ihre »Geliebtesten« seien »drüben« und sie hoffe, bald mit ihnen vereint zu sein. Zwangsläufig zog sie sich aus dem gesellschaftlichen Leben Weimars zurück. Ab 1825 wohnte sie in Jena, wo sie am 11. Januar 1847 starb und auf dem alten Friedhof ihre letzte Ruhestätte fand.
Seite an Seite im Schloss
Annette und Jenny von Droste-Hülshoff
Als Annette von Droste-Hülshoffs erster Gedichtband 1838 erschien, war die Reaktion darauf für sie enttäuschend: Ihre Umgebung reagierte mit Gleichgültigkeit oder sogar Spott. Nur wenige Exemplare wurden verkauft. Die 41-jährige Annette vertraute sich ihrer zwei Jahre älteren Schwester Jenny an und schrieb ihr im Januar 1839: »Mit meinem Buche ging es mir zuerst ganz schlecht.« Obwohl ihr das Urteil der Menschen, die mit Ablehnung reagierten, eigentlich nichts bedeute, sei ihr »schlecht zu Mute«. Schließlich handle es sich dabei um Menschen, mit denen sie gut bekannt, teilweise sogar verwandt sei. Sie müsse »zwischen diesen Leuten leben«, die sie »bald auf feine, bald auf plumpe Weise verhöhnten und aufziehn wollten«. Wie sollte sie darauf reagieren? »Ganz wunderlich« habe man sich ihr gegenüber verhalten, als ob man sich ihrer schämen würde. Mehr noch: Ihre Gedichte habe man für »reinen Plunder« erklärt, »für unverständlich, konfus«. Man verstehe nicht, »wie eine scheinbar vernünftige Person solches Zeug habe schreiben können. Nun tun alle die Mäuler auf und begreifen alle miteinander nicht, wie ich mich habe so blamieren können.«
Nicht ohne Grund hatte sich Annette in ihrem Unmut an ihre Schwester gewandt: Von Anfang an war Jenny ihre Verbündete, die fest an die Begabung ihrer Schwester glaubte und ihren Arbeitsdrang bewunderte. Bereits 1813 ist in Jennys Tagebuch zu lesen: »Nette schreibt ein Trauerspiel aus meinem Tintenfass, und jetzt ist nur noch der Bodensatz darin; ich muss Wasser zugießen.«
Die 16-jährige Annette schrieb wie im Rausch, als müsse sie die Gedanken, Bilder und Szenen, die ihr durch den Kopf gingen, so schnell wie möglich aufs Papier bringen. Jenny war beeindruckt von diesem Überschwang an Phantasie, dem Annette regelrecht ausgeliefert zu sein schien. Doch gerne gesehen wurde das in ihren Kreisen nicht. Eine Frau sollte nicht lesen, diskutieren oder gar schreiben, vor allem nicht an die Öffentlichkeit gehen, sondern ihr Zuhause verschönern – ganz so wie Jenny es tat. »Jenny malt recht viel, und macht die übrige Zeit feine Handarbeiten«, notierte Annette 1819 in ihrem Tagebuch. Sie selbst hatte jedoch einen anderen Plan für ihr Leben: »Ich mag und will jetzt nicht berühmt werden, aber nach hundert Jahren möcht ich gelesen werden.«
Von Annettes Extrovertiertheit und Selbstdarstellungsdrang – sie wusste in Gesellschaften durch ihre Beredsamkeit auf sich aufmerksam zu machen – fühlte sich Jenny manchmal »ennuyiert«. Zwar war auch sie selbst kulturell und intellektuell interessiert, doch übte sie sich bei Zusammenkünften eher in Zurückhaltung – im Gegensatz zu ihrer manchmal aufdringlichen Schwester. Dennoch schwingt in ihren Tagebucheintragungen auch Bewunderung mit: »Nette spielte nach dem Essen Klavier und sang. Es machte allen viel Freude.«
Die Musik war aus Jennys und Annettes Elternhaus nicht wegzudenken: Schon früh besuchte die Familie gemeinsam Konzerte, alle vier Kinder genossen eine fundierte musikalische Ausbildung, Jenny und Annette erhielten Gesangs- und Klavierunterricht. Darüber hinaus lernte Annette bei ihrem Onkel Maximilian, einem Freund Joseph Haydns, das Komponieren. Über 70 Liedkompositionen sind von ihr erhalten. Sogar zu einigen Opernprojekten existieren Libretti und musikalische Entwürfe. Doch es war vor allem das alltägliche Musizieren, das spontane gemeinsame Singen, das sie liebte und das Jenny und sie miteinander verband.
Maria Anna, genannt Jenny, wurde am 2. Juni 1795, Anna Elisabeth, genannt Annette, am 10. Januar 1797 auf der Wasserburg Hülshoff bei Münster geboren. Zusammen mit den beiden Brüdern – Werner-Constantin, geboren 1798, und Ferdinand, geboren 1800 – wuchsen die Schwestern wohlbehütet in der westfälischen Adelswelt auf. Ihre Eltern waren Clemens August Freiherr von Droste zu Hülshoff und seine Frau Therese, geborene Freiin von Haxthausen. Diese berichtete ihrer Schwester ausführlich über ihr Familienleben. Sie nannte ihre Kinder »Friedensstörer«, »Trabanten«, »kleines Gesindel«, die sie viel Zeit und Geduld kosteten. Ihre beiden Töchter unterrichtete sie selbst und führte sie in die Weltliteratur ein. »Mama las uns Shakespeares Was ihr wollt vor, und wir betrachteten aufmerksam das Bild im Speisezimmer, das eine Szene draus vorstellt und dessen Inhalt wir nie recht wussten«, notierte Jenny 1813 in ihrem Tagebuch. Für Annette waren die Lesungen ihrer Mutter »Gold wert«. Als diese immer weniger Zeit dafür hatte, beklagte sich Annette bei ihrer Tante Dorly.
Annette war von Anfang an ein Sorgenkind, was ihre Gesundheit betraf. Sie kam als Frühgeburt zur Welt und verdankte es dem unermüdlichen Einsatz ihrer Amme, Katharina Plettendorf, dass sie überhaupt am Leben blieb. Annette wusste, was sie »ihrer Alten«, die für sie der Inbegriff von Kindheitsidyll und Geborgenheit war, zu verdanken hatte. Die hochgeschätzte Frau wurde von der Dichterin zeitlebens unterstützt und, als sie selbst erkrankte, von ihr liebevoll gepflegt.
Obwohl Annette klein, zart und kränklich blieb, fehlte es ihr nicht an Mut und Abenteuerlust. Voller Begeisterung streifte sie durch die Umgebung des elterlichen Schlosses: Wiesen, Felder, Wald und Moor wurden von ihr genauso gründlich erkundet wie entlegene Kammern des Gebäudes. Drei Jahre vor ihrem Tod sollte sie sich in Das erste Gedicht (1846) daran erinnern, wie sie die »schwer verpönte Wendelstiege« im Schlossturm heraufgeklettert war, um dort auf dem »Hahnenbalken« ihr erstes literarisches Werk zu verstecken:
Das sollten Enkel finden,
wenn einst der Turm zerbrach,
Es sollte etwas künden,
Das mir am Herzen lag.
Im Gegensatz zu ihrer kleinen Schwester war Jenny ein ausgeglichenes Kind, das von allen aufgrund seiner Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft geliebt wurde. In sich ruhend und eher introvertiert war sie nicht auf Beifall aus.
Im Alter von 18 Jahren lernte sie Wilhelm Grimm kennen, mit dem sie eine langjährige Brieffreundschaft hegte, die zeitweise eine unerfüllte Liebe erahnen ließ. Seinem Bruder Jakob schilderte er die erste Begegnung im Juli 1813: »Es war eine große Gesellschaft, eine verheiratete Droste-Hülshoff aus Münster und zwei Mädchen, wovon die älteste Jenny was recht Angenehmes und Liebes hatte.« Damals hatten er und Jakob schon damit begonnen, Märchen und Sagen zu sammeln. »Die Fräulein aus dem Münsterland wussten am meisten, besonders die jüngste, es ist schade, dass sie etwas Vordringliches und Unangenehmes in ihrem Wesen hat, es war nicht gut mit ihr fertig werden«, erzählte er dem Bruder und lieferte umgehend eine Erklärung: »Sie ist mit 7 Monat auf die Welt gekommen und hat so durchaus etwas Frühreifes bei vielen Anlagen. Sie wollte durchaus brillieren und kam vom einen ins andere; doch hat sie mir fest versprochen, alles aufzuschreiben, was sie noch wisse und nachzuschicken.«
Als er auf Jenny zu sprechen kam, änderte sich der Ton: »Die andere ist ganz das Gegenteil, sanft und still; die hat mir versprochen zu sorgen, dass sie Wort hält.« Für ihre Unterstützung bedankte er sich bei Jenny zum Abschied mit einem selbstverfassten Märchen, das er ihr widmete. Sie steuerte seiner Märchensammlung unter anderem Die zertanzten Schuhe und Der Fuchs und das Pferd bei.
Jenny und Wilhelm sahen sich nicht oft, wie er in einem Brief bedauerte, »und doch fühle ich, dass wir uns näher bekannt sind, als andere, die sich täglich sehen.« 25 Jahre lang sollte ihre Korrespondenz dauern und alles überstehen, was sich den beiden in den Weg stellte, sogar Wilhelms Heirat, von der Jenny erst später und nicht durch ihn erfuhr.
Warum Wilhelm nicht um Jennys Hand angehalten hatte, ist nicht bekannt. Dass die unterschiedlichen Konfessionen – sie war streng katholisch, er streng reformiert erzogen worden – ein wesentlicher Hinderungsgrund gewesen waren, lässt sich nur vermuten. Aus den Briefen und Jennys Tagebüchern spricht phasenweise mehr als Freundschaft. So notierte sie 1818 nach ihrer Begegnung in Kassel: »Wilhelm war so lieb, dass ich einzig auf ihn achtete und nicht weiß, was die andern angefangen haben.« Von der »bitteren Abschiedsstunde« hielt sie fest: »Wilhelm küsste Nette die Hand … dann mir, wobei wir aber nichts sagten; ich hatte auch in dem Augenblick keine Gedanken, und wenn er etwas sagte, so habe ich es nicht verstehen können.« Wilhelm fiel es nicht leicht, seine Gefühle in Worte zu fassen. Besonders schwer tat er sich mit dem Schreiben: »Ich schreibe ungern einen Brief, oder vielmehr, ich mag nicht anfangen zu schreiben, wenn ich weiß, dass ich wenig und auch dies nur unvollständig und lückenhaft ausdrücken kann.« Er wollte ihr so vieles »sagen und erzählen« und dabei »eins mit dem andern verbinden und in Zusammenhang bringen«, aber das war ihm nur möglich, wenn er es »mündlich tun dürfte«.
Doch nicht nur Jenny blieb das Liebesglück zu dieser Zeit versagt, sondern auch Annette. Ihre Beziehung zu dem Jurastudenten Heinrich Straube wurde im Sommer 1820 zum Anlass einer Familienintrige, die rückwirkend als Annettes Jugendkatastrophe bezeichnet wurde. Eine entscheidende Rolle spielte dabei ihre Tante Anna von Haxthausen. Gemeinsam mit Heinrich Straube und August von Arnswaldt, der auf Annette ebenfalls eine große Faszination ausübte, schmiedete die Tante, die vier Jahre jünger war als Annette, ein Komplott: Arnswaldt, der um seine Wirkung auf Frauen wusste, verführte Annette zu einem Geständnis ihrer Zuneigung für ihn, um sie sofort abzuweisen und Straube davon zu berichten. Arnswaldts Aktion wurde als Treuetest deklariert, den Annette nicht bestanden hatte. Sie wurde als treulos und unehrlich denunziert. Das Motiv für die Intrige blieb ungeklärt.