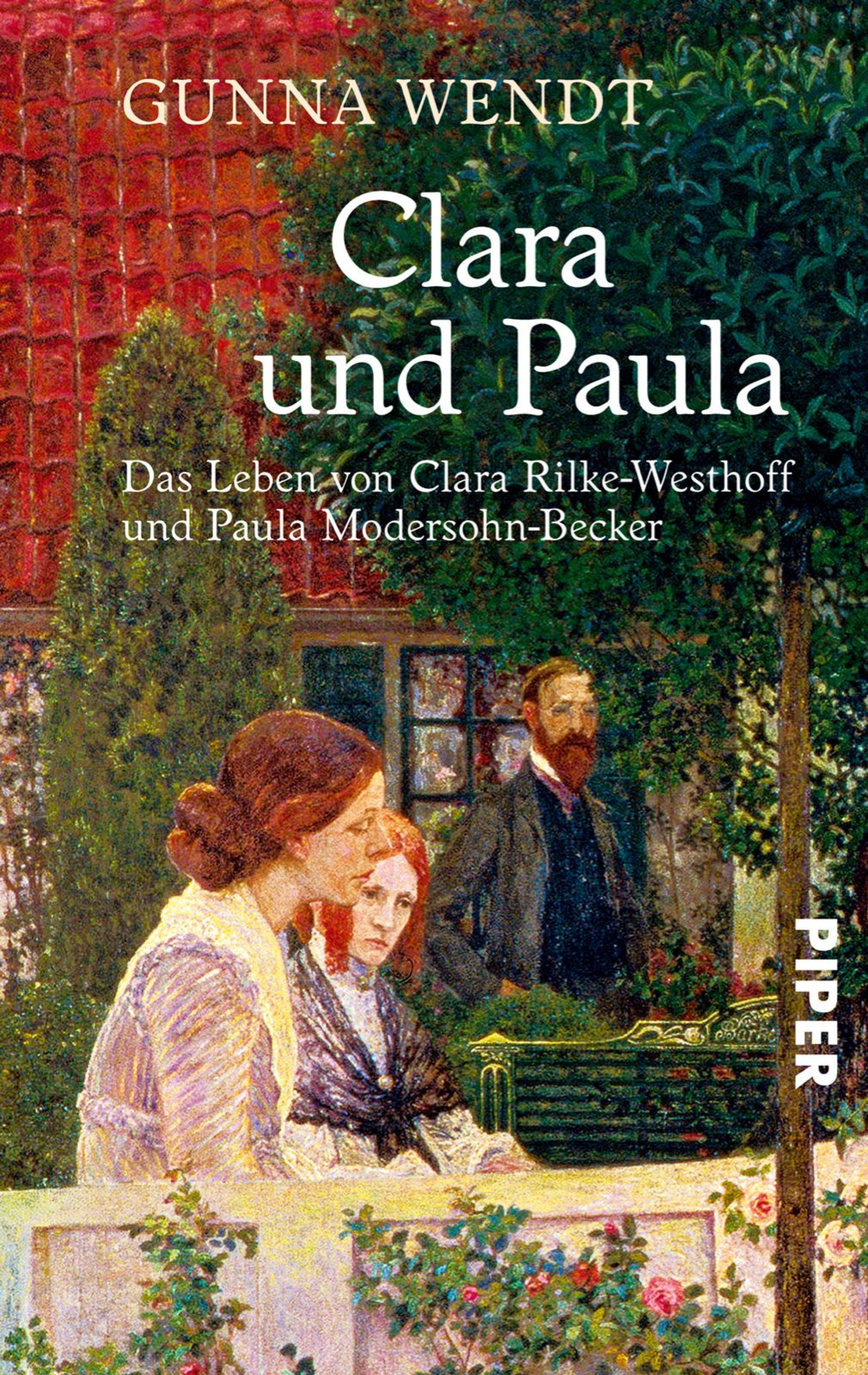18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von Müttern und Töchtern Beste Freundin oder Konkurrentin? Vertraute oder Fremde? Die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern lässt sich nicht in einem Wort beschreiben. Gunna Wendt hat in diesem Buch die bewegendsten und schönsten Mutter-Tochter-Beziehungen zusammengestellt. Mit dabei sind u. a. Maria Callas und ihre ehrgeizige Mutter Evangelia, das bunte Dreiergespann Eva-Maria, Nina und Cosma Shiva Hagen und die tragisch kurze Beziehung zwischen Romy Schneider und Sarah Biasini. Ein wunderschön illustriertes Lesebuch über Liebe, Schmerz, Enttäuschung und große Hoffnungen – über mehrere Jahrhunderte hinweg bis heute. Ein ganz besonderes Geschenk für Mütter und Töchter: zum Muttertag, zu Weihnachten, für die beste Freundin oder für sich selbst. - Emotional und leidenschaftlich: spannende Porträts berühmter Mütter und ihrer Töchter - Starke Frauen: von Katja und Erika Mann über Gracia Patricia und Stephanie von Monaco bis Maria Furtwängler und Kathrin Ackermann - Spannend und fundiert: aufregende Geschichten über starke Frauen von der Autorin Gunna Wendt Mit Porträts von Evangelia & Maria Callas + Emilie & Franziska zu Reventlow + Katia & Erika Mann + Eva-Maria, Nina & Cosma Shiva Hagen + Kathrin Ackermann & Maria Furtwängler + Gracia Patricia, Caroline & Stephanie + Romy Schneider & Sarah Biasini + Jane Birkin & Charlotte Gainsbourg + Liv & Linn Ullmann + Eva von Sacher-Masoch & Marianne Faithfull + Ingrid Bergman & Isabella Rossellini + Adele & Johanna Schopenhauer + Mary Wollstonecraft & Mary Shelley + Maria Theresia & Marie Antoinette
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gunna Wendt
»Die Freude meines Lebens«
Geschichten von berühmten Müttern und Töchtern
Reclam
2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung und Illustrationen: Hannah Kolling, Kuzin & Kolling, Büro für Gestaltung
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2023
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962182-1
ISBN der Buchausgabe 978–3–15–011380–6
www.reclam.de
Inhalt
Inhalt
Prolog
Maria Theresia und Marie Antoinette
Mary Wollstonecraft und Mary Shelley
Johanna und Adele Schopenhauer
Emilie und Franziska (Fanny) zu Reventlow
Marie, Irène und Eve Curie
Katia und Erika Mann
Evangelia und Maria Callas
Elisabeth Furtwängler, Kathrin Ackermann, Maria Furtwängler
Eva von Sacher-Masoch und Marianne Faithfull
Ingrid Bergman und Isabella Rossellini
Gracia Patricia, Caroline und Stéphanie von Monaco
Eva-Maria, Nina und Cosma Shiva Hagen
Romy Schneider und Sarah Biasini
Liv und Linn Ullmann
Jane Birkin und Charlotte Gainsbourg
Literaturhinweise
Dank
Inhalt
War sie der große Engel,
Der neben mir ging?
Oder liegt meine Mutter begraben
Unter dem Himmel von Rauch –
Nie blüht es blau über ihrem Tode.
Wenn meine Augen doch hell schienen
Und ihr Licht brächten.
Wäre mein Lächeln nicht versunken im Antlitz,
Ich würde es über ihr Grab hängen.
Aber ich weiß einen Stern,
Auf dem immer Tag ist;
Den will ich über ihre Erde tragen.
Ich werde jetzt immer ganz allein sein
Wie der große Engel,
Der neben mir ging.
1911
Prolog
❖ Eine junge Frau betritt ein Antiquitätengeschäft und schaut sich um. Es gibt viele schöne Dinge in den Regalen und an den Wänden zu entdecken: Möbel, Lampen, alte Spiegel. Außer ihr ist nur noch eine weitere Kundin im Laden, die sie ab und zu in den Gängen an sich vorbeischlendern sieht. Sie wirkt Respekt einflößend und erinnert die junge Frau an ihre Mutter. Erst als sie bei dem Versuch, ihr auszuweichen, fast mit ihr zusammenstößt, realisiert sie, um wen es sich handelt: um ihr eigenes Spiegelbild.
Eine skurrile Episode, die die Schauspielerin Isabella Rossellini, Ingrid Bergmans Tochter, erlebt hat, und die wesentliche Aspekte einer Mutter-Tochter-Beziehung enthält: Vertrautheit und Fremdheit, Identifikation und Abgrenzung. Aspekte, die in allen folgenden Porträts vorkommen, so verschieden die dargestellten Frauen auch sein mögen. Jedes Schicksal, jede Beziehung ist einzigartig. Zeitlich reicht das Spektrum vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart – ein Zeitraum, in dem sich die Rolle der Frau grundlegend verändert hat. Doch es gibt eine Erfahrung, die alle teilen: Jede Frau ist eine Tochter!
Die Töchter in diesem Band hatten und haben es nicht immer leicht mit ihren Müttern – und umgekehrt. Mutterliebe und Tochterliebe nehmen unterschiedliche Gestalt an und sind nicht immer sofort zu erkennen. Manchmal zeigt sich die Liebe eben auf eine sonderbare Art. Doch es lohnt sich, genau hinzuschauen, die Vielfalt der Gefühle auf sich wirken zu lassen und Glücksmomente nachzuempfinden. Das empfiehlt auch die Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann. So sei die Nacht, in der sie ihre Tochter Linn zur Welt gebracht habe, die schönste Nacht ihres Lebens gewesen, ein Ereignis, das ihr ganz allein gehörte: »Es gab nur mein Mädchen und mich.« ❖
Muttergefühle und kaiserliche Verpflichtungen
Maria Theresia und Marie Antoinette
❖ Am 21. April 1770 trat die 14-jährige Maria Antonia eine Reise an. Es ging von Wien nach Paris, wo sie mit dem 15-jährigen Dauphin Ludwig verheiratet und französische Thronfolgerin werden sollte. Zwei Tage vorher hatte die Trauung mit einem Stellvertreter in ihrer Heimatstadt Wien stattgefunden – ein Verfahren, das damals in höfischen Kreisen nicht ungewöhnlich war, wenn die Wohnorte der Brautleute weit voneinander entfernt lagen. Stellvertreter des Dauphins, der als Ludwig XVI. König von Frankreich werden würde, war Maria Antonias älterer Bruder Erzherzog Ferdinand gewesen. Die eigentliche Eheschließung erfolgte am 16. Mai in Versailles und ließ Maria Antonia zu Dauphine Marie Antoinette werden.
Ihre Mutter, Kaiserin Maria Theresia, die es als eine ihrer Hauptaufgaben betrachtete, ihre 13 Kinder standesgemäß und vor allem politisch motiviert zu verheiraten, war über diese Verbindung sowohl erfreut als auch besorgt. Marie Antoinette war naiv, charmant, fröhlich und leichtsinnig, und ihre Mutter fürchtete, dass ihr ihre Unerfahrenheit und Sorglosigkeit am Hof von Versailles zum Verhängnis werden könnten. Daher entschloss sie sich, ihrer Tochter zwei erfahrene Begleiter zur Seite zu stellen: Graf Mercy-Argenteau und Abbé Vermond. Marie Antoinette wusste um die Sicherheit, die ihr die Anwesenheit der Männer verlieh, aber sie wusste nicht, dass die beiden regelmäßig in Wien bei ihrer Mutter Bericht erstatten sollten.
Marie Antoinette pflegte einen regen Briefwechsel mit ihrer Mutter. Bis zu Maria Theresias Tod im Jahr 1780 sollte diese als geheim geltende Korrespondenz zwischen Mutter und Tochter andauern. Den ersten Brief hatte Marie Antoinette schon während ihrer Reise erhalten: eine »Verhaltungsvorschrift – jeden Monat zu lesen«. »Alles hängt von dem guten Beginn des Tages und der Verfassung ab, in der man ihn beginnt«, erklärte Maria Theresia ihrer Tochter. Noch bevor sie mit einem anderen Menschen sprechen würde, sollte sie ihr Morgengebet verrichten und »etwas Religiöses« lesen. Des Weiteren riet sie ihr, sich an die französischen Sitten anzupassen, ohne sich beeinflussen zu lassen. »Hören Sie auf niemanden, wenn Sie in Ruhe leben wollen«, lautete eine ihrer besonderen »Verhaltungsvorschriften«. Sie dürfe sich, um ihrer Meinung Nachdruck zu verleihen, auf ihre Mutter berufen mit der Begründung: »Die Kaiserin, meine Mutter, hat mir ausdrücklich verboten, irgendeine Empfehlung zu übernehmen.«
Maria Theresia wusste, dass es Marie Antoinette in ihrer neuen Position nicht leicht haben würde, und hoffte, ihre Defizite aus der Ferne ausgleichen zu können. Marie Antoinettes Bildung war lückenhaft, ihr Französisch ebenso. Und trotz der regelmäßigen Korrespondenz, die auf Französisch geführt wurde, schien es sich nicht zu verbessern. Maria Theresia warf ihr sogar vor, dass sich ihr Stil von Tag zu Tag noch verschlechtere. Große Sorge bereitete ihr, dass sich Marie Antoinette nicht für Politik interessierte und ihr das höfische Auftreten fremd blieb. Daran änderten auch die Kurse nichts, die sie im Schnellverfahren unmittelbar nach der Brautwerbung des Dauphins absolviert hatte. All das schien die lebenslustige junge Frau wenig zu kümmern. Dennoch nahm sie die Anweisungen ihrer Mutter ernst und bemühte sich, ihre Fragen gehorsam zu beantworten.
Doch das, was sie von sich preisgab, befriedigte ihre Mutter nicht. Wenn Maria Theresia nachfragte, wich ihre Tochter aus oder verwendete Floskeln und Allgemeinplätze, um ihren Alltag zu schildern. Zum Glück war sie nicht die einzige Nachrichtenquelle für ihre Mutter: Graf Mercy-Argenteau und Abbé Vermond setzten Maria Theresia über alle Einzelheiten im Leben ihrer Tochter in Kenntnis. Mercy-Argenteau verstand es ausgezeichnet, Informanten in unmittelbarer Nähe der Dauphine zu rekrutieren und ein hervorragend funktionierendes Netzwerk zu installieren. Dazu gehörten neben den Bediensteten auch Kurtisanen und die Töchter des amtierenden Königs.
Marie Antoinette wunderte sich manches Mal über die genauen Kenntnisse ihrer Mutter. Woher wusste sie von den nächtlichen Eskapaden, ausschweifenden Vergnügungen und Besuchen im Spielcasino? Marie Antoinette konnte es sich nicht erklären, gab sich jedoch mit dem Hinweis auf die Klatschspalten der Presse und Gerüchte zufrieden und entwickelte ihrer Mutter gegenüber kein Misstrauen. Dass diese nicht nur einen, sondern gleich drei geheime Briefwechsel pflegte und die Inhalte miteinander verglich, kam ihr nicht in den Sinn. Während Maria Theresia von ihren Briefen Abschriften anfertigen ließ, die sie sorgfältig verwahrte, vernichtete Marie Antoinette die Briefe ihrer Mutter sofort nach dem Lesen, wie es diese in ihrem ersten Schreiben angeordnet hatte: »Zerreißen Sie meine Briefe, was mir ermöglichen wird, Ihnen offener zu schreiben; ich werde dasselbe mit Ihren Briefen tun« – was sie jedoch nicht tat. Als Überbringer der Briefe fungierte ein von ihr eingesetzter Kurier, der jeweils am Monatsanfang von Wien nach Paris und wieder zurück reiste.
Wichtigstes Thema der Korrespondenz zwischen Mutter und Tochter war die eheliche Sexualität. Immer wieder erinnerte Maria Theresia, die glücklich war über die Verbindung der beiden bedeutenden europäischen Dynastien, ihre Tochter an die eigentliche Pflicht einer Frau in ihrer Position: »Denn dazu sind Sie doch vor allem berufen: Kinderkriegen.« Maria Theresia wusste, wovon sie sprach, hatte sie doch selbst innerhalb von 19 Jahren 16 Kinder zur Welt gebracht, von denen drei früh gestorben waren. Marie Antoinette war ihr zweitjüngstes Kind.
Elisabeth Badinter betont in ihrer Biographie Maria Theresia. Die Macht der Frau (2017) die Sonderrolle, die die Kaiserin als Mutter spielte. Anders als üblich bei den zeitgenössischen Herrscherinnen oder Frauen ihrer Gesellschaftsschicht überließ sie die Aufzucht und Erziehung ihrer Kinder nicht ausschließlich Bediensteten, sondern kümmerte sich so intensiv wie möglich selbst darum. Als Herrscherin eines Großreichs – nach dem Tod ihres Vaters 1740 hatte sie im Alter von 23 Jahren den österreichischen Kaiserthron bestiegen – eine schier unlösbare Aufgabe. »Oft war sie zerrissen zwischen Muttergefühlen und kaiserlichen Verpflichtungen«, erklärt Badinter. »Diese beiden Rollen standen häufig im Gegensatz zueinander.« Negatives Beispiel war für sie ihre eigene Mutter Elisabeth Christine, die nur wenig Interesse für ihre Kinder gezeigt hatte. Als ihre eigentliche Mutter betrachtete Maria Theresia die Kinderfrau, Gräfin Karolina Fuchs, die sie ›Mami‹ nannte und der sie bis zu deren Tod verbunden blieb.
Aber nicht nur Maria Theresia, sondern auch der von ihr sehr geliebte Ehemann Franz Stephan, praktizierte ein ungewöhnliches Verhalten gegenüber den Kindern. Er war ein zärtlicher Vater, der gerne mit seinen Kindern spielte und sich nicht scheute, öffentlich seine Gefühle zu zeigen. Strenge und Konsequenz in der Erziehung überließ er seiner Frau.
Maria Theresia hatte hohe Ansprüche an sich selbst, besonders was die Mutterschaft betraf. Das Wohl ihrer Kinder lag ihr am Herzen. Sie wollte eine gute Mutter sein, zweifelte an ihren pädagogischen Fähigkeiten und hatte Angst, Fehler zu machen. In einer Zeit, in der die Kindersterblichkeit hoch und auch Maria Theresia einige Male davon betroffen war, durchlebte sie jedes Mal »Todesängste«, wenn eins ihrer Kinder erkrankte.
Die Erinnerung an ihre verstorbenen Kinder hielt sie ihr Leben lang wach, wie der große Saal des Innsbrucker Schlosses zeigt. Dort ließ sie anlässlich der Hochzeit ihres Sohnes Erzherzog Leopold im Jahr 1765 die Porträts aller Familienmitglieder anbringen, darunter auch die der drei Kinder, die nicht mehr am Leben waren und als Engel dargestellt wurden.
Die ständige Konfrontation mit dem Tod ging an Maria Theresias Gemütsverfassung nicht spurlos vorbei. Sie selbst diagnostizierte ihre »periodisch wiederkehrende« Niedergeschlagenheit als Melancholie, die sie von ihrem Vater, Kaiser Karl VI., geerbt hätte. Wenn dieser Zustand eintrat, verspürte sie eine Unlust zu regieren und war versucht, sich von ihrem kaiserlichen Amt, das sie eigentlich mit Freuden ausfüllte, zurückzuziehen. Außer ihr durfte niemand das Thema erwähnen, auch nicht ihre Vertrauten wie der Hofbaumeister Emanuel Silva-Tarouca. Darüber sprach sie ungern, lieber äußerte sie sich schriftlich. Sie habe »keine Kraft zum Reden« und den Kontakt mit ihm daher gemieden, entschuldigte sie sich einmal bei Tarouca. 1747 schrieb sie ihm: »Ich bin an Geist und Körper krank, ich kann keinesfalls aufstehen; ich spüre das Alter.« Zu diesem Zeitpunkt war sie 30 Jahre alt. Ein Jahr später schilderte sie ihm in aller Offenheit ihren psychischen Zustand, den sie als »beklagenswert« bezeichnete. Sie könne sich nicht daran erinnern, sich jemals so elend gefühlt zu haben. »In der Öffentlichkeit agiere ich noch wie eine Maschine, nicht mehr vernunftgesteuert, da mir keine Vernunft übriggeblieben ist.« Sie gerate häufig in Wut und habe sich dann nicht mehr unter Kontrolle, so dass sich unschöne Szenen abspielen würden, woraufhin sie das Fazit zog: »Mir bleibt nichts, als mich allein einzuschließen.«
Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes 1765 verstärkten sich die depressiven Zustände und tauchten immer öfter auf. Ihrem Freund Obersthofmeister Rosenberg lieferte sie eine Mischung aus persönlicher Bestandsaufnahme und detaillierter Selbstreflexion, die mit den Worten beginnt: »Sie werden mich noch wohlgenährt und sogar mit guter Miene finden, doch es fällt mir schwer, das aufrechtzuerhalten.« Ihr Herz sei »von Leid durchbohrt«, ihr Kopf leer, ihre Kräfte verschwunden. Ein Leben lang habe sie sich vor dem Zustand der »gänzlichen Entmutigung« gefürchtet, den sie bei ihrem Vater beobachtet habe. Nun sei er bei ihr selbst eingetreten. Ihr Mann sei ihr immer eine Stütze gewesen, allein sein Anblick habe sie getröstet, doch nach seinem Tod sei sie ganz allein ihrer Natur überlassen. Daran konnte auch die Tatsache nichts ändern, dass sie ihren Sohn Joseph – später Kaiser Joseph II. – als Mitregent an ihrer Seite hatte.
Das Einzige, was ihr bei der Bewältigung ihrer ›Melancholie‹, wie sie ihre depressiven Phasen nannte, half, war der vollständige Rückzug: »mein Asyl, meine Sicherheit, sowohl zur Erholung meiner Seele als auch für mein gegenwärtiges Glück«, erklärte sie Tarouca.
Dass ihr »gegenwärtiges Glück« eng mit dem Glück ihrer Familie zusammenhing, war ihr bewusst. Die Verantwortung, die sie ihren Kindern gegenüber verspürte, war nicht weniger wichtig als die Verantwortung gegenüber dem riesigen Reich, dessen Herrscherin sie war. Sie betrachtete es als ihre vordringliche Aufgabe, ihre Kinder als Repräsentantinnen und Repräsentanten der Habsburger Dynastie zu erziehen – und dazu gehörte es auch, sie standesgemäß zu verheiraten. Maria Theresia stiftete einige Ehen, die sich positiv auf das Verhältnis der beteiligten Regierungen auswirkten, allen voran Maria Antonias Vermählung mit dem französischen Kronprinzen Ludwig. »Ich werde mir von Tag zu Tag mehr bewusst, was meine teuere Mama für meine Verheiratung getan hat. Ich war von allen Kindern das jüngste, und Sie haben mich wie das älteste behandelt«, schrieb ihr Marie Antoinette voller Dankbarkeit. Doch nachdem die Hochzeitsfeierlichkeiten vorbei waren, war es höchste Zeit, sich dem eigentlichen Zweck der Ehe, Kinder in die Welt zu setzen, zuzuwenden.
Maria Theresia ließ es in ihren Briefen an ihre »teure Tochter« nicht an Deutlichkeit fehlen. »Weder Ihre Schönheit, die tatsächlich nicht so groß ist, noch Ihre Talente noch Ihre Kenntnisse« würden Marie Antoinette die Akzeptanz und die Liebe des Volkes verschaffen, sondern in erster Linie »die Änderung Ihres Zustandes«, womit sie auf die ungeduldig erwartete Schwangerschaft anspielte.
Warum musste sich in den Nächten die junge Ehefrau außerhalb des Palastes vergnügen, und warum akzeptierte der junge Ehemann ihre Abwesenheit? Maria Theresia hatte als Mutter von 16 Kindern kein Verständnis für sexuelle Enthaltsamkeit, aus welchen Gründen auch immer. Zunächst versuchte sie es mit Ratschlägen von Frau zu Frau und empfahl »Zärtlichkeiten und Schmeicheleien«, da Eifer und Zielstrebigkeit das Gegenteil bewirken könnten. Sie dürfe sich vorerst nur in »Sanftmut und Geduld« üben.
Doch als das Thema in Marie Antoinettes Briefen immer seltener auftauchte und Maria Theresia von ihren beiden Informanten erfuhr, dass ihre Tochter weiterhin die Nächte ohne ihren Ehemann durchtanzte und ihr Luxusleben genoss, sah sie sich genötigt, ihr eindringlich ins Gewissen zu reden: »Ich hoffe, dass Sie weiter diesem Punkte Ihre ganze Aufmerksamkeit zuwenden werden. Das ist ein für Ihre Zukunft wesentlicher Punkt.« Sie missbilligte die Vergnügungssucht ihrer Tochter und forderte sie auf, doch einmal an ihren Mann zu denken. Sie wisse doch, dass dieser keine Freude am Ausgehen habe und sie nur begleite, um ihr einen Gefallen zu tun. Marie Antoinettes Antworten zeugen von Schuldgefühlen: »Ich muss meinen Hang zum Vergnügen und meine Trägheit gegenüber ernsten Dingen zugeben.« Doch sie hoffe, sich »nach und nach zu bessern«.
Heftig zerrte der Erwartungsdruck, dem sich Marie Antoinette ausgesetzt sah, an ihren Nerven. Die Hoffnung, schwanger zu sein, wenn die Menstruation – für die das Codewort »Generalin« vereinbart war – ausblieb, schlug in Resignation um, wenn sie nach einigen Tagen verspätet einsetzte. Manchmal lenkte sie von sich ab und klagte über die Trägheit ihres Mannes, »die ihn nur bei der Jagd verlässt«. Nicht sie sei es, die getrennte Schlafzimmer bevorzuge, sondern »der König liebt es nicht, zu zweit zu schlafen«. Dann wieder beruhigte sie ihre Mutter mit der Aussage, ihre Angelegenheiten hätten sich inzwischen gut entwickelt, so dass sie »die Ehe für vollzogen halte; wenn auch noch nicht in dem Maße, um schwanger zu sein«. Eine Erklärung, die bei ihrer Mutter für Unverständnis gesorgt haben dürfte. Zu diesem Zeitpunkt waren Marie Antoinette und Ludwig bereits drei Jahre verheiratet.
Für Marie Antoinette muss es eine Erleichterung gewesen sein, als bei ihrem Mann eine Vorhautverengung diagnostiziert wurde, die für Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sorgte. Nun lag die Verantwortung für die Kinderlosigkeit nicht mehr in erster Linie bei ihr. »Ich bemühe mich, ihn zu der kleinen Operation zu bewegen, über die man schon gesprochen hat und die ich für notwendig halte«, teilte Marie Antoinette im Herbst 1775 ihrer Mutter mit.
Ludwig vertraute sich Marie Antoinettes älterem Bruder Joseph an, als dieser im April 1777 für einige Wochen nach Paris kam. Von dort aus berichtete Joseph seinem Bruder Leopold, was er erfahren hatte: Ludwig betrachte den Geschlechtsakt »nur als reine Pflichtübung«, an der er »keinerlei Vergnügen« finde. Joseph fügte hinzu, seine Schwester sei »auch nicht gerade sinnlich veranlagt«, und zog das Fazit: »Beide zusammen sind ein Paar von ausgemachten Stümpern.« Doch nach eigener Aussage hatte Josephs Intervention Erfolg: Ludwig habe ihm mitgeteilt, dass seit ihrer Begegnung sein Befinden »immer besser geworden« sei, »bis zur vollkommenen Konklusion«. Ob er seinen Schwager zu einer Operation überredet oder nur in einem Gespräch von Mann zu Mann Aufklärung und Hilfestellung geleistet hatte, blieb unklar. Jedenfalls sei Ludwigs Zukunftsblick euphorisch gewesen, als er an Joseph geschrieben habe: »Ich hoffe, dass das nächste Jahr nicht vorübergehen wird, ohne dass ich Ihnen einen Neffen oder eine Nichte gegeben habe.«
Ganz so schnell ging es dann allerdings nicht. Zwar verkündete Marie Antoinette zwei Monate nach dem Besuch ihres Bruders, dass endlich auch sie in den Genuss der »grundlegendsten Freude« gekommen sei, doch der Optimismus des stillen Beobachters Mercy-Argenteaus hielt sich in Grenzen: Für Marie Antoinette sei die positive Wirkung des brüderlichen Besuchs nur von kurzer Dauer gewesen. Entgegen der Berichte, die sie ihrer Mutter hatte zukommen lassen, und des Versprechens, nicht mehr zu spielen und allein auszugehen, habe sie ihre Spielgewohnheiten im Casino bald wieder aufgenommen. Betrübt sei er, »dass die Königin, entgegen ihrem natürlichen Charakter, sich weder Sorgen noch Skrupel macht, das ihrem Bruder gegebene Versprechen zu brechen«.
Neben der anhaltenden Sorge um ihre unbelehrbare Tochter war es zu diesem Zeitpunkt vor allem der Konflikt mit ihrem Sohn und Mitregenten Joseph, der Maria Theresia das Leben schwer machte, denn dabei ging es um nichts weniger als Krieg und Frieden. Nach dem Tod des kinderlosen Bayerischen Kurfürsten Maximilian III. im Dezember 1777 erhob Joseph Anspruch auf Niederbayern und die Oberpfalz – gegen den Willen Maria Theresias, die ihm im März 1778 ankündigte: »Ich bin bereit, alles zu tun, um dieses Unglück noch rechtzeitig zu verhindern, bis zur eigenen Erniedrigung. Man mag behaupten, ich redete wirres Zeug, sei schwach oder zaghaft – nichts wird mich davon abhalten, Europa aus dieser gefährlichen Situation herauszureißen.« Joseph marschierte trotz der Mahnungen seiner Mutter in Bayern ein, worauf der preußische König Friedrich II. am 3. Juli 1778 Österreich den Krieg erklärte und in Böhmen einfiel. In dieser Situation bewies Maria Theresia ihr großes diplomatisches Geschick: Heimlich wandte sie sich an Friedrich II. und bat ihn um Frieden. Als sie Joseph davon in Kenntnis setzte, reagierte dieser mit heftigen Vorwürfen und der Ankündigung, sich öffentlich von ihr zu distanzieren. Anders könne er die Erniedrigung nicht ertragen. Die russische Zarin Katharina II. blieb neutral und verhandelte zusammen mit Frankreich den Frieden von Teschen, der am 13. Mai 1779, dem Geburtstag Maria Theresias, geschlossen wurde.
Ein Jahr zuvor, als Maria Theresias Engagement vor allem dem gefährdeten Frieden gegolten hatte, hatte Marie Antoinette endlich – nach einer Reihe von Fehlmeldungen, die bei ihrer Mutter jedes Mal aufs Neue Enttäuschung ausgelöst hatten – ihre Schwangerschaft verkünden können. Doch Maria Theresia war vorerst skeptisch geblieben, wie ihr Brief an Mercy-Argenteau vom 2. Mai 1778 zeigt:
So schmeichelhaft die Nachricht von dem Anschein einer Schwangerschaft meiner Tochter ist, so bin ich eingestandenermaßen fast versucht, daran bis zu dem Augenblick zu zweifeln, in dem sie das Kind zur Welt gebracht haben wird, mit dem man sie schwanger glaubt. Ich bin über dieses Kapitel so ungläubig geworden, weil ich seit so langer Zeit meine Hoffnungen enttäuscht sehe.
Zwei Wochen später, nachdem nicht nur ihre Tochter, sondern auch ihr Schwiegersohn jegliche Zweifel ausgeräumt hatten, hatte dann auch Maria Theresia endlich in den Jubel eingestimmt: »Alle meine Wünsche in bezug auf meine Familie sind also erfüllt, und ich kann nun meine Augen ruhig schließen: Ich gestehe, Ihre Situation lag mir mehr am Herzen, als ich es merken ließ, da ich Sie so innig liebe.«
Am 19. Dezember 1778 brachte Marie Antoinette eine Tochter zur Welt, die sie Marie Thérèse Charlotte nannte. »Die Söhne werden den Töchtern folgen«, versicherte Maria Theresia und behielt damit recht. Doch sie selbst würde die Geburten zweier Enkelsöhne und einer Enkeltochter nicht mehr erleben. Maria Theresia starb am 29. November 1782 im Alter von 63 Jahren an einer Lungenentzündung. So blieb es ihr erspart, das gewaltsame Ende ihrer Tochter nach Ausbruch der Französischen Revolution mitzuerleben. Marie Antoinette wurde des Hochverrats und der Unzucht angeklagt, zum Tode verurteilt und am 16. Oktober 1793, neun Monate nach ihrem Ehemann, hingerichtet. ❖
»Es ist Zeit, das weibliche Verhalten zu revolutionieren«
Mary Wollstonecraft und Mary Shelley
❖ Als »wiedergeborene Mary Wollstonecraft« wurde Mary Shelley, geborene Godwin, häufig bezeichnet, so auch von Percy Bysshe Shelley, ihrem späteren Ehemann, als er ihr das erste Mal begegnete. Sogar sie selbst konnte die verblüffende Ähnlichkeit mit ihrer verstorbenen Mutter nicht leugnen. Immer wieder betrachtete sie deren Porträt, das im Arbeitszimmer ihres Vaters, William Godwin, hing. Obwohl die Frau auf dem Bild zur Seite schaut, fühlt man sich direkt angesprochen. Ihr Blick scheint sowohl in die Ferne als auch nach innen zu weisen: wissend und fragend zugleich. Man kann sich nur schwer davon lösen. Mary Shelley dürfte beim Anblick des Gemäldes ähnlich empfunden haben.
Mary Wollstonecraft wurde am 27. April 1759 als zweites von sechs Kindern des Webers und Landwirts Edward John Wollstonecraft und seiner Ehefrau Elizabeth Dickson geboren. Der jähzornige gewalttätige Vater, der die Familie tyrannisierte und ständig finanzielle Probleme hatte, sorgte für häufige Wohnungswechsel, wie William Godwin in seinen Erinnerungen an Mary Wollstonecraft (engl. Memoirs of the Author of A Vindication of the Rights of Woman, 1798) berichtet. Seine Frau sei sich deswegen nicht sicher gewesen, ob sie in London oder auf einem Bauernhof im Epping Forest das Licht der Welt erblickt hatte. 1798, ein Jahr nach ihrem Tod, hatte der Schriftsteller Godwin die biographische Skizze über Mary Wollstonecrafts Leben verfasst, die einiges über ihre Kindheit verrät. »Es schien mir stets eine Ehrenpflicht für die Hinterbliebenen eines Verstorbenen von herausragenden Verdiensten, der Nachwelt einen Bericht seines Lebens zu geben«, erklärt er im Vorwort. Er schildert die Gewaltausbrüche des Vaters, die auf Mary allerdings nicht die beabsichtigte Wirkung ausübten. Sie »stimmten sie keineswegs demütig, sondern empörten sie vielmehr«. Nach und nach entwickelte sich bei ihr ein Überlegenheitsgefühl, so dass sie aus ihrer Verachtung keinen Hehl machte. Obwohl ihre Mutter wenig Verständnis für ihre Tochter zeigte und ihre mütterliche Liebe auf den ältesten Sohn konzentrierte, fühlte sich Mary mit ihr solidarisch und beschützte sie vor den Attacken des Vaters. Manchmal stellte sie sich sogar zwischen den Tobenden und das hilflose Opfer.
Die häufigen Umzüge der Familie hatten zur Folge, dass Mary keine solide Schulbildung erhielt, was sie zeitlebens als Makel empfand. Lernen wurde zum wichtigen Lebensthema – weit über die eigenen Belange hinaus. Mary Wollstonecraft vertraute auf die emanzipatorische Wirkung von Erziehung, verlangte gleiche Bildungschancen für Jungen und Mädchen und bevorzugte die Koedukation:
Knaben und Mädchen gemeinsam? höre ich jetzt manche Leser fragen. Jawohl! Ich erwarte davon nichts Schlimmeres als eine gelegentliche frühe Zuneigung, die zwar die besten Folgen für den moralischen Charakter der jungen Menschen hätte, aber nicht immer dem Willen der Eltern entspräche.
Im Alter von 16 Jahren lernte Mary die zwei Jahre ältere Fanny Blood kennen – schon bei ihrer ersten Begegnung habe sie ihr »in der Stille ihres Herzens ewige Freundschaft geschworen«, gestand sie ihrem Mann. Fanny übernahm die Rolle der Lehrerin, die Mary die schönen Künste – Musik, Literatur und Malerei – nahebrachte. So oft wie möglich waren die beiden Freundinnen zusammen. Wenn sie für längere Zeit getrennt waren, unterhielten sie eine intensive Korrespondenz. Auf diese Weise lernte Mary das Schreiben als Kunstform kennen, in der sie sich unbedingt vervollkommnen wollte.
Um finanziell unabhängig zu sein, trat sie 1778 eine Stelle als Gesellschafterin bei einer Witwe in Bath an, die den Ruf hatte, äußerst schwierig zu sein, weswegen es niemand länger mit ihr aushielt. Doch Mary nahm die Herausforderung an und blieb zwei Jahre bei ihr. Erst die schwere Erkrankung ihrer Mutter ließ sie nach Hause zurückkehren, wo sie die Pflege der Kranken übernahm. Fanny war ihr während der ganzen Zeit eine verlässliche Stütze. Nach dem Tod der Mutter verließ Mary endgültig ihr Elternhaus.
In ihrem Bestreben, einen gesellschaftlichen Beitrag für die Situation der Frau zu leisten, gründete Mary zusammen mit ihren Schwestern und Fanny 1783 eine Tagesschule. Doch Fanny, die in den vergangenen Jahren für den Lebensunterhalt ihrer Eltern und ihrer jüngeren Geschwister gesorgt und sich dabei überanstrengt hatte, erkrankte schwer. Als die Ärzte Schwindsucht diagnostizierten und ihr zu einem Aufenthalt im Süden rieten, folgte sie, unterstützt von Mary, der Empfehlung. Anfang des Jahres 1785 bestieg sie das Schiff nach Lissabon, wo der aus Irland stammende Hugh Skeys lebte, der zuvor um ihre Hand angehalten hatte. Mary hatte Fannys Zögern nicht gelten lassen, sondern sie dazu gedrängt, den Heiratsantrag anzunehmen. Obwohl sie kaum Hoffnung hatte, dass für ihre Freundin Aussicht auf Heilung bestand, beharrte sie auf ihrer Maxime, nichts unversucht zu lassen. Die Hochzeit fand am 24. Februar statt, kurze Zeit später wurde Fanny schwanger, was ihrem Gesundheitszustand nicht zuträglich war.
Ohne zu zögern entschloss sich Mary, nach Portugal zu reisen und ihrer Freundin beizustehen. Dass sie ihre gerade gegründete Schule eine Zeitlang allein lassen musste, fiel ihr schwer, aber Priorität hatte nun einmal die Sorge um Fanny. Zwar rieten ihr alle ihre Vertrauten von der Reise ab, unterstützten sie jedoch finanziell, als sie erkannten, wie ernst es ihr war. Kurz vor dem Geburtstermin traf sie in Lissabon ein und erlebte das traurige Ereignis an Ort und Stelle: Mutter und Kind starben am 29. November 1785. Zehn Jahre später sollte Mary in ihren Reisebriefen aus Südskandinavien (engl. Letters Written during a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark, 1796) schreiben: »Wenn ein fühlendes Herz starke Eindrücke empfangen hat, so sind diese nicht zu tilgen.« Zu diesen unauslöschlichen Eindrücken zähle die Erinnerung an ihre Jugendfreundin, über der sich die Erde geschlossen habe. »Doch sie ist bei mir, und ich höre sie mit sanfter Stimme singen, wenn ich durch die Heide wandere.«
Auf der Rückreise nach England Mitte Dezember 1785 hatte Mary Wollstonecraft Gelegenheit, ihre Empathie, ihr Verantwortungsgefühl und ihre Durchsetzungsfähigkeit zu beweisen. Auf hoher See begegnete ihnen ein französisches Schiff, das in Seenot geraten war und zu sinken drohte. Der verzweifelte französische Kapitän bat darum, zusammen mit seiner Mannschaft an Bord kommen zu dürfen, doch sein englischer Kollege lehnte mit der Begründung ab, die Vorräte würden nicht für alle reichen – eine Begründung, die Mary nicht akzeptieren konnte. Sie war fassungslos angesichts der Herzlosigkeit des Kapitäns und drohte ihm mit ernsten gerichtlichen Konsequenzen, sobald sie an Land sein würden – so eindringlich und überzeugend, dass er klein beigab und die in Not Geratenen an Bord aufnahm.
Zurück in England musste Mary feststellen, dass es ihren Schwestern nicht gelungen war, die Schule in ihrem Sinne weiterzuführen. Ihnen fehlte es an Tatkraft und Phantasie – beides besaß bloß Mary im Übermaß. Doch sie wollte nicht länger so eng mit ihren Schwestern zusammenarbeiten, wie es notwendig gewesen wäre, um deren Defizite auszugleichen. Das Angebot, als Erzieherin der Töchter des Lord Viscount Kingsborough nach Irland zu gehen, erreichte sie im richtigen Moment. So beschloss sie, so lange in Anstellung zu gehen, bis sie genügend Geld zurückgelegt hatte, um ihren eigentlichen Plan, Schriftstellerin zu werden, realisieren zu können.
Ihr erstes Buch Gedanken über die Erziehung von Töchtern (engl. Thoughts on the Education of Daughters) wurde 1786 von dem Londoner Verleger Joseph Johnson publiziert. Ein Bekannter hatte den Kontakt hergestellt, der für ihre schriftstellerische Laufbahn entscheidend sein sollte. In ihrem Erstling zeigte sich Mary Wollstonecraft von einer asketischen, puritanischen, strengen Seite, die sie später ablegen würde. Was sie beibehielt und weiterentwickelte, waren Präzision, Entschiedenheit und Eloquenz.
1787 wurde ihr nach einem Jahr überraschend von Lady Kingsborough gekündigt. Die eifersüchtige Mutter konnte es nicht ertragen, dass sich die junge Gouvernante bei den Kindern großer Beliebtheit erfreute. Sie habe bald keine andere Sorge mehr gehabt, so William Godwin, »als dass ihre Kinder die Erzieherin mehr lieben könnten als ihre Mutter«.
Mary wertete es als Zeichen dafür, von nun an ausschließlich als Schriftstellerin zu arbeiten. Sie wandte sich an Joseph Johnson, der sie dazu ermutigte. Er war ihr bei der Wohnungssuche in London behilflich und veröffentlichte 1788 ihr zweites Buch, den Roman Mary. Leitmotiv des Romans ist ihre Freundschaft mit Fanny.
Im Herbst 1792, während der Französischen Revolution, reiste Mary nach Frankreich. Dort entstand ihr berühmtestes Werk, Verteidigung der Rechte der Frau (engl. A Vindication of the Rights of Woman). Darin weist sie die Behauptung, das weibliche Geschlecht sei unvollkommen, entschieden zurück und verwahrt sich dagegen, dass Frauen »zu schwachen und elenden Geschöpfen gemacht werden«. Stattdessen müssten beide Geschlechter im Namen der Freiheit ihre Rolle neu definieren. »Es ist Zeit, das weibliche Verhalten zu revolutionieren – Zeit, ihnen die Würde zurückzugeben, die sie verloren haben – und sie als Teil der menschlichen Spezies dazu zu bringen, daran zu arbeiten, sich selbst zu reformieren, um die Welt zu erneuern«, postuliert sie in ihrem feministischen Manifest mehr als 150 Jahre vor Simone de Beauvoir.
Sie scheute sich nicht, dem berühmten Philosophen und Pädagogen Jean Jacques Rousseau zu widersprechen, allem voran seiner Auffassung, die Frau sei ein Naturwesen und ihre wichtigste Aufgabe bestünde darin, ›dem Mann‹ zu gefallen und Mutter zu werden. »Wie sehr beleidigen uns diejenigen, die uns dazu anleiten, dass wir uns selbst zu sanften Haustieren machen!«, so Mary Wollstonecraft, und weiter:
Aber die geschlechtsspezifische Schwäche, die die Frauen wegen ihres Unterhaltes vom Mann abhängig macht, erzeugt eine Art katzenhafter Zuneigung, die eine Frau dazu bringt, um ihren Ehemann herumzuschnurren, wie sie es bei jedem anderen Mann täte, der sie füttert und streichelt. Männer sind jedoch zufrieden mit dieser Art der Zuneigung, die sich in tierischer Weise auf sie beschränkt.
Im Erscheinungsjahr ihres Hauptwerks lernte Mary Wollstonecraft den amerikanischen Geschäftsmann Gilbert Imlay kennen. Sie ging mit ihm eine Beziehung ein, die von Anfang an konfliktreich war. Sie lebten an verschiedenen Orten – Paris, Neuilly, Le Havre. Erst als Mary schwanger wurde, zog sie zu ihm nach Le Havre. Am 14. Mai 1794 kam ihre Tochter zur Welt: Fanny.
In ihren Briefen schildert Mary die Geburt als beglückendes Ereignis, das nur durch Unwissenheit als grausamer Kampf der Natur erlebt würde. Sie schwärmt von der außergewöhnlichen Intelligenz ihrer Tochter und erwähnt nebenbei, dass es Imlay sowohl gesundheitlich als auch geschäftlich nicht gut gehe. Sie registrierte seinen Zustand, schien sich aber nicht dafür zuständig zu fühlen, ihm Trost und Aufmunterung zu spenden. Allmählich erkannte sie, dass die Familie für Imlay nicht der Mittelpunkt seines Lebens war, sondern nur ein Aspekt unter anderen. Sein Freiheitsbedürfnis stand der Eheschließung entgegen. Dass eine uneheliche Mutter damals als ›gefallene Frau‹ galt, auf die man herabschaute, war für ihn kein Grund zu heiraten.