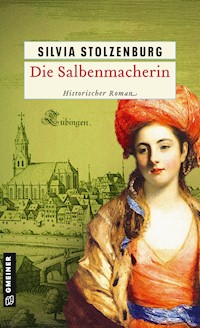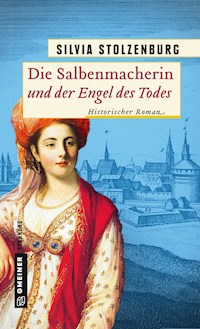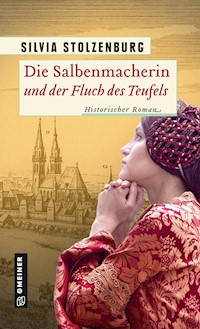Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Begine von Ulm
- Sprache: Deutsch
Ulm 1412. Als die junge Begine Anna Ehinger ihren Dienst im Spital der Stadt antritt, ahnt sie nicht, dass die Vorkommnisse im Infirmarium ihr Leben für immer verändern werden. Während der Siechenmeister Lazarus sie in ihre Aufgaben einweist, wird ein furchtbar zugerichteter Mann ins Spital eingeliefert, der wenig später seinen Verletzungen erliegt. Als sich nach einer Leichenschau herausstellt, dass der Mann ermordet worden ist, beschließen Anna und Lazarus, der Sache auf den Grund zu gehen und bringen sich damit in tödliche Gefahr. Denn bald tauchen weitere Leichen in Ulm auf …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Begine von Ulm
Historischer Kriminalroman
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)
Alle Veröffentlichungen der Autorin finden Sie bei uns im Gmeiner-Verlag: www.gmeiner-verlag.de
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Elnur / shutterstock und
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christ_Carrying_the_Cross,_with_the_Crucifixion;_The_Resurrection,_with_the_Pilgrims_of_Emmaus_MET_DT3082.jpg
ISBN 978-3-8392-6226-9
Widmung
Für Effan, meinen unbezahlbaren Schatz
Prolog
Ein Waldstück in der Nähe von Ulm, Ende März 1412
»Heilige Muttergottes, steh mir bei!« Die Worte waren kaum mehr als ein Flüstern. Die junge Frau, die sie vor sich hinmurmelte, kroch tiefer ins Dickicht und kauerte sich hinter einen kahlen Dornenbusch. Ihr dünnes Nachtgewand war zerrissen, die nackten Füße blutig von der Flucht über den stellenweise schneebedeckten Waldboden. Ihr Atem kam stoßweise, das Herz in ihrer Brust raste. Die Furcht sorgte dafür, dass sie weder den Schmerz noch die Kälte spürte, die unaufhaltsam durch das fadenscheinige Gewand drang. Sie machte sich so klein, dass die Zweige des Gestrüpps sie vollkommen verbargen.
Das Heulen des Windes in den Wipfeln der Bäume war laut und übertönte beinahe das wütende Bellen. In den Ohren der jungen Frau klang es wie der Ruf eines Dämons. Während sie die Beine an die Brust zog und mit den Armen umschlang, lauschte sie mit angehaltenem Atem in die Dämmerung.
Das Bellen wurde lauter.
Mit einem Wimmern machte sie sich noch kleiner und betete. »Barmherziger Vater, vergib mir meine Sünden. Erlöse mich von dem Bösen und lass dein Antlitz leuchten über mir«, wisperte sie. Ihre Hand wanderte zu ihrem Bauch. Das Kind darin war eine Frucht der Sünde, ein Balg des Teufels. Gezeugt ohne den Segen eines Priesters. Was Frauen wie sie im Jenseits erwartete, wusste sie nur zu gut. Ihre Seelenwaage würde sich nach unten senken und sie zu einer Ewigkeit im Fegefeuer oder der Hölle verdammen. Sie schlug die Hände vors Gesicht und ließ den Tränen der Verzweiflung freien Lauf. Warum hatte sie kein gottgefälligeres Leben geführt? Wieso war sie den Versuchungen der Sünde erlegen und hatte Vergnügungen gesucht, vor denen die Pfaffen bei jeder Messe warnten? Weshalb war sie nicht wie ihre Schwestern damit zufrieden gewesen, einen anständigen Burschen zum Mann zu nehmen und in frommer Demut zu leben? Welcher Dämon hatte Besitz von ihr ergriffen, sie im Netz der Sünde gefangen? Sie wischte sich mit dem Handrücken über die Augen und schlug ein Kreuz vor der Brust. »Herr Jesus, erlöse mich«, flehte sie erneut.
Doch ihr Bitten schien auf taube Ohren zu stoßen, da sich zornige Rufe zu dem Bellen gesellten.
Er war fast bei ihr! Nicht mehr lange, dann würden die Hunde sie wittern, aus ihrem Versteck ziehen und sie zerfetzen. Die Furcht war wie ein wildes Tier, das seine Klauen in ihr Herz schlug. Seit Stunden war sie auf der Flucht, hatte bereits zu hoffen gewagt, dass Gott sie doch nicht verlassen hatte. Aber dann war sie immer tiefer in den Wald geraten, der mit jedem Schritt undurchdringlicher zu werden schien. Als eine Schlucht sie schließlich zum Umkehren gezwungen hatte, hatte das erste Bellen die Stille zerrissen. Seitdem waren die Vögel verstummt, und mit der Zeit war die Sonne hinter den Wipfeln verschwunden. Bald würde es ganz dunkel sein. Wenn er sie bis dahin nicht gefunden hatte, würde die eisige Kälte ihm die Arbeit abnehmen.
Sie vernahm ein Geräusch. Es dauerte einige Augenblicke, bis sie begriff, dass es ihre eigenen Zähne waren, die aufeinanderschlugen. Inzwischen waren ihre Glieder so steif, dass sie sich kaum mehr bewegen konnte. Ihre Zehen brannten, als ob sie in Flammen stünden, und sie wusste, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis sie müde wurde. Was, wenn sie ihr Versteck verließ und ihn um Vergebung bat? Gewiss würde er Gnade zeigen. Sie tastete nach ihrem Rücken, der übersät war von Striemen und tiefen Wunden. Er hatte sie nur bestrafen wollen, nicht töten, redete sie sich ein. Wenn sie aufgab …
»Zeig dich, du verdammte Hure!«, hallte eine tiefe Stimme durch den Wald.
Sie wagte kaum zu atmen.
»Sucht sie!« Der Befehl galt den Hunden, deren Hecheln deutlich zu hören war.
Als sich plötzlich etwas neben der jungen Frau bewegte und mit einem Rascheln durch das Dickicht huschte, hätte sie beinahe einen Schrei ausgestoßen. Im letzten Moment presste sie die Hand auf den Mund und erstarrte.
Das Bellen der Hunde verwandelte sich in kehliges Knurren, dann stoben sie davon.
»Aus!« Ein Pfiff gellte durch den Wald, gefolgt von einem gotteslästerlichen Fluch. »Lasst den Hasen in Ruhe!« Die Schritte ihres Verfolgers entfernten sich.
Eine Zeit lang wartete die junge Frau, ob die Hunde zurückkehren würden, doch offenbar hatte der Hase sie von ihrer Fährte abgelenkt. Mit dem Mut der Verzweiflung nahm sie ihre letzte Kraft zusammen, kroch aus dem Dickicht hervor und sah sich zitternd um. Gott schien ihr Flehen erhört zu haben. Sie bekreuzigte sich erneut und humpelte mit steifen Beinen in die entgegengesetzte Richtung, aus der die Hunde gekommen waren. Sie musste nur lange genug laufen, dann würde sie irgendwann den Waldrand oder eine Siedlung erreichen.
Wenn sie nicht vorher erfror.
Während es immer dunkler wurde, stolperte sie auf zerschundenen Füßen einen kaum erkennbaren Pfad entlang. Der Mond war bereits aufgegangen, als sich die Bäume endlich lichteten und die erleuchteten Fenster eines Anwesens durch die kahlen Äste blitzten.
Mit einem Schluchzen schleppte sie sich über einen frisch gepflügten Acker auf die Gebäude zu, während der Mond hinter einer Wolke verschwand. Im Dunkeln war nicht viel zu sehen, weshalb sie ihren Fehler zu spät erkannte. Erst als der Mond sich wieder zeigte, sah sie, wohin sie gelaufen war. »Heilige Jungfrau Maria!«, keuchte sie und fiel, vor Erschöpfung zitternd, auf die Knie. Sie war direkt zurück in die Hölle gelaufen!
Kapitel 1
Ulm, April 1412
Die Ulmer waren eine Versammlung leichtsinniger Narren! Der Spielmann Gallus versicherte sich, dass er seine Sackpfeife richtig geschultert hatte, ehe er näher an das Lagerhaus der Gräth, des städtischen Waag- und Zollhauses, schlich. Dieses befand sich nordwestlich des prunkvoll bemalten Rathauses, vor dem sich zahllose Buden und Läden von Kaufleuten drängten. Er duckte sich in die langen Schatten der Giebel, die vom Mondlicht gespenstisch beleuchtet wurden. Was er aus der Entfernung nur vermutet hatte, bestätigte sich, als er vor dem Lagerhaus anlangte: Eines der Tore des flachen Gebäudes stand einen Spalt offen. Ein Grinsen huschte über sein Gesicht, da weit und breit kein Stadtwächter zu sehen war. Vor dem direkt an das Lagerhaus anschließenden Gebäude, einem dreigeschossigen Fachwerkbau, stand ein halbes Dutzend leerer Karren, die vermutlich am nächsten Tag beladen werden sollten. Allerdings schienen sich die Besitzer in die Herbergen der Stadt zurückgezogen zu haben.
Die Nacht war kalt und ungemütlich, da es vor einigen Stunden angefangen hatte, leicht zu regnen. Obwohl er die Stadt als Fahrender eigentlich bei Sonnenuntergang hätte verlassen müssen, war Gallus noch auf der Straße – in der Hoffnung, einen Unterschlupf innerhalb der Stadtmauern zu ergattern. Er verzog das Gesicht. Wenn er ehrlich zu sich war, befand er sich nicht nur auf der Suche nach einem trockenen Platz zum Schlafen, sondern auch nach lohnender Beute. Die Anstellung, wegen der er nach Ulm gekommen war, hatte ihm ein anderer vor der Nase weggeschnappt. An Gallus’ Stelle hatte ein aufgeblasener Lump aus der Gegend den Posten des Türmers und Stadtpfeifers erhalten, auf den Gallus gehofft hatte. Er schlug den Kragen seines abgetragenen Mantels hoch und schüttelte die letzten Bedenken ab. Wenn man ihn erwischte, konnte er sich damit entschuldigen, dass die Tür offen gestanden hatte. Strenggenommen beging er keinen Einbruch. Nach einem letzten Blick auf den verwaisten Marktplatz eilte er zur Lagerhalle und schlüpfte hinein.
Im Inneren des riesigen Gebäudes war es nicht viel wärmer als im Freien. Es roch nach Holz, frisch gefärbten Tuchen, Gewürzen und eingesalzenen Heringen, außerdem nach kaltem Pferdeschweiß. Durch die Fenster in den Giebeln der Lagerhalle fiel etwas Mondlicht herein, wodurch die Umrisse der gelagerten Waren erkennbar wurden. In der Nähe der großen Tore befanden sich zahllose Ballen des »Ulmer Goldes«, wie man den in der Stadt hergestellten Barchent nannte. Dieses Gewebe aus Leinen und Baumwolle war so begehrt, dass es in die ganze Welt verschifft wurde.
Gallus ließ die Ballen links liegen und machte sich auf den Weg in den hinteren Bereich der Gräth. Dort reichten die Kisten und Fässer bis fast unter die Decke, von deren Balken pralle Netze herabhingen. Den Inhalt konnte Gallus trotz des Mondlichts nicht erkennen. Er folgte seiner Nase, bis er in einem Teil der Lagerhalle ankam, in dem sich kleine und große Säcke türmten. Die meisten waren bereits mit dem städtischen Stempel versehen, dem Zeichen dafür, dass sie gewogen und ihr Inhalt überprüft worden war. Gallus’ Nase kitzelte. Der Duft von Pfeffer, Muskat, Kardamom und Zimt hing so schwer in der Luft, dass er spürte, wie ein Niesen in ihm aufstieg. Er presste den Ärmel auf Mund und Nase und rang den Drang nieder. Dann zückte er sein Messer, um ein paar der Säckchen aufzuschneiden und einige der kostbaren Körnchen in den Lederbeutel an seinem Gürtel abzufüllen.
Er hatte gerade die Klinge angesetzt, als er ein Geräusch vernahm. Mit einem lautlosen Fluch duckte er sich hinter einen prallen Salzsack und umfasste sein Messer fester.
»Schschsch!«, hörte er jemanden zischen.
Ein Poltern folgte, dann ein Geräusch, als ob jemand mit einer Brechstange den Deckel einer Kiste aufbrach.
Gallus zog die Brauen hoch. Offenbar war er nicht der einzige Strolch, dem die offen stehende Tür aufgefallen war. Obwohl ihm sein Verstand sagte, dass es klüger war, in seinem Versteck zu bleiben, gewann die Neugier die Oberhand. Vielleicht erkannte er die Kerle und konnte dieses Wissen später gewinnbringend nutzen. So leise wie möglich kroch er hinter dem Salzsack hervor und schlich in die Richtung, aus der die Geräusche kamen.
Je weiter er sich vom Gewürzlager entfernte, desto stärker wurde der Geruch nach eingesalzenem Fisch. Es dauerte nicht lange, bis Gallus eine lange Reihe von Fässern erreichte, in denen er Heringe vermutete. Sämtliche Fässer waren unversiegelt und warteten offenbar noch darauf, mit dem Stempel der Stadt versehen zu werden. Als Holz splitterte, zuckte er zusammen. Ein platschendes Geräusch folgte, dann schien jemand Nägel in einen Deckel zu schlagen, um ein Fass zu verschließen.
»Nichts wie weg hier!«
»Noch nicht. Die Zeichen!«
Etwas kratzte über Holz, ehe sich die Schritte der Männer entfernten.
Gallus wartete, bis wieder Ruhe eingekehrt war, und näherte sich vorsichtig der Stelle, an der sich die Männer an den Fässern zu schaffen gemacht hatten. Auf halbem Weg trat er auf etwas Weiches, das empört fauchte. Die Hand mit dem Messer zuckte nach vorn, während Gallus’ Herz beinahe einen Überschlag machte. Es fauchte erneut, dann stob etwas zwischen seinen Beinen hindurch und suchte das Weite.
Eine Katze! Gallus blies die Wangen auf und ließ die Luft durch die gespitzten Lippen entweichen. Die Hand mit dem Messer zitterte. Er schalt sich einen Narren. Es war nur eine Katze, nichts weiter, versuchte er, sich selbst zu beruhigen. Während sein Herz immer noch so heftig schlug, dass er es in seiner Halsgrube spüren konnte, schlich er auf Zehenspitzen weiter. Im schwachen Mondlicht sah er auf dem Boden etwas glitzern. Als er in die Hocke ging, um es zu betasten, stellte er fest, dass es sich um einen Hering handelte. Mit einem Stirnrunzeln hob er den Fisch auf und schnupperte daran. Er roch nach Salz, Zwiebeln und Essig und schien noch nicht lange auf dem Boden zu liegen.
Merkwürdig, dachte er. Wenn die Kerle im Lagerhaus eingebrochen waren, um etwas zu stehlen, warum hatten sie sich dann mit den Salzheringen zufriedengegeben? Er trat näher an die Fässer und sah, dass an einem von ihnen Flüssigkeit hinabrann. Außerdem war der Deckel des Fasses mit hastig hingekritzelten Kreidezeichen versehen. Gallus beugte sich tiefer, um besser sehen zu können. Als er die Zeichen erkannte, erschrak er bis ins Mark. »Was, bei allen Heiligen …?«, murmelte er und sah sich nach etwas um, mit dem er den Deckel öffnen konnte. Nicht weit entfernt lag eine Eisenstange auf dem Boden. Ohne zu zögern, hob Gallus sie auf und hebelte den Deckel auf.
Der Inhalt des Fasses ließ ihn ein entsetztes Keuchen ausstoßen. Die Eisenstange fiel polternd zu Boden.
»Heda! Was hast du hier zu suchen?«
Gallus fuhr zusammen.
»Gib dich zu erkennen! Wer bist du?« Ein Mann mit einer Laterne kam einen der schmalen Gänge entlang auf Gallus zu. Seine Hand wanderte zu dem Dolch an seinem Gürtel.
Die Erstarrung fiel von Gallus ab. Er machte auf dem Absatz kehrt und rannte wie von Furien gehetzt davon.
»Bleib hier, du Strauchdieb!«, rief ihm der Mann hinterher.
Aber Gallus dachte nicht daran. Er machte erst Halt, als er einen Schlag und einen kehligen Schrei vernahm. Das Geräusch eines zu Boden fallenden Körpers folgte, dann entfernten sich Schritte. Die darauf folgende Stille war unheimlich. Gallus spürte, wie sich die kleinen Härchen auf seinen Unterarmen aufrichteten. Obwohl es ihn zur Flucht drängte, machte er kehrt, um nachzusehen, was geschehen war. Schon von weitem sah er, dass der Mann, vor dem er davongerannt war, reglos am Boden lag. Seine Laterne war erloschen, der Deckel des Fasses, das Gallus geöffnet hatte, wieder an seinem Platz.
Der Mann gab ein Stöhnen von sich. Als er den Kopf hob und begann, auf Gallus zuzukriechen, ergriff der Spielmann die Flucht.
Kapitel 2
Ulm, April 1412
Die Luft an diesem sonnigen Apriltag war frisch und trug den Duft des blühenden Bärlauchs aus dem Garten der Beginensammlung heran. Auf den Dächern der Ställe und Scheunen schimpften die Spatzen, während der Schmied die Hufe der Zugtiere neu beschlug. Es roch nach Heu, frisch gebackenem Brot und den Blüten der Kirschbäume, die von Bienen umschwärmt wurden. Die um den rechteckigen Innenhof angeordneten Fachwerkgebäude erstrahlten in frisch getünchtem Weiß. Die Ehehalten, die Knechte und Mägde der Beginen, waren emsig bei der Arbeit, schöpften Wasser aus dem Zugbrunnen und misteten die Ställe aus. Außerdem kümmerten sie sich um die reisenden Frauen, die in der Herberge der Sammlung untergebracht waren. Aus der Ferne trug der Wind das Schlagen von Zimmermannshämmern heran.
Mit einem Seufzen reckte die siebzehnjährige Anna Ehinger ihr Gesicht der Sonne entgegen und lächelte selig, als der Wind ihre Wangen kühlte. Nach einem Morgen voller harter Arbeit war sie froh, der Hitze der Hostienbäckerei entkommen zu sein und wenigstens einen Augenblick lang den Frühling genießen zu können. Obwohl sie jeden Tag dankbar dafür war, eine der zwölf Schwestern zu sein, die in dem großen Anwesen in der Frauengasse lebten, wünschte sie sich an Tagen wie diesem, frei zu sein wie ein Vogel. Neidisch beobachtete sie das Spiel der Spatzen, die ausgelassen auf den Dachgiebeln herumhüpften.
Da die Meisterin der Sammlung zusammen mit der Kornmeisterin und der Kellerin am Vortag in das Dorf Ersingen aufgebrochen war, über das die Schwestern die Gerichtsbarkeit besaßen, trug Anna bis zu ihrer Rückkehr mehr Verantwortung als sonst. Zwar waren die Zinsmeisterin und die Schreiberin in Ulm geblieben, doch diese beiden Amtsschwestern verließen die Schreibstube und die Bibliothek nur selten. Die anderen Schwestern und Novizinnen hatten mit der Schulspeisung und dem Unterricht der Mädchen alle Hände voll zu tun, weshalb es Annas Aufgabe war, sich neben den Hostien auch um die Tränke und Arzneien für das Heilig-Geist-Spital zu kümmern. Sie war froh, dass die Fastenzeit vorüber war. Denn in den Wochen vor Ostern waren die Beginen verpflichtet, Tausende von kleinen und großen Oblaten an die Frauenpfarrei und das Predigerkloster zu liefern. Das Backwerk vom heutigen Tag würde – wie das der gesamten nächsten Woche – nach Italien verschifft werden.
Mit einem Seufzen strich sie sich das graue Gewand glatt, unter dem sie eine weiße Haube und ein Gebende trug, um ihre Keuschheit zu bezeugen. Zwar waren die Beginen nicht zu lebenslanger Ehelosigkeit verpflichtet, doch bisher hatte Anna nie den Wunsch verspürt, die Sammlung zu verlassen, um eine Familie zu gründen. Sie war zufrieden mit ihrem Leben und konnte sich nicht vorstellen, einen der hohlen Gecken zu heiraten, die in ihren schreiend bunten Gewändern durch die Stadt stolzierten. Sie wollte sich gerade auf den Weg in die Kräuterküche machen, als zwei etwa achtjährige Jungen aus einem der Ställe auf den Hof rannten und anfingen sich zu balgen.
»Lass das! Gib es wieder her!« Der Kleinere der beiden zog den anderen am Ärmel und versuchte, ihm etwas zu entwinden.
Ein Lächeln huschte über Annas Gesicht.
»Es gehört aber mir!«
»Stimmt nicht. Ich habe es gefunden!«
»Hast du nicht!«
»Doch!«
Der Größere schlug nach dem Kleinen, der sich heftig zur Wehr setzte.
Annas Lächeln verwandelte sich in ein Stirnrunzeln. Ohne zu zögern, eilte sie über den Hof auf die beiden Streithähne zu und packte den Größeren beim Kragen. »Was soll das?«, fragte sie. »Warum hast du ihn geschlagen?«
Die Bengel senkten die Köpfe und starrten beschämt auf ihre nackten Zehen.
Anna ließ das Hemd des Jungen los. »Ich habe dich etwas gefragt.« Es fiel ihr schwer, so streng zu sein, da die beiden sie an ihre jüngsten Brüder erinnerten, die sie schon viel zu lange nicht mehr gesehen hatte.
»Er hat mir mein Küken weggenommen«, beklagte sich der Kleinere und schob die Unterlippe vor. Es sah aus, als ob er gleich anfangen wollte zu heulen.
»Stimmt nicht«, widersprach der andere Bengel. »Und du bist eine Petze!«
Anna versetzte ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. »Zeig mir das Küken«, sagte sie.
Einen Augenblick lang sah der Junge trotzig auf den Boden. Dann streckte er ihr die Hand entgegen und öffnete widerwillig die Faust.
Ein zerzauster gelber Federball kam zum Vorschein.
»Es ist meins!« Der Kleinere wollte nach dem Küken greifen.
Aber Anna hielt ihn davon ab. »Bringt es zurück in den Stall«, befahl sie. »Ihr könnt froh sein, dass Schwester Agnes nicht hier ist.«
Bei der Erwähnung der Meisterin erbleichten die Bengel.
»Und jetzt geht wieder an die Arbeit. Das nächste Mal lasse ich euch nicht so glimpflich davonkommen.« Anna sah ihnen nach, als sie über den Hof stoben und wenig später in einem der Stallgebäude verschwanden. Sie benahmen sich nicht nur wie ihre jüngeren Geschwister, sie sahen ihnen auch ähnlich. Aber vermutlich ähnelten sich alle kleinen Jungen. Sie machte mit einem Kopfschütteln kehrt, schob die Gedanken an ihre Brüder beiseite und tauchte in die Schatten eines Arkadengangs ein. Kurz darauf betrat sie die Kräuterküche. Da der Raum nur zwei winzige Fenster besaß, war es angenehm kühl, obwohl unter der gemauerten Kochstelle ein kräftiges Feuer prasselte. Der Funkenhut über der Kochstelle war mit einem Schornstein verbunden, dennoch hing immer etwas Rauch in der Luft. Anna ging zu den Fenstern, um die Läden zu öffnen. Dann überlegte sie, womit sie anfangen sollte. Schlichte Regale, bis obenhin gefüllt mit Behältnissen aller Art, säumten zwei der Wände. Auf einem kleinen Tisch lagen etwa ein halbes Dutzend Bücher. Außerdem befanden sich zwei Zuber, Mörser, Kessel, Schüsseln und ein großer Hacktisch im Raum. Da Anna nicht alle Rezepte auswendig kannte, schlug sie eines der illustrierten Kräuterbücher auf und begann, die Zutaten für Betonienwein, Mutterkrautsuppe und Veilchencreme zusammenzusuchen.
Bei den Heilmitteln für Frauenkrankheiten war es wichtig, zwischen den Temperamenten zu unterscheiden, da Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker an einem charakteristischen Ungleichgewicht der Körpersäfte litten. Bei fehlender Blutreinigung konnten sich aus diesem Ungleichgewicht schwere Krankheiten entwickeln, zu denen der Brustkrebs, Hauterkrankungen oder Krampfadern zählten.
Laut der Schriften in der Bibliothek gehörten die molligen, schönen Frauen zu den Sanguinikern. Sie waren kinderlieb, fruchtbar und liebenswürdig, wohingegen die cholerischen Frauen meist stark, klug, gefürchtet und mit einer natürlichen Autorität ausgestattet waren. Wie die Meisterin. Anna selbst rechnete sich zu den Melancholikern, die ein schlankes und hochgewachsenes, dunkles und oft wankelmütiges Wesen auszeichnete. Die meisten anderen Schwestern schienen Phlegmatiker zu sein, ernst und tüchtig.
Während Anna Betonienkraut hackte und es mit Wein vermischte, dachte sie über all die anderen Theorien über Frauen und Empfängnis nach, die sie gelesen hatte. Wenn man den alten Abhandlungen Glauben schenkte, enthielt der männliche Samen einen Homunculus, einen winzigen Menschen, der in der Gebärmutter der Frau ausgebrütet wurde. Oft schon hatte Anna sich gefragt, warum dieser Homunculus nicht beim Mann ausgetragen wurde, dessen Leib für stärker, wärmer und vollkommener gehalten wurde als der der Frau. Sie erinnerte sich daran, gelesen zu haben, dass der weibliche Körper schwächer, feuchter und poröser war als der des Mannes. Der Grund für diese Schwachheit war offenbar, dass der weibliche Körper die Nahrung nicht bis zur letzten Stufe, dem Samen, sondern nur bis zur vorletzten Stufe, dem Menstruationsblut, verkochen konnte. Deshalb galten Frauen vielen Gelehrten als »verstümmelte Männchen«, wodurch ihre Unterlegenheit begründet wurde.
Während ihr diese Theorien durch den Kopf gingen, seihte sie die Flüssigkeit durch ein feines Sieb ab und stellte den fertigen Betonienwein zur Seite. Dann hackte sie getrocknete Mutterkrautblätter, übergoss sie mit kochendem Wasser und gab Butter, Dinkelgrieß und Salz hinzu. Schließlich holte sie einen Tiegel mit Olivenöl aus dem Regal und vermischte es mit Veilchenblättern und Ziegenfett zu einer Creme gegen Zysten in der Brust. Sobald die Arzneien abgekühlt waren, packte sie alles in einen großen Korb und versuchte, die in ihr aufsteigende Aufregung zu unterdrücken. Dennoch konnte sie nicht verhindern, dass ihre Gedanken zu Bruder Lazarus, dem neuen Siechenmeister des Heilig-Geist-Spitals, abschweiften. Zu ihrem Verdruss beschleunigte sich ihr Herzschlag, als sie die Kräuterküche verließ und auf das große Tor des Beginenhofes zusteuerte.
Kapitel 3
Ulm, April 1412
Wie jedes Mal, wenn sie die schützenden Mauern verließ, fühlte Anna sich einen Moment lang klein und verloren. Dazu trugen auch die abfälligen Blicke der Zisterziensermönche des gegenüberliegenden klösterlichen Pfleghofes bei. Wie die meisten in der Stadt ansässigen Brüder brachten die Zisterzienser den Beginen Misstrauen, wenn nicht gar Hass entgegen. Da auf dem Konzil von Vienne vor beinahe einhundert Jahren das Beginentum offiziell verboten worden war, galten Anna und ihre Mitschwestern vielen Geistlichen als Ketzerinnen. Obwohl sich die Sammlung den Barfüßermönchen angeschlossen und sich den Regeln des Ordens unterstellt hatte, wurden auch in Ulm immer öfter Rufe nach einer Schließung des Beginenhofes laut.
»Es ist eine Schande!«, hörte sie einen der Mönche zischen.
»Man sollte sie allesamt auf dem Scheiterhaufen verbrennen«, schnaubte ein anderer.
»Das sind Bräute des Teufels«, pflichtete ihm ein dritter bei.
Die Männer bekreuzigten sich und starrten Anna feindselig an.
Mit dem wohlbekannten Gefühl der Ohnmacht ignorierte sie die Verachtung der Mönche, drückte den Korb fester an ihre Hüfte und floh in Richtung Donau. Sie brauchte sich nicht zu fürchten! Ihr und den anderen Schwestern würde nichts zustoßen. Niemand würde es wagen, sie zu verhaften oder gar hinrichten zu lassen. Schließlich stammten sie alle aus angesehenen Patriziergeschlechtern. Sie war eine Ehinger! Ihr Großonkel Lutz Krafft hatte als Bürgermeister vor fünfunddreißig Jahren den Grundstein für den Bau der Münsterkirche gelegt. Gewiss würde der Rat sie und die Sammlung beschützen, sollte es je zu einer Anklage kommen. Da ihr die Gedanken Übelkeit bereiteten, hielt sie sich davon ab, sich auszumalen, was trotz ihrer mächtigen Familie passieren konnte. Mit heftig klopfendem Herzen eilte sie nach Süden die Frauengasse entlang und wandte sich beim Ochsenbergle nach Osten. Vorbei am Predigerkloster der Dominikaner begab sie sich zum Heilig-Geist-Spital, vor dem der Andrang an diesem Morgen groß war. Fuhrknechte, Mägde, Werkleute und Bedürftige warteten vor dem Haus des Torwächters, und Anna reihte sich in die Schlange ein.
Vor ihr stritten sich zwei Metzger darüber, wessen Fleisch billiger war.
»Ich wette, du verwurstest auch Hunde«, brummte einer, dessen haarige Arme speckig glänzten.
»Das sagt der Richtige«, schnaubte der andere. Seine Schürze war voller Blut, um das Fleisch auf seinem Karren kreisten Fliegen. Einige der Stücke schillerten grün im Sonnenlicht.
Anna war sicher, dass der Kellerer den Mann samt seiner Ware nach Hause schicken würde. Jedenfalls hoffte sie das, da sie fürchtete, sonst in den nächsten Tagen zahllose verdorbene Mägen behandeln zu müssen.
»Ich ziehe den Bedürftigen wenigstens nicht den letzten Pfennig aus der Tasche«, sagte der Mann mit den haarigen Armen.
»Dafür verkaufst du ihnen …«
»Zur Seite! Lasst uns durch!«, wurde er von einem lauten Ruf unterbrochen. Es kam Leben in die Wartenden. Von hinten drängten sich zwei Stadtwachen mit einem Ochsenkarren an der Schlange vorbei. Auf der Pritsche lag ein lebloser Mann. Sein Gesicht war blutverschmiert, die Haut wächsern wie die eines Toten.
»Geht zur Seite! Er braucht Hilfe!«
Augenblicklich drängte sich eine Handvoll Gaffer um den Karren.
»Macht Platz!«, befahl der Torwächter. Er trat aus dem Torhäuschen und winkte einen Knaben zu sich. »Sag dem Siechenmeister Bescheid«, befahl er dem Jungen. »Bringt ihn zur Dürftigenstube«, wandte er sich an die Männer mit dem Wagen.
Neugierig reckte auch Anna sich auf die Zehenspitzen, um den Verletzten besser sehen zu können. Doch der Karren hatte sich bereits in Bewegung gesetzt und verschwand kurz darauf in einem der beiden Höfe des Spitals. Während die Menschen um sie herum anfingen zu tuscheln, kaute Anna aufgeregt auf ihrer Unterlippe herum. Vielleicht durfte sie Lazarus dabei helfen, den Verletzten zu versorgen. Auch wenn sie dadurch das Missfallen der für die weiblichen Hilfskräfte zuständigen Meisterin auf sich ziehen würde.
»Vermutlich wieder so ein armer Tropf, der vom Gerüst der Münsterbaustelle gefallen ist«, ließ sich einer der Werkleute vernehmen. »Der Tracht nach muss es ein Zimmermann sein.«
»Wenn du mich fragst, hat ihm jemand den Schädel eingeschlagen«, widersprach ein Fuhrmann.
»Dich fragt aber keiner.«
Einige der Männer lachten.
»Das wäre der dritte Unfall in diesem Monat«, mischte sich ein weiterer Handwerker ein.
»Es ist ein Zeichen, das man kein Bauwerk errichten soll, das so hoch ist, dass es das Reich Gottes gefährdet«, meldete sich eine rundliche Frau zu Wort. »Dieser Turm wird nichts als Leid und Elend über die Stadt bringen, weil der Allmächtige uns für unseren Hochmut bestrafen wird!«
»Was geht es dich an, Weib?«, fragte der Handwerker.
»Gottes Zorn geht uns alle etwas an«, gab die Frau zurück und schlug ein Kreuz vor der Brust.
»Das war nicht Gottes Zorn. Der Kerl war vermutlich betrunken.«
»Woher willst du das wissen?«, fragte die Frau. »Glaubst du, Gottes Wege besser zu kennen …?«
»Ach, sei still, Weib!«
»Vielleicht ist ihm ein Dämon in den Arsch gekrochen und durch seinen Schädel wieder aus ihm gefahren«, lästerte ein anderer.
Die Frau schüttelte den Kopf und griff nach dem Kruzifix an ihrem Hals. »Ihr seid Narren. Verblendete Narren!«
Erneut lachten einige der Männer, andere hingegen blickten gescholten zu Boden.
Anna wusste nicht, was sie von dem Gerede halten sollte. Auch sie hatte davon gehört, dass der Bau des Münsterturms die Gemüter erhitzte. Einige Mitglieder des Rates fürchteten offenbar, dass Gott die Ulmer genauso für ihren Frevel bestrafen könnte wie die Babylonier. Andere hingegen waren der Ansicht, dass mit dem Bauwerk Gott besser gehuldigt wurde als irgendwo anders im Land. Auch die Beginen hatten sich schon öfter darüber unterhalten, da die Meisterin die Meinung der Mahner teilte.
Als sich die Schlange wieder in Bewegung setzte, verstummte der Streit, und wenig später betrat Anna den kleineren der beiden Spitalhöfe. Zu ihrer Rechten befanden sich Scheunen, Ställe und Fruchtkästen, zu ihrer Linken ragte die Spitalkirche in den blauen Himmel. Eine Bäckerei, mehrere Wirtschaftsgebäude und eine Schmiede schlossen an die Kirche an. Gegenüber dem Tor befand sich die Dürftigenstube, hinter der einer der Türme der Stadtbefestigung aufragte. Durch einen Bogengang neben der Kirche gelangte man in einen zweiten, größeren Hof. In dessen Mitte befand sich ein Ziehbrunnen, aus dem mehrere Mägde Wasser schöpften. Daneben waren die Fuhrwerke und größeren landwirtschaftlichen Geräte des Ordens abgestellt. Östlich der Kirche prangte das stattliche Haus des Spitalmeisters mit einer Kapelle. Den Abschluss des größeren Hofes bildeten die Häuser für die Pfründner, die alten Insassen des Spitals, eine Badestube und ein Speisesaal. Im Schatten der Stadtummauerung befanden sich ein kleiner Friedhof und ein Kräutergarten.
Wie immer herrschte reger Betrieb in den Höfen, da nicht nur zahlreiche Kranke und Bedürftige im Spital wohnten. Außer Lazarus, dem Siechenmeister, kümmerten sich Dutzende von Ordensbrüdern um die männlichen Kranken, wohingegen die weiblichen Insassen von der Meisterin, zwei im Spital wohnenden Schwestern und einer Milchmutter versorgt wurden. Das Geschrei von Neugeborenen vermischte sich mit dem Brüllen der Todkranken und dem Blöken der Ziegen und Schafe.
Aus dem einheitlichen Schwarz der Schwestern und Mönche stach ein bunt gekleideter Mann hervor, der sich mit dem Magister Hospitalis, dem Spitalmeister, vor dessen Haus unterhielt. Der Austausch wirkte selbst aus einiger Entfernung hitzig. Die ärgerlichen Stimmen der Männer wurden über den Hof getragen. In dem bunt Gekleideten erkannte Anna einen ihrer älteren Brüder, der als städtischer Pfleger im Dienst des Rates stand. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Vermögensverwaltung des Spitals zu überprüfen und den Hospitalmeister und dessen Zinseinnehmer zu beraten.
Sein Besuch schien beim Magister Hospitalis auf keine große Begeisterung zu stoßen. »Was soll das? Wie oft wollt Ihr unsere Bücher noch sehen?«
»Der Rat hat mich beauftragt …«
»Der Rat hat hier keine Befugnis!«, fauchte der Spitalmeister. »Ich habe mich an Rom gewandt. Bevor ich keine Antwort von der Leitung unseres Ordens habe, werde ich Euch überhaupt nichts mehr zeigen!«
»Warum macht Ihr es Euch schwerer als nötig?«, fragte Annas Bruder. »Ihr wisst, dass Ihr nur noch dem Namen nach ein Orden seid. Ihr werdet Euch daran gewöhnen müssen, dass Ihr in Zukunft dem Kaiser und nicht dem Papst untersteht.«
»Einen Teufel werde ich tun!« Der Spitalmeister bekreuzigte sich erschrocken.
Selbst aus der Ferne war zu erkennen, wie erregt er war. Immerhin standen Fluchen, Gotteslästern und schweres Zanken im Spital unter Strafe und konnten zu einem Ausschluss der Insassen führen. Sein Gesicht hatte beinahe dieselbe Farbe wie das Ordenszeichen auf seiner Kutte, ein rotes Kreuz auf blauem Grund.
Als er den Kopf wandte und Anna direkt ansah, ergriff sie hastig die Flucht. Sie hoffte, dass er nicht wusste, aus welcher Familie sie stammte, da sie sonst vermutlich seinen Zorn zu spüren bekam. Während ihr Bruder weiter auf den Magister Hospitalis einredete, umklammerte sie den Korb fester und eilte in Richtung Dürftigenstube. Kurz darauf betrat sie die lange Gewölbehalle.
Kapitel 4
Ulm, April 1412
Der Spielmann Gallus trat unschlüssig von einem Fuß auf den anderen. Seit Stunden wanderte er ziellos durch die Stadt und langte immer wieder, wie durch Zauberhand geführt, vor der Gräth an. Eigentlich hatte er am Morgen die Stadt verlassen wollen. Doch das, was er gesehen hatte, ließ ihn nicht mehr los. Das Entsetzen war ihm die ganze Nacht über im Nacken gesessen wie ein Gespenst. Als er nach langem Suchen endlich eine offen stehende Scheune gefunden hatte, in der er sich verkriechen konnte, war an Schlaf nicht zu denken gewesen. Immer wieder hatte er den Inhalt des Fasses vor sich gesehen und sich gewünscht, er wäre nie nach Ulm gekommen.
Inzwischen hatte man den Mann gefunden, allerdings schien dieser sich bis zu einer der Buden auf dem Marktplatz geschleppt zu haben. Dort war er blutüberströmt liegen geblieben und erst vor kurzem entdeckt worden.
Das Geschrei war groß, die Schaulustigen immer noch dicht gedrängt, obwohl der Verletzte inzwischen auf einen Karren geladen worden war. Gallus vermutete, dass man ihn in ein Spital brachte, doch die Kopfverletzung war so schwer, dass er gewiss bald versterben würde. Da konnten selbst die Pfaffen nichts mehr ausrichten. Jedenfalls hoffte Gallus das, da er fürchtete, der Mann könne jemandem von ihm erzählen.
Er sah sich verstohlen auf dem Marktplatz um.
Überall wimmelte es von Stadtwächtern, die jeden befragten, der nicht rechtzeitig das Weite suchte. Den Inhalt des Fasses in der Gräth schien man noch nicht entdeckt zu haben, da sich niemand um den Verkehr vor dem Waag- und Zollhaus kümmerte. Sicherlich nahmen die Wachen an, dass der Verletzte Opfer eines Strauchdiebes geworden war, auf offener Straße überfallen und halb erschlagen. Nur Gallus wusste es besser. Und je länger er im Schatten des Rathauses stand und das Gewimmel beobachtete, desto klarer reifte ein Entschluss in ihm. Es war ein gefährliches Spiel. Aber sofern er es richtig anstellte, konnte es lohnender sein als jede ehrliche Arbeit es je sein würde. Ein kaltes Lächeln huschte über sein Gesicht. Wenn er sich verriet, würde man ihn zweifelsohne festnehmen und in einen der Türme werfen. Doch das Risiko nahm er gerne auf sich. Denn falls sein Plan Früchte trug, würde er Ulm als reicher Mann verlassen.
Er blieb noch eine Weile, wo er war, während das Vorhaben in seinem Kopf weiter Gestalt annahm. Aufgrund der vielen Stadtwächter war es nicht ratsam, hier aufzuspielen. Deshalb kehrte er dem Marktplatz den Rücken und machte sich auf zur Münsterbaustelle, wo er auf viele Zuhörer hoffen konnte.
Als er den Holzmarkt hinter der Gräth erreichte, schlug die Glocke des Rathauses die volle Stunde. Wenig später gesellte sich die Glocke der Frauenkirche hinzu, des gewaltigen Münsters, auf das Gallus zusteuerte. Auch wenn er den Münsterplatz bereits mehrmals überquert hatte, erfüllte ihn der Anblick des riesigen Bauwerks auch heute mit Ehrfurcht. Das Geräusch von Metall auf Stein war weithin zu vernehmen. Der weiße Kalkstein des riesigen Kirchenbaus erstrahlte im grellen Sonnenlicht, das sich funkelnd in den Werkzeugen der Steinmetze fing. Überall hämmerten, klopften und zimmerten die Handwerker, während in schwindelerregender Höhe Mörtelträger ihre Lasten über Laufschrägen schleppten. Obgleich es nicht besonders stürmisch war, schwankten die hölzernen Stangengerüste im Wind. Gallus ließ den Blick über die Fassade der Kirche wandern, die zwar schon geweiht, aber längst nicht fertiggestellt war. Die Seitenschiffe standen erst bis zum neunten Joch unter Dach, das Mittelschiff war mit einem Notdach versehen. Das Nordostportal besaß bereits eine bunte Fensterverglasung, doch von dem ungeheuren Westturm waren erst das Erdgeschoss, die Vorhalle und das erste Obergeschoss abgeschlossen. Vor allem an diesem Teil der Kirche wurde gebaut, an einem großen Bogen zwischen Turmhalle und Mittelschiff mit einer Scheitelhöhe von etwas mehr als einhundertdreißig Fuß. Eine Zeit lang beobachtete Gallus gebannt, wie sich ein paar Handlanger mit einem Galgenkran abmühten, der von einem Laufrad angetrieben wurde. Schließlich suchte er sich einen Platz etwas abseits des Materiallagers und nahm die Sackpfeife von der Schulter. Nachdem er mit einer heiteren Melodie eine Schar Schaulustiger angelockt hatte, hob er zu dem Lied an, das er vor dem Rathaus gedichtet hatte.
»Es war in einer kalten Nacht,
der Wind war schneidend, das Mondlicht schwach,
als ein einsamer Wandersmann,
einen Platz für die Nacht zu suchen begann.
Er fand ein trutzig’ Haus, bewacht,
hat sich dennoch dorthin aufgemacht,
ein Tor, ein Loch, er schlüpft hinein,
wird wohl des Nachts verborgen sein.
Da hört er etwas, schwer und schlagend,
und er weiß nicht, kann er’s wagen?
Der Mut gewinnt, er schaut hervor,
und hört und lauscht und spitzt das Ohr.
Da fällt sein Blick auf finstere Gesellen,
die …, ja, was nur, wagen anzustellen,
Hört, ihr Leut’ gar schrecklich Kunde?
Bald ist es wohl in aller Munde.«
Er blies zum Abschluss der Weise in die Sackpfeife, hopste ein wenig von einem Fuß auf den anderen und zog schließlich die Kappe vom Kopf, um sie herumzureichen. Während er sich demütig für die Pfennige bedankte, beobachtete er die Gesichter der Zuhörer unauffällig. Alle lachten, keiner wirkte angespannt. Gallus versuchte, die Enttäuschung im Zaum zu halten. Vielleicht war es besser so, ein Wink des Schicksals, die Torheit sein zu lassen. Denn falls seine Worte die Richtigen erreichten, würde er auf der Hut sein müssen wie eine Jungfrau allein im Wald.
Kapitel 5
Ulm, April 1412
»Hol den Wundarzt!«, hörte Anna Bruder Lazarus beim Betreten der Dürftigenstube rufen. »Die Wunde fängt wieder an zu bluten.«
Der Knabe, dem er den Auftrag gegeben hatte, flitzte in Richtung Badestube davon, wo der Wundarzt für gewöhnlich zu finden war.
Während Lazarus zur Vorsicht mahnte, wurde der Verletzte von zwei weiteren Gehilfen auf eines der Betten in dem Teil der großen Halle gelegt, der für besonders pflegebedürftige Kranke vorgesehen war.
Die Säulen, die das Kreuzrippengewölbe stützten, unterteilten die Siechenstube in drei Bereiche: einen für Männer, einen für Frauen und einen für Schwerkranke. An der westlichen Stirnseite befanden sich ein Brunnen und eine Kanzel, von welcher der Kaplan zweimal in der Woche die Predigt für die Sterbenden las. Da das Stundengebet der Sext bald beginnen würde, herrschte reger Betrieb in der Stube. Mägde und Knechte halfen den Kranken beim Ankleiden, derweil diese sich, teils lautstark jammernd, beklagten. Manche humpelten auf Krücken zum Ausgang, andere wurden getragen, wieder andere wirkten auf Anna vollkommen gesund. Wer kräftig genug war zum Arbeiten, würde vom Spitalmeister im Anschluss an den Kirchgang zum Kehren, Holzhacken oder zur Gartenarbeit eingeteilt. Nur diejenigen, die zu krank oder zu schwach waren, durften in ihren Betten bleiben, die sie sich je zu zweit teilten.
»Vorsichtig!«, herrschte Lazarus die Gehilfen an. »Passt auf seinen Kopf auf!« Sobald der Kranke richtig gebettet war, scheuchte er die Gehilfen davon.
Während Anna sich auf den Weg zu den Frauen machte, die unter Brustkrebs litten, um ihnen mit der Veilchencreme und dem Betonienwein Linderung zu verschaffen, schielte sie verstohlen zu Lazarus.
Er war hochgewachsen, schlank und hatte ebenso schwarzes Haar wie sie. Wohingegen ihre Augen von einem durchdringenden Blau waren, blickten seine braun und sanft auf den Verletzten hinab. Anna wusste von den klatschsüchtigen Mägden, dass er vor drei Monaten direkt aus Rom gekommen war, wo er an einer Universität studiert hatte. An seinem Hals hing ein großes silbernes Kruzifix, in dem sich das Licht der durch die Bogenfenster hereinfallenden Sonne fing. Seine Hände waren schlank, mit langen Fingern, die geschickt und behutsam das Haar des Mannes zur Seite strichen.
Als er aufsah und sein Blick Annas traf, errötete sie heftig.
»Schwester Anna!«, begrüßte er sie freudig.
Sie spürte, wie sich die Röte vertiefte. Jedes Mal, wenn er sie ansah, fing es tief in ihr an zu brodeln wie in einem überhitzten Kessel. Ganz offensichtlich hatte er keine Ahnung, was für eine Wirkung sein strahlendes Lächeln auf sie hatte. Sie unterdrückte die plötzliche Unsicherheit und erwiderte den Gruß.
»Würdest du mir helfen, ihn beim Aderlass festzuhalten?«, bat Lazarus.
Anna sah sich suchend um. Doch die anderen Ordensbrüder schienen sich alle in Luft aufgelöst zu haben. Lediglich sie, Lazarus und zwei Siechenmägde waren noch in der Stube, die übrigen Insassen befanden sich auf dem Weg zur Kirche.
Sie nickte. Auf etwas unsicheren Beinen näherte sie sich dem Bett und stellte ihren Korb am Fußende ab. »Was ist ihm zugestoßen?«, fragte sie.
Lazarus zuckte die Achseln. Er zeigte auf die staubigen Kleider des vor ihm Liegenden. »Er scheint Zimmermann zu sein. Vermutlich ein Unfall.«
Anna runzelte die Stirn. »Warum haben ihn dann die Stadtwächter ins Spital gebracht?«
»Das ist eine gute Frage.« Lazarus schürzte die Lippen. Er beugte sich tief über den Besinnungslosen und tastete vorsichtig seine Glieder ab. »Es ist nichts gebrochen«, stellte er fest. »Das spricht gegen einen Sturz oder einen herabfallenden Balken.«
»Wo hat man ihn gefunden?«, wollte Anna wissen.
Lazarus richtete sich wieder auf. »Danach habe ich die Wachen nicht gefragt.«
»Soll ich ihm eine Schafgarbenkompresse machen?«, fragte Anna. Das Spital verfügte über eine eigene Kräuterküche, in der sich die gängigsten Zutaten finden ließen.
»Das ist gewiss …«, hob Lazarus an.
»… kein guter Einfall, ehe ich ihn nicht behandelt habe«, wurde er vom Wundarzt unterbrochen, der in diesem Moment zu ihnen trat. Er war ein vierschrötiger Mann mit einem Gesicht wie von einem schlechten Steinmetz gehauen. Seine Augen waren durchdringend, der Mund hart und schmallippig.
Anna fürchtete sich ein wenig vor ihm, da er ohne Mitleid schnitt, brannte und stach. Seine Heilmittel waren Pflaster, Brenneisen und Buße. Das Brennen wandte er bei solch unterschiedlichen Erkrankungen an wie Kopfschmerzen, Leber-, Milz- oder Magenbeschwerden, Fisteln am Darm und Hämorrhoiden. Außerdem schwor er bei der Nachbehandlung von Bruch- oder Zahnoperationen darauf. Meist konnte man seine Anwesenheit in der Stube schon von weitem am Brüllen der Behandelten hören. Er stellte seine Tasche auf einem Schemel ab und zog ein großes, gebogenes Messer hervor. Damit schor er dem Verletzten den Kopf und betrachtete die Wunde. »Das war kein Unfall«, sagte er schließlich. »Diesem Mann wollte jemand den Schädel einschlagen.« Ohne auf eine Antwort von Lazarus zu warten, steckte er ein Brenneisen in die Glut eines der Kohlebecken. Während er darauf wartete, dass es heiß wurde, bedeutete er Anna und Lazarus, den Mann festzuhalten. Dann machte er mit dem Messer einen langen Schnitt in der Armbeuge des Kranken, um ihn zur Ader zu lassen. Als das Eisen rot glühte, zog er es aus dem Becken und drückte es auf die Kopfwunde.
Das Zischen ging Anna durch Mark und Bein. Augenblicklich stank es nach verbranntem Fleisch, doch der Verwundete gab lediglich ein schwaches Stöhnen von sich.