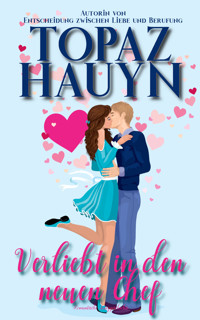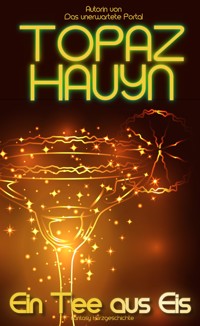8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau atmet die kalte Morgenluft tief ein. Noch hängt Nebel zwischen den Hainbuchen und Tannen rechts und links des erdigen Waldweges. Sie schwitzt vom Joggen. Sie liebt den Wald am Morgen. Unsichtbare Hände entführen die junge Frau. In die Welt der Elfen. Als Braut für den Wiesenprinzen. Oder den Steinelfenprinzen. Der Prinz des Wassers flirtet hemmungslos mit ihr. Welchen Prinzen soll sie wählen? Welchen Prinzen soll sie wählen? Wo doch alle fantastisch aussehen? Und wie kann sie jemals in ihre Heimat, die Menschenwelt zurückkehren? Ein romantischer, fantastische Reverse Harem Roman. Die große Liebe und der Kampf um die Heimat der Elfen. Können sie beides zugleich bekommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Die Braut der Elfenprinzen
Die Braut der Elfenprinzen
Die Braut der ElfenprinzenEntführtPalast der WaldelfenWaldlichtungEingesperrtHochzeitsverträgeBei den SteinelfenEine fremde WeltMercuras IdeeXervols WerbungSamico flirtetZurück im WaldLif hilftHochzeitWachsende GefühleVerhörMachtübernahmeGemeinsames GlückLeseprobe: Einhornbraut des DrachenWeitere BücherFantasyRomanceScience FictionSpannung / KrimiGegenwartImpressumDie Braut der Elfenprinzen
Mercura atmete die kalte Morgenluft tief ein und durch ihren leicht geöffneten Mund wieder aus.
Obwohl noch Nebel zwischen den Hainbuchen und Tannen rechts und links des erdigen Waldweges schwebte, war ihr heiß.
Sie rannte seit einer halben Stunde ihre übliche Morgenrunde durch den Wald. Ihr Dauerlauftraining um in Form zu bleiben. Außerdem wollte sie den Dauerlauf in ein paar Wochen wirklich gerne gewinnen. Letztes Jahr hatte sie nur knapp den ersten Platz verfehlt.
Mercura atmete die Morgenluft ein und genoss den Geruch von nasser Baumrinde, die vor sich hin moderte. Denn zwischen den hohen Bäumen lagen immer wieder umgestürzte Bäume, oder abgesägte Baumstümpfe.
Die Förster hier hielten es damit, der Natur ihren Lauf zu lassen und nur einzelne Bäume zu fällen, um die Kosten für die Waldpflege zu decken. Ansonsten wurden Bäume nur entfernt, um die Wege freizuhalten und für die Sicherheit der Waldbesucher zu sorgen. Manchmal fragte Mercura sich, ob dieses Verhalten, das, wie sie wusste, eher selten war, zu der besonderen Atmosphäre dieses Waldes geführt hatte.
Wenn sie, wie jetzt, durch den nebligen Morgen rannte, dann hatte sie oft das Gefühl, beobachtet zu werden.
Wie immer tat sie das Gefühl als Einbildung ab. Wer sollte sie hier beobachten?
Im Morgengrauen war außer ihr niemand unterwegs. Und die Waldtiere, die waren längst verschwunden, schließlich hörte man sie schon von Weitem keuchen und auftreten.
Sie bemühte sich auch gar nicht leise zu sein. Im Gegenteil. Sie genoss es, ungehemmt keuchen zu können und so zu rennen, dass sie sich wohlfühlte.
In einem Fitnessstudio dagegen bemühte sie sich immer darum, leise zu atmen, keine Geräusche zu machen und möglichst nicht aufzufallen. Als Frau tat man das einfach. Schließlich waren Männer anwesend die einen beobachteten. Wer wusste schon, was die über eine Frau denken würde, die schwitzte? Wirklich schwitzte.
Im Unterholz raschelte es.
Ohne langsamer zu werden, schaute Mercura zur Seite.
Sie sah Brennnesseln, die ihr bis an die Knie reichten. Dahinter und dazwischen wucherten Brombeerranken, die mit braunen, welken Blättern vom Vorjahr und mit neuen grünen Blättern von diesem Jahr bewachsen waren. Die Baumstämme glitten an ihrem Blick vorbei wie Zaunstreben: Braun, gerade, nebeneinander stehend.
Nichts bewegte sich.
Vermutlich hat der Wind durch die Äste am Boden geraschelt, überlegte Mercura.
Bevor sie ihre schwarze Sporthose mit den pinken Streifen an den Seiten und ihre grüne Jacke mit der Rückentasche über ihr weißes T-Shirt gezogen hatte, hatte sie gefrühstückt.
Das halbe Brötchen mit Hummus und das Glas Sojamilch mit Vanille waren lecker, hielten aber nicht lange vor. Sie spürte bereits, wie sie wieder hungrig wurde.
Vor Mercura tauchte die Kreuzung auf, an der sie immer links abbog, um im Bogen zurück zur Stadt zu rennen.
Zum Glück wohnte sie am Stadtrand und war damit schnell auf dem Feld und im dahinter liegenden Wald zum Rennen.
Ein bisschen bedauerte sie die Menschen, die tiefer in der Stadt wohnten, und nicht so schnell in der Natur draußen sein konnten. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie man auf Dauer ohne die angenehme, frische Waldluft leben und sich wohlfühlen konnte.
Wenn sie einmal krank war, was zum Glück selten vorkam, dann vermisste sie den Wald und die frische Luft schon nach einem Tag. Jedes Mal war es für Mercura wie ein Fest, wenn sie, wieder gesund, zurück zu den Bäumen konnte.
Dabei machte sie sich noch nicht einmal viel daraus. Gerade, dass sie die Hainbuche von der Buche und der Tanne unterscheiden konnte. Oder die Brennnessel und die Brombeere. Aber das Wissen um die vielen kleinen Kräuter oder auch um die Pilze, dass ihre Mutter hatte, das hatte sie nie erreicht.
Mercuras Gesicht war nass vom Schweiß. Sie wischte ihn mit ihrem Handrücken zur Seite. Ihre Kleider fühlten sich kühl an, aber nicht nass. Funktionskleidung mit seinen tollen Eigenschaften um Feuchtigkeit ableiten sei Dank. Wenn ihre Mutter das sehen würde, sie würde die Hose, das T-Shirt und die Jacke umgehend vernichten. Wenn es nach Mercuras Mutter ging, dann durften nur Naturfasern in die Kleidung und in die Wohnung.
Traurig dachte Mercura an ihre Mutter, die seit einem Jahr spurlos verschwunden war.
Obwohl sie beide sich regelmäßig wegen Mercuras Kleidung und Lebensstil aneinander rieben, so hatte sie ihre Mutter doch gerne. Nicht zu wissen, wo sie war, oder ob es ihr gut ging, das schmerzte sie.
Mercura nahm sich vor, auf dem Weg zur Arbeit nochmals auf dem Polizeirevier vorbeizugehen. Vielleicht, redete sie sich ein, hatte sich doch endlich ein Hinweis darauf gefunden, wo ihre Mutter war.
Die Kreuzung vor ihr sah anders aus heute Morgen. Die Wege, die sonst nebelverhangen und ruhig dalagen, waren heute verändert.
Tiefe Radspuren gruben sich in die braune Erde und hatten die Blätter in die Erde gedrückt, Zweige zerbrochen und waren teilweise mit Wasser vollgelaufen.
Die doppelten, breiten Radspuren waren nicht von den Förstern. Diese benutzten leichte Fahrzeuge, ohne Zwillingsreifen, wusste Mercura. Sie hatte die Förster oft gesehen in den 22 Jahren, die sie hier lebte.
Den alten Förster Michael Waldmann duzte sie sogar, seit er sie als Kind einmal am späten Abend im Wald aufgesammelt und nach Hause gebracht hatte.
Seitdem begegnete sie ihm mindestens einmal die Woche. Und wenn sie ihn nicht traf, dann stellte sie ihm kleine, selbstgebackene Kuchen in einer Dose auf seinen Hochsitz, von dem aus er die Tiere beobachtete. Noch etwas, was Mercura sich für heute vornahm: Neue Kuchen für Michael backen, damit sie ihm diese morgen mitbringen konnte. In Gedanken an die Gedichte, die Michael ihr zum Dank in ihre Dosen legte, begann sie zu lächeln. Dann lenkte sie ihren Blick wieder auf die Radspuren vor ihr. Das war niemand aus der Nähe gewesen, der hier gefahren war. Besser sie machte ein Foto, dann konnte sie es nachher der Polizei zeigen, wenn sie sowieso dort war. Und anschließend Michael per Mail schicken.
Mercura tastete über die glatten Kunstfasern nach dem Reißverschluss am Rücken ihrer grünen Laufjacke. Dort hatte sie ihr Smartphone verstaut.
Der runde Zipper des Reißverschlusses hatte sich wieder in einer Falte versteckt.
Mercura brauchte einen Moment um die Tasche zu öffnen, dann hielt sie ihr Smartphone in der Hand.
Sie schaute nach links und rechts. Nichts zu sehen.
Die frühen Vögel zwitscherten in den Baumwipfeln über ihr. Es hörte sich normal an.
Sie öffnete die Foto-App und fotografierte die Kreuzung in einer Gesamtaufnahme und die Radspuren im Detail.
Woher das Wasser in den Spuren kam, konnte Mercura sich nicht erklären. Letzte Nacht hatte es nicht geregnet.
An den Sohlen ihrer Turnschuhe klebten ein paar Erdklumpen und kleine Blätter, die feucht waren vom nächtlichen Tau. Aber wenn es geregnet hätte, dann wäre der Waldweg matschig und sie hätte inzwischen große Erdklumpen an ihren Schuhen hängen, die das Rennen unmöglich machen würden. Von ihrer verschmutzten Kleidung durch das Ausrutschen auf dem nassen Boden gar nicht zu reden.
Waren die Spuren womöglich schon ein paar Tage alt?
Aber warum hatte sie diese Spuren dann nicht bereits gestern gesehen?
Mercura verstaute ihr Smartphone und ging an der Kreuzung links, um ihrer üblichen Runde zu folgen.
Nach wenigen Schritten, bevor sie wieder in ihrer Renngeschwindigkeit angekommen war, stoppte sie erneut. Hinter dem dicken Eichenstamm, an dem sie gerade vorbeirannte, bogen die Radspuren ins Unterholz ab.
Mercura stoppte, stolperte und konnte nicht glauben, was sie sah. Dort, am Ende der Spuren lagen blaue Fässer wild durcheinander. Auf ihnen waren leuchtende, dreieckige Schilder in Gelb angebracht. In der Mitte der Dreiecke war das Bild für giftige Chemikalien: Ein Totenkopfschädel.
Mercura schluckte.
Jetzt war ihr kalt.
Die Radspuren führten nur hin, nicht zurück.
Hatte sich das Fahrzeug nach dem Abladen des Giftmülls in Luft aufgelöst?
Zitternd drehte Mercura sich im Kreis. Immer noch nichts Ungewöhnliches zu sehen, abgesehen von der giftigen Müllhalde, die vermutlich den ganzen Wald zerstören konnte.
Sie griff nach dem Reißverschlusszipper und holte ihr Smartphone aus der Rückentasche ihrer gelben Jacke. Beinahe hätte sie es fallen lassen, als ein Zweig knackte.
Erschrocken drehte Mercura sich um. Nichts bewegte sich.
Hatten die Vögel aufgehört zu singen, oder hörte sie das Zwitschern nur nicht mehr, weil ihr das Blut so laut in den Ohren rauschte?
Laut hörte sie ihr Herz pochen.
Mit dem Telefon in der Hand ging Mercura einen weiteren Schritt rückwärts, um einen guten Abstand zu haben, aus dem heraus sie alle Fässer auf das Foto bekam. Mitten im nächsten Schritt stieß sie gegen ein hartes Hindernis. Sie riss den Kopf herum und sah Leere hinter sich.
Mercura stand zwischen zwei Bäumen.
Da war nichts wogegen sie gestoßen sein konnte. Warum fühlte es sich dann an ihrem Rücken so angenehm kuschelig und warm an? Hatte sie Halluzinationen? Dann spürte sie, wie ihr Oberkörner umschlungen wurde und auch um ihren Bauch legte sich ein Band. Es fühlte sich an wie Arme, die sie von hinten umarmten und dann hochhoben und nach rückwärts in den Wald trugen. Eine Leistung bei ihrer Größe von einem Meter achtzig.
Sprachlos vor Erstaunen und Verwunderung, ließ Mercura es geschehen, ohne sich zu wehren. Sehen konnte sie die Arme nicht, die sie an einen Mann pressten und davon trugen. Als ein Baum in ihr Blickfeld gelangte und sie die Fässer und den Waldweg nicht mehr sehen konnte, kam Mercura zurück in die Wirklichkeit. Wer immer sie wegtrug, sie musste zusehen, dass sie frei kam.
Nur wie?
Sie versuchte sich zu winden und ihren unsichtbaren Träger zu treten, doch erfolglos. Sollte sie um Hilfe rufen? Vielleicht die Giftpanscher und Umweltverschmutzer dabei anlocken und sich noch mehr in Lebensgefahr bringen?
Die Chancen einen Spaziergänger herbeizurufen waren gleich null. Noch nie war ihr auf diesem Waldweg jemand begegnet. Es schien, als ob selbst Hundebesitzer, die sonst überall anzutreffen waren, diesen Weg mieden. Bisher hatte Mercura das nicht gestört, vielmehr, es wahr ihr nie so bewusst geworden, bis jetzt.
Mehrmals atmete Mercura tief ein und aus und versuchte sich zu beruhigen. Der trockene Duft von Erde stieg ihr in die Nase. Das war unerwartet, denn der Boden war vom Herbstregen feucht und dunstig. Vielleicht konnte sie mit einem tiefen Atemzug die Arme weit genug lockern, um dann schnell auszuatmen und durchzuschlüpfen? Sie versuchte es, holte Luft so tief sie konnte und wurde von den Armen fester gedrückt als zuvor, sodass sie pfeifend, unfreiwillig ausatmete.
»Lass das«, sagte eine leise Stimme an Mercuras Ohr und die Lippen kitzelten über den Rand ihrer Ohrmuschel.
»Lass los!«, forderte Mercura.
Sie trat erneut mit einem Fuß nach hinten, in der Hoffnung nun besser zu treffen, wo er angefangen hatte sich selbst mit Worten abzulenken.
»Du kannst mich nicht treffen.«
Es klang, wie das Glucksen eines wilden Waldbaches, der über Steine und herabgefallene Äste sprudelte, doch gleichzeitig belustigt und amüsiert an ihrem Ohr.
»Komm, ich bringe dich weg, ehe die Männer und Frauen dich sehen, die diese Verschmutzung angerichtet haben«, versprach das Gluckern an ihrer Ohrmuschel.
Da er Mercura weiter festhielt, konnte sie nichts anderes tun, als zuzusehen, wie der Wald dichter und dunkler wurde und die hellen Flecken an denen Licht durch die fast kahlen Herbstkronen fiel, im Tannen- und Fichtendickicht weniger wurden, bis sie schließlich ganz im Dunkel stand.
»Wohin, bringst du mich?«, brachte Mercura ihre Gedanken zum Wesentlichen zurück.
Darüber zu träumen wie warm die Stimme klang, oder wie geborgen sie sich in diesen fremden Armen fühlte, war ein gefährlicher Abweg, den sie nicht weiter verfolgen durfte. Heute Morgen stand eine wichtige Präsentation im Büro an und heute Abend wollte sie sich mit Daniel treffen. Zum Abendessen.
Hoffentlich endlich eine erfolgreiche Verabredung. Bisher war noch jeder Kandidat irgendwann während des Essens aufgestanden und hatte sich unter einer fadenscheinigen Entschuldigung fort geschlichen. Träume an einen unsichtbaren Entführer passten zwar zum Blind Date Charakter, den sie für ihre Abendessen nutzte, aber sie wollte ihre kostbare Zeit nicht verschwenden. Sie musste hier weg, so schnell wie möglich.
»Ich will nirgendwo hin. Lass mich los«, verlangte Mercura mit leiser Stimme, als ihr Entführer ihre letzte Frage immer noch nicht beantwortet hatte.
Sie versuchte sich mit ihren Füßen am nächststehenden Baum einzuhaken und loszureißen aus dem Griff.
»Heute herrsche ich über den Wald. In deiner Welt heißt der Tag Tag-und-Nachtgleiche. Du kannst mir nicht entkommen. Ich beherrsche die Pflanzen«, gluckste es belustigt an Mercuras Ohr.
Ihre Haut kribbelte zu einer Gänsehaut, als sie sah, wie sich der Baum wegbog und ihre verhakten Füße freigab. Sie starrte blinzelnd auf die Stelle, an der der Baum jetzt stand.
Bäume konnten sich nicht verbiegen!
»Das Verschmutzen mit Gift wird bestraft werden. Du solltest dann weit weg davon sein, Prinzessin«, sagte er, in ruhigem Säuseln.
So, als ob er ein Kind beruhigen wollte und diese Erklärung auch nur irgendetwas klären würde, dachte Mercura.
Mercura schnaubte.
»Ich bin Samico«, stellte sich der Mann schließlich vor.
War er überhaupt ein Mann, fragte sich Mercura? Sie war sich nicht sicher. Er war kräftig genug, sie mit ihren einsachtzig und achtzig Kilogramm einfach davon zu tragen, offensichtlich ohne zu ermüden, aber seine Stimme klang so hell. Beinahe erinnerte diese Stimme sie an die abendlichen Märchen, die ihre Mutter ihr früher immer erzählt hatte. So hatte sie geklungen, wenn sie ihre Märchen von der Elfenwelt erzählt hatte. Fröhlich, verspielt, glucksend, wie ein singendes Lied klang ihre Stimme dann immer. Mercuras Herz zog sich zusammen. Nie wieder würde ihre Mutter ihr Märchen erzählen können.
»Zeig dich endlich, Samico«, forderte Mercura ungeduldig.
Sie mochte keine Geister, keine Magie und keine Geheimnisse. Ihre Mutter hatte ihr zu viele Schauermärchen erzählt, in der Magie ein Machtmittel gewesen war. Viel lieber hätte sie Prinzessinnengeschichten gehört, wie ihre Klassenkameradinnen.
Moment.
Magie?
Was hatte Samico gesagt? Tag-und-Nachtgleiche?
Ein eisiger Klumpen formte sich in Mercuras Magen und breitete sich aus, bis sie sich bis in die Fingerspitzen ganz kalt und verfroren fühlte. Hatte ihre Mutter vielleicht doch keine Märchen erzählt? Wurde sie gerade von einem Elfen entführt in die Elfenwelt?
Mit neuer Energie versuchte Mercura sich zu befreien.
»Lass los! Du Elfe, Geist oder was du sonst bist. Lass mich los!«, brüllte Mercura, sicher, dass selbst die Umweltverschmutzer eine bessere Wahl waren als die Elfenwelt.
Sie trat um sich und versuchte den Arm, der ihre Arme festhielt zu beißen.
Bei dem Versuch fiel ihr Smartphone zu Boden und der Aufprall schaltete das Display ein. Ein gespenstisches Leuchten in der Dunkelheit, das kurz darauf erlosch.
»Ich will nicht mit in dein Reich. Lass mich gehen!« Mercura kämpfte gegen ihren unsichtbaren Gegner. »Und zeig dich endlich zu Feigling!«
Glucksendes Lachen schüttelte den Körper, an den ihr Rücken gepresst wurde, bevor sie wieder seine Lippen an ihrer Ohrmuschel spürte:
»Du bist klug, Tochter der S-o-l-r-e-n, aber du wirst mich begleiten. Du wirst an dieser Straße vorbeigehen«, versprach Samico, ohne auf den Vorwurf Elfe einzugehen.
Das verschlimmerte Mercuras Angst noch weiter. Was wartete auf der anderen Seite auf sie? Und woher wusste dieser Elf den geheimen Namen ihrer Mutter? Warum buchstabierte er ihn ihr? Zum Glück schien er ihren Namen noch nicht zu kennen. Aber warum nannte er sie dann Prinzessin?
Fragen und Gedanken jagten durch Mercuras Kopf. Immer hatte sie die Märchen ihrer Mutter für Märchen gehalten und die Verbote den Wald zu betreten, besonders an den hohen Feiertagen im Jahr, als Anlass genommen, genau dann im Wald spazieren zu gehen. Sie hatte beweisen wollen, dass es nur Märchen waren.
Wem eigentlich?, fragte sie sich nun.
Nie war etwas passiert. Bis heute. Mercura hatte immer gelacht, hatte ihre Mutter ausgelacht, wenn sie wieder eine lange Rede anfing, warum es gefährlich war in den Wald zu gehen. Selbst vor zwei Jahren, als ihre Mutter spurlos verschwand und ein Nachbar meinte sie wäre endlich zurück in den Wald verschwunden, hatte Mercura gelacht.
Moment.
Vor zwei Jahren?
War es nicht auch die Herbst-Tag-und-Nachtgleiche gewesen, als ihre Mutter verschwand? Der Polizeibeamte hatte noch süffisant kommentiert, dass Paare die Nacht gerne für sich nutzten, als Mercura ihre Mutter am nächsten Morgen vermisst gemeldet hatte. Die Suche lief noch immer, weil Mercura regelmäßig nach dem Stand der Dinge fragte. Die Beamten versicherten ihr jedes Mal, dass sie alles versuchten, allen Spuren folgten.
Also nichts taten, mangels Spuren, dachte Mercura ironisch. Außerdem hatte sie die Akte mit den Verschwindenssfällen ihrer Mutter bereits mehrfach vorgelegt bekommen. Oft war sie verschwunden und drei bis sechs Monate später wieder aufgetaucht, in guter Verfassung, ohne Erklärung. Warum sollte es dieses Mal anders sein, hatten die Beamten mehrfach zu bedenken gegeben. Allerdings war das letzte Mal inzwischen zwei Jahre her und drei Monate vor ihrer Mutter war Mercuras Vater ebenfalls verschwunden, was die Beamten mit einer Freundin wegerklärt hatten und die Akte im Archiv liegen ließen.
War ihre Mutter entführt worden, so wie selbst von Samico entführt wurde, fragte Mercura sich. War es schlau, den Elf danach zu fragen? Was wartete im Elfenreich, vor dem ihre Mutter sie immer gewarnt hatte. Konzentriert durchforstete Mercura ihre Erinnerungen, aber sie fand nichts. Sie hatte den Geschichten zu wenig zugehört und jede Möglichkeit ihnen auszuweichen oder sie abzubrechen ergriffen.
Weitere Bäume glitten wie dunkle Schatten an ihr vorbei, während Samico sie weitertrug.
War ihr Vater ebenfalls in der Elfenwelt? Nach all den Märchenbruchstücken, an die sie sich erinnern konnte, war es für sie nicht vorstellbar, dass ihre Eltern freiwillig gegangen waren. Sicher wurden sie genauso gewaltsam entführt wie sie selbst. Würden die Elfen nun alle Menschen entführen?
Mercura schüttelte den Kopf, nein, sagte sie sich selbst, vermutlich nicht. Ihre Freunde, erinnerte sie sich, hatten keine geheimen Namen, nur sie und ihre Eltern.
»Ich spüre, du beginnst zu verstehen, Prinzessin. Das ist wichtig, denn du musst deine Aufgabe erfolgreich erfüllen«, plätscherte Samicos Stimme an ihrem Ohr.
»Erinnerst du dich an die Geschichte mit den Portalen? Nur Paare die echte Liebe verbindet können sie erneut durchqueren.«
Er küsste sie auf die Haare und Mercura fühlte sich noch unwohler.
Sie mochte seine Stimme und seine Berührung an ihrem Ohr bereits viel zu sehr.
Das Blind Date heute Abend würde sie vermutlich nicht wahrnehmen können. So würde es nichts werden mit der Liebe. Und wie es schien, war das auch ihr einziger Weg zurück.
Eigentlich könnte sie jetzt ohnmächtig werden. Schließlich war ihre Lage verzweifelt. Sie wurde entführt, ohne Weg zurück und außerdem fand ihr Entführer es auch noch lustig. Als wäre es ein Spaß.
»Liebst du einen Menschen genug und echt um zurückkehren zu können?«
Kalte Angst kroch über Mercuras Arme und Nacken. Es musste einen anderen Weg zurück geben. Wer würde einen Entführer wie diesen in der Menschenwelt lieben, damit er andere entführen konnte?
Mercura versuchte nochmals sich zu befreien und trat nach hinten, in der Hoffnung ein Schienbein zu erwischen.
Sie trat daneben.
Lachend trug Samico sie weiter, ging schneller und sprang ins Dunkel.
Mercura spürte wie ihre braunen Haare um sie herumflatterten und über ihr Gesicht strichen.
Entführt
»Liebst du einen Menschen genug und echt, um zurückkehren zu können?« Mercura dachte noch immer über Samicos Frage nach. Die Geschichte mit den Portalen? An die erinnerte sie sich nicht. Sollte sie ihm das wirklich glauben? Entführer waren nicht vertrauenswürdig. Sie würde selbst herausfinden müssen, ob es stimmte.
Sie sah sich um.
Die Bäume hier, die langsam aus dem Dunkel sichtbar wurden, sahen unbekannt aus. Anders. Das war nicht mehr der Wald, in dem sie gerade eben noch gewesen war. Diese Bäume waren größer, verwachsener. Ein richtiger, verwunschener Märchenwald, wie er in ihren Kinderbüchern immer gezeichnet gewesen war. Es wuchsen hier und da kleine Büsche und Sträucher und tote Bäume lagen übereinander in allen Richtungen auf dem Boden. Dort wo Sonnenstrahlen durch die Kronen drangen und das Dunkel vertrieben erkannte Mercura Brombeeren und Himbeeren, rote, weiße und schwarze Johannisbeeren. Hungrig knurrte ihr Magen. Aber die Beeren waren unerreichbar weit weg, denn noch immer hielt Samico sie fest.
»Deine Antwort, Mercura«, erinnerte Samico sie und das glucksende, helle Geräusch wurde durch ein dunkles, stürmisches Meer bei Nacht abgelöst.
Schauer liefen Mercura über den Rücken und sie fragte sich, ob sie nun für immer seine Gefangene sein würde. Es würde ihr nichts ausmachen, seine Stimme ist so schön, dachte sie flüchtig und schob den Gedanken schnell beiseite.
Was war die Frage gewesen? Ob sie jemanden genug liebte, um zurückkehren zu können? Was ging das diesen Rüpel an?
»Die geht dich nichts an. Bring mich zu meiner Mutter«, sagte Mercura. Ein Bluff, in der Hoffnung, mehr zu erfahren.
Die Wahrscheinlichkeit Solren hier zu finden erschien ihr inzwischen sehr hoch.
»Zuerst wirst du dich angemessen kleiden, Tochter von Solren. Deine«, Samico machte eine Pause, als müsste er nachdenken, »… Sporthose und Jacke.« Noch eine Pause. »Sie sind unangemessen.«
Hätte Mercura gekonnt, wie sie wollte, sie hätte ihm eine Ohrfeige verpasst. Über ihre Kleidung hatte auch ihre Mutter immer genörgelt und verlangt, dass sie Röcke, oder besser Kleider trug, die fließend wie springendes Wasser um ihren Körper fielen.
Zu weit und zu unpraktisch war Mercura Meinung.
Das galt auch für diesen Wald: Unpraktisch.
Sie brach in lautes Gelächter aus, dass von den Bäumen zurückgeworfen wurde.
Würde sie nicht lachen, würde sie durchdrehen, dessen war sie sich sicher.
»Nein. Bring mich zu ihr. Und zeig dich endlich. Oder hast du Angst, dich zu zeigen?«, versuchte Mercura es erneut mit einer Provokation.
Samico ging nicht drauf ein, stellte sie auf den Boden und ließ sie los. Mercura schwankte erst einmal und musste ihr Gleichgewicht finden. Neugierig drehe sie sich um.
Da war niemand.
Sie stand allein mitten in einem fremden Wald.
Würde sie weiter kommen, wenn sie sich auf ihren geheimen Namen Serisa berief?
Eigentlich war es eine schlechte Idee. Wer den geheimen Namen eines anderen kannte, der konnte ihn zu sich rufen, sagte ihre Mutter immer.
Ja, Mercura war immer sofort gekommen, wenn ihre Mutter sie Serisa gerufen hatte, doch dann hatte sie etwas angestellt und ihre Mutter war ärgerlich.
Als Solren verschwand, hatte Mercura es selbst versucht und sie gerufen, gerufen bei ihrem echten Namen. Aber ohne Ergebnis.
Nur eine weitere Märchengeschichte um sie als Kind gefügig zu machen? Wütend dachte Mercura an das Gefühl des Verlustes zurück. Den Vertrauensbruch und die Leere in sich.
Trotzdem war sie von diesem Elfen, diesem Samico, entführt worden, oder spielte ihr ihre Fantasie einen Streich? War den giftigen blauen Fässer Dämpfe entstiegen, die sie bereits beeinträchtigen? Wie konnte sie es herausfinden, und wenn dem so war, wie entkommen? Sie spürte ihr Herz schneller schlagen und ihren Magen sich schmerzhaft verknoten. Eine Panik konnte sie jetzt nicht gebrauchen. Sie musste sich konzentrieren und einen Ausweg finden!
Die Woche war lang gewesen. Bestimmt träumte sie nur. Mercura zwickte sich in den Arm. »Au.« Nein, sie träumte nicht. Umdrehen und zum Weg zurück gehen war eine gute Idee. Samico schien verschwunden. Sie spürte seine Wärme nicht mehr. Er würde sie also nicht aufhalten.
Mercura machte den ersten Schritt, einen zweiten und dann lief sie los. Immer schneller.
Vögel sangen in einem Baum. Hell und klar.
Mercura drehte im Laufen den Kopf, um hinaufzuschauen, welcher Vogel dort wohl, für sie fremde, Gesänge anstimmte.
Sie sah den Vogel nicht. Dafür klatschte etwas hart gegen ihre Wange und ihren Kopf.
Mercura taumelte, etwas raschelte, sie konnte ihr Gleichgewicht nicht halten und stürzte zu Boden. Dann wurde alles schwarz und leise für sie.
Palast der Waldelfen
»Mercura, wie kannst du es wagen, so vor mir zu erscheinen?«, empörte sich ihre Mutter mit schriller Stimme.
Mercura blinzelte. Ihr Kopf und ihre Wange schmerzten. Eine der rechte Arm, mit dem sie sich versucht hatte, abzufangen, pochte verdächtig. Das Licht war viel zu hell. Sie blinzelte noch mehr. Ein verschwommener, dunklerer Umriss wurde sichtbar, schärfer und schließlich erkannte Mercura darin ihre Mutter, die mit vor der Brust verschränkten Armen dastand.
Solren sah wütend aus. Wütend und gleichzeitig traurig.
Wie schaffte ihre Mutter das nur immer, so viele verschiedene Gesichtsausdrücke gleichzeitig zu haben?
Mercura schloss die Augen wieder und blieb liegen, wo sie war. Das war nicht ihre Mutter. Das war jemand anders, der zufällig ähnliche Gesichtszüge hatte. Ihre Mutter hatte braune Haare, keine dunkelgrünen.
Es roch nach warmem Holz und Sonnenschein. Wo immer sie jetzt war, sie war ganz sicher nicht mehr im Wald. Und auch wenn es nach Holz roch, so war da kein Hauch von Lack oder Öl dabei. Sie war daher auch nicht Zuhause, wo alle Holzmöbel lackiert oder geölt waren.
»Steh auf. Du kannst nicht den ganzen Tag herumliegen und schlafen«, forderte ihre Mutter. »Schlimm genug, dass du dich so überhaupt hierher traust.«
Mercura blinzelte wieder. Die Stimme der Frau war leider viel ähnlicher als ihr lieb war. Genauso wie die Wortwahl.
Sie sah auf.
Über und hinter der Frau, die wohl doch ihre Mutter war, warum auch immer sie ihre Haarfarbe so drastisch geändert hatte, sah sie grün belaubte Äste. Langsam drehte sie sich auf die Seite. Der Boden bestand aus glatten Brettern in hellem Braun.
Sie zog die Knie an und rappelte sich langsam auf.
Dabei beobachtete sie ihre Umgebung so gut es ging. Sie sah die Beine von mehreren anderen Personen. Besser sie überlegte, bevor sie redete. In Gegenwart von anderen war ihre Mutter immer schon strenger gewesen, als wenn sie allein waren. Schließlich war das, was andere von einem wahrnahmen wichtig. Der erste Eindruck zählte, war Solrens Einstellung. Wobei sie den Spruch immer ergänzt hatte mit »und jeder weitere Eindruck zählt genauso.«
Mercura unterdrückte ein schmerzhaftes Stöhnen, als sie versehentlich ihren rechten Arm belastete. Ihr erster Eindruck hier war auf jeden Fall miserabel. Ohnmächtig auf dem Boden liegend und sich nur umständlich aufrappelnd.
Als sich Mercura endlich vom Fußboden aufgerappelt hatte, schaute sie nicht direkt ihre Mutter an, sondern sah sie sich erst einmal um.
Der Raum war klein, wenn man die Bodenfläche betrachtete, die zwischen mehreren, dicken Ästen, oder waren es Baumstämme, eingelassen war.