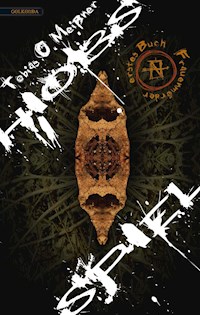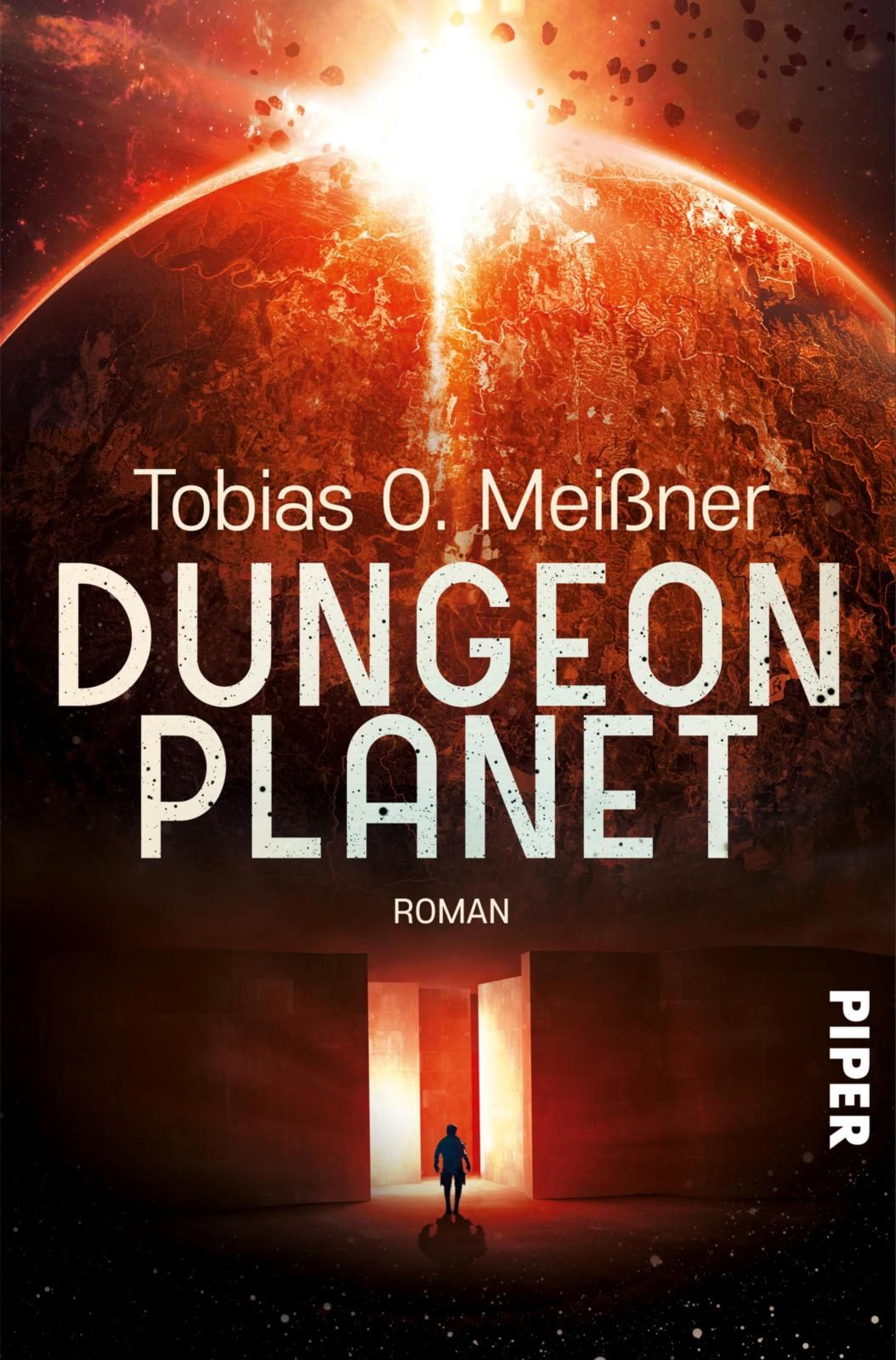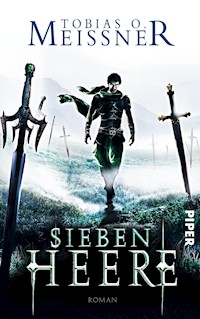2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Adain ist ein Wiederkehrer, ein Dämon, der seine Form verändern kann, und der Einzige seiner Art, der die Schlacht von einst überlebt hat. Nachdem er jahrhundertelang die Lehren des Dämonenkönigs studiert hat, treibt ihn nun die Neugier aus der Tiefe. In Menschengestalt verschafft er sich Zutritt in jene zerstörte neue Welt, die nicht nur fremdartiges Leben erschaffen hat, sondern auch abscheuliche Gefahren. Und als Adain in den Besitz der wertvollsten Substanz der alten Zeit gelangt, sieht er den Moment für eine neue dämonische Invasion endlich gekommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ISBN 978-3-492-98049-4 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © Piper Verlag GmbH 2011 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Algol / shutterstock.com Karte: Erhard Ringer
Zitat T. S. Eliot:
Das wüste Land, © 1951 Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2011 In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ornis stieg auf
und umfasste alles
und währte siebzehn Tage.
Danach
fiel die Finsternis wie Niederschlag,
wurde aufgesogen
von Felsen und Lehm
und war fort.
Stille herrschte.
Kein einziger Vogel sang.
Der Himmel war matt wie etwas Blindes.
Die Senke von Zegwicu,
ein guter Ort,
um endgültige Entscheidungen zu treffen,
kühlte sich ab.
Wo vorher
das neungeteilte Land Orison gewesen war,
lag nur noch
winterliche
Wüste.
Schlusssätze von DIE DÄMONEN –
I
Adain konnte das Ende hören.
Wie ein leuchtender Regen und ein strahlender Sturm prasselte es über das Land. So viele Tote. All ihr Schreien verstummte. Berge wurden zu Wolken. Flüsse zu wehendem Dampf. Der Boden riss sich los aus seiner Verankerung und schoss brüllend empor in den Himmel, um von dort aus in Asche verwandelt zurückzukehren. Menschen, Dämonen, Tiere und andere, noch fremdere Lebensformen vergingen. So viel Vergeblichkeit und so viele unerreichte Ziele.
Adain begriff, dass etwas schiefgelaufen sein musste. Energielinien hatten sich aufeinander zubewegt, eine Konfrontation herbeiführend, oben im Norden, in der fernen Senke von Zegwicu. Doch dann war etwas geschehen. Eine weitere Linie, die vorher nicht als solche zu erkennen gewesen war, hatte sich hineingemischt. Die Linien hatten sich ineinander verschlungen und miteinander verknotet. Und dieser Knoten war geplatzt.
In seiner Höhle, in der schon seit Langem außer ihm niemand mehr war, blieb Adain vom Ende verschont. Während sich oben das neungeteilte Land Orison auflöste und dabei aschfahl wurde vor Schreck, trieb Adain sich im verwaisten Ratssaal herum und studierte die Kreideinschriften, die sämtliche Wände überzogen.
Alles Mögliche und Denkbare fand sich hier. Schriftzeichen unterschiedlicher Sprachen, einige von ihnen ausgestorben, andere vermutlich erfunden. Kreise, Spiralen und Dreiecke sowie die Formel zur Berechnung der Seiten eines Dreiecks. Verse von Gedichten, einige mit Reimen, andere vollkommen abstrakt. Bildergeschichten. Die Anfänge zweier Romane, von denen der erste mit »Der König« begann und der zweite mit »Der Himmel«. Bannsprüche und Beschwörungsformeln. Alchimistische Herleitungen. Numerologien und Benennungen der leuchtenden Städte des Himmels sowie sogar das Ordnen der leuchtenden Städte des Himmels zu bedeutsamen Bildern. Tier- und Landschaftsdarstellungen. Karten, Wegskizzen und Lagepläne. Risszeichnungen. Entwürfe von Mischwesen: Baupläne für mannigfaltige Dämonenleiber.
Während oben im Land das Ende tobte und wütete, blickte Adain an seinem eigenen Leib hinab: Er war schlank und nicht besonders groß. In seiner Nacktheit schimmerte er grün. Er war weder Frau noch Mann, und sein linker Arm und sein linkes Bein waren deutlich kürzer als sein rechter Arm und sein rechtes Bein. Wenn er ging, hinkte er stark, und wenn er sich etwas nehmen wollte, musste er mit links näher herangehen als mit rechts. Dafür waren seine Wimpern beinahe doppelt so lang wie die anderer Lebewesen, und die Wimpern immerhin – davon konnte er sich in einem Stück Felsen überzeugen, das glatt geschliffen war wie ein Spiegel – waren links und rechts gleich, brachten also Ruhe in Adains bizarre Asymmetrie und versahen sein Gesicht mit einem Ausdruck der Milde und Vergebung.
Adain war niemandem böse, auch nicht für die offensichtlichen Mängel seines Leibes.
Er selbst hatte es nicht anders gewollt.
Er war lieber einsam als unter anderen. Lieber unbedrängt als zusammengepfercht. Lieber in Finsternis als draußen, wo nun alles hell und tot glänzte wie geschmolzener Sand. Als der Bann gefallen war und jeder sich gegriffen hatte, was er nur hatte packen können, hatte Adain sich zurückgehalten und sich als einer der Letzten mit den Resten beschieden. Es hatte ihm nichts ausgemacht, deformiert und schwach zu sein. Er hatte ohnehin nicht vorgehabt, an diesem kindischen Feldzug teilzunehmen. Und wie es aussah, war seine Entscheidung richtig gewesen.
Zeit verging, und Adain studierte weiterhin die Inschriften. Draußen war es nun stiller und finsterer. Der Tod hatte sich eine Farbe gewählt und einen Klang: ein hohles Rauschen.
Adain vertiefte sich in Bilder und Formeln. In die Handschrift von Orison. In das eigenartige, geheime, fremde und dennoch so freigebig mitgeteilte und festgehaltene Wissen des mächtigsten Dämonen aller Zeiten.
Immer wieder, sogar in verschiedenen Ausprägungen, stieß Adain auf jene zentrale Prophezeiung, die über sämtliche Wände zugleich zu fließen schien und die alles mit allem in Verbindung brachte. Ein Text, der durch das Kürzen einer früheren Fassung entstanden war:
menschliche Magier
waren Dämonen,
um lebendig zu sein
Gier
und Freude
Lebenskraft
Zukunft
Weiterexistenz Freiheit
Orison war gestorben,
zu Licht zerflossen und wiederauferstanden
Das Land
ging an die Menschen
niemals
Und verschwand
die Dämonen
die Dämonen
Auf welche Zeit bezieht sich dieser Text, fragte sich Adain. Auf die Vergangenheit? Auf die Gegenwart? Oder vielleicht sogar auf die Zukunft oder auf eine mögliche Zukunft?
Zeit.
Zeit verlor sich.
Adain litt weder Hunger noch Durst. Ganz am Anfang, kurz nach dem ungestümen Ausbruch der Hunderttausend, hatte er sich noch Sorgen gemacht, denn König Orison höchstpersönlich hatte sich hier unten herumgetrieben und alles zusammengerafft, was sich an Lebenskraft und somit an Nahrung in der Höhle verfangen hatte. Nachdem Orison gegangen und aufgestiegen war, lag die Höhle leer. Einst war sie ein unendlicher Mahlstrom gewesen, ein mit wirbelnden Dämonen gefüllter Abgrund. Dann war sie still und hohl geworden, und Adain hatte den Hunger gefürchtet, bevor er begriff, dass er die Lebenskraft gar nicht mehr benötigte. Die Lebenskraft war freigesetzt worden wie die Dämonen auch. Die Lebenskraft war nun überall, in jedem Atemzug, den Adain tat, in jedem vielfach gebrochenen Lichtstrahl, der zu ihm nach unten fand, und in jedem abgehackten Echo, das seine nackten Schritte an die blanken Wände warfen.
Die Lebenskraft war das Dasein selbst. Das, was einen Menschen oder einen Dämon oder ein Tier oder eine Pflanze von einem Stein oder einem Sandkorn unterschied.
Adain brauchte nichts zu fürchten. Er brauchte keine Gier, um lebendig zu bleiben.
Er konnte die Zeit verstreichen lassen.
Und Zeit, Zeit, Zeit verfloss.
Ihn trieb nichts nach droben, nach draußen. Dort war doch ohnehin nichts mehr. Die Finsternis löste sich auf wie ein Albdruck und ließ nichts zurück außer Leere.
Manchmal jedoch lauschte Adain dennoch. Wenn die Stunden sich dehnten und ihm die Augen schmerzten vom Lesen in völliger Dunkelheit. Dann konnte er die Last von Gebäuden spüren und Unbeträchtlichkeiten, die sich in diesen Gebäuden regten. Insekten. Die winzigen Verwandten jener schrecklichen Rekamelkish, mit denen die Menschen sich verbündet hatten, um dem Heer der Dämonen entgegentreten zu können.
Adain gewann den Eindruck, ein paar Städte hätten das Ende überstanden. Im Windschatten zweier unterschiedlicher Gebirge war die rasende Vernichtung vorübergezogen an Aztreb und Icrivavez, an Tjetdrias, Cerru, Kirred und Witercarz. Aber selbst diese Städte standen weitestgehend ausgeschabt. Der Krieg hatte sie ihrer Bevölkerung beraubt. Es gab nur noch Insekten dort, zurückgelassenes Nutzvieh, den einen oder anderen freien Vogel – aber keine Menschen mehr und auch keine Dämonen.
Das änderte sich mit der Zeit.
Flüchtlinge, die sich vor dem furchtbaren, unüberschaubaren Krieg auf die See zurückgezogen hatten in Booten, auf Flößen und auf improvisierten Konstruktionen, die aus mehreren Booten große Flöße gemacht hatten und aus mehreren Flößen große Boote, kehrten wieder in das nun still gewordene Land und nahmen sich die fünf Küstenstädte zurück: Aztreb und Icrivavez im Süden sowie Tjetdrias, Cerru und Kirred im Osten. Nach Witercarz landeinwärts jedoch wagte sich niemand. Witercarz war dem Ursprung des Endes, der Senke von Zegwicu, zu nahe. Aber selbst in Witercarz regte sich etwas – Adain konnte es rascheln hören, wenn er ein Ohr auf den Boden presste. Es mochte ein paar überlebende Menschen gegeben haben, die in den Katakomben der von Felsen umgebenen Stadt die Angriffe des Dämonenheeres überdauert hatten. Oder es waren Dämonen, die sich zum Zeitpunkt des Endes tief unter der Erde befunden hatten, um zu plündern oder um Bodenschätze aus Gestein zu reißen. Adain wusste es nicht, und anfangs war sein Interesse für diese Vorgänge auch äußerst gering.
Zeit verströmte sich.
Jahre.
Etliche Jahre.
Adain formte seinen Körper um, einfach nur, weil er dies aus den Zeichnungen an den Wänden gelernt hatte. Er begriff noch nicht ganz, ob all die hunderttausend Dämonen, die dem Schlund entstiegen waren, ihre vielgestaltigen Umrisse und Ausprägungen dem König Orison verdankten oder ob sie – wie Adain das eigentlich für sich selbst in Anspruch genommen hatte – einen eigenen Willen bekundeten, indem sie zu Fleisch wurden. Aber auch das erschien ihm im Nachhinein unwichtig, denn die anderen waren alle tot. Orison selbst war tot. Orison war gestorben, zu Licht zerflossen. Und wiederauferstanden. Wiederauferstanden, wirklich? Wann? Und – wenn überhaupt – in welcher Form?
Adain trug Erinnerungen in sich an frühere Daseinsformen als Wurm, als Vogel und als Katze. Vor langer Zeit, noch bevor Orison alle Dämonen in den Mahlstrom gebannt hatte, um ihr Überdauern zu sichern, war Adain diese drei Tiere gewesen. Also nahm er diese drei Ausformungen nacheinander wieder auf. Sie waren ihm vertraut. Sie trugen sich wie eine maßgefertigte Bekleidung. So kroch er als grünlicher Wurm umher, flatterte als grün schillernder Vogel durch die verlassene Katakombe und schnürte als Smaragdkatze um Stalagmiten herum. Er genoss diese Spiele, doch in den visionären Kreidezeichnungen Orisons sah er noch so viel mehr.
Er nahm wieder seine menschenähnlichere Form an und experimentierte damit herum. Eine Zeit lang machte er seine rechte Seite kürzer als die linke. Das war ungewöhnlich faszinierend. Der Unterschied zu vorher ließ ihn oftmals straucheln und sogar stürzen, aber er rappelte sich immer wieder auf mit einem belustigten Ausdruck im Gesicht.
Zeit verflüchtigte sich.
Adain formte sich um, ordnete die Moleküle, aus denen sein Leib bestand, zu neuen Zusammensetzungen an und probierte Neuartiges aus.
Oben in den Städten regte sich das Leben, und die Bewohner dieser Städte – Adain war sich immer noch nicht im Klaren darüber, ob es sich um Menschen oder um Dämonen handelte – begannen, Fahrzeuge zu entwickeln, mit denen sie die Wüste erkunden konnten. Es klang, als würden sie Schiffe umwuchten und wüstentauglich machen, denn er konnte das Flügelschlagen von Segeltuch zwischen Dünen hören. Das ganze Land war nun eine Wüste, eine junge und unerforschliche Wüste, und in dieser Wüste rührte sich etwas Neues, etwas, das auch Adain noch nicht kannte. Wesen, die groß waren, sehr groß sogar. Wesen, die es früher nicht gegeben hatte. Die das Ende mit seinem Strahlen, seinem Staub und seinem Licht überhaupt erst hervorgebracht hatte.
Adain spürte, wie sehr, sehr langsam die Neugier in ihm anwuchs.
Neugier auf die Wüste. Neugier auf die Städte und ihre fremden Bewohner.
Einmal fragte er nach oben in den Schlundtrichter: »Orison?«
Und dann noch einmal: »Orison?«
Aber er erhielt keine Antwort. Er wusste nicht, was dort oben vor sich ging, ob das Fremde, das sich bildete, auch nur das Geringste mit dem König der Dämonen zu tun hatte. Ob Orison tatsächlich wieder auferstanden war, wie es in der Prophezeiung der Streichungen hieß.
Adain erhielt keine Antworten auf seine Fragen. Und dennoch wartete er immer noch ab.
Er war ein geduldiger Dämon.
Zeit verstrich.
Jahre zogen ins Land.
Viele Jahre.
Adain formte sich weiter.
Und dachte nach.
Die Skizzen an den Wänden zeigten die Körper der Dämonen. Aber weshalb waren alle diese Körper hässlich? Weshalb waren sie dämonisch? Waren die Dämonen denn nicht früher, bevor Orison sie in die Verbannung zwang, wunderschöne Fabelwesen gewesen? Nicht nur Würmer und Vögel und Katzen, sondern auch feuerspuckende Würmer mit Flügeln und Vögel, die in diesem Feuer baden und sich darin erneuern konnten, und Katzen mit Skorpionschwänzen oder Säbelzähnen? Warum hatte Orison den tumben Krieg angestrebt anstatt die Schönheit, die Bewunderung und das Verständnis? Und was war mit ihm, mit Adain selbst? Konnte er sich nicht aussuchen, was er sein wollte?
Er beschloss, sich einen schönen Körper zu machen.
Eines Tages hatte er eine Gestalt gefunden, die ihm ausgesprochen gut gefiel. Sie war eher ein Zufall, eine Spielerei mit mehreren denkbaren Möglichkeiten, aber genau deshalb, weil er fürchtete, diese Form nicht mehr willentlich wiederherstellen zu können, behielt er sie fürs Erste bei.
Er war jetzt sehr ebenmäßig. Seine beiden Arme waren gleich lang, seine beiden Beine ebenfalls. Sein Körper war groß und schlank und in den Hüften wohlgeformt und gerundet wie ein menschliches Musikinstrument. Sein Gesicht war sehr faszinierend, mit großen dunkelblauen Augen, ausgesprochen weiblich, weil er fand, dass Frauen schönere Gesichter hatten als Männer. Seine Haare waren sehr lang und von einem beinahe blonden Hellbraun, besaßen jedoch im Dunkeln einen leicht grünlichen Schimmer. Da er sich nicht hatte entscheiden können, ob er ein Mann oder eine Frau sein wollte, war er jetzt beides. Nur auf Brüste verzichtete er. Sie schienen ihm unzweckmäßig und stets im Weg zu sein. Stattdessen entschied er sich für sehnige, wohlmodellierte Muskeln.
Er betrachtete sich.
Und gefiel sich sehr.
Er sprach seinen Namen laut aus. »A-da-in.« Es konnte sowohl ein weiblicher als auch ein männlicher Name sein. Er war beides. Und indem er mehr war als ein gewöhnlicher Mensch, war er ein Dämon.
Zeit veränderte sich.
Adain lauschte. Häufiger und häufiger fand er sich am Grund des tiefen Schlundtrichters wieder und horchte, spähte in die Höhe, wo ferne, unstete Wolken zogen. Einmal sah er etwas über den kreisförmigen Ausschnitt fliegen, der seine ganze Sicht darstellte. Es mochte ein Vogel sein, ein von Menschenhand geschaffenes Fluggerät oder ein stürzender Himmelskörper. Was immer es war, es beschäftigte ihn lange, und er fand in Orisons Zeichnungen keine zufriedenstellende Entsprechung.
In der Wüste bewegte sich das Fremde und Neue. Ansonsten war alles still. Die Menschen oder Dämonen oder was immer in den übriggebliebenen Städten nistete, verhielten sich verhältnismäßig ruhig. Sie hatten ihre Lektionen aus den beiden Dämonenkriegen gelernt, dem Krieg der Zwei und dem Krieg der Hunderttausend.
Zeit und Zeit verrann.
Und mit der Zeit wurde es oben unruhiger.
Die Menschen oder Dämonen schwärmten aus den Städten und begegneten dem Neuen. Sie begegneten sich auch untereinander, und es kam zu Reibereien, die bis zu Adain nach unten durch den Boden zu spüren waren als schabendes Schleifen sich aneinander vergehender Körper.
Nichts änderte sich dort oben.
Selbst mit der Zeit änderte sich nichts.
Adain wusste nicht, was dort im Einzelnen vor sich ging, aber er begriff langsam, dass er es zu wissen begehrte.
Er schneiderte sich ein Gewand, das aus derselben Substanz bestand wie sein Leib. Es war enganliegend, glänzend und reißfest. Vorne und hinten hatte es je einen Umhang, der bis zu den Knien reichte. Die Schuhe waren ohne Sohle, sollten aber schützen gegen Hitze und Kälte.
Er dachte auch nach über eine Bewaffnung. Er würde etwas brauchen, um sich verteidigen zu können. Das Land kannte den Krieg, hatte den Krieg verinnerlicht, war vom Krieg umgestaltet worden – Adain durfte sich ihm nicht einfach wehrlos aussetzen. Also schuf er sich zwei Schwerter, eines lang und gebogen, in seiner Mitte ein Griff wie eine verdoppelte Sense, und das zweite kürzer und gerade, aus zwei kreuzförmig ineinander verschränkten Klingen gefügt. Klingen und Griffe bestanden aus dem polierten Gestein der Höhle, waren also schwerer als das, was Menschen zu führen gewohnt waren. Adain gab der verdoppelten Sense den Namen Die Stimme und dem Kurzschwert mit den vier Schneiden den Namen Das Schweigen. Er brachte sich bei, die Waffen mit großem Geschick und großer Geschwindigkeit zu handhaben. Ihr Gewicht wurde Bestandteil seiner Bewegungsabläufe. Und er arbeitete seine Kleidung so um, dass er die Waffen in zwei stabilen Halftern verstauen konnte.
Dann hielt er es nicht mehr aus. Seine Geduld war verströmt wie die Zeit.
Zweihundertundzehn Jahre nach dem Ende stieg Adain, indem er seine beiden Klingen als Werkzeuge benutzte, aus dem Dämonenschlund auf und betrat wie ein Kind, das des Staunens noch mächtig ist, die eingesunkene Ruine einer alten Kapelle und dahinter die unendliche Helligkeit der Wüste des Winters.
II
Das Kräftespiel der körperlichen Anziehung
»Hörst du das?«, fragte Glai. Ihr Gesicht war unter Staubschal und Lichtschutzbrille so gut wie überhaupt nicht zu erkennen.
Koaron gab sich alle Mühe, in den Wind hinaus zu lauschen, aber außer dem Knarren der Takelage, dem Knattern der Segelund dem allgegenwärtigen Mahlen der Räder vernahm er nichts.
»Nichts? Überhaupt nichts?«, fragte Glai ihn spöttisch.
»Nichts«, musste er zugeben. »Was soll ich denn hören?«
»Streng dich ruhig mal ein wenig an, schließlich willst du ein Sammler sein!«
Koaron verdoppelte seine Anstrengungen und lauschte. Sollte er etwa einen Dämon hören? War es das, worauf sie anspielte? Er hängte sich ganz weit hinaus, obwohl die Miralbra Vii nicht stillstand, sondern stetig vom Wind getrieben durch den Sand vorwärtsrauschte. Es war nicht ungefährlich, sich unter der Fahrt so über die Reling zu krängen. Wer abstürzte, konnte vom weißen Sand verschlungen werden. Oder von Dämonen, falls welche in der Nähe waren.
»Ich höre einfach nichts«, musste Koaron nach einer Weile zugeben.
Glai klopfte ihm auf die Schulter. »Wir müssen anhalten. Ich bin mir sicher, dass ich mich nicht getäuscht habe.« Sie löste sich aus dem Tauwerk und stiefelte über das sandige Deck zum Kapitän. Dieser ließ umgehend backbrassen, die Segel teilweise reffen und das klobige Rollschiff dadurch verlangsamen. Dann befahl er, drei Draggenanker auszuwerfen. Die Miralbra Vii fraß sich an den vierhakigen Draggen im Sand fest und schien anschließend an drei Ketten vor verhaltener Spannung zu zittern, denn noch boten die Segel dem Wind eine nicht unbeträchtliche Angriffsfläche.
Die Tageszeit war uneindeutig. Schlieren des weißen Sandstaubes erfüllten den Himmel und degradierten die Sonne zu einem fahlen, vernachlässigbaren Kreis. Die Wüste ringsum war niemals eben, sondern immer in Wellen begriffen wie ein schockgefrorenes Meer. Es war früh im Jahr, was bedeutete, dass es tagsüber schon drückend heiß werden konnte, aber es war spät am Tag, also bildeten die Dünen weite Schatten aus, in denen sich alles Mögliche verborgen halten konnte.
Die Miralbra Vii war der zweitälteste noch aktive Zweimaster der Landflotte von Aztrivavez und wie die anderen auch mit einer zehnköpfigen Besatzung bemannt. Renech war der Kapitän, ein älterer, erfahrener Klotz von einem Mann, der schon so manchen Beutezug in die Wüstemitgemacht und schon so manchen Überfall der Bescheidenen abzuwehren geholfen hatte. Aus Renechs imposantem, rotgefärbtem Backenbart rieselte fortwährend Sand, seine Kapitänswürde betonte er durch einen silberbeschlagenen Dreispitzhut und gewaltige, silbern irisierende Fransenepauletten auf den Schultern seiner regenbogenfarbenen Uniformjacke.
Als Koaron noch ein Kind gewesen war – und allzu lange war das noch nicht her –, hatte er sich gewundert über die Buntheit der Kleidung von Wüstensammlern. »Fallen die denn dann nicht viel zu sehr auf in der weißen Wüste?«, hatte er seine Mutter gefragt, sobald er ein Alter erreicht hatte, in dem man begann, sich über Gebräuche und ihre Zusammenhänge Gedanken zu machen. Seine Mutter hatte ihm nur antworten können, dass diese Buntheit eben eindrucksvoll aussah, weshalb es ja auch den Begriff Farbenpracht gab. Inzwischen jedoch hatte Koaron begriffen, dass Wüstensammler sich bunt kleideten, um in der alles umgebenden Monotonie nicht trüb- oder sogar wahnsinnig zu werden. Es gab in der Tradition der Sammler etliche verbriefte Fälle von Weiß-Koller und Helligkeitsfurcht; andererseits hatte noch niemand jemals beweisen können, dass Dämonen auf Farben reagierten. Dämonen reagierten auf Gerüche oder Geräusche, manchmal auch auf Bewegungen. Es spielte also keine Rolle, ob ein Sammler sich bunt kleidete oder in weiße Tarnfarben hüllte. Letzteres war höchstens sinnvoll im Kampf gegen die Bescheidenen, die ebenfalls der Wüste sehr ähnlich waren: winterlich hell. Dämonensammler des Landes jedoch sahen am liebsten aus wie die Paletten von exzentrischen Gemäldemeistern.
Koaron hatte sich dieser Tradition angepasst. In den Sanddocks hatte er immer eher grau in grau oder sandgelb in braun getragen. Jetzt war das anders. Seine Staubmütze, die sein langes dunkelblondes Haar gegen den Flugsand abschirmte, war knallrot. Seine Jacke gelb, die Hosen hellgrün, die unverschnürten, wuchtigen Halbstiefel violett, die Handschuhe hellblau und der Schutzschal wiederum ebenso violett wie die Schuhe. Dieser Schutzschal war unverzichtbar, wenn man nicht andauernd Sandkörner zwischen den Zähnen haben wollte. Gleichzeitig war er ein verhältnismäßig gefährliches Kleidungsstück. Jeder Sammler kannte die Geschichte von dem Sandmatrosen, der beim Über-die-Reling-Flanken mit seinem Schal an einem Belegnagel hängen geblieben war und sich erbärmlich stranguliert hatte. Die Enden des Schals mussten immer innerhalb des Jackenkragens stecken, so wie auch – damit kein schmerzhaftes Geriesel hineingelangte – die Stulpen der Handschuhe immer innerhalb der Jackenärmel.
Die beiden weiblichen Steuerleute Jitenji und Tibe, die dem Kapitän bei all seinen Entscheidungen zur Seite standen, trugen anstatt der Jacken knielange, grüne Sandmäntel aus knisterndem Material sowie hellblaue Stiefel. Dann gab es noch Zemu, den kochenden Wundarzt oder verarztenden Smutje mit seiner orangefarbenen Fischlederhose und dem blutroten, ärmellosen Hemd, aus dem ihm überall an Rücken, Armen, Brust und Achselhöhlen seine überreichliche krause Körperbehaarung hervorwucherte. Das Schiffsmädchen Voy hatte einen rosafarbenen, kurzen Faltenrock an, türkisfarbene Kniestrümpfe, eine Bluse aus schwarzem, sandabweisendem Fischledergewebe und eine Art Schutzhelm von blassgelber Farbe. Und die Sammler, die – wenn es, wie meistens unterwegs, gerade nichts zu sammeln gab – all die vielfältigen Aufgaben einer Schiffsbesatzung zu erfüllen hatten, waren ähnlich gekleidet wie Koaron, nur in anderen Farbzusammenstellungen. Glai trug überwiegend Blau, Tsesin vorrangig Rot. Die hübsche Bakenala, in die, außer Koaron, jeder an Bord heimlich verliebt war, jeder, auch die Mädchen, trug einen einteiligen Fischlederanzug in allen erdenklichen Tönen des Farbspektrums. Nur Gilgel stach ein wenig heraus, weil seine bunte Schutzkleidung über und über mit grünen und roten und im Dunkeln sogar leuchtenden Symbolen mystischen Gehalts bekrakelt war.
Koaron war – neben dem Schiffsmädchen – der Jüngste an Bord. Er war erst siebzehn. Noch nie hatte er einen Dämon zur Strecke gebracht, und dies war seine erste richtige Ausfahrt als Sammler. Aber er bildete sich einiges ein auf seine Leistungen im Sanddock, und sowohl Kapitän Renech als auch die erfahrenere Glai, die Koaron ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hatte, erwarteten sich viel von dem schlaksigen Jungen, dessen Übermut zumindest»innerstadts« nur schwerlich zu bremsen gewesen war. An Bord der Miralbra Vii war Koaron jedoch nur an den ersten drei, vier Tagen noch übereifrig und tollkühn gewesen. Inzwischen hatte sich auch ihm, wie man so treffend sagte, der allgegenwärtige Wintersandstaub ins Gemüt gefressen.
Jetzt lauschten alle nach Backbord, denn Glai hatte etwas gehört, und besonders die beiden Steuerfrauen und der Kapitän, die alle drei jeweils einen eigens konstruierten Schwingungstrichter an ihre Ohren hielten, strengten sich an, etwas zu erhaschen, das nicht Wind war oder das eigene Schiff.
»Ist doch nicht zu glauben, dass Glai ohne Hilfsmittel bei voller Fahrt etwas hören konnte, was wir selbst jetzt …«, grummelte der Kapitän, aber die kleingewachsene Tibe unterbrach ihn, indem sie eine Hand erst hob und dann sich an die Lippen legte.
»Jetzt höre ich auch etwas«, sagte sie. »Es muss ein Großer sein. Dreibeinig vermutlich. Bugwärts steuerbord. Mindestens eine Sandmeile entfernt.«
»Ich habe ihn«, bestätigte Jitenji. »Ja, es ist gut, dass wir angehalten haben. Wir hätten seinen Weg vor ihm gekreuzt. Er hätte uns folgen und von achtern attackieren können.«
Dem Kapitän war es immer noch nicht gelungen, etwas zu hören, deshalb fluchte er so derb, dass sein Backenbart prasselte. »Ich werde langsam zu … ungeduldig für diese Spuckschüsseln«, haderte er und gab seinen Schwingungstrichter an das Schiffsmädchen weiter, das auftragsgemäß in der Nähe stand und bedingungslose Hilfsbereitschaft vermittelte. »Bringt uns nahe ran, aber nicht zu nahe, ihr wisst schon …«
Die beiden Steuerfrauen warfen sich einen kurzen Blick zu und übernahmen das Kommando, während der Kapitän unter Deck ging, um seine Lieblingsharpune zu holen.
Sämtliche Sammler bis auf Koaron und Bakenala stiegen jetzt in die Wanten. Der Wind formte den Sand zu Spiralen und Wirbeln, die manchmal wie Dämonen mit fadenscheinigen Tentakeln aussahen. Koaron wurde von Bakenala herbeigewunken. Sie verhüllte niemals ihr Gesicht, außer im Kampf mit einem Dämon, und dann trug sie eine eitle Schutzmaske, die ihrem eigenen Gesicht nachempfunden war. Ihre stets wie zum Kuss gerundeten Lippen prangten Koaron in ihrer kapuzenumrahmten Sinnlichkeit entgegen, aber er war immun dagegen. Er war der einzige Junge in ganz Aztrivavez, der Bakenala nicht im Mindesten attraktiv fand. Ihr Gesicht und ihre Figur erschienen ihm eher wie eine Parodie auf eine schöne Frau, wie eine Übertreibung wenig origineller Männerphantasien: große Augen, geschwungene Brauen, winzige Nase, volle Lippen, üppiges Haar, großer Busen, schmale Taille, runder Hintern. Sie war beinahe unglaubwürdig, so sehr entsprach sie jedermanns Wünschen. Koaron hingegen interessierte sich eher für Mädchen, die nicht so ganz den allgemeinen Erwartungen entsprachen. Er fand an Glai ansprechend, dass sie schon Fältchen um die Augen hatte, an Voy, dass ihr der Helm immer anders, aber immer irgendwie schief auf dem Kopf saß, an Tibe, dass sie so winzig war und gleichzeitig so herrisch, und an Jitenji, dass sie so ein länglich-melancholisches Gesicht mit tiefen Schatten unter den Augen hatte und ein trauriges Lächeln, das niemals ihre Zähne sehen ließ. Nur an Bakenala konnte er nichts finden – es war, als würden seine Blicke an ihrer Makellosigkeit abgleiten.
»Einer der Anker hat sich verfangen«, schmollte Bakenala ihn an. »Gehst du oder soll ich?«
»Ich mach das schon.« Er war kein sich ständig als vom Fürsten höchstpersönlich ausgezeichneter Spitzensammler aufspielender Angeber wie Gilgel. Er war nur froh, für eine kurze Weile von dem Schiff runterzukommen und wenigstens halbwegs festen Boden unter die Füße zu kriegen. Das dauernde Ruckeln des Räderseglers machte ihm mehr zu schaffen als das allumfassende Weiß.
Koaron ergriff ein Fallreepstau und schwang sich über die Reling. Alle, die ihn jemals bei solchen Verrichtungen gesehen hatten, bescheinigten ihm außerordentliche Geschicklichkeit. Zum Herablassen am Tau benutzte er kaum die Beine, einzig, um sich von der Schiffswand abzustoßen. Die mit Fischleder und -därmen umwickelten Räder eines Sandschiffes waren oftmals mit rasiermesserscharfen Steinchen gespickt, die sich während einer Fahrt einbohrten, und so mancher vom Wind hin und her geschlenkerte Sammler hatte sich auf ihnen schon schwer verletzt. Koaron sprang aus großer Höhe ab, flatterte durch den Wind wie ein Raubvogel und landete im aufstaubenden Sand. Sein Oberkörper klappte dabei vornüber, die Knie bogen sich durch, bis sein Hintern beinahe auf der Düne saß. Dann entfaltete er sich wieder und lief zum festgefressenen Anker, den Bakenala ihm bezeichnete. Die übrigen Sammler hingen inzwischen wie bunte Insekten im Netz einer Spinne zwischen den Segeln und hielten sich bereit. Wie immer würde das Schiff losrasen, sobald Koaron den Anker gelöst hatte, und er würde sich anstrengen müssen, um wieder an Bord zu kommen, aber ihm gefiel das, und es gefiel ihm auch, dass die anderen keine Rücksicht auf ihn nahmen, weil das bedeutete, dass sie ihm zutrauten, ein fahrendes Schiff wieder einholen zu können.
Der Anker hing in einer felsigen Rinne fest. Die Segel der Miralbra Vii waren windgefüllt, das Schiff zerrte an dieser Leine, die Ankerkette hatte kein Spiel mehr, Koaron konnte sie nicht lösen. Also musste er den Anker am vorletzten Glied der Kette über eine Öse abnehmen und ihn dann einsammeln, während das Schiff bereits knirschend losschoss. Anschließend sprintete Koaron der schleifenden Kette hinterher, holte sie ein und ergriff sie. Bakenala ließ auf Deck die Kette durch eine Kurbel laufen, um ihn hochzuziehen, doch Koaron sprang, so weit es ging, hinauf und kletterte mit den Armen aufwärts. Der Moment, als seine Füße die Wüste zurückließen, war wie immer: Die Wüste bildete Arme aus, wie um Koaron zu halten oder ihn anzuflehen, aber dies war nur eine Illusion hochspritzenden Sandstaubs. Die Wüste hatte keine Macht über ihn, sondern er beherrschte sie.
Bakenala stand bereit, um ihm über die Reling zu helfen, aber Koaron benötigte keine Hilfe. Mit einem kompletten Überschlag kam er über die Reling geturnt und drückte Bakenala den Draggenanker in die Hand. Sie zwinkerte ihm schmollend zu. Dann machte er sich unverzüglich hinauf in die Wanten, um Glai beizustehen. Gleichzeitig ersehnte er den besseren Ausblick von dort oben. Dies würde sein erster Dämon werden. Und gleich ein Großer! Seit ermüdenden acht Tagen kreuzte die Miralbra Vii nun schon durch die Wüste unterhalb der Zerbrochenen Berge, und bislang hatte sich noch nichts blicken lassen, nicht mal ein Mannshoher. Fürst Glengo Dihn und sein Schamane, Dereiferer, würden nicht erfreut sein, wenn Kapitän Renech mit leeren Händen von dort zurückkehrte, wo die Miralbras Cix, Xi und Xiv schon jeweils Beute gemacht hatten. Zehn Dämonen hatte der Fürst diesmal verlangt. Zehn Dämonen für einen neuen Vorstoß gegen die Bescheidenen. Zwölf Miralbras waren ausgeschwärmt. Insgesamt fünf Mannshohe hatten drei von ihnen erbeutet. Kapitän Renech hatte für sein Schiff und seine Besatzung das Ziel formuliert, diese Zahl um mindestens drei zu erhöhen. Ein Großer jedoch war deutlich mehr wert als drei oder sogar fünf Mannshohe. Ein Großer war ein Glücksfall. Glai hatte ihn in voller Fahrt gehört. Glai war ebenfalls ein Glücksfall. Ein Großer würde die Miralbra Vii auf einen Schlag in den Augen des Fürsten hervortun, sie vielleicht sogar zu seiner Lieblingsmiralbra des Jahres machen. Ein Großer! Und bald würde Koaron ihn mit eigenen Augen erblicken können, unverringert, in seiner ganzen Pracht, und nicht nur gebunden in einem der Gatterdocks oder übertrieben gigantisch in den Schilderungen halbbetrunkener Sammler in den Sanddockkaschemmen.
Die Wüste war weiß wie Schnee.
Der Sand war genau genommen Asche.
Die Asche all dessen, was vor der großen Weiß-Sagung hier existiert haben mochte. Menschen. Pflanzen. Tiere. Dämonen aus dem Schlund. Legendenumwobene Reitgämsen und Riesenkäfer aus dem unbekannten Land jenseits des fernsten aller Gebirge. Das alles gab es nicht mehr. Stattdessen der ewige Aschewinter, der so heiß und gleißend war, dass man ohne Schutzkleidung Blasen auf der Haut bekam und ohne Augenschutz blind werden konnte. Die Wüste war weiß. Der Himmel war weiß. Die Sonne in ihm: weiß. Und weiß waren die Wirbel, die der Wind aus dem Flugsand formte. Weiß legte sich beständig über das Deck der Miralbra Vii und musste von Zemu und dem Schiffsmädchen Voy unermüdlich über Deck geschippt werden. Weiß in Weiß war auch jetzt alles, was Koaron erblicken konnte. Weiße Verwirbelungen auf tiefweißem Grund. Weißer Atem, der beständig und feinnadelig gegen einen prasselte. Und dennoch: Irgendwo dort vorne musste ein Großer sein.
Die beiden Steuerfrauen lenkten das Schiff, indem die kleine, kurzhaarige Tibe im Bugspriet Zeichen gab und die hochgeschossene Jitenji durch ihre zwei Heckruder den Kiel ausrichtete. Gleichförmig schoss das Rädergefährt dahin, durch die Dünen und Wellen in ein beständiges, zittriges Auf und Ab versetzt. Die Aufgabe der Steuerfrauen bestand nicht nur darin, einen vom Kapitän angegebenen Ort zu erreichen, sondern auch darin, darauf zu achten, dass das Gelände voraus überhaupt befahrbar war. Ein Boot auf See konnte nur schwerlich auf ein Hindernis auflaufen. Ein Rollschiff jedoch konnte an einer zu hohen Düne scheitern, an einer sandfarbenen Steinformation, einem kaum erkennbaren Felsgrat unter dem trügerischen Weiß – oder sogar an einer plötzlichen Abbruchkante, hinter der das Land sich um einen oder zwei, vielleicht aber auch um ganze sieben Schritt abgesenkt hatte. Ganz zu schweigen von Feinsandtrichtern, Treibkieszonen, Glasschären, Untersandklippen oder Felsrutschen im Zerbrochenen Gebirge, die der Grund dafür waren, dass diese Gegend inzwischen vom Schamanen als Überwiegend untersagt deklariert worden war. Von Tibe hingen Wohl und Wehe der gesamten Besatzung ab. Jitenjis Aufgabe war es lediglich, Tibes Zeichen reaktionsschnell umzusetzen.
Kapitän Renech zeigte sich wieder an Bord. In seinen Händen hielt er seine mit kunstvollen Schnitzereien verzierte Lieblingsharpune, die er auf den Namen Blannitts Fluch getauft hatte. Er schrie den in den Wanten hängenden Sammlern ein paar Kommandos zu, doch die wussten schon längst, was zu tun war. Tibe und Jitenji hatten alles im Griff.
»Wie konntest du hören, was sonst niemand hört?«, fragte Koaron Glai, während sie immer wieder, in der Takelung hängend, nahe aneinander heran und dann wieder voneinander weg schaukelten.
»Ich habe gemogelt«, antwortete sie, und er war sicher, dass sie unter ihrem blauen Schal griente.
»Gemogelt? Aber … da war doch wirklich was! Die Steuerfrauen haben es doch bestätigt!«
»Ja, natürlich war da was. Aber ich habe es nicht gehört. Nicht mit den Ohren jedenfalls.«
»Nicht mit den Ohren? Aber womit denn sonst?«
»Mit den Füßen. Ich habe die Vibrationen gespürt. Aber mach nicht so ein Gesicht: Ich kann nur Große so spüren. Für Mannshohe habe ich mittlerweile zu viel Hornhaut an den Sohlen.«
»Aber … das ist doch nicht möglich! Wie kannst du mit den Füßen etwas wahrnehmen, wenn du gar nicht im Sand stehst, sondern an Deck eines Schiffes?«
Glai machte mit den Fingern ihrer freien Hand Gesten, um das von ihr Gesagte zu unterstützen. »Das Schiff bewegt sich auf dem Sand, verstehst du? Es ist durch die Räder mit der Wüste verbunden. Und ich durch die Füße mit dem Schiff. Alle Erschütterungen gehen durch den Schiffsrumpf in meinen. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann kann man schon erkennen, ob wir gerade über eine Unebenheit rollen oder ob sich etwas Großes in der Nähe bewegt.«
Koaron schwieg. Aber er hatte das deutliche Gefühl, sich noch viel mehr Fähigkeiten aneignen zu müssen als Springen und Klettern, um sich hier draußen als Sammler einen Namen machen zu können.
Die Anspannung an Bord der Miralbra Vii wuchs.
Gilgel, der ewige Selbstdarsteller, hangelte an Deck hinunter, salbte sich dort mit Sonnenglockenmilch, betete viermal gegen die Unsichtbarkeit des in den Zerbrochenen Bergen verborgenen Dämonenschlunds und ritzte sich die Unterarme mit der Spitze seiner gläsernen Harpune, um – wie er es immer nannte – »Rauch auf Blut und Blut auf Rauch vorzubereiten«.
Bakenala machte selbst an der Marsstenge herumturnend dem alten Tsesin schöne Augen.
Tsesin schwor ihr in feierlicher Übertreibung, den Dämon ganz allein um ihretwillen zur Strecke zu bringen. Sie kicherte gekonnt.
Das Schiffsmädchen Voy schnaubte eifersüchtig, aber sie war nicht eifersüchtig auf Bakenala, sondern auf Tsesin, denn auch sie war schon mehrmals in den Genuss von Bakenalas zärtlichen und recht freigebig verteilten Zuwendungen gekommen. Um Bakenala wütend zu machen, gewährte Voy dem feisten Schiffskoch Zemu einen Blick unter ihren kurzen Rock, und obwohl dieser darunter nichts anderes ausmachen konnte als fleischfarbene Schutzstrumpfhosen, gurgelte er etwas Unverständliches, als ihm das Blut in den Kopf schoss. Kapitän Renech mahnte seine Mannschaft, sich auf den Ernst der Jagd zu besinnen. Die beiden Steuerfrauen taten nichts anderes. Über das gesamte Deck hinweg arbeiteten sie wie Hand in Hand. Koaron und Glai folgten ihren Kommandos und hielten ihre Segel kontinuierlich unter Wind.
Der Wind schralte, er kam also von vorn. Das war gut, denn dann konnte der Dämon, dem sie sich nun näherten, sie nicht wittern.
Tibe benutzte ein weiteres Mal einen Schwingungstrichter, um ihre Beute besser orten zu können. Dann tauchte der Dämon in der Entfernung vor ihnen auf. Jitenji und Bakenala warfen sofort mehrere Anker aus. Das Schiff fraß sich fest und wurde lautlos. Das Ungetüm vor ihnen verschwand wieder im Weiß, aber alle hatten es gesehen. Es war dort.
Koaron konnte sein Herz im Hals schlagen spüren. Vor dem weißen Hintergrund waren Entfernungen schwer abzuschätzen, aber nach der Dunstigkeit des Anblicks zu urteilen war der Dämon etwa doppelt so groß wie der höchste Mast der Miralbra Vii, also gute zehn Mannslängen. Was für ein Brocken! Noch nie hatte Koaron einen so großen gesehen. Selbst die gefangenen und verringerten Großen in den Gatterdocks waren vor ihrer Bindung wohl nicht so riesig gewesen. Koaron suchte in den Gesichtern und Gesten seiner Mannschaftskameraden verräterische Anhaltspunkte dafür, dass auch sie aufgeregt waren, und er fand solche Anzeichen, wenngleich nicht in dem Maße, wie er selbst sie verspürte.
»Es ist ein Gäus«, erklärte ihm Glai, während sie beide die Webleinen hinabkletterten. »Drei Beine. Sechs Arme. Stacheln am ganzen Leib, die schwarz und gifttriefend sind. Und er hat keine Augen. Das bedeutet, er hört und riecht uns nur.«
»Aber er ist nicht wirklich blind«, ergänzte Koaron. »Frentes hat mir mal erzählt, dass Gäen mit ihren Stacheln Schwingungen aufnehmen können, so wie das Licht in unseren Augen eigentlich auch nur eine Schwingung ist.«
»Warum faselt Frentes immer einen solchen Quatsch? Licht schwingt nicht. Licht strahlt, das weiß jedes Kind. Und sieht jedes Kind.«
»Ja, aber irgendwie schwingt auch ein Strahl, glaube ich.«
»Behauptet Frentes.«
»Ja.«
»Du solltest nicht immer so viel Zeit mit ihm verbringen. Ohne seine tägliche Injektion Rauschöl kommt er überhaupt nicht mehr klar.«
»Das mag sein, aber mit Rauschöl kommt er klarer als die …«
»Konzentration an Deck, verdammt noch eins!«, mahnte Kapitän Renech nun wieder. Bakenala und Jitenji fierten bereits die beiden Beiboote hinab. Gilgel und Tsesin waren schon über die Reling. Kapitän Renech brauchte nicht zu klettern. Seiner Position entsprechend wurde er von Jitenji auf einer Querstange stehend hinabgekurbelt. Nur die beiden Steuerfrauen und der Wunden versorgende Smutje blieben an Bord. Selbst das Schiffsmädchen Voy nahm teil an der nun beginnenden Jagd, wenn auch nur als dienstbares Maskottchen im Hintergrund allen Geschehens.
Die Beiboote waren kleine, wendige Vier-Personen-Rollschlitten mit dreieckigen, stabil wattierten Segeln. Das eine war rot und kapitänswürdig mit grünen Mustern verziert, das andere von einem bläulichen Grau.
Der Kapitän – der für die Jagd seinen Dreispitzhut abgelegt hatte, weil allein der Fahrtwind ihm den dauernd vom Kopf gerissen hätte –, Gilgel, Voy und Bakenala bemannten das rote, Tsesin, Glai und Koaron das graue.
Koaron konnte den erfahrenen Tsesin gut leiden. Tsesins Vernarrtheit in Bakenala war zwar ein wenig peinlich und ließ ihn für sein fortgeschrittenes Alter ein wenig kindisch wirken, aber wenn Bakenala gerade nicht hinschaute oder nicht allzu aufdringlich in der Nähe war, war Tsesin ruhig und abgeklärt, und Koaron hatte schon seit Beginn dieser Reise das Gefühl gehabt, es mit Tsesin und Glai in einem Beiboot ziemlich gut getroffen zu haben. Glai übernahm das Segel, Tsesin das Steuerrad. Koaron hatte eigentlich nichts zu tun. Er stellte sich hinter Tsesin ins Heck und spähte voraus, eine Hand neben den Augen wegen des Sandes. Koaron mochte die Schutzbrillen nicht. Die Lichtreflexe in ihnen irritierten ihn immer, wenn es auf schnelle Reaktionen ankam, und außerdem wurde er den Eindruck nie los, dass sein Gesichtsfeld empfindlich eingeschränkt wurde. Also nahm er es lieber in Kauf, die ganze Zeit über die Augen zusammenkneifen zu müssen und dennoch ab und zu Sandtränen zu heulen.
Das Weiß gischtete um sie her, während der Wind die Segel prall machte und die beiden Beiboote Seite an Seite durch die Dünen schlüpften. Mit diesen Schlitten konnte man sogar Sprünge machen. Koaron hatte einen großen Teil seiner Jugend in den Sanddocks damit zugebracht, immer waghalsigere Kunsttücke mit Segelschlitten einzustudieren. Bis zu einem Zweifachen Taucher an der Hochrampe hatte er es gebracht, aber dann hatte er mit ansehen müssen, wie Wennim, einer seiner besten Freunde, ungenau absprang, falsch aufkam und sich das Rückgrat zerschmetterte. Wennim war heute noch ab und zu in den Docks anzutreffen, in seinem segelgesteuerten Räderstuhl, aber er war nur noch der bleiche, abgemagerte und zynische Geist seines früheren Freundes, und Koaron mied ihn, so gut er konnte. Er mied ihn und andere mitleidlose Erinnerungen an die Docks bis hierhin, bis weit in die winterliche Wüste hinaus. Seit Wennims Unfall hatte Koaron den Wunsch verspürt, die winkelige Enge der Docks gegen die unermessliche Weite der Wüste zu vertauschen. Er hatte eine kostspielige Schulungsfahrt an Bord der Miralbra Xxiii mitgemacht und aufgrund seiner dort gezeigten Fähigkeiten seine erste Heuer auf der Miralbra Vii erhalten. Und nun war er hier mitten im ewigen Aschewinter und hatte einen leibhaftigen Großen vor sich.
Die Sonne verwirbelte. »Ich kann ihn wieder spüren«, lachte Glai ihm schalgedämpft zu. »Er ist nahe.«
Koaron lächelte zurück. »Ich glaube langsam, du hast Stacheln an den Füßen, genau wie ein Gäus.«
»Wenn das stimmt, dann wird es besonders wehtun, wenn ich dich gleich trete.«
»Still, ihr zwei«, raunte Tsesin nach hinten. »Noch eine hohe Düne, dann haben wir ihn.« Also konnte auch Tsesin den Großen wahrnehmen. Wahrscheinlich aber nicht an den Vibrationen seiner Schritte, sondern aufgrund der Verwirbelungen des Staubes oberhalb des Körpers eines solchen Riesen. Das dachte sich Koaron zumindest, feststellen konnte er nichts dergleichen. Er hatte noch so unendlich viel zu lernen.
Sie nahmen die nächste Düne – und Tsesin hatte sich nicht geirrt: Da war er!
Der Gäus war immer noch zwei weitere Dünenketten entfernt, aber er ragte über diese hinaus wie ein wandelnder Berg. Zehn oder elf Mannshöhen, er war mindestens zehn oder elf Mannshöhen groß, wie zwei sechsstöckige Dockverladetürme übereinandergestapelt. Und er bewegte sich. Er ging ruhig seines Weges. Der Anblick war überwältigend! Der gedrungene Schädel des gigantischen Dämons verschwand beinahe in einer Sandbö, von der hier unten gar nichts zu spüren war. Dennoch vermeinte Koaron katzenartige Tasthaare rund um ein mit Hauern bewehrtes Maul ausmachen zu können.
Tsesin schaute zum Kapitän hinüber. Der gab die vertrauten Zeichen: Unbemerkt annähern! Umkreisen! Zu Fall bringen! Dann erst binden! Dieses letzte Zeichen machte er immer zweimal und besonders eindringlich, als ob schon jemals ein Sammler auf die Idee gekommen wäre, einen nicht zu Fall gebrachten Großen zu binden.
Die beiden Segler schwenkten in den Rücken des Riesen. Der Wind kam weiterhin beinahe von vorne, die Segel wurden von Bakenala und Glai in spitzem Winkel zur Windrichtung geführt. Koaron fasste nach einer der Beibootharpunen. Er hatte noch keine eigene, persönliche, so wie der Kapitän oder Gilgel oder Tsesin oder Glai. Dieses Privileg musste er sich erst noch verdienen, aber bis dahin durfte er sich von der in den Booten installierten Standardausrüstung bedienen.
Es kam ihm so vor, als würden die Beiboote langsamer werden, aber das täuschte. Der Riese bewegte sich mit gewaltigen Schritten, deshalb näherten sie sich ihm nur allmählich. Als Koaron sich nach der Miralbra Vii umblickte, war diese schon längst nirgendwo mehr zu sehen.
Das Beiboot mit dem Kapitän ging nun leicht in Vorlage. Dem Kapitän gebührte immer der erste Wurf.
Der Sand schrammte hoch mit dem Geräusch reißender Ketten und prasselte unablässig gegen Koaron. Die Beiboote verfügten über Schutzbleche, aber die schützten eher das Beiboot selbst, nicht seine Mannschaft. In solchen Situationen wünschte sich Koaron doch manchmal eine Schutzbrille oder sogar eine komplette Schutzmaske, wie Bakenala jetzt im Gefecht eine trug und auch der Kapitän, der mit Maske selbst wie ein Dämon aussah: eine silberfarbene, reißzahnige Metallfratze als Gesicht, deren Augen golden zu glänzen schienen und die sogar zwei abwärts gebogene Hörner aufwies. Aber spätestens, wenn es in den Nahkampf ging, würde Koaron ein uneingeschränktes Gesichtsfeld wieder zu schätzen wissen, das wusste er, denn das hatte er schon an Bord der Miralbra Xxiii so erfahren, nicht im Kampf, aber in einem Sandstaubsturm, bei großer allgemeiner Hektik.
Der Gäus bemerkte sie nicht. Das war ideal, denn wenn er sie wahrnahm und angriff, würde es von Anfang an schwieriger werden. Wenn er aber zu fliehen versuchte, hätten sie wahrscheinlich gar nicht die erforderliche Windstärke, um ihn einzuholen. Insofern mussten sie ihn von Anfang an umkreisen und am Entkommen hindern, das war das oberste Gebot.
Der Gäus stapfte dreibeinig und klobig wie ein stachelbewehrter Turm seines Weges und lauschte höchstens dem stetigen Donnern seiner eigenen Schritte. Seine Körperkonturen verschwammen dabei. Die Dämonen der Wüste waren nur bedingt stofflich. Dereiferer bezeichnete sie als »die Geister der unruhig Gefallenen«. Aber was sie an Masse besaßen, war allemal ausreichend, um sie als Kriegswerkzeuge gegen die Bescheidenen unverzichtbar zu machen.
Für einen Augenblick schürfte Tsesin mit seinem Beiboot in den Fahrsand des Kapitäns. Es war nicht zu vermeiden gewesen, Tsesin hatte einem Stein ausweichen müssen, aber nun gischtete so viel Dreck über ihn und seinen Schlitten, dass er kurzzeitig geblendet war und ins Schlingern geriet. Tsesin versuchte den Abstand wieder aufzuholen, Glai korrigierte den Mastwinkel, und durch geschicktes Steuern und versiertes Segeln kamen sie wieder an das rote Boot heran. Beide Beiboote sprangen beinahe gleichzeitig über den letzten Dünenkamm und krachten dahinter wolkenbildend ins Weiß. Der Gäus hörte sie immer noch nicht. Vielleicht war er nicht nur blind, sondern auch stocktaub. Oder aber – durchfuhr es Koaron mit einem Schaudern – er nahm dermaßen winzige Gegner überhaupt nicht für voll.
Der Kapitän umfuhr den Riesen steuerbords, Tsesin hielt sich nach backbord. Als der Kapitän fast um das Ungetüm herum war, schleuderte er seine Harpune. Sie durchquerte die Reichweite der seitlich schlenkernden Arme des Gäus und traf die rechte Hüfte. Als Befehlsgeber mochte Kapitän Renech seine Schwächen haben, aber als Harpunier machte ihm so leicht niemand etwas vor. Gilgel warf seine Glasharpune ebenfalls und traf eine der sechs Schultern in erstaunlich großer Höhe. Glai warf. Sie erwischte einen Schenkel. Koaron zielte noch. Die Harpune kam ihm während der schlingernden Bewegungen des Beibootes ungewohnt unhandlich vor. Die sechs Hände des Riesen irritierten ihn zusätzlich. Wie natürliche, ungewöhnlich bewegliche Schilde schienen sie den turmhohen Körper vor Angriffen abzuschirmen. Mit einem Ächzen warf Koaron und musste mit ansehen, wie sein Wurf fehlging. Die Harpune klatschte dicht neben dem Riesen in den Sand. »Ahhhh, nein!«, schrie Koaron und zerknüllte sich in dramatischer Geste die Staubmütze. »Wie kann man ein so großes Ziel verfehlen?«
»Man kann alles, wenn man nur genügend Talent dazu hat.« Glai grinste unverschämt.
Drei Harpunen steckten nun in dem Giganten. Schulter. Hüfte. Schenkel. Drei Fesselleinen, die die Beiboote mit den Harpunen verbanden. Jetzt kreisten die beiden Beiboote in gegenläufiger Bewegung um den Riesen, um ihn in die Schnüre zu verheddern. Der Kapitän und Gilgel hatten es am besten gemacht, denn je höher das Ziel getroffen wurde, desto geringer war die Chance, dass die Beiboote selbst mit den Leinen in Berührung kamen. Glais Schnur hing schon beinahe zu tief, aber nur beinahe. Jetzt beugte sich Tsesin, das Steuerrad nur noch einhändig führend – es war ohnehin ganz nach rechts eingeschlagen –, weit nach hinten und schleuderte seine Spezialharpune. Gleichzeitig Bakenala aus dem anderen Boot. Tsesin traf einen Oberarm genau im Muskel. Bakenala hatte auf den Kopf des Riesen gezielt und verfehlt, aber schon im Flug der Harpune holte sie mit großem Geschick die Leine wieder ein und die Harpune dadurch schon nach weniger als der Hälfte der Leinenlänge wieder zurück.
Koaron wollte sich seine Harpune ebenfalls wieder zurückangeln, doch Glai schnitt ihm ungerührt das Fesselseil durch. »Wir verheddern uns sonst. Die Harpune schleift im Sand und kann irgendwo hängen bleiben. Du bist einfach viel zu langsam, Junge.«
»Ich kann sie mir auch so wiederholen«, schnaufte Koaron und sprang seitlich über Bord. Tsesin rief etwas, aber das konnte Koaron beim Aufprall nicht hören. Er lag nun im selben Weiß, das die drei Titanenfüße aufrührten. Die Erde schien zu beben. Jetzt konnte er den Gäus ebenfalls spüren. Deutlichst.
Der Riese reagierte. Die Einstiche der Harpunen schien er kaum gespürt zu haben, doch die stabilen Leinen legten sich nun über seine Arme und um seine Beine und begannen, diese zusammenzuzurren. Er verhielt seine Schritte und blickte sich um. Mit zum Himmel erhobenem, hin und her schwankendem Gesicht wie ein blinder Mensch. Seine Barthaare und Körperstacheln zitterten. Und dann explodierte er.
Zumindest sah es so aus.
Er schoss seine Körperstacheln ab, mindestens einhundert von ihnen, die in alle Richtungen davonzischten. Der längste dieser Stacheln maß mehr als zwei Mannslängen.
Niemand hatte jemals einen Gäus so etwas tun sehen.
Tsesin konnte nicht mehr ausweichen. Er wurde in seinem Steuersitz gepfählt. Er schrie nicht einmal. Er starb womöglich auch vor Schreck. Das Geräusch von Fleisch und Leder und Metall, die sich mit Horn durchdrangen, war Schrei genug. Dafür kreischte Glai, als ihr Boot kenterte. Das Boot des Kapitäns dagegen wurde um Haaresbreite von gleich drei Stacheln verfehlt. Gilgel, der am Steuer saß, lenkte fluchend und wie rasend durch einen plötzlich vor ihm aufragenden Wald im Boden steckender Stacheln hindurch, konnte aber mindestens vier schürfende Kollisionen nicht vermeiden. Voy wurde wild hin und her gerüttelt. Bakenala sprang nach hinten ab und duckte sich, um von ihrer eigenen an der Leine hinter dem Boot herdengelnden Harpune nicht getötet zu werden.
Koaron fand sich plötzlich umgeben von vier schrittlangen, im Sand steckenden Stacheln wieder. Er blinzelte irritiert. Die Stacheln glänzten feucht und rochen scharf. Das von Glai erwähnte Gift.
Und dann erblickte er etwas, das die anderen womöglich noch gar nicht gesehen hatten: Die nach oben abgeschossenen Stacheln des Dämons beendeten ihren Steigflug und begannen wieder zu sinken. Es waren noch mindestens zwei Dutzend solcher tödlichen Geschosse im Himmel. Der Dämon stieß ein tiefes, befriedigtes Grollen aus.
»O Blannitt, o Blannitt, o Blannitt!«, beschwor Koaron den Gründer und legendären Beschützer von Aztrivavez und versuchte, wieder auf die Beine zu kommen. »Vorsicht!«, schrie er allen anderen zu. »Es regnet gleich Stacheln!« Doch niemand hörte ihn. Alle waren zu sehr in ihrem eigenen Lärm befangen.
Dem Kapitän galt Koarons Pflicht.
Aber Glai: Glai war seinem Herzen am teuersten.
Er rannte zu ihr hin.
Der Gäus war inzwischen stehen geblieben und nestelte mit seinen sechs Händen an den stabilen Spinnwebfäden herum, die ihn umgaben. Gilgel jedoch hatte das Unternehmen noch nicht aufgegeben. Er fuhr noch immer im Kreis um den Dämon herum, und indem er fuhr, verstärkte er die Fesselung der zwei Leinen, die von seinem Beiboot ausgingen. Kapitän Renech hatte sich eine weitere Bordharpune genommen und legte damit auf den Riesen an. Voy schrie aufgeregt etwas, das niemand verstehen konnte. Bakenala rannte zu Koarons herumliegender Harpune. Koaron erreichte Glai, die benommen an einem Dünenhang lag. Die fallenden Speere waren schon nahe. Koaron spürte, wie sich vor Furcht seine gesamte Haut zusammenzog, überall am Körper, denn die Fallkurven der Stacheln waren unglaublich schwer vorauszuberechnen. Sie waren nicht gerade und ausbalanciert wie echte Speere, sie bestanden aus Horn oder sonst was, niemand konnte wissen, ob sie innen hohl waren, einige schienen zu trudeln, sie kamen nur näher und näher und wurden dabei größer und größer. Zwei von ihnen zitterten sich aufreizend in Glais Richtung ein.
Koaron riss Glai aus dem Sand hoch und an sich. Der Gedanke, dass sie dort, wo sie bis eben noch gelegen hatte, sicher gewesen wäre und nun nicht mehr, brachte ihn beinahe zum Schreien. Der erste der beiden Speere schlug ein, zwei Schritte entfernt. Er hätte sie ohnehin verfehlt. Der zweite jedoch hielt genau auf sie beide zu.
Im Sanddock, vor einem besonders gefährlichen Sprung, hatte Koaron schon mehrmals einen solchen Augenblick erlebt. Dass der Tod sehr nahe war, sehr fassbar, sehr viel präsenter eigentlich als das Leben. Dem Leben musste man sich immer hinterherstrecken, für den Tod jedoch bedurfte es nur eines einzigen Atemzugs der Trägheit.
Er spürte das auch jetzt wieder. Tod war einfach. Leben bedeutete Mühsal.
Er stieß Glai so weit wie möglich von sich. Dadurch prallte auch er nach hinten. Der Stachel fuhr knirschend zwischen sie beide und blieb zitternd stecken wie das schwarz manifestierte Symbol einer Trennung.
Auch die anderen Stacheln prasselten nun ins Weiß. Koaron revidierte seine Meinung über Gilgel, den Poseur, den Schmierendarsteller, den ritualisierten Wichtigtuer. Gilgel lenkte, als sei er selbst ein Dämon, seinen Schlitten durch alle um ihn herum einschlagenden Projektile hindurch und behielt dabei immer noch Fahrt bei, obwohl niemand ihm mehr das Segel ausrichtete. Bakenala wurde beinahe getroffen, aber nur beinahe. Sie hatte nun Koarons Harpune ergriffen und warf sie mit einem wütenden Schrei dem Gäus abermals Richtung Kopf. Und diesmal traf sie. Die Harpune blieb im Nasenbereich des riesigen Ungetüms stecken.
Der Gäus brüllte. Dieses Geräusch klang, als würde die winterliche Wüste zerreißen.
Glai kam wieder zu sich. »Tsesin?«, stöhnte sie. »Ist er …?«
»Wir haben andere Probleme«, antwortete Koaron nur, denn der brüllende Riese packte nun seine Fesseln und riss an ihnen, sodass das Beiboot des Kapitäns aus seiner Bahn gezerrt wurde. Gilgel und der Kapitän sprangen heraus, Voy jedoch schien eingeklemmt zu sein. Vielleicht hatte sich der Rahmen durch die vorherigen Kollisionen mit den Stacheln verzogen. »Voy!«, entfuhr es dem Kapitän. Das Schiffsmädchen hob sich mitsamt dem Beiboot in die Luft, als der rasende Gäus sich zu schütteln begann. Sie schrie nicht mehr. Vielleicht hatte sie schon die Besinnung verloren.
Bakenala musste sich abermals ducken. Diesmal war es nicht nur eine Harpune, sondern ein ganzes Beiboot, das, von Leinen gehalten, über sie hinwegrauschte. Ihre Harpune kam noch hinterdrein – wie ein kläffendes und nach allem schnappendes Hündchen kapriolte sie wild durch die Luft.
Kapitän Renech gellte Befehle und zeigte mit den Armen rudernde Kommandos: »Alle über die Düne dort! Taktischer Rückzug!« Und er deutete auf ebenjene Düne, an der Koaron und Glai kauerten. Bakenala zögerte noch, ihre wächserne Gesichtsmaske schimmerte schön und unbewegt als Nachformung ihres eigentlichen Gesichts. Gilgel setzte sich bereits in Bewegung. Der Kapitän deckte Gilgels Rückzug und warf dann die einfache Beibootsharpune, die er immer noch in Händen hielt. Er warf sie hart und genau dem Dämon in die Kehle. Wieder spürte das der Riese, denn diese Harpune drang über die Hälfte ihrer Länge in ihn ein. Aus dem schüttelnden Brüllen wurde ein blubberndes Röcheln. Für einen Moment verschwanden die Konturen des Riesen. Dann bildeten sie sich neu. Er strauchelte, von Fesseln behindert, auf den Kapitän zu, der viel zu langsam rückwärts ging.
Gilgel rannte nicht genau in Richtung Koaron und Glai, sondern hin zu deren gekentertem Beiboot, dem graublauen, in dem noch immer Tsesin am Steuer saß und ausblutete, vermischt mit Gift. Gilgel sang etwas, während er die Beibootharpunen aus ihren Verankerungen klaubte und aus ihren Fesselleinen ausklinkte. Dieses Singen – so hatte Glai erst vor ein paar Tagen, als die Stunden noch langsam vergangen waren, erläutert – war eine Art Beten. Koaron hörte es zum zweiten Mal, das erste Mal war bei der Abfahrt aus dem Hafen gewesen. Gilgel warf ihm und Glai zwei leinenlose Harpunen hin, zwei behielt er selbst. Dann lief der Sammler singend zu seinem Kapitän zurück, um diesen gegen den Riesen in Schutz zu nehmen.
»Das ist Irrsinn«, ächzte Glai. »Die beiden haben doch keine Chance gegen das Viech. Und zu viert haben wir immer noch keine Chance!«
»Aber Voy ist noch da oben. Wir können Voy nicht im Stich lassen.« Koaron versuchte, sich an seine wenigen Begegnungen mit dem Schiffsmädchen zu erinnern. Sie war – wie alle Schiffsmädchen – ausgesprochen hübsch und ausgesprochen knapp bekleidet, aber als Neuester und Unerfahrenster unter den Sammlern hatte Koaron keinerlei Anrechte auf ihre vielfältigen Dienstleistungen gehabt. Sie waren immer nur in engen Kabinengängen aneinander vorbeigeschabt. Dennoch war sein Wunsch, sie zu retten, bezeichnenderweise größer als der, seinem Kapitän beizustehen. Sie war noch so jung. Und ein Anblick, der Freude machte inmitten der Wüstenödnis.
»Zieh dich hinter die Düne zurück«, sagte er zu Glai. »Der Käpt’n hat das so befohlen.« Er selbst jedoch rannte geduckt zu dem gekenterten Beiboot.
»Was hast du vor?«, fragte Glai ihm hinterher.
»Voy da rausholen«, antwortete er knapp und wuchtete an dem schweren Schlitten herum.
Gilgel hatte inzwischen den Kapitän erreicht, der sich mühte, dem Riesen auszuweichen. Der Riese zerrte an seinen Fesselschnüren. Das Beiboot mit Voy darin hing an dem mit neun Extremitäten versehenen Leib als ein klobiges Amulett. Bakenalas ursprüngliche Harpune wiederum schlenkerte an dem Beiboot wie der stachelbewehrte Schwanz eines Skorpions.
Glai zog sich immer noch nicht zurück. Die Harpune in ihrer Hand schien ihr neuen Mut zu verleihen. »Du kriegst das doch alleine nie in Fahrt, jemand muss dir das Segel ausrichten!«, rief sie Koaron zu.
»Ich kann sowieso nicht steuern«, antwortete Koaron hastig. »Tsesin ist … niemand könnte ihn da rauslösen. Ich werde den Schlitten mit dem Segel steuern. Keine Sorge, so was habe ich in den Docks schon tausendmal gemacht.«
»Aber das waren Einhandsegler, keine Vier-Mann-Beiboote!«
»Das ist doch dasselbe, nur in klein.«
»Das ist absolut nicht dasselbe. Das steuert sich ganz anders.«
»Hilf mir lieber, das verfluchte Ding aufzurichten, verflucht noch mal!« Als der Jüngere und Ungeübtere hatte Koaron kein Recht, der versierten Sammlerin Glai Befehle zu erteilen und dabei auch noch ausfallend zu werden. Aber das war ihm jetzt egal. Er wollteja auch gar nicht ausfallend werden. Er wollteGlai nicht anschreien. Er wollte nur den Schlitten flottbekommen. Aber durch Tsesins Leichnam und den in ihm steckenden massiven Dämonenstachel war das Beiboot zusätzlich beschwert.
»Lass es uns zusammen versuchen«, sagte Glai und meinte damit nicht nur das Aufrichten des Schlittens, sondern auch das, was Koaron danach vorhatte. Er begriff das und nickte dankbar.
Gilgel warf singend eine Harpune. Auch er hatte auf den Hals des Ungetüms gezielt, aber diesmal wehrte der Gäus mit einer Hand ab. Die Harpune blieb im Handrücken des Riesen stecken. Jetzt warf Kapitän Renech die Harpune, die Gilgel ihm gebracht hatte. Renech hatte sorgfältiger gezielt, er besaß sehr viel Erfahrung darin, die Bewegungsmuster vieler Arme vorauszuberechnen. Seine Harpune zischte zwischen drei Händen hindurch und traf den Dämon in die Stirn, dort, wo bei einem sichtbegabten Wesen die Augen gewesen wären.
Der Dämon schrie. Alle Harpunen waren von Demeiferer gesegnet und mit dickflüssigem Weißwasser bestrichen worden. Dämonen der Wüste vertrugen kein Weißwasser, das hatte sich vielfach erwiesen. Dieser hier war jedoch so groß und ungewöhnlich, dass man ihn wohl an einer besonderen Stelle erwischen musste, und Kapitän Renech hatte diese Stelle nun gefunden.
Der Gäus brach auf die Knie, sodass sämtliche Dünen ringsum ins Rutschen gerieten. Die Harpunenseile schnitten ihm dabei ins irisierende Fleisch, das nun abwechselnd unsichtbar, schwarz, dunkelrot und violett wurde. Gilgel und den Kapitän riss die Erschütterung von den Beinen. Das Beiboot, in dem Voy eingekeilt war, hüpfte nun nur noch zwei Mannslängen über dem Sand wie ein Korken auf bewegtem Wasser. Voys Kopf wackelte, als sei ihr Genick bereits gebrochen. Der Gäus fuhrwerkte sich mit drei Händen im Gesicht herum, zwei weitere wischten und hieben nach etwaigen Gegnern, ein Arm war durch die Seile an den Körper gebändigt.
Koaron und Glai stürzten durch die Erschütterung mit dem halb aufgerichteten Rollschlitten fast wieder hin, aber Glai stand auf der richtigen Seite, um ein neuerliches Kippen abzufangen. Sand rutschte vom Dünenhang gegen sie und stützte den Schlitten zusätzlich. Glai sprang an Bord und richtete das Segel. Der Wind fasste. Durch den Schlitten lief ein Ruckeln. Koaron flankte ins Innere, stellte sich über Tsesins Leichnam, fasste mit einer Hand ins Steuerrad, mit der anderen hielt er sich samt seiner Harpune an dem Stachel fest, der Tsesin getötet hatte.
»Wir müssen springen, um an Voy ranzukommen!«, brüllte er in Richtung Glai.
»Du bist verrückt!«, brüllte sie zurück. »Das ist kein Einhandsegler! Mit einem solchen Boot kann man nicht springen! Und pass auf das Gift von dem Stachel auf, verdammt noch mal!«
Koaron ignorierte das Letztere. Der Stachel war feucht, aber Koaron gut bekleidet. »Hast du eine bessere Idee? Er richtet sich gleich wieder auf. Diese Düne dort steht günstig!«
Der Kapitän und Gilgel waren unbewaffnet. Sie krochen umher, als hätten sie nun auch keine Augen mehr, und vielleicht stimmte das, denn die Erschütterung des Riesen hatte weißen Schwebsand in rauen Mengen aufgewirbelt, der allen in der Nähe Sicht und Atem nahm.
Wo war eigentlich Bakenala abgeblieben? Koaron erblickte sie. Sie kletterte an dem Seil, an dem ihre Harpune aus Voys Beiboot hing, aufwärts zu Voy.
»Verflucht!«, schimpfte Koaron schon wieder. »Bakenala wird uns in die Quere kommen. Lass es uns dennoch versuchen. Wenn wir scheitern, können wir vielleicht wenigstens den Dämon so hart rammen, dass er vollends zu Boden fällt.« So oder so ähnlich hatte er es zumindest Glai mitteilen wollen, aber was er in der neu aufbrandenden Geschwindigkeit, dem gegen ihn spritzenden Fahrtsand und dem überall wabernden Staub lediglich herausbrachte, war: »Verflucht! Bakenala! Dennoch! Können! Dämon! Rammen!« Glai verstand ihn nichtsdestotrotz. Zu zweit lenkten sie ihr Gefährt hinter Dünen aus dem Geschehen hinaus. Der Wind war eigentlich nicht stark genug für Sprungmanöver, aber Glai wusste, wie man das Möglichste aus Segel- und Maststellung herausholen konnte. Beiboote waren leicht gebaut, besonders wenn man, wie Gilgel das vorhin getan hatte, alle ihre Harpunen entnommen hatte. Es war nicht vollkommen ausgeschlossen, ein Dockkunststück zu vollführen. Es war nur sehr, sehr unwahrscheinlich mit dem toten Tsesin und dem in ihm steckenden Dämonenstachel an Bord.
Tsesins Kopf kippte nun nach hinten. Seine schreckgeweiteten Augen starrten Koaron entgegen, darunter, in der perspektivischen Verzerrung, sah Koaron das sich ausbreitende Blut wie einen roten Umhang oder ein rotes Kissen, auf dem Tsesin in seiner ebenfalls roten Kleidung saß. Es sah aus, als würden Tsesins Kleider schmelzen. Alles ging ineinander über. Oder wie eines jener scharlachflutenden Deckengemälde eines früheren Krieges, mit denen der sagenumwobene Meister Dirgin Kresterfell mehrere Gotteshäuser des alten Icrivavez geheiligt und somit vor der Zerstörung durch die Weiß-Sagung bewahrt hatte.
Während das Beiboot hinter den Dünen herumschlingerte und versuchte, auf einer alles andere als ebenen Strecke möglichst viel Fahrt aufzunehmen, zog Bakenala sich unermüdlich an dem Harpunenseil aufwärts, zwei Mannslängen hoch. Der Kapitän und Gilgel bemühten sich, aus dem Radius der umherwischenden Riesenarme zu gelangen. Der Gäus versuchte, sich die wie ätzend brennende Harpune aus dem Gesicht zu zerren. Gilgel sprang singend über eine der heranfauchenden Hände hinweg, aber Kapitän Renech wurde getroffen. Es schleuderte ihn vier Mannslängen nach hinten, aber eine Dämonenhand war nicht hart wie Stein. Stöhnend stemmte sich der Kapitän wieder hoch und versuchte weiterzukriechen, seine Bewegungen sahen lediglich langsamer und fahriger aus als vorher, und seine imposante silberne Fratzenmaske war ihm abhandengekommen.
Der Gäus bekam die Harpune in seinem Gesicht zu fassen und riss sie sich heraus. Aus der Wunde sprühte etwas, das wie Funkenflug aussah oder wie eine dunkle Flüssigkeit, was sich dann aber als fettiger Rauch entpuppte. Jetzt bekam er auch die Harpune in seinem Hals zu fassen und machte mit ihr das Gleiche. Seine Konturen wurden zu klarem Wasser, dann wieder wie zu Erz. Der fettige Rauch floss an ihm abwärts und duftete nach frisch erblühten weißen Rosen.