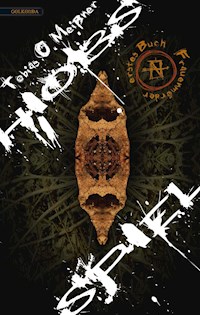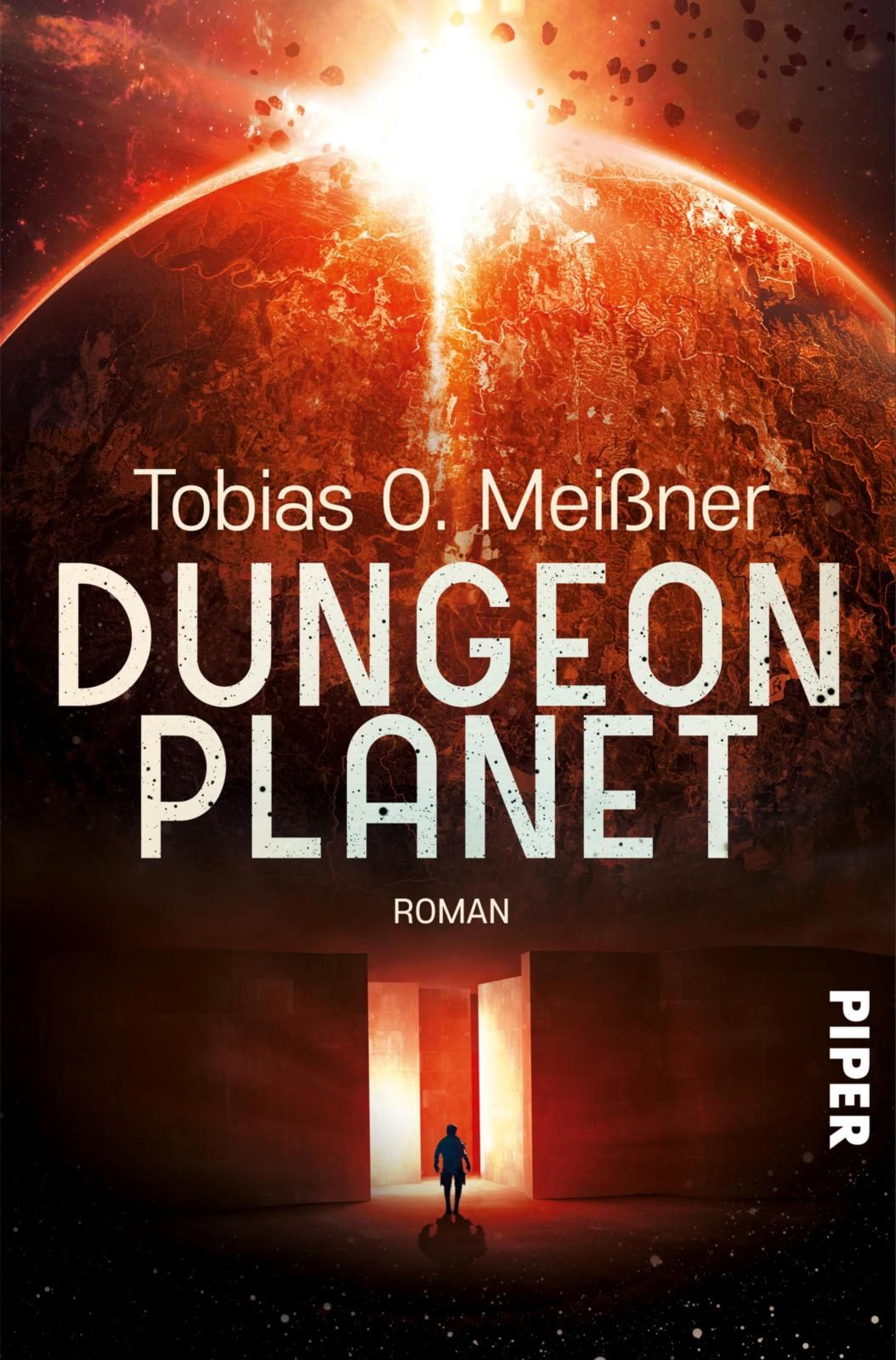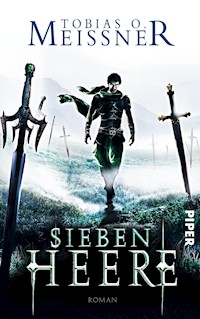2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Geheimbund des Mammuts erhält einen neuen Auftrag: In der Küstenstadt Wandry sollen Rodraeg und seine Gefährten ein Massensterben von Walen verhindern. Doch bereits auf der Reise nach Wandry gerät die Gruppe in höchste Gefahr: Ein Werwolf greift sie an und prophezeit, dass sie die Wale nicht werden retten können. Als Rodraeg die auf Pfählen errichtete Stadt erreicht, wird die Mission zur tödlichen Falle: Denn Wandry ist ein Labyrinth voller Attentäter, Verschwörer und intriganter Machthaber. Und eine Gruppe geheimnisvoller Krieger setzt alles daran, die Wale zu vernichten … Nach »Die dunkle Quelle« kehrt der neue deutsche Fantasy-Star Tobias O. Meißner in die faszinierende Welt des Mammuts zurück. Mit »Im Zeichen des Mammuts« hat er den spannendsten und innovativsten Fantasy-Zyklus der letzten Jahre geschaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ISBN 978-3-492-98066-1
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2013 © Piper Verlag GmbH, München 2006 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © MelliMoor / shutterstock.com Karte: Ehrhard Ringer Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2006
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Prolog
Es war um die Mitte des Wiesenmonds. Ein früher Abend.
Der Mann ging über sein Feld. Die Heuernte hatte noch nicht begonnen, für einen Bauern gab es wenig zu tun in diesen Wochen. Alles Säen und Pflanzen war geschehen, der lästige Maulwurf war – obwohl der geizige Bürgermeister sich wieder nicht an den Unkosten beteiligt hatte – von dem Fachmann Jerik Trinz vertrieben worden, das Wetter war nicht so trocken, daß das Feld gewässert werden mußte, und nicht so naß, daß Fäulnis zu befürchten stand. Die Hundsrosen blühten in den Hecken und erfüllten den milden Wind mit ihrem Duft, das Feld wogte und knisterte in Schattierungen von prachtvollem Gelb und unreifem Grün.
Geduldig begutachtete Pargo Abim hier und da den Stand des Roggens und den Wuchs des für das Futterheu wichtigen Weißklees. Er war allein auf dem Feld, Frau und Tochter waren im Haus. Um so mehr irritierte es ihn, als er aus den Augenwinkeln plötzlich eine Bewegung wahrnahm. Er wandte sich um.
Dort standen vier Männer, mitten in seinem Feld. Vier Männer, die ein paar Augenblicke zuvor noch nicht da gewesen waren. Um sie herum flimmerte die Luft wie in der Glut des Hochsommers, doch das Flimmern ließ nach und verschwand. Die vier kamen auf Pargo Abim zu, es war zu spät für ihn, sich noch zu verstecken oder zur Flucht zu wenden. Sie waren nur fünfzehn, zwanzig Schritte entfernt und würden ihn im Nu erreicht haben.
Was waren das für Gestalten? Groß waren sie alle, groß und breitschultrig, der Vorderste maß über zwei Schritt. Gekleidet waren sie in verschiedenfarbige Felle wie im tiefsten Winter, obwohl das Wetter warm und angenehm war. Sie trugen Waffen: Schwerter, Doppeläxte, Speere, eigenartig verbogene Armbrüste, massive, lederumwickelte Bögen. Der Vorderste trug ein verziertes Metallrohr anstatt eines Schwertes. Alle waren sie vollbärtig, mit düsteren, sturmgegerbten Gesichtern. Ihre Haare waren geradezu absurd; Pargo Abim hatte in Kuellen noch nie dergleichen gesehen, obwohl ab und zu Waldläufer aus dem Larnwald hierherkamen, die auch eine verrückte Haartracht hatten. Aber einer der vier trug nur einen hohen Haarkamm in der Mitte des Kopfes, der Rest seines Schädels war rasiert. Ein anderer hatte ebenfalls eine Glatze – bis auf zwei lange Zöpfe, die wie Hörner oben aus seinem Kopf sprossen. Der dritte hatte seine Stoppeln wie ein Schachbrett gefärbt und gestutzt. Der Vorderste hatte lange Haare fast bis zum Gurt, aber die Farbe war vollkommen unnatürlich: ein dunkles Blau, beinahe schwarz wirkend, aber nichtsdestotrotz ein Blau.
Pargo Abim stand erstarrt, wie ein Kaninchen vor einem speicheltriefenden Raubtier.
Die vier Männer kamen auf ihn zu – und gingen an ihm vorüber. Sie beachteten ihn überhaupt nicht. Ihr Weg kreuzte nur ungefähr den seinen, lediglich der mit den Haarhörnern schritt direkt an ihm vorbei und berührte ihn an der Schulter, wie um ihn besser umschiffen zu können oder wie um zu sagen: »Fürchte dich nicht, Bauer. Weder du noch dein Feld sind für uns von Belang.«
Sie gingen Richtung Nordwesten, das Getreidefeld mit einer vierfachen Spur durchziehend. Was lag in dieser Richtung? Tagelang nur Wald; der Larn, in seiner selbst vom Frühsommerlicht kaum zu durchdringenden Finsternis. Dann die Stadt Tyrngan, mitten in den Kjeerklippen. Dahinter die Klippenwälder und irgendwann das Meer, aber darüber wußte Pargo Abim nichts Genaues. Er hatte das Meer noch nie gesehen. Der Bruder seiner Frau hatte ihm davon erzählt, von blauen Wellen bis hinter den Horizont, von riesigen Fischen und schuppenbedeckten Ungeheuern, aber Pargo Abim hatte nur die Schultern gezuckt und »Aha« gesagt.
Wo waren die Männer hergekommen?
Pargo Abim ging zu der Stelle, wo er sie zuerst erblickt hatte. Hier begann ihre Spur, begann einfach so, mitten im Getreidefeld. Der Bauer untersuchte den Boden, als ob die vier Männer vielleicht aus einem Maulwurfsloch gekrochen seien, das Jerik Trinz übersehen hatte, doch da war nichts, der Boden war eben und fest. Langsam blickte Pargo Abim hinauf zum Himmel, der blau und klar und ehrlich war, aber dennoch keine Antworten gab.
1
In Ruhe
Rodraeg erschien als letzter zum Frühstück.
Zum ersten Mal hatte er in seiner engen, lichtlosen Kammer richtig tief und entspannt schlafen können. Vorher hatte er nicht zu schätzen gewußt, was das bedeutete – ein eigenes Bett. Einundvierzig Tage Sklavenarbeit in einer giftdurchwehten Höhle hatten das gründlich geändert.
Er betrachtete die anderen.
Naenn, das Schmetterlingsmädchen, das ihn aus seiner Existenz als Rathausschreiber herausgelöst hatte, so, wie man eine Muschel von einer Muschelbank löst. Vorsichtig genug, um die Schale nicht zu zerbrechen, aber dennoch mit Bestimmtheit. Mit ihrer Magie hatte sie hineingeleuchtet in diese Muschel und ein Sandkorn darin entdeckt, das eines Tages eine Perle werden könnte. Und dennoch war es für Rodraeg bislang nichts weiter als Sand.
Naenn sah müde aus, sie hatte dunkle Schatten unter den Augen. Ihr ohnehin bleiches, zart-schönes Antlitz wirkte noch zerbrechlicher als sonst, wie angespannt unter einem inneren und äußeren Druck, den Rodraeg sich nur teilweise erklären konnte. Er vermied es, ihrem Blick zu begegnen, aber er konnte selbst aus den Augenwinkeln stets Glut sehen dort, wohin sie ihren Blick richtete.
Cajin Cajumery, der Junge neben ihr. Blond, sonnig, freundlich, nichts wissend von dem düsteren und blutbesudelten Geheimnis seiner Herkunft. Er war der Verwalter und Instandhalter dieses Warchaimer Häuschens, das der Kreis finanzierte, damit die Gruppe namens Mammut ihrer Arbeit nachgehen konnte. Cajin kochte, putzte, wusch, kümmerte sich gemeinsam mit Naenn um Korrespondenzen, hatte sämtliche Schlafstätten selbst gezimmert und machte nebenbei noch Hilfsarbeiten für verschiedene Handwerker, um die Unkosten des Mammuts möglichst gering zu halten. Ihm war es zu verdanken, daß Naenn und er in den zwei Monden, die die anderen fort gewesen waren, mit den wenigen Talern, die Rodraeg ihnen dagelassen hatte, hatten auskommen können.
Cajin gegenüber saß Bestar Meckin, der große, muskelbepackte Klippenwälder. Hinter seinem häßlichen Gesicht mit den schiefen Zähnen und der breiten Nase verbarg sich eine treue und verantwortungsbewußte Seele, soviel war schon während ihres ersten gemeinsamen Einsatzes deutlich geworden. Zweimal war Bestar schwer verwundet worden, noch immer litt er unter der Bauchverletzung, die ein geschleuderter Speer ihm zugefügt hatte, aber er ließ sich nichts anmerken. Er scherzte und lachte mit Cajin und versuchte auf unbeholfene Art, einen guten Eindruck auf Naenn zu machen, der er aber allein schon wegen seiner enormen körperlichen Präsenz unheimlich war.
Neben Bestar schließlich Hellas Borgondi. Hellas hatte sich den dunklen Bart, der verriet, daß seine weißen Haare nicht natürlich waren, längst wieder abgenommen, so daß er älter aussah, als er eigentlich war. Älter und einsamer. Er reiste mit ihnen, aß mit ihnen, sprach mit ihnen, lachte sogar mit ihnen, aber zwischen ihm und allem anderen stand eine unsichtbare Mauer. Hellas tötete ohne Skrupel. Bestar hatte im Talkessel bei Terrek ebenfalls mehrere Menschen erschlagen, aber er hatte dabei jedesmal sich selbst, den eigenen Leib in die Waagschalen geworfen. Hellas dagegen war ein Bogenschütze, ein sehr begabter Bogenschütze – er tötete aus der Distanz. Sogar die königliche Armee hatte ihn vor Beginn ihres zwielichtigen Affenmen schenfeldzuges als Ausbilder angeheuert. Aber dort hatte Hellas einen Magier getötet und war desertiert. Rodraeg fand es nach wie vor gut, im Ernstfall jemanden wie ihn dabeizuhaben, aber bevor er sich wirklich wohl fühlen konnte mit dieser kleinen Truppe, mußte es ihm erst noch gelingen, Hellas davon zu überzeugen, daß es oft sinnvoller war, mit einem Pfeil zu warnen, statt gleich zu töten.
Einer fehlte bereits. Migal Tyg Parn, Bestars Kindheitsfreund aus Taggaran, hatte das Mammut verlassen und war zu einer anderen Gruppe namens Erdbeben übergelaufen, die skrupelloser war und weniger nachdenklich und somit deutlich mehr Spaß verhieß. Daß Bestar geblieben war – darüber staunte Rodraeg immer noch.
Er schob sich den Rest eines frischen Brötchens in den Mund, kaute, hustete kurz und begann dann seine für den heutigen Morgen geplante kleine Ansprache.
»Mit den fünfhundert Talern, die uns Riban mitgebracht hat, haben wir jetzt 504 Taler zur Verfügung. Ich kann euch also erstmals euer redlich verdientes Geld auszahlen. Ursprünglich dachte ich an dreißig Taler pro Kopf und Mond, aber nun hat unser erster Auftrag schon zwei Monde gedauert, ich muß jetzt aufpassen, daß das Geld nicht gleich wieder weg ist. Deshalb habe ich mir folgenden Auszahlungsschlüssel überlegt: Bestar und Hellas erhalten – auch als Entschädigung für die Gefangenschaft, die sie unter meiner ziemlich hilflosen Führung erdulden mußten – jeweils fünfzig Taler. Ich selbst nehme dreißig Taler. Ich bin zwar nicht der Meinung, daß ich mir einen Lohn wirklich verdient habe, aber es ist sinnvoll, auf Reisen etwas Handgeld dabeizuhaben. Wir haben das letztes Mal erlebt, als wir uns die Rückreise kaum noch leisten konnten. Von meinen dreißig Talern bekommt Hellas noch mal zehn, denn er hat mir zehn Taler geliehen, damit ich mir den Oobokopf von Benter Smoi kaufen konnte. Nun zu Naenn und Cajin. Ich bin mir sicher, daß beide jetzt die Hände heben und abwehren werden, aber auch sie haben sich Lohn verdient. Es ist nicht hinnehmbar, daß ihr in Warchaim am Hungertuch nagt, während wir im ganzen Kontinent von Gasthaus zu Gasthaus reisen. Etwas weniger als für den Einsatztrupp, aber doch immerhin: jeweils zwanzig Taler für Naenn und Cajin. Das macht insgesamt 170 Taler Lohnkosten, dann bleiben uns immer noch 334 Taler übrig. Von diesen Talern werden wir uns heute ein paar grundlegende Besorgungen leisten. Jeder von uns soll sich einmal neu einkleiden können, Hellas braucht einen Bogen aus der Fertigung der Ehefrau Baitz, und Bestar soll einen Brustpanzer aus Hartleder bekommen. Sonst mache ich mir zu große Sorgen um deine Wunden.«
»Das … das geht doch nicht«, haspelte Bestar erschrocken. »Du kannst mir nicht fünfzig Taler zahlen und dann noch ’ne Rüstung. Ich weiß, was die für einen in meiner Größe kostet: volle hundert Taler.«
»Ja. Hundert für deine Rüstung. Hundert für einen wirklich erstklassigen Bogen, etwa zehn für jeden von uns an Kleidung -bleiben immer noch 84 Taler übrig. Das sollte doch wohl reichen bis zur nächsten Geldlieferung.«
»Wir wissen nie, ob und wann Riban wieder etwas schicken kann«, gab Naenn zu bedenken.
»Bestar hat recht«, mischte auch Hellas sich ein. »Du verteilst zuviel Geld. Wenn Bestar und ich jetzt mit mehr als fünfzig Talern herumlaufen und wir wieder in Gefangenschaft geraten, dann ist das Geld einfach weg.«
»Das wird nicht noch einmal passieren«, sagte Rodraeg bestimmt. »Außerdem: Wenn ihr befürchtet, daß euch das Geld unterwegs abhanden kommen könnte, dann laßt es doch hier im Haus auf euren Zimmern. Dafür ist so ein Haus ja da. Ich finde es jedenfalls sinnvoller, das Geld innerhalb der Gruppe zu verteilen, als es in einer Truhe zu horten. Wenn jemand hier einbricht und die Truhe stiehlt, sehen wir ziemlich alt aus, denn dann haben wir gar nichts mehr.«
»Wahnsinn«, hauchte Bestar, dem wie den anderen auch dämmerte, daß Rodraeg von seinem Vorhaben wohl nicht mehr abzubringen war. »Fünfzig Taler und eine Lederrüstung! So reich war ich noch nie!«
»Du mußtest auch ziemlich viel durchmachen, um so reich zu werden«, lächelte Rodraeg. »Kommt, eßt auf, wir gehen einkaufen.«
»Mmh – der Brief!« platzte es aus Cajin heraus. »Wann öffnen wir endlich den zweiten Auftragsbrief?«
»Eins nach dem anderen, Cajin. Eins nach dem anderen.«
Das Bekleidungshaus Vierfaden in der Nähe des Adelsbezirkes war in Warchaim die erste Adresse für erschwingliche Kleidung. Das Mammut sah sich hier in aller Ruhe um, probierte an und aus, lief voreinander auf und ab und hatte eine Menge Spaß. Für Schuhe reichte das Geld nicht, aber die vier Männer kauften jeweils neue Hemden und Hosen, Strümpfe, Lendenschurze und ärmellose Unterhemden. Naenn bekam ein Kleid, das zwar einfach war und von unverziert dunkelgrauer Farbe, in dem sie aber dennoch sehr weiblich aussah. Sie lächelte beinahe, als sie es den anderen vorführte.
Rüstungen, die zu mehr taugten, als nur gut auszusehen, gab es nicht im Vierfaden, und auch im großen Ausrüstungsladen von Bep Immergrün waren zwar normale Ausführungen vorrätig, aber nichts in Bestars Größe.
Auf dem großen Rathausplatzmarkt wurden sie fündig. Eine selbst in enges Leder geschnürte Lederschneiderin namens Cobeni Zayl nahm Bestar Maß – seine »Flügelspannweite«, wie sie es nannte – und versprach, für einhundert Taler bis morgen abend einen stabilen Harthautpanzer anzufertigen.
Vom Markt aus waren es dann nur noch ein paar Schritte bis zur Schmiede von Teff Baitz. Hier unterhielt Hellas sich ausführlich mit Lerte Baitz, der Frau des Schmiedes, während ihr Mann mit verschränkten Armen im Hintergrund stand und überwachte, was vor sich ging. Lerte Baitz war eine geübte Bognerin und hatte, wie sie stolz betonte, ihr Handwerk in Galliko gelernt, wo es die berühmtesten Schützenregimenter des Kontinents gab. Hellas ließ sich von ihr vier unterschiedliche Langbögen zeigen, konnte sich zwischen den beiden längeren jedoch nicht entscheiden.
»Das ist nicht so einfach, Rodraeg«, raunte er zur Seite hin. »Ein guter Bogen für hundert Taler will wohl gewählt sein. Gib mir den Rest des heutigen Tages, dann gehe ich wieder zur Straße mit der Vogelscheuche und finde in Ruhe heraus, welcher mir am meisten liegt.«
»Gut. Ich würde gerne mitkommen und dir zuschauen, aber ich will mit den anderen noch ein wenig Warchaim erkunden. Nimm die hundert Taler und laß sie hier beim Ehepaar Baitz, als Pfand, als Anzahlung, als Zeichen unserer Vertrauenswürdigkeit.«
So machten sie es. Hellas ging mit drei Köchern voller Pfeile und zwei Langbögen Richtung Miura aus der Stadt, und die anderen machten bei dem wunderschönen Wetter einen ausgedehnten Spaziergang, der sie bis hinunter zur Larnusbrücke führte.
Auf dem Rückweg nordwärts Richtung Stadt kamen sie an einem kleinen Haus vorbei, das auffällig abseits von allen anderen Gebäuden stand. Ringsum war fast fünfzig Schritt weit freies Feld, während sich die Warchaimer Gebäude ansonsten gegenseitig in die Höhe drängelten. »Diese Hütte dort ist äußerst interessant«, erläuterte Cajin. »Niemand traut sich in der Nähe zu wohnen, weil hier unheimliche Dinge vorgehen sollen. Die Hütte gehört den Dulfs, drei Brüdern, die auch die Dreimagier genannt werden.«
»Hast du sie schon mal zu Gesicht bekommen?« fragte Rodraeg.
»Nein. Es heißt, sie führen ein sehr zurückgezogenes Leben und lassen sich ihre Nahrungsmittel liefern. Einer, den ich mal befragt habe, sagte, die Dreimagier seien noch recht jung, aber eine alte Frau wiederum hat mir erzählt, daß es die drei schon gab, als sie noch ein Kind war. Jedenfalls sind sie keine Bedrohung für die Stadt, höchstens für Unbefugte und allzu Neugierige, die sich an ihr Häuschen heranpirschen wollen.«
»Hmm«, brummte Rodraeg nachdenklich. »Man läßt sie gewähren, obwohl man nicht versteht, was sie eigentlich treiben. So etwas in der Art möchte ich für das Mammut auch gerne erreichen.«
»Meinst du, wir sollten Kontakt mit ihnen aufnehmen?« fragte Naenn.
»Eines Tages sicherlich. Wenn es sie wirklich schon so lange gibt, dann gehören auch sie zum geheimen Wissen Warchaims, das wir nutzen müssen. Aber im Moment sollten wir erst einmal unseren zweiten Auftrag abwarten, bevor wir drei rätselhafte Magier auf uns aufmerksam machen.«
Als sie weitergehen wollten, blieb Naenn noch stehen und blickte zu dem Magierhäuschen hinüber. Sie zitterte leicht.
»Was macht denn der Junge da?« fragte sie.
»Welcher Junge?« Rodraeg konnte niemanden sehen. Auch Cajin und Bestar machten ratlose Gesichter.
Naenn schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Ich muß mich getäuscht haben. Er sah wie ein Schmetterlingsjunge aus. Zwölf, dreizehn Jahre alt.«
»Jemand, den du kennst?« fragte Rodraeg besorgt.
»Nein. Ich muß mich getäuscht haben. Da ist niemand.«
»Sollen wir hingehen und nachsehen?« schlug Bestar vor.
»Nicht nötig.« Erneut durchlief sie ein Schauder. »Da ist nichts.«
»Hier sind wahrscheinlich Energien am Werk, genau wie im Tempelbezirk«, mutmaßte Rodraeg. »Für so was bist du empfänglicher als wir, deswegen konntest du etwas sehen. Oder die Dreimagier versuchen, mit dir Kontakt aufzunehmen, weil sie gespürt haben, daß draußen ein Schmetterlingsmensch vorbeigeht. Du kannst das selbst am besten einschätzen. Sollen wir jetzt zu ihnen hingehen oder lieber nicht?«
»Bitte nicht«, sagte Naenn beinahe flehentlich. »Ich bekomme hier Kopfschmerzen. Laß uns weggehen von hier. Laßt uns doch lieber irgend etwas … Lustiges tun.«
»Au ja«, sagte Bestar. »Eine Keilerei am Hafen!«
Naenn ließ sich nicht beirren. »Cajin hat mir von diesem Volkstheater erzählt: Lachende Maske. Wollen wir nicht alle zusammen ins Theater gehen? Ich war noch nie in einem Menschentheater.«
»Na gut«, zuckte Rodraeg die Schultern. »Ist denn da tagsüber schon etwas los?«
»Das ist ein Volkstheater, keins für den gehobenen Abendgeschmack«, erläuterte Cajin grinsend. »Es gibt zwei Vorstellungen tagsüber, und eine mit etwas derberem Inhalt nach Einbruch der Dunkelheit.«
»Also los.« Rodraeg machte ihnen Beine. »Gehen wir ins Theater.«
Die Lachende Maske lag am westlichen Stadtrand im Schatten des Adelsbezirkes und unweit der Straße Richtung Aldava. Ein einstöckiges Gebäude mit einer bunt bemalten Fassade, auf der unterschiedliche Fabelwesen und Kostüme dargestellt waren. Ein Mammut war unter den abgebildeten Sagengestalten nicht zu finden.
Das Stück, das zur Zeit mehrmals täglich gegeben wurde, hieß Der nasse Rock – ein volkstümlicher Schwank mit etlichen turbulenten Szenen, wie die Kartenverkäuferin versicherte. Vorstellungsbeginn war in einer Drittelstunde. Rodraeg kaufte die Sitzplatzkarten, und dann setzten sich die vier auf eine runde Bank im Innenhof, tranken Apfelwein und knabberten an frischen Brezeln.
Außer ihnen fanden sich etwa ein Dutzend weitere zahlende Zuschauer ein, so daß der Bühnenraum, in den vielleicht fünfzig Personen paßten, alles andere als voll war. Rodraeg, Naenn, Cajin, Bestar – so plazierten sie sich nebeneinander in die fünfte Reihe und warteten gespannt darauf, daß der flickenübersäte Vorhang sich hob.
Was sich in den nun folgenden anderthalb Stunden abspielte, konnte bestenfalls als billig bezeichnet werden. Die Hauptdarstellerin lief pausenlos in tropfnasser Wäsche durch die Papierkulissen, und die hauptsächliche Komik des Stückes schien darin zu bestehen, sie immer wieder aufs neue mit Wasser zu übergießen oder in Bottiche zu tunken und anschließend Witze über ihre deutlich sichtbaren Brüste zu reißen. Darum herum gab es ein paar Raufereien zwischen mehreren absurd herausgeputzten Galanen, eine Gesangsnummer mit einem rempeligen, auf dem Bretterboden dröhnenden Gruppentanz und eine Verfolgungsjagd zwischen den Sitzreihen der Zuschauer, bei der die Zuschauer auch ihren Gutteil Wasser abbekamen. Bestar lachte laut und dröhnend, besonders die unwahrscheinlichen Prügeleien ließen ihn auf dem Sitz vor Belustigung vor- und zurückzucken, während er auf das Geschehen deutete und Cajin Einzelheiten erzählte, die jeder sehen konnte. Cajin wurde von Bestars prustendem Gelächter angesteckt und steigerte sich ebenfalls in ausgelassene Albernheit. Naenn saß mit gerötetem Gesicht steif da und hielt ab und zu die Hände vor die Augen. Keine einzige Pointe zündete bei ihr, es war geradezu rührend, mit anzusehen, wie sie zweimal höflich lachte, in Szenen, die fast gar nicht komisch waren. Rodraeg war das Ganze äußerst peinlich. Aus der Hauptstadt war er anspruchsvolles Theater gewöhnt, bei dem die Schauspieler nicht einfach nur laut, sondern begabt und mitreißend waren. Von der Lachenden Maske fühlte er sich regelrecht verschaukelt. Zu allem Überfluß überfiel ihn im zweiten Akt ein Hustenreiz, den er nicht mehr unter Kontrolle bringen konnte. Minutenlang versuchte er, den Husten zu unterdrücken, aber immer wieder platzte es bellend aus ihm hervor, bis zwei Zuschauer sich bei ihm beschwerten, weil sie dem Krawall auf der Bühne nicht mehr folgen konnten.
Der Husten wurde schlimmer. Rodraeg bekam Schmerzen und Schwierigkeiten beim Atmen. Naenn sah ihn besorgt an.
»Ich gehe kurz raus«, würgte er mühsam hervor. »Das hat keinen Sinn so.«
»Soll ich mitkommen?«
»N-n. Du … verpaßt ja sonst… das tolle Finale.«
Hustend und röchelnd verließ er das Gebäude. Draußen an der runden Sitzbank beugte er sich vornüber, stützte die Hände auf die Knie und hustete, bis ihm fast schwarz vor Augen wurde.
Die Vergiftung. Es gab kein Entkommen. Das Schwarzwachs, das er während der Gefangenschaft eingeatmet hatte, wütete und wucherte in seinem Inneren wie ein Tier, das den Ausbruch aus einem zu engen Käfig begehrte.
Als der Anfall vorüber war, war Rodraeg naßgeschwitzt und ausgelaugt. Mit unsicheren Schritten ging er zu der Kartenverkäuferin hinüber und erklärte ihr, daß sie seinen Freunden, wenn die Vorstellung vorüber wäre, ausrichten solle, er sei noch eine Besorgung machen gegangen und komme dann nach Hause.
Da er sich nicht mehr erinnern konnte, wo der Kräuterladen sich befand, den Cajin ihm auf dem Stadtplan bezeichnet hatte, mußte er zuerst zum Haus des Mammuts zurück. Er umrundete die Mauern, mit denen Baron Figelius sich und sein Anwesen vom Rest der Stadt abgrenzte, kam erneut am Vierfaden und bei Bep Immergrün vorbei und schloß die Tür seines neuen Zuhauses auf. Nach dem Frühstück hatte Cajin jedem von ihnen einen eigenen Schlüssel ausgehändigt.
Hinten rechts in seinem kleinen Schreibzimmer hing Warchaims Stadtplan an der Wand. Der hölzerne Oobokopf auf dem Schreibtisch strahlte Ruhe und Würde aus und half Rodraeg dabei, die neuen Hustenwallungen niederzuhalten. Er verglich die fünfzig Zahlen auf dem Stadtplan mit den fünfzig Beschriftungen auf der linken Seite und fand schließlich, was er suchte: Nummer 41, Samistien Breklaris, Kräuter & Drogen. Zwei Häuser östlich von der Schmiede des Teff Baitz, gar nicht weit entfernt vom Tempelbezirk. Dort hatte Rodraeg ohnehin noch einen Besuch abstatten wollen. Er fürchtete sich zwar ein wenig davor, Priester ins Vertrauen zu ziehen, aber angesichts der Rätsel um Quellen, Zahlen und die Götter gab es wohl keine andere Möglichkeit, als jede sich bietende Informationsmöglichkeit auszuschöpfen.
Erneut ging er Richtung Markt. Der Tag neigte sich dem Abend entgegen, das Blau des Himmels wurde langsam stumpf. Eine Dreierpatrouille Stadtgardisten kam ihm entgegen und passierte ihn. Auf dem Marktplatz wandte sich Rodraeg nach Süden, dann nach Osten auf die Miurastraße, die auch Hellas genommen hatte, um sich mit seinem neuen Bogen anzufreunden. Das Geschäft von Samistien Breklaris war schwer zu finden. Es lag nicht direkt an der Straße, sondern weiter hinten in einem Hof, am Ende eines wahren Labyrinths von kreuz- und querstehenden Häusern, Hütten, Zäunen und Mauern. Der Laden war noch winziger als das Haus des Mammuts. »Kräuter & Drogen« stand über dem Eingang.
Als Rodraeg die Tür öffnete, die nur halb so breit war wie gewöhnliche Türen, bimmelte ein darüber angebrachtes Glöckchen. Eine Treppe führte ein paar Stufen hinab. Der Laden lag tiefer als die Straße und war nur von Kerzen und einigen Glutbecken erhellt. Der Geruch war überwältigend. Rauch und Gewürze, Kräuter und Aromaöle. Rodraeg mußte erneut husten.
Samistien Breklaris war ebenso hoch und schmal wie seine Tür. Der Eindruck von länglicher Verzerrtheit wurde noch verstärkt durch den seltsamen, federgeschmückten Hut, den er trug. Sein Gesicht war dunkel und faltig, überwuchert und beherrscht von einem schwarzen Rauschebart und einer markanten Nase.
»Ihr wünscht? Etwas gegen Husten, nehme ich an?«
»Ich bin auf der Suche nach Marionettengras. Habt Ihr das vorrätig?«
»Marionettengras. Ihr meint Mastiges Fettengras?«
»Nein. Marionettengras. Eine Heilerin namens Geskara hat es mir in Terrek gegeben. Man kann es kauen und bekommt davon grünen Speichel. Es hat mir gut geholfen.« Rodraeg beschrieb das Aussehen des Grases. Der Kräuterhändler zog die Stirn kraus. Dann wandte er sich um, öffnete eine Schublade und hielt Rodraeg einen in voller Blüte getrockneten Halm hin.
»Das hier. Ihr meint das hier.«
»Ja, das ist es! Habt Ihr auch frisches?«
»Das ist Grüner Fadenwurz. Den habt Ihr frisch gekaut.«
»Ja. Mehrere Tage lang.«
»Da ist Euch eine seltene Ehre zuteil geworden. Grüner Fadenwurz wächst nur in unzugänglichen Gebieten des Nekeru-Gebirges, das, zugegebenermaßen, von Terrek nicht allzu weit entfernt ist, aber immerhin noch fünf Tagesreisen.«
»Aber das verstehe ich nicht. Es war frisch gepflückt. Ein ganzes Büschel davon.«
»Nun, womöglich hat diese Geskara eine Methode entwikkelt, den Fadenwurz bei sich im Garten wachsen zu lassen.«
Rodraeg fiel in diesem Augenblick ein, daß er sich noch gar nicht Naenns Kräutergarten angesehen hatte. Seit zwei Monden war sie dort am Zupfen und Jäten, und er hatte das vollkommen vergessen. Hoffentlich war sie ihm nicht böse deswegen.
»Mit anderen Worten«, faßte Rodraeg zusammen, »Ihr habt nur getrockneten Fadenwurz da, weil er so schwer zu bekommen ist.«
»Genau. Und selbst wenn ich frischen dahätte, würde ich ihn Euch wohl nicht zu kauen geben. Das Gras enthält ziemlich stark wirkende Substanzen, die süchtig machen können. Aus diesem Grund ist der Name Marionettenkraut recht originell. Als diese Heilerin Euch das gab, meinte sie damit, das Gras wird Euch in eine Marionette verwandeln. In einen Süchtigen.«
»Aber das kann nicht sein! Ich habe doch gar keine … der Husten? Ist dieser hartnäckige Husten ein Anzeichen der Sucht?«
»Das kann ich leider nicht beurteilen. Ich würde schätzen, Ihr habt eine ziemlich heftige Erkrankung, sonst hätte Euch diese Heilerin nicht ein Kraut verabreicht, das man im allgemeinen allenfalls Sterbenden gibt, um ihnen die letzten Tage und Wochen zu erleichtern. Ihr macht aber nicht den Eindruck eines Süchtigen auf mich. Womöglich wußte die Heilerin genau, was sie tat, und Eure Erkrankung hat die Suchtfaktoren des Fadenwurzes aufgesogen und vollständig eliminiert. Ihr müßtet mir sagen, was Euch fehlt, dann kann ich womöglich weiterhelfen.«
Rodraeg lächelte hilflos. Jetzt saß er in der Falle. Er konnte dem Kräuterhändler nicht verraten, was ihm fehlte. Wenn er jetzt erzählte, daß er an einer Schwarzwachsvergiftung litt, würde Breklaris fragen: Schwarzwachs? Wo gibt es denn heutzutage noch Schwarzwachs? Vielleicht würde er Erkundigungen anstellen. Womöglich würde er in Erfahrung bringen, daß es da diese Mine bei Terrek gab, wo unter dem Segen der Königin Schwarzwachs abgebaut wurde. Diese Mine war in mehrere gewalttätige Gefechte verwickelt und wurde schließlich stillgelegt. Einer seiner Kunden war offensichtlich dort gewesen. Die Spur, hochverehrte Königin, führt hierher, nach Warchaim.
Rodraeg konnte überhaupt niemandem von seiner Krankheit erzählen, auch keinem Priester. Die Kleriker Warchaims standen gewiß mit denen der Hauptstadttempel in Verbindung. Von dort aus bis zum königlichen Palast war es nur noch ein kleiner Schritt. Daß er eben Terrek erwähnt hatte und Geskara, war schon viel zu leutselig gewesen für einen, der eine Einsatztruppe anführte, deren Missionen den Interessen der Königin zuwiderliefen. Er mußte sich endlich angewöhnen, wie ein Geheimniskrämer zu denken.
»Entschuldigt bitte«, rang er sich schließlich ab. »Gebt mir einfach etwas gegen Reizhusten. Ich bin offensichtlich nicht süchtig nach Marionettengras, denn ich bin gerne bereit, etwas anderes auszuprobieren.«
Samistien Breklaris musterte ihn argwöhnisch und fragte ihn noch nach den genauen Äußerungsformen dieses Hustens. Rodraeg konnte nicht mehr berichten als: schmerzhaft, krampfartig, aber ohne Auswurf. Der Kräuterhändler verkaufte ihm ein Dutzend selbstgemachter Pastillen, die das Öl des Kampferbaumes und Harzanteile einer Zwergkiefernart enthielten. Rodraeg bedankte sich und verließ den Laden ein wenig zu hastig.
Draußen atmete er erst einmal durch. Er fühlte sich schwindelig und benommen von dem Geruch dort unten, ähnlich wie damals in den Katakomben des Kreises, als der Feenrauch ihm zugesetzt hatte.
Er wollte in den Tempelbezirk, zu Kjeer, dem Erdreich, das ihn verwundet hatte, und zu Delphior, dem Wasser, an dessen Quellen er jahrelang vor sich hin gelebt hatte. Er wollte zu Helele, weil deren Schüler sich am ehesten auf Heilkunde verstanden, und zu Arisp, weil er zum Frühling gebetet hatte in dem kleinen Dorf namens Kirna, als er noch nichts wußte über Schwarzwachs oder Kruhnskrieger oder Organisationen namens Batis oder Erdbeben. Er wollte zu Lun, weil jetzt Sommer war, und er in einem Mond – wenn das Lunfest gefeiert werden würde und er bis dahin noch lebte – möglicherweise ein Gebet zu Lun sprechen würde. Er wollte zum Siechenhaus im Nordosten der Stadt gehen und sich dort heilen und pflegen lassen, aber er wollte auch zum Haus des Mammuts zurück und den neuen Auftragsbrief öffnen. Er hatte warten wollen bis mindestens morgen, sich einen Tag Ruhe gönnen, an dem er die Ereignisse des ersten Auftrages überdenken und verarbeiten konnte, ohne daß der zweite ihm bereits Sorgen und Befürchtungen dazwischenkrakeelte. Aber es hatte keinen Sinn, so zu tun, als gäbe es nichts Dringliches zu erledigen. Der Kontinent wurde weiterhin von rätselhaften Begebenheiten heimgesucht. Der Kreis würde in seinem Brief mit Sicherheit von einem weiteren solchen Ereignis zu berichten wissen.
Eine der wohlschmeckenden Pastillen lutschend, kehrte er nach Hause zurück.
Die anderen waren schon dort. Bestar lachte immer noch über die letzten turbulenten Purzeleien auf der wackeligen Bühne. Hellas hatte sich für den längsten aller Bögen entschieden und trug ihn selbst hier im Haus über die Schulter gespannt.
»Alles in Ordnung?« fragte Naenn.
Rodraeg zeigte ihr die Pastillen. »Hilft.«
»Wann öffnen wir endlich den zweiten Auftragsbrief?« wiederholte Cajin seine Frage vom Frühstückstisch.
»Jetzt, Cajin«, antwortete Rodraeg. »Genau jetzt.«
2
Der zweite Brief
Sie waren alle im großen Raum um den Tisch versammelt. Das Tageslicht schwächelte schon sehr. Deshalb hatte Cajin den großen Wagenradkerzenleuchter entzündet, der unter der Decke hing.
Rodraeg öffnete den mit einem nicht ganz geschlossenen Kreis bemalten Umschlag mit bedeutungsvoller Miene und sah dann jeden einzelnen von ihnen prüfend an.
An das Haus des MammutsRodraeg T. Delbane
Ein gutes Leben allen Teilen des Kontinents!
Nach Auskunft zweier Seemagier der Glutsee wird am vierten oder fünften Tag des Sonnenmondes eine große Herde Buckelwale im Sund von Wandry stranden. Es ist nicht auszuschließen, daß von Wandry aus Magie wirksam wurde, um die Tiere in den Tod zu locken. Ihr müßt dieses Massaker unter allen Umständen verhindern – wenn die Informationen der beiden Seemagier richtig sind, ist dies die letzte Herde von Buckelwalen, die es überhaupt noch gibt!
Für einen bequemen und zügigen Transport haben wir diesmal Sorge getragen: In Rigurds Stall steht eine Kutsche für Euch bereit, deren Kutscher Alins Haldemuel in der Lage ist, Euch binnen zwölf Tagen nach Wandry zu bringen.
Tut Euer Bestes, mehr kann niemand von Euch verlangen.
Viel Erfolg!
»Unterzeichnet mit dem Kreis«, beendete Rodraeg die kurze Lesung.
Cajin pfiff anerkennend durch die Zähne. »In zwölf Tagen nach Wandry – das ist wirklich schnell. Zu Fuß von hier aus am Larnwald entlang und über die Kjeerklippen … das wären gut dreißig Tage, würde ich mal schätzen. Ein voller Mond.«
»Es geht in deine Heimat«, sagte Rodraeg zu Bestar. »Die Klippenwälder.«
»Ja, aber nicht meine Gegend. Wandry liegt an der Küste, nicht drin in den Wäldern. Das ist Laichgebiet, wie wir aus den Wäldern sagen. Dort wohnen nur Schwächlinge.«
»Na, dann wird das alles ja wieder ganz einfach«, bemerkte Hellas. »Diesmal haben wir zwar nicht nur die Bemannung einer Mine gegen uns, sondern eine ganze Stadt, weil die ganze Stadt sich am Abschlachten einer gestrandeten Walherde gesundstoßen kann. Aber da das alles nur Schwächlinge sind, legen wir die gefürchteten Freibeuter von Wandry einfach ein bißchen übers Knie, und dann werden sie schon ablassen von ihrem unrechten Tun.«
»Ganz genau!« bestärkte ihn Bestar.
»Fängermagie ist von den Göttern verboten worden«, sagte Naenn leise.
Rodraeg beugte sich vor. »Fängermagie?«
Naenn räusperte sich. Ihr Blick irrte im Raum umher wie ein verirrter Käfer, der nach einem Fenster sucht. »Am Anfang, als die Götter noch unter den Menschen wandelten, um sie anzuleiten und ihnen Rat und Trost zu spenden, bildeten sich die ersten magisch begabten Menschen heraus. Die Götter waren erfreut über diese Entwicklung, zeigte dies doch, daß die Menschen den Göttern ähnlicher waren als den Tieren. Die Schmetterlingsmenschen gingen sorgfältig um mit ihrer Magie, verschlossen sie in Zeichen, Gegenständen und komplizierten Ritualen und benutzten sie nur selten. Die Riesen gingen sorgfältig um mit ihrer Magie, langsam, bedächtig und stabil wie die Felsen, zwischen denen sie lebten. Die Untergrundmenschen gingen sorgfältig um mit ihrer Magie, denn sie fürchteten sich vor ihr und wollten sie am liebsten überhaupt nicht mehr einsetzen. Doch die gewöhnlichen Menschen, die Menschen der Küsten und Ebenen – sie merkten, daß sie sich die Magie zunutze machen konnten. Daß sie sich dadurch Vorteile verschaffen konnten, die nicht natürlich waren. So bildeten sie zum Beispiel Fängermagier aus, deren Aufgabe es war, das Wild in ganzen Herden zum Jäger zu locken. Mit Hilfe dieser Fängermagie richteten die Menschen schon in der Frühzeit des Kontinents großen Schaden an. Ganze Tierarten wurden ausgerottet. Ich glaube, auch die Mammuts sind den Fängermagiern zum Opfer gefallen.«
Rodraeg biß die Zähne aufeinander. In seinem Mammut-Traum hatte er Jäger gesehen, die dem letzten überlebenden Jungmammut erbarmungslos nachgestellt hatten. Sie hatten nicht wie Magier ausgesehen, eher wie Barbaren, wie Wilde, aber etwas an ihnen war dennoch seltsam und fremd gewesen. Rodraeg hatte sich nie einen Reim darauf machen können.
Das Schmetterlingsmädchen fuhr fort: »Als die Götter des Schadens gewahr wurden, legten sie einen Bann über Fängermagie jeglicher Art. Alle, die diese Art der Zauberei praktizierten, wurden wahnsinnig und starben. Wenn ihr jagen müßt, so sprachen die Götter, dann geht dorthin, wo die Beute ist. Vergießt euer Blut und euren Schweiß, um Beute zu machen. Andernfalls habt ihr sie euch nicht verdient. Das Verbot wirkte fort. Seitdem gibt es keine Fängermagier mehr. Es kamen das Zeitalter der Städte, das Zeitalter der Verdrängung, das Zeitalter der Kriege und das Zeitalter der Vereinigung, doch niemals mehr wurde Fängermagie gewirkt. Dieses Geschehen in Wandry jedoch, von dem der Brief uns berichtet, sieht mir sehr danach aus. Jemand bricht die uralten Gesetze.« Sie schüttelte sich, und auch Rodraeg fühlte einen kalten Schauder seinen Rücken hinabrinnen.
»Das sieht mir jedenfalls nach einer lohnenden Aufgabe aus«, faßte er zusammen. »Und ich glaube nicht, Hellas, daß wir uns mit der ganzen Stadt anlegen müssen. Diese … Fängermagie wird doch höchstwahrscheinlich nur von einer einzigen Person ausgehen – und die müssen wir ausschalten. Wir müssen sie nicht einmal umbringen. Es genügt, daß wir sie betäuben und daran hindern, die Magie wirken zu lassen, bis die Wale in Sicherheit sind.«
»Eines verstehe ich trotzdem nicht«, sagte Hellas mit einem weiterhin unzufriedenen Gesichtsausdruck. »Kann es sein, daß das Mammut - im Auftrag des Kreises – die Aufgabe hat, darüber zu wachen, daß die heiligen Gesetze der Götter eingehalten werden? Wir sind doch keine Kleriker! Ehrlich gesagt kann ich diese frommschwatzenden Kuttenträger nicht ausstehen.«
»Die Priesterschaften und Tempel sind doch nur das, was den Menschen von den Göttern geblieben ist, Hellas«, versuchte Naenn ihm zu erläutern. »Eigentlich vertreten sie die Götter gar nicht, sondern in erster Linie sich selbst. Aber sie nähren sich von überliefertem Wissen, das bis in Wahrheiten zurückreicht. Deshalb plädiere ich dafür, daß wir langfristig Kontakt mit den Tempeln aufnehmen und halten – was nicht unbedingt bedeutet, daß ich gutheiße, was sie den anderen Völkern im Namen der Menschheit angetan haben.«
»Ich höre immer Wahrheit«, hielt der Bogenschütze dagegen. »Jeder hält sich für im Besitz der Wahrheit. Der Kreis weiß und bewahrt die Wahrheit, die Schmetterlingsmenschen stehen für Wahrheit, die Priester mit ihren Göttern predigen die Wahrheit. Aber die Königin steht auch für Wahrheit. Das Heer streitet für die Wahrheit. Batis und Deterio und die Kruhnskrieger schürften in Terrek nach der Wahrheit. Und wahrscheinlich kämpfen sogar die verdammten Affenmenschen für ihre eigene Wahrheit. Der Witz an der ganzen Sache ist: Es gibt viel zu viele Wahrheiten, um wahr zu sein.«
»Weshalb machst du es dir so schwer?« fragte Rodraeg schmunzelnd. »Du kannst es doch auch ganz einfach folgendermaßen sehen: Jemand bezahlt dir Geld dafür, daß du nach Wandry gehst und dort verhinderst, daß die Buckelwale ausgerottet werden. Das kann doch eigentlich nichts Schlechtes sein.«
»Ich habe noch nie einen Buckelwal gesehen«, entgegnete Hellas unbeeindruckt.
»Aber ich«, mischte sich erstmals Bestar ein. »Nicht in echt, aber der alte Selt Fremmender hat Schnitzereien von ihnen gehabt, an seiner Hütte und innen drin auch. Riesige Tiere, dick und drollig, mit unglaublich klugen Augen. Sie müssen so ziemlich das Größte sein, was in den Meeren rumschwimmt. Ich finde es toll, daß wir sie retten. Ich fand auch die Sache mit dem Fluß gut. Und daß wir zumindest dazu beigetragen haben, daß die Pferdchen nicht gefressen wurden. Das sind Wahrheiten, Hellas. Wir schaffen Wahrheiten, dadurch, daß wir was tun.«
»Wenn du keine Lust hast, uns zu begleiten, können wir dich nicht zwingen«, sagte Rodraeg zu dem Bogenschützen.
»Darum geht’s doch gar nicht. Du hast ja recht. Aus dem Blickwinkel eines Söldners betrachtet ist die Sache für mich ganz simpel. Außerdem seid ihr mir hundertmal lieber als meine bisherigen Auftraggeber. Ich kann nur dieses geschwollene Gequatsche nicht vertragen. Letzten Endes gehen wir wieder zum Blutvergießen hin, machen wir uns doch nichts vor. Wir leisten die Drecksarbeit, wir werden Salzwasser schlucken und Hiebe kassieren, und dieser arrogante Greisenknabe streicht den Ruhm dafür ein und erzählt uns hinterher, was wir alles falsch gemacht haben.«
Erneut mußte Rodraeg schmunzeln. Hellas’ Beschreibung des Kreis-Anführers Riban Leribin, ihrer aller direkter Vorgesetzter, war einigermaßen zutreffend. Leribin hatte sich sogar noch Mühe gegeben, bei seiner Manöverkritik nach dem ersten Einsatz nicht allzu herablassend zu wirken, aber seine Unzufriedenheit und Geringschätzung war ihm doch zwischen sämtlichen Silben hervorgequollen.
Er hustete kurz und fragte dann: »Kennt sich eigentlich einer von euch mit Booten aus? Es ist ja immerhin nicht auszuschließen, daß wir aufs Wasser rausmüssen, um etwas für die Wale tun zu können.«
Nur einer von ihnen hob zaghaft die Hand: Cajin.
Rodraeg schüttelte den Kopf. »Das war ja fast zu erwarten. Wahrscheinlich gibt es nichts, womit du dich nicht auskennst. Dabei stammst du doch mitten aus der Wüste.«
»Aber die Flüsse«, erklärte Cajin immer noch kleinlaut. »Ähm, Tambul und Mesat. Ich bin oft in Booten gerudert oder gepaddelt, aber richtig zur See gefahren bin ich natürlich noch nicht.«
»Trotzdem kannst du uns leider nicht begleiten. Naenn kommt diesmal mit, und da brauchen wir dich hier im Haus. Sonst keiner? Bestar? Nie im Brennenden See gesegelt?«
»Geschwommen, ja. Gerudert, gut. Aber wie man ein größeres Boot in Gang kriegt – keine Ahnung.«
»Na ja. Ein Ruderboot werden wir ja wohl noch bewegt bekommen.« Rodraeg seufzte. »Also, der Zeitplan sieht folgendermaßen aus: Wir brechen übermorgen auf. Wenn wir wirklich innerhalb von zwölf Tagen in Wandry sind, haben wir dann immer noch fünf oder sechs Tage Zeit, um dort in Erfahrung zu bringen, was wir tun müssen – und es zu tun. Das sollte eigentlich reichen. Morgen bringen wir unsere Ausrüstung in Ordnung. Bestar holt seinen neuen Brustpanzer ab, und ich kann im Rathaus in der Encyclica stöbern gehen und alles in Erfahrung bringen, was uns über Buckelwale vielleicht von Nutzen sein könnte. In der Nacht zu übermorgen erwarten wir dann noch die zwei uns von Riban angekündigten Kandidaten auf Mitgliedschaft in unserer erlesenen Runde. Wer weiß – vielleicht hat unser hochverehrter Auftraggeber ja vorgesorgt, und es ist ein Seebär mit dabei? Jetzt noch Fragen?«
»Noch eine.« Hellas.
»Ja?«
»Wieder dreißig Taler, und fünfzig bei mondelanger Gefangenschaft?«
»Hm. Wieviel haben wir jetzt noch, Cajin?«
»Vierundachtzig.«
»Tjaaa. Wenn wir alle fünf gefangen werden – Naenn, Bestar, du, ich und unser neuer Seebär -, dann wird das ziemlich teuer. Wir werden diesmal wohl ohne Gefangenschaft arbeiten müssen. Wenn uns der Kreis bis dahin wieder mindestens hundert Taler nachschickt, können wir uns dreißig pro Mann leisten.«
Jetzt war es Hellas, der breit grinste. »Ich wollte nur hören, wofür ich das Ganze eigentlich mache. Eigentlich habe ich heute genug Geld vom Kreis bekommen. Das reicht fürs erste. Ich bin also dabei.«
»Wunderbar«, schloß Rodraeg. »Dann erkläre ich den heutigen Abend zur freien Verfügung. Ich für meinen Teil werde ins Bett gehen. Ich könnte nur noch schlafen.«
»Kurier dich mal richtig aus mit deinem Husten«, sagte Bestar besorgt. »Ich gehe noch mal ins Theater. Cajin hat gesagt, die Abendvorstellung ist noch lustiger als die vom Tag.«
»Lustiger habe ich nicht gesagt«, warnte Cajin. »Lüsterner.«
»Will ich trotzdem sehen. Sonst noch jemand?«
»Ich hasse Theater«, erklärte Hellas. »Ich gehe auch früh schlafen.«
»Kann ich mitgehen?« fragte Cajin Rodraeg.
»Du brauchst mich nicht um Erlaubnis zu fragen. Es ist deine Freizeit.« Als er sich erhob und an Naenn vorüberging, raunte er ihr zu: »Morgen früh zeigst du mir mal den Kräutergarten. Ich bin sicher, ich werde ihn nicht wiedererkennen.«
Sie nickte ernst und zog sich von allen als erste auf ihr Zimmer zurück.
In dieser Nacht erwachte Rodraeg mehrmals. Sein Schlaf war nicht mehr so ohnmachtstief wie in der Nacht davor, der ersten, die er nach längerer Zeit wieder in seinem Bett hatte verbringen dürfen.
Die Tür ging, als Bestar und Cajin mitten in der Nacht nach Hause kamen. Auf Zehenspitzen schlich der Klippenwälder an Rodraegs Zimmertür vorbei. Danach war aus seinem Zimmer noch mehrmals gedämpftes Glucksen zu hören. Bestar lachte sich kaputt über das Theaterstück, und er preßte dabei sein Kissen aufs Gesicht, um niemanden zu wecken.
Zu Mitternacht sang die Andachtglocke des Bachmu-Tempels leise und mit klarer Stimme durch die Stadt. Es war also noch gar nicht so spät.
Die Tür ging noch einmal, aber Rodraeg war zu dicht vorm Einschlafen, um darüber nachzudenken.
3
Geheimnisse
Rodraeg stand diesmal sehr früh am Morgen auf. Hustenanfälle hatten ihn aus dem Schlaf gerissen, und er wollte nicht das ganze Haus damit wach machen. Er zog sich hastig an und ging in den Keller hinunter, um sich dort so richtig auszuhusten. Als er erschöpft und schweißgebadet aufblickte, stand Cajin neben ihm.
»Ich mache mir echte Sorgen um dich, Rodraeg.«
»Mist, verdammter«, ächzte Rodraeg. »Ich habe meine Pastillen oben im Zimmer vergessen.«
»Ich hole sie dir.« Cajin lief annähernd lautlos nach oben und kehrte mit den Pastillen wieder zurück. Es waren nur noch fünf übrig. Schweigend beobachtete Cajin, wie Rodraeg verbissen lutschte und inhalierte. Bei jedem Einatmen rasselte und quietschte seine Lunge wie ein altes Scheunentor.
»Wir gehen jetzt zusammen zum Haus der Kranken«, schlug Cajin vor. »Ich begleite dich. Die Heleleschwestern dort werden bestimmt wissen, wie sie dir helfen können.«
»Das geht nicht. Ich darf niemandem verraten, woran ich eigentlich leide. Wir waren in Terrek Gesetzesbrecher. Ich kann das leider nicht herumposaunen.«
»Dann … fragen wir Naenn! Sie wird dir etwas Schmetterlingsmäßiges zusammenbrauen, da bin ich ganz sicher.«
»Ja, das können wir versuchen. Was ist eigentlich los mit ihr? Sie sieht so … bleich und angespannt aus. Ist irgend etwas vorgefallen, während wir weg waren?«
»Ich fürchte, sie leidet ein wenig unter der Stadt. Sie ist das Leben im Wald gewöhnt, und im Vergleich dazu kommt ihr das Haus wohl wie ein Gefängnis vor. Da kann ich tun, was ich will, um es ihr so gemütlich wie möglich zu machen, aber gegen den großen Larnwald in ihrem Herzen komme ich nicht an.«
»Du hast recht. Gut, daß sie jetzt mitkommt nach Wandry. Wir reisen am Larn vorbei und kommen in die Klippenwälder. Das wird ihr guttun.«
»Ich gehe sie holen. Die anderen können wir ja noch schlafen lassen.«
»Cajin?«
»Ja?«
»Mir war so, als hätte ich heute nacht die Tür gehört, nach Mitternacht, nachdem du und Bestar schon wieder zu Hause wart. Hast du das auch mitbekommen?«
»Das war ich.«
»Ach so?«
»Ich hatte ein Geräusch gehört. Eine Art Schnuppern und Schaben, wie von einem Hund, und ich habe nach dem Rechten gesehen. Auf der Straße war nichts, auch kein Hund. Wahrscheinlich habe ich mich getäuscht.«
»Hm. Trotzdem gut, daß du wachsam bist. Man kann ja nie wissen.« Stöhnend richtete Rodraeg sich auf. Seine Stirn glänzte feucht. »Es geht mir schon besser jetzt, lassen wir Naenn doch noch schlafen. Im Laufe des Tages habe ich genügend Zeit, mit ihr zu sprechen. Mensch, ist das ein Dreck mit diesem Husten. Ich weiß immer gar nicht, wo ich hin soll. Ich kann ja auch nicht einfach rausgehen an die frische Luft und nachts halb Warchaim aus den Federn bellen.«
»Du solltest dir nicht so viele Gedanken um die anderen machen, Rodraeg. Wenn du husten mußt, dann huste doch einfach. Bestar schnarcht so laut, daß er und Hellas wahrscheinlich nicht mal etwas davon mitbekommen.«
»Du könntest recht haben. Wie war das Stück gestern abend?«
»Unglaublich. Ich wäre vor Peinlichkeit am liebsten untern Sitz gekrochen. Bestar fand’s großartig.«
»Hast du eigentlich die beiden Bücher gelesen, die ich dir dagelassen hatte?«
Cajins Gesicht leuchtete regelrecht auf. »Natürlich! Der Roman ist wirklich wunderbar. Bei den Gedichten finde ich nicht alle gut, aber eine ganz bestimmte Zeile wird mir für immer im Gedächtnis bleiben.«
»Welche?«
»Er lebte neben dem Geschehenen, den Fesseln des Gesehenen. Die ganze Zeile hat nur Es als Selbstlaute. So etwas ist nicht einfach.«
»Stimmt.« Rodraeg sah Cajin nachdenklich an. »Das ist mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Ich möchte in Wandry gerne ein Buch über das Meer kaufen und unserer kleinen Sammlung hinzufügen.«
»Laß dich durch so etwas aber nicht vom Auftrag ablenken.«
»Nein – ich finde, das gehört dazu.«
Sie gingen ein Stockwerk höher in die Küche, und Rodraeg bereitete ihnen beiden einen wohlschmeckenden Tee zu.
Nachdem alle gemeinsam gefrühstückt hatten, zogen Bestar und Cajin los Richtung Markt. Hellas verbarrikadierte sich auf seinem winzigen Zimmer und beschäftigte sich damit, seinen neuen Bogen mit Wildlederstreifen zu umwickeln.
Naenn tat geschäftig und unabkömmlich, aber es gelang Rodraeg dennoch, sie sanft in Richtung auf den kleinen Hinterhof zu drängen, wo sie im Laufe der letzten beiden Monde einen Garten angelegt hatte, dessen Anblick für Rodraeg ziemlich verblüffend war. Die verschiedenen Kräuter und Gemüse wuchsen nicht entlang gerader Furchen, sondern in Wellen- und Kurvenmustern, und sie waren auch nicht voneinander getrennt in Beeten angelegt, sondern alles schien zu fließen und ineinander überzugehen. Die verschiedenen Pflanzen und Farben und Wuchse bildeten Muster, Gefälle, Ballungen und Lichtungen aus. Alles schien lebendig und ungestüm zu sprießen, und dennoch der ordnenden Hand eines Künstlers unterworfen. Rodraeg war schlichtweg begeistert.
»Ist der Boden hier so fruchtbar, daß das alles gedeihen kann?«
»Boden ist fast immer fruchtbar. Selbst in der Felsenwüste gibt es Leben.«
»Mit diesem Garten hinterm Haus können wir selbst einer Belagerung wochenlang standhalten. Großartig gemacht. Ich hoffe, Cajin wässert das Ganze ausreichend, während du mit uns auf Reisen bist.«
»Cajin ist zuverlässig«, sagte sie fast tonlos.
»Das ist er gewiß. Mann, schau sich einer diese Tomaten an. Solche habe ich noch nie gesehen, die sind ja überhaupt nicht rund. Die Bohnen und die Salatköpfe sind zum Essen fast zu schade. Und was ist das da? Zwischen den Erdbeeren? Knoblauch? Wieso zwischen den Erdbeeren? Das paßt doch gar nicht.«
»Das schützt die Erdbeeren vor Pilzbefall. Rodraeg, ich muß dringend mit dir reden.«
»Jederzeit.«
»Nicht hier. Nicht im Haus. Unter vier Augen.«
Rodraeg schaute ihr forschend ins Gesicht. »Wo sollen wir denn hingehen?«
»Ich weiß es nicht. Irgendwohin, wo wir wirklich ungestört sind.« Naenn schien zu frieren, hatte die Arme um den Oberkörper geschlungen und wirkte aufgeregt und scheu, als würde sie am liebsten davonlaufen.
»Ähhhhm, ich weiß … wir gehen …« – Rodraeg überlegte fieberhaft – »nach Westen aus der Stadt raus in den Wald?«
»Ja. Gut. Sofort.«
Sie gingen dorthin, wo sie sich am Tag vor ihrem Aufbruch zur Terrek-Mission in verschiedenen Wettkämpfen gemessen hatten. Der Himmel war unverschämt blau, nicht eine einzige Wolke war zu sehen. Die Schatten der Bäume und Äste übermalten beim Gehen ihre Gesichter, und sie gingen, bis sie inmitten von Laub und Sträuchern am murmelnden Larnus ankamen. Hier war sogar noch der Kreis von fünf Schritt Durchmesser zu sehen, den Rodraeg vor zwei Monden mit einem Stock in den regenfeuchten Boden gekratzt hatte. In diesem Kreis hatte Cajin gegen Migal gekämpft und verloren. Danach Rodraeg gegen Bestar, bis Rodraeg aufgab. Einen Entscheidungskampf Migal gegen Bestar hatte Naenn verhindert, und sie hatte recht gehabt damit. Ein solcher Schlagabtausch hätte – selbst mit dick umwickelten Fäusten – beiden mehr geschadet als genutzt.
Es war still hier und menschenleer. Einhornhirsche nutzten diese Stelle zum Trinken.
Den ganzen Weg über hatte Rodraeg auf Naenns Lippen geachtet, ob sie sich öffneten, um zu sprechen, aber sie blieben verschlossen.
Auf dem Rückweg nach den Übungen waren sie vor zwei Monden hier im Wald einer jungen Frau begegnet, Meldrid, einer Dienerin im Hause Figelius, die zwischen den Sträuchern auf Beerensuche gewesen war. Bestar und Migal waren ganz aufgeregt gewesen angesichts der Schönheit dieser Frau. Rodraeg jedoch konnte sich kaum noch an sie erinnern. Er hatte immer nur Naenn vor Augen; wenn sie bei ihm war, wie jetzt, oder wenn sie fern war, und selbst wenn er die Augen geschlossen hielt. Er benahm sich närrisch, das wußte er selbst. Er war alt genug, ihr Vater zu sein, und sie war innerhalb des Mammuts kostbarer und wertvoller als er. Rodraeg hoffte nur, daß sie nicht über seine Gedanken mit ihm reden wollte, daß sie nicht erneut in ihn hineingesehen und ihn gelesen hatte wie ein aufgeschlagenes Buch, und ihn nun zur Rede stellte wie einen Schuljungen, der bei etwas Unanständigem ertappt worden war.
Naenn ging am glitzernden Ufer auf und ab, versteifte sich dann und blieb stehen. »Ich muß dir etwas Wichtiges sagen«, seufzte sie.
»Nur zu.«
»Ich … ich …« Sie sah sich wie hilfesuchend um. »Ich kann nicht mitkommen. Nach Wandry.«
»Warum nicht? Ich habe es dir doch versprochen.«
»Ich kann… in nächster Zeit eigentlich überhaupt nirgendwohin mehr mitkommen. Ich … sollte besser … zu Hause bleiben. In Warchaim. Ich muß zu Hause bleiben. Ich bin schwanger.«
Rodraeg wurde bleich, als hätte ihm jemand in den Bauch getreten. Er hatte mit allerhand Unwahrscheinlichem gerechnet, aber mit so etwas überhaupt nicht. Für einen Moment war er selbst überrascht, wie sehr ihn diese drei Worte schockten.
»Aber … aber … das verstehe ich nicht…«, stammelte er. »Wann bist du denn …? Als wir in Terrek waren?«
»Nein.«
»Aber … dann warst du schon schwanger, als wir uns in Kuellen … das erste Mal begegnet sind?«
»Nein.«
»Das verstehe ich nicht. Wir waren doch ansonsten die ganze Zeit zusammen. Und ich habe nichts getan.«
»Nein. Auch eine Schmetterlingsfrau kann nicht von einem gemeinsamen Traum schwanger werden.« Sie war jetzt weniger zittrig als er. Einmal die Worte ausgesprochen, gewann sie wieder an Kraft. Aber was meinte sie damit? Was meinte sie genau? Rodraeg versuchte, nicht von Verzweiflung übermannt zu werden. Er konnte kaum noch atmen. Ihm war, als würde er ohnmächtig, und diesmal hatte der Husten nichts damit zu tun.
Sie sah ihn nicht an, aber ihre Worte durchbohrten ihn wie Messer. »Erinnerst du dich an die drei Wegelagerer, die uns vor Aldava überfallen haben?«
»O nein. Naenn, sag, daß das nicht wahr ist.«
»Ryot Melron von der Roten Wand. Als du bewußtlos am Boden lagst.«
Jetzt mußte er sich tatsächlich setzen, um nicht zu stürzen. Der Uferboden war hart und warm. Rodraeg wollte husten, aber er konnte nicht.
Ryot. Der gutaussehende Scheißkerl. Der ihn überrumpelt hatte, ihm den Säbel seines Onkels gestohlen und ihm dafür diesen verfluchten Anderthalbhänder dagelassen hatte, den niemand, der kein Klippenwälder war, vernünftig führen konnte. Der sich Naenn genommen hatte. Den Schmetterling. Das unerreichbare Licht.
»Seine beiden Kumpane?« fragte Rodraeg.
»Die hat er weggeschickt. Wir waren allein. Und es war keine Vergewaltigung.«
»Was?« schrie Rodraeg. »Was erzählst du mir da für einen Mist?!«
»Es war keine Vergewaltigung«, wiederholte sie, jede einzelne Silbe betonend wie im Gespräch mit einem Schwachsinnigen. »Er hatte sogar ein wenig Angst. Er zitterte. Ich wollte ihn mehr als er mich.«
»Ich bin verrückt geworden«, rief Rodraeg aus. »Das kann doch alles nur ein Fiebertraum sein! Was erzählst du mir da? Daß du diesen Krieger und Mörder … du hast ihn doch selbst als Mörder bezeichnet… verführt hast? Nachdem er mir fast den Schädel eingeschlagen hat? Das Ganze ist ein Witz, oder? Das kann doch nur ein Witz sein?! Irgendein komplizierter Schmetterlingsmenschenfrauenmädchenscherz, weil heute irgendein Jahrestag ist und man gutgläubige Trottel für dumm verkauft. Stimmt’s?«
Sie setzte sich neben ihn auf den kargen Boden, und dann tat sie etwas, was ihn noch mehr aufwühlte als ohnehin schon. Sie nahm seine wehrlose Hand zwischen ihre beiden warmen und kleinen Hände und drückte sie fest.
Ende der Leseprobe