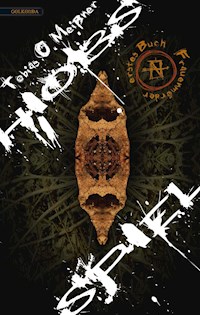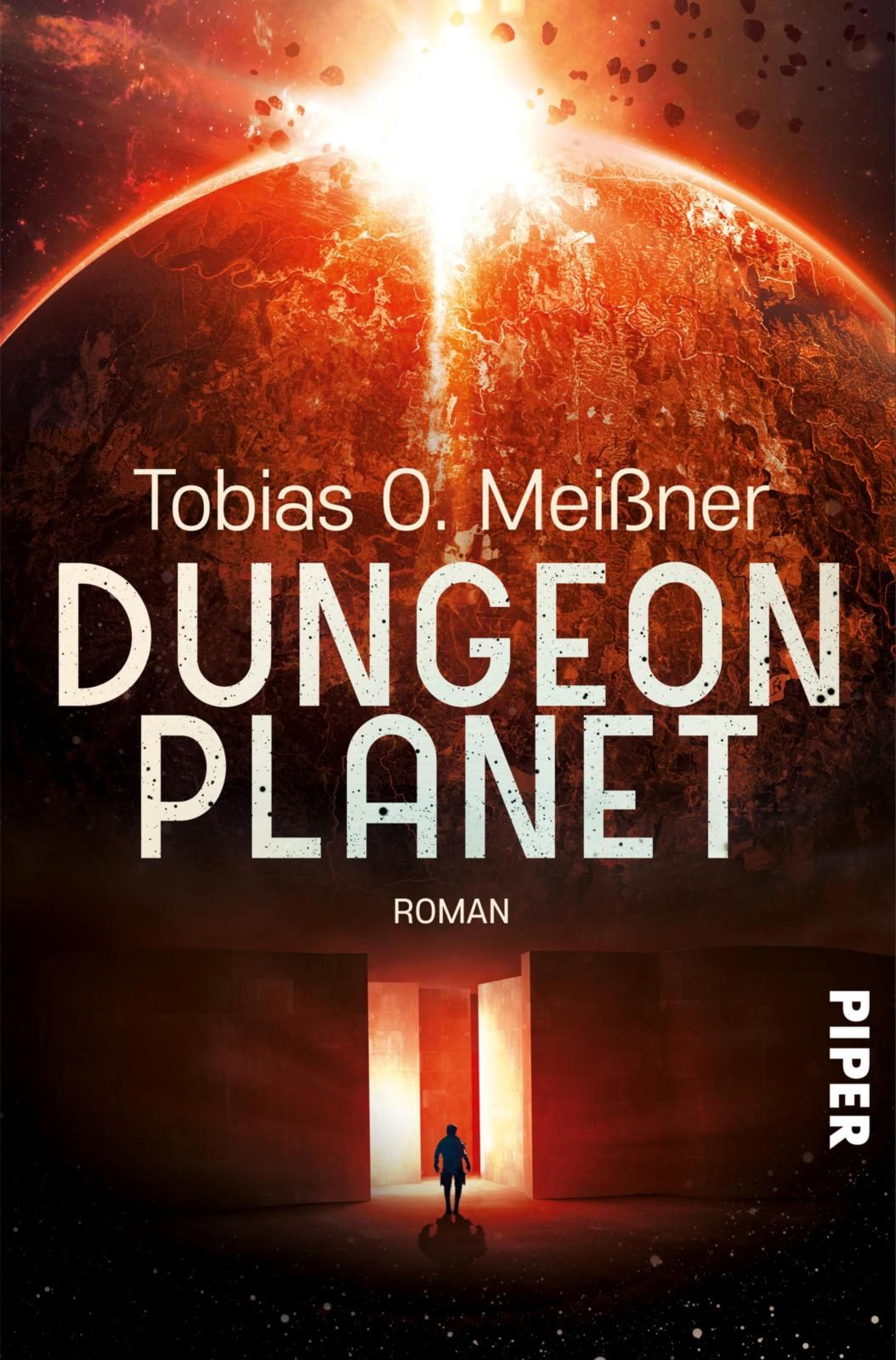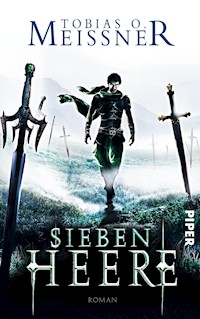2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Geheimbund des Mammuts hat unzählige Gefahren überstanden, Rückschläge erlitten und Siege errungen. Nun müssen Rodraeg und seine Gefährten den letzten Auftrag erfüllen. Nach Überfällen durch Spinnenmenschen, verlustreichen Schlachten und der Erkundung einer geheimnisvollen Tempelruine begegnet Rodraeg seinem Auftraggeber – und muss erfahren, dass die wahre Mission des Mammuts von ungeahnter Bedeutung für das Schicksal aller ist. Dieser Band enthüllt die letzten Geheimnisse der Welt des »Mammuts«. Fesselnde Fantasy vom Autor der »Dämonen«-Bestseller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ISBN 978-3-492-98095-1 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © Piper Verlag GmbH, München 2011 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Melkor3D / shutterstock.com Karte: Erhardt Ringer Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2011
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Prolog
Von Anfang an hatte Ogan »Schartbart« Broog kein gutes Gefühl bei der Sache gehabt. Aber es ist immer leichter, hinterher zu sagen: »Ich habe es doch geahnt«, als im Voraus, während die Dinge sich entfalten, im entscheidenden Augenblick eine andere Richtung einzuschlagen.
Der Auftrag, so wie die Königin höchstpersönlich ihn in nur vier Sätzen formuliert hatte, war simpel und deutlich genug gewesen:
»Schaut euch bei den Riesen um! Findet heraus, was ihre neuartigen magischen Aktivitäten zu bedeuten haben! Seht zu, ob ihr Anhaltspunkte findet für etwaige neue Bündnisse oder dergleichen! Wenn möglich, unterbindet die magischen Aktivitäten!«
»Die Riesen!«, hatte einer von Broogs Männern gehöhnt. »Sind das nicht diese halb vergessenen zotteligen Ungetüme, die seit Jahrhunderten im Wildbart Inzucht betreiben und keinen Schritt mehr vor die eigene Höhlentür zu machen wagen?« Genau das war es gewesen, was Schartbart so stutzig gemacht hatte.
Er hatte schon zu vieles erlebt und gesehen. Vor zwanzig Jahren hatte er im jazatischen Bürgerkrieg nacheinander auf beiden Seiten mitgemischt. Seitdem war sein Gesicht von Brandnarben verunziert. Ein unregelmäßig wachsender schwarzer Vollbart verdeckte das meiste, aber die Narben verliefen tiefer als nur durch die Haut. Sie erzählten von Unvernunft und Leichtsinn, und sie juckten, wenn ihm gut gelaunte Ahnungslosigkeit so hohl klang wie ein geleertes Fass.
Schartbart erinnerte sich noch daran, wie es im Herbst des letzten Jahres, als die Vorbereitungen für den Affenmenschenfeldzug anliefen, in den Palästen und auch den Unterkünften der einfachen Soldaten genauso hohl getönt hatte. »Die Affenmenschen! Sind das nicht nur Tiere, die man mit Feuer und einer Pauke so erschrecken kann, dass sie sich auf die Bäume flüchten?« Doch was war dann geschehen? Von den zweitausend tapferen Soldaten und Soldatinnen, die an diesem Feldzug teilgenommen hatten, waren nur sechshundert zurückgekehrt. Von diesen sechshundert starben weitere einhundert an rätselhaften Folgeschäden. Die überlebenden Fünfhundert wirkten traumatisiert und verwirrt. Und was war erreicht worden? Eine Ansiedlung der Affenmenschen war angeblich vernichtet worden, ein einziges klägliches Dorf, aber wirklich zu Gesicht bekommen hatte man den Feind nicht ein einziges Mal.
Ogan »Schartbart« Broog hatte sich und seine Leute aus diesem Feldzug herausgehalten, weil er den vollmundigen Fehleinschätzungen der Aldavaer Theoretiker von Anfang an misstraut hatte. Seine Narben hatten gejuckt wie verrückt. Broog war in Galliko gewesen, vor einigen Jahren. In Galliko, wo man seit Jahrhunderten unablässig Krieg führte gegen die Affenmenschen und sich deshalb zu Recht alleingelassen und abgespalten fühlte von der Krone und ihren Privilegien. In Galliko, wo man es sich nicht leisten konnte, den Gegner überheblich zu unterschätzen. Dort hatte man Wunderdinge erzählt von den Affenmenschen. Von einer eigenartigen Magie, die sie manchmal zu benutzen schienen und die in der Lage war, jede Schlacht und jedes Handgemenge so herumzudrehen, dass alle Menschenvernunft nur noch kopfstand. Die Königin hatte diese Gerüchte aus Galliko ebenfalls vernommen, deshalb hatte sie ihren Feldzug mit einer ungewöhnlich großen Ansammlung von Magiern unterfüttert. Aber diese Magier waren nun alle tot, und das Land der Affenmenschen war immer noch das Land der Affenmenschen.
Schartbart hasste Magie. Er misstraute allem, was über das reine Kriegshandwerk hinausging. Dass er nun den Auftrag hatte, gegen Magie vorzugehen, schmeckte ihm ganz und gar nicht.
Immerhin: Er hatte seine eigenen Leute mitnehmen dürfen. Sieben Männer und drei Frauen, deren Namen und Augen er kannte, die er hatte kämpfen sehen während einer Nadelstichaktion in Skerb und während der Zerschlagung eines Schmugglerringes in den unheimlichen, nebelverhangenen Schluchten des Nekerugebirges.
Immerhin: Die Königin hatte sie mit Schwarzwachsrüstungen ausgestattet, einem geradezu legendären Material, das fester war als Stahl und dabei nicht schwerer als wattierter Stoff. Die Beweglichkeit, die man in diesen Rüstungen besaß, war nachgerade unheimlich, und dennoch war kein herkömmlicher Pfeil in der Lage, eine solche Rüstung zu durchschlagen. Allerhöchstens zwanzig solcher Harnische und Helme, hatte der Waffenkämmerer gesagt, gäbe es in den Lagern des Königshauses überhaupt, und elf davon trugen nun Ogan Broog und seine Truppe.
Immerhin: Die Bezahlung war gut, sehr gut sogar. Allein der Vorschuss hatte den Söldnern leuchtende Augen beschert und die Hoffnung auf die Anzahlung eines eigenen Grundstückes irgendwo in den lieblichen Ebenen von Hessely oder Gagezenath genährt. Die Bezahlung der Königin war immer gut, deshalb arbeitete »Schartbart« auch am liebsten für die Krone. Aber er hatte sich nie bereit erklärt, sich den echten Soldatenrängen unterzuordnen. Er war unabhängig und unduldsam geblieben. Vielleicht bekam er deshalb meistens Aufträge, die für einfache Befehlsempfänger zu heikel waren.
Die Narben juckten, und er kratzte, anstatt auf sie zu hören.
Ohne Komplikationen war die Reise zum Wildbart verlaufen. Aber schon auf dem Weg ins Gebirge hinauf hatten die Schwierigkeiten begonnen.
Die Söldnergruppe geriet mit einer bunten Schar aneinander, die sich »Haarhändler« nannte und offensichtlich den Wildbart als Jagdgebiet für sich beanspruchte. Diese Haarhändler waren allesamt noch nicht ganz trocken hinter den Ohren und fürchteten wohl, Broogs professionell ausgerüsteter Trupp würde ihnen die verheißene Beute streitig machen. Im Nu waren die Haarhändler auf etwa zwanzig struppige Gesellen angewachsen. Es flogen Pfeile und Schleudersteine. Mit Knüppeln und Tierhäutungsmessern drang man auf die Söldner ein. Nur um ein abschreckendes Exempel zu statuieren, erschlugen Broogs Frauen die beiden Vorlautesten der keifenden Horde. Der Rest zog sich winselnd zurück, blieb aber fortan stets in beobachtender und beschimpfender Nähe und machte ein unbemerktes Vorankommen so gut wie unmöglich.
Die Riesen zu finden wiederum erwies sich als echte Herausforderung. Die Angaben der menschlichen Bergbewohner hierzu waren mehr als nur widersprüchlich. Viele bestritten, dass es die Riesen überhaupt gab. Andere schrieben ihnen Viehdiebstähle und den einen oder anderen grässlichen Mord zu, der dann von den Autoritäten als Gebirgsunfall vertuscht wurde, aus Angst vor der Rache der Riesen. Ältere Dorfbewohner raunten Spukgeschichten von den »Schemenreitern«, unbeschreiblichen schweigsamen Berittenen, die als Leibwächter für die Riesen fungierten. Einige Fallensteller behaupteten sogar, dass die Riesen über gut ausgebildete und gerüstete Krieger verfügten. Nichts davon hatte die Königin anklingen lassen. Womöglich kümmerte es sie einfach nicht. Broog jedoch wurde immer hellhöriger und argwöhnischer.
Schließlich mussten sie den Spieß umdrehen. Um die Höhlen der Riesen in diesem Felsenwirrwarr überhaupt ausfindig machen zu können, mussten sie das spärliche Wissen der Haarhändler anzapfen. Sie schnappten sich drei ihrer keifenden Verfolger und verhörten sie dermaßen grob und demütigend, dass diese Kerle alles ausplauderten, was sie jemals in ihrem Leben gelernt hatten, darunter auch ein wenig Halbwissen über Gebiete, in denen man Riesen finden konnte.
Dorthin begaben sich die Söldner. Aber dort wimmelte es geradezu von weiteren Haarhändlern. Es kam zu Handgemengen und Raufereien, die sich nicht vermeiden ließen, weil die Haarhändler dermaßen unerfahren im Umgang mit Kriegern waren, dass ihnen überhaupt nicht klar war, dass sie auf Überlegene trafen. Zwei weitere Haarhändler blieben auf der Strecke, die anderen wagten einen nächtlichen Überfall – und es gelang ihnen tatsächlich, einem von Broogs Männern die Kehle durchzuschneiden. Noch bevor sie überhaupt einen einzigen Riesen zu Gesicht bekommen hatten, musste Broogs Trupp bereits ein Grab ausheben.
All seine Erfahrungen als Spurenleser, Pfadfinder und Wildnisdeuter musste »Schartbart« aufbieten, um den geheimen Tälern der Riesen auf die Spur zu kommen. Aber immerhin stießen sie dadurch nach mehreren Tagen endlich auf ein siebeneckiges abgeerntetes Getreidefeld und in dessen Nähe auch auf einen Hintereingang ins verborgene Höhlenreich der Riesen. Alte, drei Mannsschritt große Wesen mit grauen Rauschebärten gingen hier ein und aus, melkten Gebirgsziegen und sammelten Maulbeeren. Broog und seine neun Söldner verbargen sich hinter moosigen Felsen und begannen ihren Vorstoß dann bei Einbruch der Nacht.
Der Höhlengang roch betäubend nach Kräuterrauch und Pilzsud. Zwei von Broogs Leuten wurden von dem Rauch enthemmt und begannen laut zu plappern und zu kichern, als wären sie zu Hause oder in einer Taverne. Fluchend musste Broog hinnehmen, dass sie bemerkt und von sieben mit gewaltigen Doppeläxten und Kriegshämmern ausgerüsteten Riesenwächtern angegriffen wurden. Der Kampf jedoch tat den Söldnern gut. Nach Tagen des sinnlosen Umherwanderns, nach Verknappung der Essensrationen und den dauernden, nagenden Störungen durch die Haarhändler war es angenehm, endlich wieder richtig in Aktion treten zu können. Selbst die beiden Angeheiterten rissen sich wieder zusammen und gingen beherzt in den Nahkampf.
Die Riesen waren kräftig und gut gepanzert, hatten aber gegen die wendigeren und kampferfahreneren Söldner keine Chance. Ihre kolossalen Hiebe gingen ins Leere und ließen höchstens Felssplitter und Funken durch die Gegend sprühen. Schon nach kurzer Zeit waren drei der Riesen tot und die vier verbliebenen in größter Bedrängnis. Dann jedoch bekamen die Riesen Verstärkung durch zwei Menschenfrauen.
Eine Bogenschützin, die fast noch ein Kind war und so gut wie unbekleidet und die sich darauf verstand, ihre kurzen Pfeilchen in so großer Geschwindigkeit abzufeuern, dass der Höhlengang sich in ein wütendes Hornissennest zu verwandeln schien. Einer von Broogs Männern bekam einen Pfeil durch den Helm in die Wange und ging wimmernd zu Boden.
Und eine mit einem schönen Metallgesicht behelmte junge Frau in einer geradezu unsittlich höhnischen Version einer Ritterrüstung, die eine sperrige Turnierlanze als Waffe führte und die matt schimmernden Schwarzwachsrüstungen damit zwar nicht durchdringen konnte, deren Träger jedoch nach links und rechts an die Felswände schmetterte. Zwei der Söldner schaltete sie mit reiner Wucht aus, einen dritten beschäftigte und irritierte sie. Die vier überlebenden Riesenkrieger bekamen durch diese Verstärkung Raum und neuen Atem, und einer von ihnen spaltete mit seiner Axt einen Söldner vom Helmscheitel bis hinunter zum Kinn. Selbst das Schwarzwachs konnte dieser Schlagwucht nicht standhalten und gab nur ein hässliches Kreischen von sich.
Ein weiterer Söldner tot, drei kampfunfähig. Die verbliebenen fünf kämpften gemeinsam mit Broog gegen sechs Gegner, das Kräfteverhältnis stand nun eins gegen eins. Darüber hinaus konnten die Riesen noch weitere Verstärkung aufbieten, die Söldner nicht. Der Auftrag war jetzt schon gescheitert. Außerdem setzte der abscheuliche Rauch selbst Ogan »Schartbart« Broog zu; er begann die beiden Gegnerinnen zuerst verführerisch zu finden, dann als Riesen wahrzunehmen, dann wiederum sich in eine seiner Mitstreiterinnen zu verlieben. Die vier kämpfenden Riesen wiederum wurden mehr und mehr zu verwinkelten Naturgewalten. Er gab seinen Leuten die Erlaubnis zum »Rückzug nach Ermessen« und versuchte einen Durchstoß. Als schwächstes Glied in der Verteidigungskette hatte er die Bogenschützin ausgemacht. Ihr rückte er jetzt dicht auf den Leib, bis sie heftig gegen ihn atmete. Sie war noch so jung, dass sie wahrscheinlich noch niemals einem Mann etwas anderes geschenkt hatte als ihre störrischen Pfeile, und Ogan Broog spürte eine heftige Zuneigung zu ihr, die über ein reines, vom Rauch noch verstärktes Begehren hinausging. Er wollte sie nicht töten. Also schlug er sie zu Boden und setzte über sie hinweg. Sofort schlossen seine Söldnerinnen die Lücke und deckten ihn dadurch sowohl gegen die Riesen als auch gegen die Turnierlanze. Ein abzweigender Gang nahm ihn auf, und durch diesen kämpfte er sich gegen immer dichter werdende Rauchschwaden weiter voran in das Innere des Höhlenkomplexes.
Ein Mann kam ihm entgegen, ein weiterer Mensch. Muskelstrotzend, mit verwirrenden, räumlich erscheinenden Landschaften tätowiert und beinahe ausschließlich mit sauberen Verbänden bekleidet. Broog hielt ihn erst für eine Einbildung, bis das Breitschwert des Hünen ihn beinahe in zwei Hälften hieb. Dieser Gegner war echt. Was lebten in den Höhlen der Riesen nur für Völker?
Broog rang Schwert gegen Schwert und hatte große Mühe, die ungestüme Wucht der Hiebe abzufangen und in sinnvolle Konter umzuleiten, doch sein schweigsamer Gegner schien noch nicht ausgeheilt zu sein. Wiederholt machte er Bewegungen, die seine bandagierte Leibesmitte schützen sollten, und das konnte Schartbart mit all seiner Erfahrung erkennen und sich zunutze machen. Nach dem achten Aufeinanderprallen der Klingen täuschte Broog ein Einsinken in den Knien vor, nutzte diese Abwärtsbewegung jedoch, um unter das Schwert des Gegners zu kommen und diesem einen harten Faustschlag auf die Bandagen zu verpassen. Kämpfe schmutzig, brachte er auch seinen Söldnern immer bei, denn wenn du bezahlt werden willst, musst du vor allem überleben. Dem Gegner blieb vor Schmerz die Luft weg, Broog sprang hoch und trümmerte dem Tätowierten von schräg oben den Schwertknauf über den Schädel. Broog wollte auch ihn nicht töten. In diesen eigenartigen Augenblicken begriff er den Bebilderten als ein lebendiges Kunstwerk. Der Tätowierte blickte ihn an, mit einer Art von Grinsen, die durchaus auch eine Grimasse des Schmerzes sein konnte. Broog schlug noch zweimal zu. Röchelnd brach das Kunstwerk in sich zusammen. »Seraikella!«, rief jemand. Da war noch ein weiterer Gegner, noch ein Mensch, und auch dieser war mit Bandagen umwickelt, stützte sich beim Gehen auf zwei Holzstangen und kam scharrend und tappend auf Broog zu, doch der Söldner hatte genug von diesem ganzen Wahnsinn. Die Königin hatte ihm nicht gesagt, dass er überhaupt gegen Menschen kämpfen musste bei diesem Auftrag, aber seit sie in den Wildbart gelangt waren, hatten sie es fast ausschließlich mit Menschen zu tun bekommen. Broog entging diesem Gegner, indem er in einen Nebengang eintauchte, in immer undurchdringlicher wirbelnden Rauch.
Hinter ihm verebbte jeglicher Kampflärm. Ob seine Leute die Segel gestrichen hatten und in den Rückzug gegangen waren oder ob etwas anderes geschehen war – Broog konnte es nicht wissen. Er drang weiter vor, auf der Suche nach einem König, nach Magie oder einem wie auch immer gearteten Rätsel.
Er fand alle drei.
Gleichzeitig.
Plötzlich konnte er nicht mehr weitergehen. Ein unsichtbares Netz hielt ihn fest, entwand ihm schlängelnd das Schwert, schnitt sogar einschmelzend durch das Schwarzwachs der Rüstung, fühlte sich aber auf seiner Haut eher kühl und klebrig an. Der Gang begann zu leuchten. Der Rauch drehte sich zu einer Spirale. Broog riss und zog und knurrte, doch das Gewebe wurde eher stärker, zog ihn vom Boden hoch, bis er mitten im Gang hing wie eine Fliege in einem Spinnennetz. Der Gang selbst schien sich zu verformen, ebenfalls zur Spirale zu werden. Das Innere einer Turmmuschel. Das Leuchten wurde stärker und kam aus noch mehr Richtungen. Zwei Riesen wuchsen aus dem Nebel. Beide trugen keine Rüstungen, sondern bodenlange Gewänder.
»Du bist nun weit genug in den Riesen eingedrungen«, sagte der jüngere der beiden mit einer Stimme, die in Broogs Ohren widerhallte wie eine tiefe Glocke. »Was ist dein blutiges Begehr?«
Broog antwortete. Er hatte das Gefühl, eine Antwort gar nicht verweigern zu können. Seine Stimme machte sich selbstständig und wurde dicht gefolgt von seinem Verstand. »Zu viel … Magie … Ihr habt … zu viel Magie … Die Königin … macht sich große Sorgen.«
»Daran tut sie gut. Doch nicht, weil der Riese zu viel Magie sein eigen nennt, sondern weil er noch immer zu wenig besitzt.« Die Stimme des Riesen rumpelte durch den rotierenden Gang wie ein verlangsamter Erdrutsch. »Der Riese wird das Dunkel, das von Norden her durchs Land kommt auf Pfoten leise wie Samt, nicht mehr aufhalten können. Mit magischer Verhüllung wird er sich bergen, um nicht zu vergehen vor seinem ältesten Feind. Der Feind jedoch wird weiterziehen, unbehelligt, und aus der Krone der Königin sich launisch eine Beute reißen. Die Zeiten und Verträge Irinwehs sind nicht mehr. Der Riese steht euch nicht mehr bei. Doch der Riese hat sein Zepter wieder, und es ist ihm von Menschen überbracht worden. Deshalb gibt es ein neues Bündnis. Du selbst konntest bezeugen, dass Menschen für uns kämpfen. Um dieses Bündnisses willen wollen wir dich unbestraft sein lassen und zurückschicken zu deiner Königin, die nicht die unsere ist, mit einer Botschaft. Höre gut, Menschenkind, und hüte dich: Du kommst hierher und erschlägst unsere Brudersöhne und die wenigen kostbaren Menschen, welche unsere Freunde sind in dieser Welt der Jäger. Du kommst hierher und überbringst königliches Ungemach. Der Riese ist ohn’ Dulden nun. Zieh noch einmal gegen uns ein Schwert oder gegen uns ein Heer, und der Riese wird über die Krone kommen, um sein Recht einzuklagen, denn unsere Krieger sind zum Feldzug bereitet.«
»Diese … Drohung … soll ich wirklich ausrichten?«, ächzte Broog.
»Dies ist ohn’ Drohung«, sagte nun der andere der beiden Riesen, ein weißbärtiger Greis. »Dies ist ein Vermitteln von Wissen, in dessen Besitz ihr noch nicht wart. Die Königin sucht ihre Feinde im Falschen. Die wahren Feinde sind die Haarhändler, denn sie setzen dem Riesen zu und reißen ihn aus Frieden und Stille, während die Königin nichts dagegen unternimmt. Die wahren Feinde sind jene, welche die Quellen der Elemente aufbrechen und für sich selbst auszubeuten trachten, denn sie laben sich am Gefüge der Welt und wollen Götter spielen, und die Königin unternimmt nicht nur nichts dagegen, sondern sie kleidet sogar ihre gedungenen Mörder in Panzer der Schuld. Die wahren Feinde sind jene, welche Irinwehs Klinge überlebten und die nun zurückkehren werden, weil auch sie durch die Königin aus ihrer Stille gerissen wurden. Die wahren Feinde sind jene, welche mitten unter euch wandeln mit Habgier und Rachsucht anstelle von Güte.«
Broog schaffte es, höhnisch zu grinsen. »So viel … aufgeblasenes Gequatsche kann ich mir … nie und nimmer … merken.«
»Das Zepter wird dafür Sorge tragen, dass die Worte dich nicht verlassen, bevor du sie deiner Königin übergeben hast«, sagte nun wieder der jüngere der beiden Riesen mit ernstem, aber zuversichtlichem Gesichtsausdruck. »So wählten die Worte Turgenngranet, der eurer Königin eine eigene Krone entgegenträgt, und Attanturik, sein Sprecher. So sollst du frei sein und ziehen dürfen.«
Das Netz schüttelte Broog, der noch etwas hatte sagen wollen. Dann kippte es und stellte ihn auf den Kopf. Die Höhle drehte sich genau andersherum, bis er sie aus den Augen verlor. Als er wieder etwas erkennen konnte, saß er in einem schönen herbstlichen Wildbartgebirgswald, über sich zerklüftete Berggipfel und gelbrote Baumkronen. Die Luft war klar und ohne Rauch. Um ihn herum lagen seine überlebenden drei Frauen und drei Männer und rührten sich stöhnend. Keiner von ihnen trug noch Schwarzwachs am Leibe. Auch ihre Waffen waren fort.
»Was ist passiert?«, fragte eine der Söldnerinnen. »Wie kommen wir … hierher?«
»Magie«, knurrte Broog. »Die Höhlen sind voll davon. Was für ein gelungener Scherz! Ohne Waffen und Geld sollen wir zurück. Wir gehen nach Uderun, dort bekommen wir alles Nötige für unsere Rückkehr nach Aldava.«
»Ist unser Auftrag denn erledigt?«
»So gut es, verflucht noch mal, denn möglich war.«
»Und was ist mit unseren Toten?«
Broog betrachtete die nahen Berge. »Ich denke … die Riesen werden sie bestatten. Immerhin wissen sie, was ein Krieger ist. Also hoch mit euch, ihr müden Streiter! Wir haben eine unangenehme Botschaft zu überbringen!«
Zu siebt brachen sie auf, und als ihnen unterwegs vier Haarhändler über den Weg liefen, überwältigten sie diese und nahmen ihnen alles ab, was sie bei sich hatten.
Die Narben juckten noch immer, und schließlich musste man als Söldner all die sinnlosen Verluste mindern.
1
Menschen ziehen vorüber
Die Grablegung der vier von den Söldnern getöteten Riesen erinnerte Seraikella an das Einpflanzen übergroßer Blumenzwiebeln. Zusammengekauert, durch Rankenpflanzen verschnürt, mit Pilzsud und Moospaste bestrichen, wurden die vier Toten in die Erde gesenkt, und die neunundzwanzig verbliebenen Krieger sangen ein tiefes, dröhnendes Lied.
Seraikella, ansonsten ein Hüne unter den Menschen, fühlte sich winzig und schmächtig im Kreis dieses Chores. Er versuchte seinen Respekt zu bekunden, umringt von seiner schönen Ritterin, der jugendlichen Bogenschützin Bhanu Hedji und dem ebenfalls bandagierten Jeron MeLeil Gabria, aber Seraikella war in Gedanken nicht ganz bei den Toten. Er schwebte über sich, schaute auf sich herab mit Zweifel und Verachtung. Ihm war, als würde etwas von ihm selbst dort vor seinen Augen in die herbstlich duftende Erde gesenkt – aber etwas, das er schon vor Wochen eingebüßt hatte.
Die Beerdigung war vorüber. Der Riesenkönig hatte ein paar Worte gesprochen, Seraikella hatte nicht zugehört. Erneut waren die Riesen weniger geworden, und die neu gewonnene Magie des Fliegenstabes würde noch Zeit brauchen, bis sie den wenigen noch verbliebenen Frauen Zwillinge und Drillinge als Nachwuchs schenken würde. Die Vergänglichkeit war den Riesen ein zu alltäglicher Begleiter, als dass man ihr noch mit großer Traurigkeit hätte begegnen können. Für Seraikella jedoch war Vergänglichkeit ein neues und niederschmetterndes Erlebnis.
In diesen Tagen war er noch schweigsamer als ohnehin schon. Mehrmals hintereinander hatte er, dessen stets unbekleideter Oberkörper eine aus Tuschefarben gestaltete Landschaft war und dessen Breitschwert in dieser Landschaft das verdichtete Licht, nun in Gefechten versagt – zuerst gegen die Schemenreiter, wobei er seine tief reichenden Schnittwunden erhalten hatte, und nun erneut gegen diesen einzelnen Söldner, der ihn niedergestreckt hatte wie einen unerfahrenen Knaben. Die Landschaft war nun durch Narben entstellt, und Seraikella fühlte sich, als entspräche die Schändung des Bildes auch einer Zerstörung seiner Kraft, als sei er nun der Aufgabe, seine schöne Ritterin vor der Welt zu beschützen, nicht mehr gewachsen. Er begab sich abseits von den anderen in die tiefen und schattigen Schluchten der Riesengebiete und meditierte an Gebirgsbächen, unter nächtlichen Schwärmen von Fledersalamandern, im unheimlichen Wispern des Mondes und dem Fallen bunter Blätter vor dem Winter.
Er suchte sich selbst, seine Klarheit, sein eigenes Bild.
Das Bild war einfach gewesen, schwarz und weiß in schattierten Abstufungen, bevor das Rot seines Leibes es verunreinigt hatte.
Nun saß er inmitten von strahlend herbstlichen Farben und fragte sich, ob dies nicht die vollkommen falsche Jahreszeit war, um zur Ruhe zu finden.
Jeron MeLeil Gabria dagegen gelangte langsam wieder zu sich. Seine beiden Degen waren ihm zwar von einem Schemenreiter zerbrochen worden, aber er beschloss, die Klingenruinen einfach weiterhin als Waffen zu führen.
»Was hältst du davon?«, fragte er Bhanu Hedji, während er vor ihrem Gesicht mit den Klingen herumwirbelte. »Erzählen sie nicht eine hübsche Geschichte? Die Geschichte einer Ehrenschuld, die noch nicht beglichen ist? Was sagst du, Bhanu, hm? Verleihen mir diese geborstenen Klingen nicht die tragische Aura von einem, der sich bereits Übermenschlichem entgegengestellt hat, unterlegen war, aber dennoch überdauerte?«
Schnaubend wandte sie sich ab und ging davon, aber das Lächeln auf seinen Lippen konnte auch das nicht vertreiben.
Noch immer bedurfte Jeron zweier Krücken als Gehhilfe, noch immer schlurfte er herum wie ein Zerrbild seiner selbst. Mitten durch den Leib war ihm die durchsichtig flimmernde Klinge eines Schemens gestoßen worden und hatte alles durcheinandergebracht. Bei manchen Bewegungen hatte Jeron noch immer das Gefühl, in zwei oder mehr Teile auseinanderbrechen zu müssen, wenn er jetzt nicht sehr genau achtgab. Bis in seine Träume hinein verfolgte ihn dieser schreckliche, flackernd uneindeutige Hieb. Jeron erinnerte sich lebhaft daran, wie er mit Rodraeg, dem Anführer der kleinen Gruppe, die sich das Mammut nannte, Seite an Seite gegen einen dieser geisterhaften Reiter gefochten hatte. Das Ende dieses Kampfes hatte Jeron nicht mehr bewusst mitbekommen.
Aber er lebte. Er besaß die Freundschaft von Riesen. Mit ihren Pilzen, ihrem Rauch, ihren Moospackungen, heißen Schneckenhäusern, Laubauflagen, Käferzangen und Wurzelsalben heilten sie seinen Leib und ordneten sein Inneres wieder so an, dass Jeron mit sich selbst wieder zurechtkam.
Rodraeg, der Anführer des Mammuts, war von einem seiner eigenen Leute erschossen worden, doch die Bande der Ritterin war immer noch intakt, vollständig und – dank der Bernsteine, welche die Riesen für ihre Dienste zu zahlen bereit waren – in absehbarer Zeit sogar wohlhabend.
Bhanu Hedji fühlte diese eigenartige Hingezogenheit zu einem Mann, der bereits vor zwei Wochen aus ihrem Leben verschwunden war.
Ein Bogenschütze wie sie, hämisch und grausam.
Aber er hatte ihr Dinge vorausgehabt.
Furchtlosigkeit im Angesicht eines heranstürmenden berittenen Geisterfeindes. Nie würde Bhanu vergessen, wie Hellas Borgondi den einen Schemenreiter aus dem Sattel geschossen hatte. Überblick in Momenten, in denen alle überfordert waren. Nie würde Bhanu vergessen, wie Hellas seinen Anführer in Sicherheit gezogen hatte, als dieser leichtfertig Gefahr lief, niedergeritten zu werden. Kaltblütigkeit im Chaos. Hellas hatte begriffen, dass die Reiter flackerten, und den richtigen Augenblick abgewartet, um zu schießen und zu treffen. Bhanu selbst hatte mindestens zwanzigmal danebengeschossen und höchstens zweimal getroffen – peinliches, unfähiges Kind, das sie noch immer war!
Und dann hatte Hellas Borgondi noch etwas Weiteres fertiggebracht: Er hatte seinen eigenen Anführer erschossen. Einen Mann, der ihm ein Freund gewesen war, der – so zumindest hatte es Bhanu wahrgenommen – vielleicht den einzigen Grund darstellte, den ein von sämtlicher Liebe im Stich gelassener Mensch wie Hellas Borgondi noch besaß, um überhaupt weiterzuleben.
Er hatte ihn niederstrecken müssen, um frei zu werden. Frei von jeglicher Gefühlsbindung, Zugehörigkeit und Pflicht.
Bhanu Hedji beneidete ihn um diese uneingeschränkte Freiheit und Größe. Sie wollte eine Frau werden, so eng umrissen und einzeln wie Hellas Borgondi.
Nun fand man sie tagaus, tagein in der Nähe des Stelenfeldes, auf dem die Riesenkrieger gravitätisch miteinander rangen. Sie übte sich im Schießen, übte mit einer Beharrlichkeit und Ernsthaftigkeit wie noch niemals zuvor, weil sie früher immer nur auf ihr von den Göttern gegebenes Talent vertraut hatte. Sie übte das Schießen und Zielen auf unbewegliche Objekte und auch auf vom Wind bewegte oder von der Jahreszeit zu Boden gewirbelte Blätter, um Hellas Borgondi ebenbürtiger zu werden.
Um ihm eines Tages in einem Duell auf Leben und Tod die abschließende und allumfassende Ehre erweisen zu können.
Der Tod durch ihre bewusste, ruhige und verstehende Hand war das schönste und wertvollste Geschenk, welches Bhanu Hedji sich für einen Mann wie Hellas Borgondi vorstellen konnte.
Die Ritterin trug bei den Riesen niemals ihren Helm.
Der Gesichtsschutz mit dem klassisch modellierten Antlitz darauf war ein praktisches Utensil gewesen für das Leben als umherziehende, von zornigen Stadtgardisten verfolgte Banditin. Hier in den Höhlen jedoch war er absurd. Er beengte das Gesichtsfeld noch zusätzlich, ließ sie ungelenk und fahrig wirken und ihr in der Hitze rauschhaltigen Rauches mehrmals schier die Sinne schwinden.
Die Riesen faszinierten die Ritterin. Obwohl sie eine Männergesellschaft waren. Aber sie hielten die wenigen Frauen, die ihnen noch verblieben waren, beinahe heilig. Selbst der Ritterin wurde es nur ein einziges Mal erlaubt, Riesenfrauen zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Die Riesinnen waren weder besonders hübsch noch zartgliedrig, hatten vielmehr beinahe die selben wulstigwuchtigen Gesichter und Leiber wie die Männer, aber die Ritterin hatte noch niemals zuvor Frauen gesehen, die allen Ernstes doppelt so groß und breit wie Bhanu Hedji waren. Sie wirkten weise und milde und mächtig, und sie wollten die Ritterin dazu bewegen, ihre knappe Metallrüstung genauso abzulegen wie den Helm. Aber die Ritterin erklärte verlegen, dass sie sich nackt fühle ohne den Schutz von Metall am Leib. Man habe ja vor Kurzem erst gesehen, dass es nicht schaden könne, gerüstet zu sein, wenn Unbefugte in die Höhlen eindrängen.
Nach ihren ruhigen Begegnungen im wandbemalten Frauenbereich des Höhlensystems war die Ritterin noch fester als bislang entschlossen, den Riesen beizustehen.
Sie unterbreitete Klellureskan, dem Anführer der Krieger, einen Vorschlag: »Die Haarhändler nähern sich immer weiter euren Höhlen, werden immer frecher und ungeduldiger. Seraikella, der sich viel draußen aufhält, hat mir gestern von mehreren Sichtungen berichtet. Ich schlage vor, wir unternehmen einen Gegenangriff, um sie ein für alle Mal von der Idee abzubringen, Pilze sammelnde Riesen zu erlegen. Wenn dreißig Riesenkrieger durch das Unterholz brechen, ist dies ein Anblick, den kein zugereister Möchtegernjäger so ohne Weiteres verkraften wird.«
Klellureskan lächelte. »Der Riese ist ohn’ Not nun. Das Zepter ist wieder bei ihm.«
»Aber was tut es denn, dieses Zepter? Sogar Söldner wissen jetzt, wo es in eure Höhlen geht!«
»Nichts werden sie wissen. Das Zepter verwirbelt die Pfade, biegt den Ort, verwandelt selbst die Zeit.«
Das Zepter! Immer wieder dieses Zepter! Dieser golden schimmernde, jedoch auch wie Erz irisierende Stab, den sie mit ihrem eigenen Leben beschützt hatte während des Transports von der Höhle des Alten Königs hierher, erschien der Ritterin mehr und mehr wie eine Droge, welche die Riesen stärker, als es für sie gut war, ruhigstellte. Noch sechsmal innerhalb von nur zwei Tagen versuchte sie, Klellureskan oder einen der anderen Krieger von der Notwendigkeit einer Abschreckungsaktion zu überzeugen. Sie sah es so deutlich vor sich: Falls die Krieger sich weigerten, würde ihre Bande es eben selbst in die Hände nehmen müssen. Bhanu mit ihrem den Tod speienden Bogen. Seraikellas wuchtiges Schwert. Jeron mit seinen noch ungewohnten, aber dennoch markanten Bruchdegen und sie selbst in voller Rüstung mit ihrer Turnierlanze. Sie würden sich einen Namen machen können im Osten des Kontinents, eindrucksvoller, als ihnen dies im Westen je gelungen war.
Kurz bevor sie den Entschluss treffen konnte, mit ihren Leuten auf eigene Faust aufzubrechen, um mindestens zehn, aber besser noch zwanzig Haarhändler auszumerzen, zitierte der König der Riesen sie durch seinen Sprecher Attanturik zu sich.
König Turgenngranet saß auf einem Thron, der aus Tropfstein gewachsen war und dementsprechend wie geschmolzen aussah. »Meine Rittersfrau«, begann er würdevoll, »der Riese möchte dich und einen deiner Leute mit einer gefahrvollen Aufgabe betrauen.«
Die Ritterin ging auf ein Knie und verbeugte sich tief. »Sehr wohl, mein König!« So wenig sie die Krone Aldavas jemals akzeptiert hatte, so leicht fiel es ihr, sich vor diesem weisen Riesen zu verneigen.
»Menschen sind in die Höhle des Alten Königs eingedrungen«, erläuterte Turgenngranet. »Menschen, die nicht zum Mammut gehören. Das Zepter konnte dem Riesen nicht viel über diese Menschen mitteilen, doch der Felsen spürt, wie es auch die Adern des Erzes verstehen, dass diese Menschen Magier sind, dass sie drei sind an Zahl und in Wirklichkeit nur einer und dass es sich bei ihnen um Brüder handelt.«
»Brüder? Drei, die nur einer sind?«
»Sie kamen zu dritt und nannten ohn’ Unterschied der Höhle denselben Familiennamen. Dann wurden sie eins und betraten das richtende Licht. Womöglich führen sie nichts Böses im Schilde, nichtsdestotrotz haben sie die heilige Stätte Rulkineskars ohn’ Einverständnis des Riesen betreten. Sie besaßen den Schlüssel, woher, entzieht sich der Kenntnis. Doch die Höhle ist nun bar des Zepters und ging ihrer Form der Lehre verlustig. Bereits auf den Wegen Der Sieben Wesen wird der Dreibrüderbruder verloren gehen. Eile du dorthin und führe ihn zurück zum Tag, damit er in seiner Verwirrtheit keinen Schaden anrichten kann! Nimm nur einen deiner drei Begleiter mit dir! Falls zu viele Menschen in den nun zepterlosen Hallen umherwandeln, könnten die Fliegen in Unruhe verfallen und sich zu wehren suchen. Wen also willst du wählen?«
»Ich weiß nicht … Seraikella und Jeron sind noch nicht ganz ausgeheilt, aber eine Bogenschützin kann in einer Höhle ja wahrscheinlich nicht viel ausrichten …«
»Zwei Frauen und ein dreigeteilter Mann. Lass es derart beschlossen sein. Geht, ihr Frauen, und lasst dem Riesen eure Männer zur Heilung.«
Die Ritterin hatte das Gefühl, keinerlei Entscheidung selbst getroffen zu haben, fügte sich jedoch. Immerhin gab es endlich etwas zu tun und zu erleben. »Wann sollen wir aufbrechen?«
»Ihr werdet nicht zu reisen brauchen. Das Zepter wird euch ohn’ Verzug zur Höhle bringen. Einzig den Rückweg werdet ihr selbst finden müssen, wiewohl kennt ihr ihn ja bereits.«
»In der Tat. Das wird dieselbe Reise noch einmal, nur diesmal ohne die Angriffe durch Tote. Sollen wir euch den … dreigeteilten, unbefugten Magierbruder mitbringen?«
»Falls er den Weg des Riesen, den des Schmetterlings, des Maulwurfs, der Spinne, des Affen oder des Menschen wählte: Geleitet ihn einfach nur nach draußen und lasst ihn seiner dreifaltigen Wege ziehen! Falls er jedoch den Weg der Tsekoh beschritt: Bringt ihn zu uns! So unverzüglich es euch möglich ist.«
»Und was ist, wenn er Widerstand leistet? Magier haben Mittel und Wege, selbst einer Ritterin schwer zuzusetzen …«
»Frauen sind ebenfalls Magierinnen«, schmunzelte der König nun. »Ihr alle seid es. Ihr müsst es lediglich zu nutzen begreifen.«
Alles andere als zufrieden mit dieser Antwort holte die Ritterin sich Helm und Lanze von ihrem Lager, überprüfte die Verschlüsse ihrer Rüstung, suchte und fand die am Stelenfeld übende Bhanu Hedji, verabschiedete sich von Jeron und Seraikella, die beide eifrig angetrabt kamen und denen sie einschärfte, alles klaglos auszuführen, was die Riesen ihnen während ihrer Abwesenheit auftrugen – und fand sich nach einem kurzen, raucherfüllten Ritual des Rates der Sieben, nach Licht, Dunkelheit und einem Traum, an den sie sich anschließend nicht mehr erinnern konnte, in der legendenumwobenen Höhle des Alten Königs am entgegengesetzten Ende des Kontinents wieder.
Für Jeron MeLeil Gabria und Seraikella verlief der restliche Blättermond ruhig, entschieden zu ruhig. Unter der Obhut des von Hellas Borgondi angeschossenen, jedoch schon wieder seinen Aufgaben nachkommenden Riesenschamanen kurierten sie weiterhin ihre Verwundungen aus. Danach hatten sie beide das Gefühl, auf Jahre hin keine Pilze mehr sehen zu können. Immerhin wurde Jeron seine Gehhilfen los, und Seraikellas Narben waren nur noch Schlieren – die ungestümen Pinselschwünge eines Schwertschemens.
Am 1. Nebelmond knöpften sie sich fünf Haarhändler vor. Einfach nur so, um zu sehen, wozu sie nach ihrer verwundungsbedingten Zwangspause noch in der Lage waren.
Die fünf waren nicht einmal die üblichen Jungspunde, gerade Mutterns Rockzipfel entfleucht, die in der weiten Welt zu Talern und Ruhm kommen wollten. Es handelte sich vielmehr um erfahrene, sehnige Fährtenleser, die schon im Larnwald Flechtenwölfe und Baumspinnen zur Strecke gebracht hatten und im südlichen Bereich der Klippenwälder hinter Langhornkeilern und den sagenumwobenen Buschelefanten vom Anga hergewesen waren, ohne allerdings jemals eines dieser Tiere zu Gesicht zu bekommen. Nun waren sie den Behausungen der Riesen schon näher gekommen als alle anderen Haarhändlerrotten, und Jeron und Seraikella fielen über sie her, als seien die Fährtenleser selbst eine Beute, die um ihrer Stoßzähne willen hoch gehandelt wurde. Im Nu hatte Seraikella einen mit der Breitseite seines Schwertes von den Füßen gehauen und Jeron einen zweiten niedergeschlagen. Jeron hatte dazu die zerbrochenen Degen falsch herum in den Händen, mit den Klingenruinen an seinen Unterarmen, und benutzte Griff und Handschutz der Waffe wie Schlagringe. Zwei Haarhändler wehrten sich, einer flüchtete sofort. Jeron bewegte sich geschmeidig hierhin und dorthin und schlug abwechselnd mit links und rechts dermaßen schnell und hart zu, dass er die beiden Wehrhaften rasch mit aufgeplatzten Gesichtern am Boden hatte. Seraikella setzte unterdessen dem Flüchtenden nach, der jedoch schneller und langbeiniger war. Also warf Seraikella kurzerhand sein Schwert und nagelte den Flüchtenden damit an einen Baum. Schlagartig erstarben alle Bewegungen und sämtlicher Lärm.
Seraikella zog sein Schwert aus dem Toten, sodass dieser ungelenk am Baum herabrutschte und einen blutroten Strich abwärts malte. Dann machte sich der hünenhafte Krieger ans Plündern, so wie auch Jeron, der die Besiegten fachmännisch nach Münzen, Ringen und anderweitigen Wertsachen durchsuchte.
»Es gibt Hunderte von denen«, sagte Jeron, nachdem Seraikella wieder zu ihm zurückgekehrt war. »Eigentlich schade, dass die Riesen keine Kopfprämie für sie zahlen. Wir könnten uns tagelang so beschäftigen.«
Seraikella schwieg. Er fühlte sich ein wenig besser, hatte endlich einmal wieder einen Kampf bestanden. Aber gegen was für Gegner? In einer Welt, in der es reitende Schwertschemen und in schwarze Rüstungen gehüllte Söldnertrupps der Königin gab, Affenmenschen und Spinnenmenschen; in einer Welt, in der Gebirgsbäche ehrfürchtig die Namen der letzten Bartendrachen wisperten und in der die Riesen von wandelnden Schattengöttern raunten, hatte umherstreifendes Mordgesindel keine wirkliche Bedeutung.
Als sie zurückkehrten zu den verborgenen Höhlen, trat ihnen mitten im Wald der Riesenkrieger Arnetukritt in den Weg. Arnetukritt war ein noch verhältnismäßig junger Kämpfer, sein Haar und Bart waren weizenblond, aber an Statur überragte er beinahe alle anderen.
»Habt ihr das Raubgut noch bei euch?«, fragte er, auf die beiden Menschen hinabblickend.
Jeron betrachtete die mit Steinsplittern gespickte Keule, auf die der Riese sich stützte, und antwortete: »Ja. Es gehört jetzt uns. Warum?«
»Was ich jetzt sage, spricht nicht der Riese. Dies spreche einzig ich«, grollte Arnetukritt. »Ihr seid nicht besser als jene. Darum wisset, dass euer Morden nicht im Auftrag des Riesen sich ereignet. Dies ist die Tat von Menschen, welche Menschen Übles wollen. Weiter nichts als dies.«
»Es gibt noch Hunderte von denen«, sagte Jeron noch einmal. »Du musst nicht befürchten, dass wir euch irgendetwas weggenommen haben. Komm, Seraikella.« Sie zwängten sich an dem Riesen vorbei, der einfach stehen blieb. Jeron wollte ruhig und freundlich bleiben, wie die Ritterin ihm das eingeschärft hatte, aber er ärgerte sich. Das Überfallen von Haarhändlern war ihnen als eine gute Idee erschienen, eine angemessene Übung nach zu vielen Tagen in entwürdigendem grünem Verbandszeug. Aber es hatte sich hohl und unbefriedigend angefühlt. Es war einfach kein lohnendes Ziel gewesen. Sie waren Banditen. Sie waren es gewohnt, zu planen, zu überfallen und auch zu töten. Aber ohne die Ritterin – ohne jemanden, der einen Plan verfolgte – wirkte das alles nur wie das sinnlose Herumtrampeln eines Kindes auf einem Ameisenhaufen.
In der Nacht vom 3. auf den 4. Nebelmond bemerkten die Riesen einen eigenartigen Wind im Wildbart, eine Art Wirbelsturm, der kaum größer war als ein Riese und dabei melodiös rauschte und pfiff. Sie beobachteten diese Erscheinung durch das schützende Zepter, die volle Nacht und den Großteil des folgenden Tages lang. Schließlich obsiegte ihre Neugier: Sie beauftragten Jeron und Seraikella damit, den Sturm zu den Riesen zu führen.
Der Sturm entpuppte sich als ein Magier mit südlich dunkler Haut, dunkler noch als die Jerons. Er war in eine schwarze Kapuzenrobe gekleidet und führte einen übermannshohen, hell geschälten Wanderstab mit sich, sonst nichts. Der Mann nannte sich Akamas. Mit einer fließenden Geste seiner Finger ließ er den Wind verschwinden und sagte, er wolle die Riesen treffen, um von ihnen eine Erlaubnis zu erhalten.
König Turgenngranet höchstpersönlich nahm sich des Mannes an, der offensichtlich ein Elementenmagier war, welcher es verstand, mithilfe seines Stabes dermaßen zu brausen und zu musizieren, dass er gefunden werden konnte, anstatt mühsam suchen zu müssen. Von Akamas erfuhren die Riesen, dass die drei Brüder, die in die Höhle des Alten Königs eingedrungen waren, die Gebrüder Dulf aus Warchaim seien, die dort unter dem Namen »die Dreimagier« bekannt waren und den Schlüssel zur Höhle von einem Mitglied des Mammuts verraten bekommen hatten. Dadurch erhielten die Riesen auch frohe Kunde über das Mammut selbst: Rodraeg Delbane hatte seine Pfeilverletzung überstanden, und Naenn – das Schmetterlingsmädchen, das im Sonnenmond in den Wildbarthöhlen zu Besuch gewesen war – hatte ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Sowohl Turgenngranet als auch der übrige Rat der Sieben freuten sich über diese Neuigkeiten sehr.
Das Anliegen jedoch, welches den jungen Schüler der Vier Gründe Akamas zu ihnen führte, war alles andere als erfreulich. Er unterhielt sich lange und ausführlich mit den Riesen über die Tsekoh, jene geheimnisumwitterten Erzfeinde des Riesengeschlechtes, und über seine Theorie, dass die Tsekoh identisch waren mit dem Geisterfürsten und seiner neunköpfigen Truppe – und letzten Endes auch identisch mit den Göttern, wie die Menschen sie verstanden. Darüber hinaus erzählte Akamas von einer Prophezeiung, die den Untergang der Hauptstadt des Glaubens noch für dieses Jahr ankündigte. Diese Prophezeiung erschien der Königin und ihrem Beraterstab glaubhaft, und Akamas sah ebenfalls keinen Anlass, an ihrem Wortlaut zu zweifeln.
Der Rat der Sieben wurde unruhig, als der Magiermönch ihnen dies vortrug. Einige flüsterten sogar in der alten Sprache der Riesen miteinander.
»Darf der Riese fragen«, beugte sich schließlich der König zu Akamas hinunter, »woher diese Prophezeiung stammt?«
»Aus uralten Büchern, die in Tempeln unterschiedlicher Gottheiten verwahrt werden. Man geht allerdings davon aus, dass der Ursprung dieser Prophezeiungen König Rinwe höchstpersönlich ist. Auf seinem Sterbebett soll er seinen Untergebenen noch diktiert haben, worauf sie in Zukunft achtgeben sollten. Dieses ›in Zukunft‹ umfasst letztlich einen Zeitraum von mehr als zweitausend Jahren.«
»Irinweh.« König Turgenngranet nickte, den überlieferten Namen benutzend, mit dem die Riesen König Rinwe bezeichneten. »Er war ein großer König, aber der Riese fand ihn weder des Zepters noch auch nur des Schlüssels zur Höhle des Alten Königs würdig.«
Der Rat der Sieben beobachtete genau, wie Akamas auf diese Herabwürdigung des Mannes reagierte, der den Menschen ihre Zeitrechnung und dem Kontinent seine einheitliche Gestalt verliehen hatte. Doch der junge Magiermönch lächelte nur. »Auch ich bin kein Verfechter der absoluten Rinwe-Verehrung, wie sie in Hauptstadtkreisen in Mode ist. Rinwe war ein bedeutender Kriegsherr, aber wie soll ein Schüler der Vier Gründe wie ich jemanden heilighalten, der durch das Schwert zu Völkern spricht? Unwiderlegbar ist allerdings, dass die Prophezeiungen von großer Genauigkeit und großem Wahrheitsgehalt sind, von wem auch immer sie letztlich stammen. Es gibt für jedes Jahrhundert eine bis vier Voraussagen, und in den rund sechshundertundfünfzig Jahren seit König Rinwes Tod sind ausnahmslos alle diese Prophezeiungen in Erfüllung gegangen.«
»Weil in ihnen der Wille des Einen sich offenbart«, erläuterte einer der anderen uralten Riesen aus dem Rat. »Die Geschichte dieses Kontinents, wie vom ursprünglich Einen Gott entworfen.«
Turgenngranet nickte. »Alle Völker spielen eine Rolle in einem großen Plan. Die Rolle des Riesen war es, die Armeen der Tsekoh zurückzuschlagen, in einem Zeitalter, als von Menschen noch gar ohn’ Reden war. Diese mächtige Aufgabe hat der Riese erfüllt, und nun schwebt er gefangen in Freiheit – ohn’ weiteren Sinn womöglich, doch ohn’ Verantwortung ebenfalls. Du irrst nicht, wenn du annimmst, dass der Geisterfürst und seine Vasallen Tsekoh waren. Du irrst, wenn du annimmst, dass die Tsekoh Götter sind, denn Tausende von Göttern hat es niemals gegeben, allenfalls die Zehn, in die der Eine sich aufspaltete, um der Vielfalt des großen Planes gerecht werden zu können. Du irrst nicht, wenn du annimmst, dass einige der Tsekoh, die von Irinweh in den Sonnenfeldern niedergeworfen wurden, nach dem Norden hin entkommen konnten. Du irrst, wenn du annimmst, dass die Prophezeiungen von Irinweh stammen. Du irrst nicht, wenn du annimmst, dass diese Irinweh entkommenen Tsekoh es sind, von denen die Prophezeiungen sprechen. Du irrst, wenn du annimmst, das Wahrwerden der Prophezeiungen verhindern zu können, denn es sind die Worte und der große Plan des Einen, und sie müssen sich bewahrheiten, wenn nicht die ganze Welt verlöschen will.«
Akamas schwirrte der Kopf. Er musste sich setzen und tat es auch. Aufmerksam betrachteten die Riesen die vierfarbige Elemententätowierung auf seiner Stirn, hinter der es arbeitete, sodass das Zacken- und Wellenmuster mit Leben erfüllt schien.
»Also ist die Hauptstadt des Glaubens verloren«, sagte Akamas tonlos.
»So ist es«, nickte König Turgenngranet.
Akamas’ Lippen wurden schmal und bleich. »Das kann ich nie und nimmer akzeptieren.«
»Du wirst es lernen müssen.«
»Nein!« Der junge Mönch sprang auf. Die schwarzen Augen in seinem ausdrucksvollen Gesicht schienen Funken zu sprühen. »Dann lasst uns Worte und Bedeutungen in Stücke hacken! Die Prophezeiungen sagen, die Hauptstadt des Glaubens wird fallen beziehungsweise sie wird zu Schatten verbrannt werden. Aber es gibt verschiedene Arten und Weisen, zu fallen oder verbrannt zu werden. Mit oder ohne Einwohner zum Beispiel. Fünftausend Tote, wenn es sich um Warchaim handelt, vierhunderttausend Tote aber, falls es doch Aldava ist! Es muss einen Weg geben, die Katastrophe abzuschwächen, sodass es eben nur eine Stadt trifft, nur die Gebäude und Dinge, nicht jedoch die Menschen und Tiere!«
Turgenngranet und auch einige andere Mitglieder des Rates der Sieben lächelten. »Dem mag durchaus so sein.«
Jetzt warf sich Akamas wieder auf den Boden, aber diesmal auf die Knie, in der Geste unterwürfigster Verbeugung. »Dann bitte ich Euch, großer König der Riesen, weiser Rat der Sieben – gewährt mir die Gunst, in der Höhle des Alten Königs den Weg der Tsekoh zu beschreiten, auf dass ich möglichst viel über die Feinde zu lernen vermag und ihnen entgegentreten kann mit Wissen, um den Schaden für den Kontinent, wenn auch nicht abzuwenden, so doch immerhin so gering wie nur irgend möglich zu halten!«
»Dies ist nicht ohn’ Widerhall.« Der König der Riesen lächelte. »Erst vor einem Halbmond sandte der Riese zwei Verbündete in die Höhle des Alten Königs, um die Dreimagier zu bergen und vielleicht sogar hierher zu führen. Noch sind sie nicht zurück. Akamas, der Alte König Rulkineskar selbst wird die Entscheidung treffen. Der Riese sendet dich dorthin ohn’ Zeitverzug. Dort beschreitest du den Weg, nach welchem du verlangst. Trage dann der Höhle all dein Trachten vor und bitte den Alten König, dich so schnell als möglich an ein Ziel zu bringen! Da du nichts trägst und nichts stiehlst, da du deinen Stab hierlassen wirst und auch dein Gewand, ist es nicht ohn’ Möglichkeit, dass die Fliegen dir beistehen, sofern sie begreifen, dass du dich aufrichtig den Tsekoh entgegenstellen möchtest. Bist zu solchem Wagnis du bereit?«
»Das bin ich.« Akamas händigte dem König ohne jegliches Zaudern seinen Stab und seine Robe aus und stand nun tatsächlich lediglich mit einer einfachen Lendenhose bekleidet vor dem Rat.
Mit der Kraft des vergessenen Zepters schickte der Rat auch ihn in die viele Tagesreisen entfernte Höhle des legendären Riesenkönigs Rulkineskar.
Und da Akamas ein Magier war und nicht weltlich wie die Ritterin, Bhanu Hedji, Rodraeg Delbane, Bestar Meckin oder der seine Magie eingebüßt habende Eljazokad, war für ihn diese Reise durch einwärts gekrümmten Raum und zum Stillstand bewegte Zeit ein Erlebnis reich an Farben und Gerüchen, voller Poesie und Irritation, ein Auf-den-Kopf-Stellen von Gegebenheiten, ein sich als wahr erweisendes Trugbild, ein Witz, der zu schallendem Gelächter reizte und ein Sehnsuchtsgesang von verloren gegangenen Möglichkeiten, welcher Tränen der Rührung hervorzurufen imstande war.
Vier Tage später waren weder die Ritterin noch Bhanu Hedji noch Akamas wieder zurück, doch dafür erreichte ein anderer Besucher die Höhlen der Riesen, einer, der keinen Wind und keine Klänge brauchte, um auf sich aufmerksam zu machen, sondern der die Höhlen aus eigener Kenntnis finden konnte.
Es war Bestar Meckin.
Seraikella und Jeron MeLeil Gabria wollten ihn am Eingang abfangen, doch er beachtete sie gar nicht und ging einfach schweigsam an ihnen vorüber nach drinnen. Jeron kannte Bestar von der gemeinsamen Reise von Somnicke nach Tyrngan und erinnerte sich noch gut an dessen unerfahrenes Gebaren in dem fahrbaren Bordell. Seraikella dagegen hatte Bestar Meckin noch nie zu Gesicht bekommen. Auf der Reise mit dem Fliegenstab von Tyrngan zum Wildbart war Bestar nicht dabei gewesen, und während der anderthalb Tage, bevor die Riesen dann das Mammut mit seinem schwer verwundeten Anführer nach Warchaim geschickt hatten, war Seraikella – genau wie Jeron – zu schwer verwundet gewesen, um bei Sinnen zu sein. Seraikella spürte eine ganz unterbewusste Rangordnungskonkurrenz zwischen sich und dem ebenso großen und kräftigen Meckin auflodern, hielt sich jedoch im Zaum, weil Jeron ihm dies nahelegte.
Bestar wünschte den König zu sprechen. Er war aufgebracht und verzweifelt. Dreimal während seiner Reise zum Wildbart war er drauf und dran gewesen, nach Warchaim umzukehren, um dem im Gefängnis sitzenden Rodraeg beizustehen, aber dreimal war ihm klar geworden, dass er nichts ausrichten konnte, ohne selbst verhaftet oder sogar im Kampf erschlagen zu werden. Sein Plan war es gewesen, Warchaim zu verlassen, um so viel wie möglich von der dem Mammut ungerechtfertigterweise angelasteten Schuld mit sich zu ziehen, aber je weiter er kam, desto heftiger quälte ihn das Gefühl, Rodraeg, Naenn, Cajin und Tjarka im Stich gelassen zu haben. Doch was konnte er tun, nun, wo er als Dreifachmörder – als Gardistenmörder noch dazu! – gesucht und verfolgt wurde?
Immerhin hatte er auf der Fahrt den Larnus hinunter zur Abwechslung auch einmal Glück gehabt. Er war bereit gewesen, seinen von den Riesen erhaltenen Bernstein gegen Nahrung und Unterkunft auf dem mit Larnwaldbrennholz beladenen Lastenkahn einzutauschen, doch nachdem er sich der alten Kapitänin bemerkbar gemacht hatte, bewog ihn ihr grundehrliches und faltenreiches Gesicht, die näheren Umstände seiner Flucht aus Warchaim zu erläutern. »Sie halten mich für einen Meuchelmörder, dabei war der eine Getötete ein Schmetterlingsmann und Freund, der zweite war ein Gardist, der wirklich aufrichtig mit uns zusammenarbeitete, und der dritte war der Mörder, der sich vor meinen Augen selbst umgebracht hat, nur um mir das alles anzuhängen!« Die Kapitänin hatte Bestar mit seinem Segmentpanzer, seinem Erzschwert und seinem klatschnassen Vollbart lange betrachtet, dann hatte sie gesagt: »Was immer du auch sein magst, Klippenwälder – ein Meuchler bist du mit Sicherheit nicht.« Und sie hatte ihn umsonst mitgenommen nach Uderun und ihn umsonst mit Nahrung und Proviant versorgt und ihn sogar bei einer Hafenkontrolle der Uderuner Stadtgarde in einer nach Weichkäse riechenden Transportkiste verborgen. Bestar hatte erwogen, ihr seinen Bernstein aus Dankbarkeit zu schenken, aber dann wiederum war dieser Bernstein eine Gabe der Riesen, und er fürchtete, ohne ihn keinen Einlass mehr in die verborgenen Höhlen des Wildbarts zu erhalten. Also hatte er der Kapitänin lediglich versprechen können, ihr eines Tages ebenso zur Seite zu stehen wie sie ihm jetzt und ihren Namen – Yondi Kilkello – bis dahin in Ehren zu halten.
Dennoch hatte er dreimal innegehalten, um umzukehren, das letzte Mal kurz nach Erreichen des Wildbarts.
Nun kämpfte er sich – wie es ihm schien – an sinnlos herumstehenden Tropfsteinen und grundlos freundlichen Riesen vorbei, bis sein Lieblingsriese Kurgattunek ihn irgendwo im Höhlenlabyrinth herumirren fand und ihn behutsam zum König führte.
»Großer König!«, schluchzte Bestar dort. »Gib mir deine Krieger mit! Wir müssen nach Warchaim und Rodraeg dort herausholen! Auch Naenn und Cajin und Nemialé, das kleine Kindlein – sie sind alle in furchtbarer Gefahr!«
»Bestarmekin«, sprach König Turgenngranet ihn mit dem Namen an, dem die Riesen ihm verliehen hatten, »beantworte dir nur eine einzige Frage: Glaubst du wirklich, im Sinne deines guten Freundes Rodrachdelban zu handeln, wenn du nun mit Riesenkriegern und Waffenklirren in die Stadt der Not zurück dich wendest?«
»Aber was soll ich denn sonst tun? Was soll ich denn nur machen? Die bringen es fertig und schlagen ihm den Kopf ab! Und Naenn und Cajin und dem Kind ebenfalls!« Nun musste Bestar die gesamte Geschichte erzählen: von DMDNGW, den mit Nadeln getöteten Einwohnern Warchaims, Rodraegs magisch erzwungenem Attentatsversuch am Stadtgardekommandanten und, und, und. Vieles davon brachte Bestar durcheinander. So verstand er bis zuletzt die Verwicklung ihres Nachbarn von Heyden und des Slessinghausbrandes in das Gesamtgeschehen nicht und schob der Einfachheit halber alles DMDNGW in die Schuhe. Aber sowohl Turgenngranet als auch der übrige Rat der Sieben begriffen, dass dem Mammut eine wohldurchdachte Falle gestellt worden war, eine Falle, die sogar über die noch recht überschaubare Historie des Mammuts hinausreichte und auch andere Warchaimer, andere Generationen und andere Städte miteinbezog. Eine Falle, die in die unheilsdurchwobene Zeit zu passen schien, von der ihnen der Magiermönch Akamas mit seinen Prophezeiungen berichtet hatte.
»Bestarmekin«, sprach der König erneut, »alles, was dir der Riese vorschlagen kann, ist jenes: Nun, da du hier bist, um dem Riesen zur Seite zu stehen, könnte er einen der beiden Krieger der Rittersfrau entbehren. Beide sind nicht in die Geschehnisse um Warchaim verwickelt, mithin könnten sie sich dort umhören, ohn’ Gefahr für ihr eigenes Leben. Doch auszurichten vermöchten sie alleine nichts. Und es würde eine weitere Woche mit sich bringen, ehe sie mit ihren Neuigkeiten bis hierhin gelangen.«
»Verflucht!«, spie Bestar heraus. »Das bringt doch alles nichts. Seit ich dort weg bin, sind doch auch schon wieder … mehr als zehn Tage verstrichen. Ich habe schon völlig den Überblick verloren. Es waren mehr als zehn Tage, zwölf oder dreizehn. Bis dahin … wir haben doch längst Nebelmond, oder?«
»Der Mensch schreibt schon den Achten heute.«
Bestar barg sein Gesicht in den Händen. »Dann ist doch ohnehin alles schon vorbei. Das Mammut ist gefallen, und ich feige Drecksau habe mich rechtzeitig aus dem Staub gemacht.«
»Bestarmekin«, sagte der König zum dritten Mal, und diesmal dröhnte seine Stimme regelrecht in der kleinen, nach gewürztem Rauch duftenden Thronhalle. »Allein, dass du am Leben bist, bedeutet, dass du eurem Feind eine Niederlage zugefügt hast. Selbst wenn es ihm gelingen sollte, alle anderen von euch zu bezwingen, so wird das Mammut dennoch fortbestehen, denn du bist das Mammut.«
Bestar hörte diese Worte, die auch in den folgenden Tagen immer wieder, lauter und lauter werdend, in seinem Kopf widerhallten, doch sie vermochten sein Herz nicht im Mindesten zu trösten.
Er rannte aus den Höhlen, verbarg sich vor den anderen, weinte wie ein kleiner Junge im vielfarbenen und in den Nächten in höheren Lagen nun bereits frostig bereiften Herbstlaub der Wildbarthänge, prügelte auf bemooste Steine ein, erwog, sich von einem hohen Grat herabzustürzen, mied das Stelenfeld und die anderen Plätze, wo weniger schuldbeladene Krieger als er sich trafen und miteinander maßen, und bediente sich höchstens verstohlen von dem abgebratenen Bergziegenfleisch mit Kräuterbrot, das Kurgattunek ihm mitfühlend in verschlossenen Tongefäßen zwischen die Steine mit dem abgeplatzten Moos stellte.
Nach vier weiteren Tagen war es ausgerechnet Seraikella, der ihn auf einem windigen und trostlosen Felsvorsprung aufspürte, um ihm mitzuteilen, dass Rodraeg Talavessa Delbane wohlbehalten bei den Riesen angekommen sei.
Bestar zersplitterte beinahe vor unbändiger Freude. Er wurde von Seraikella gleich einem zappeligen Staffelstab an Kurgattunek übergeben und kam Seite an Seite mit dem Riesen in die Höhlen gestürmt wie eine Naturgewalt. Als er Rodraeg dann tatsächlich dort stehen sah, schmaler und älter als jemals zuvor, lachte er laut auf, packte ihn, hielt ihn mit ausgestreckten Armen vor sich hin wie ein Kind, drückte ihn dann an seine Wange und wiegte ihn hin und her. Dabei kullerten erneut Tränen in seinen Bart. Dann erst gelang es ihm, sich einigermaßen zu fassen: »Wie bist du …? Wie kannst du …? Sie haben dich freigelassen, und alles wird gut?«
Rodraeg lächelte schüchtern. Ihm war schwindelig von den Strapazen der Reise und von Bestars Schüttelei.
Er trug Kleidung, die schlecht roch, ihm deutlich zu groß und für den Nebelmond auch nicht warm genug war. Er war unbewaffnet, hatte eine böse aussehende Schnittwunde in der rechten Handfläche und als einzigen Besitz eine leere, verkorkte Glasphiole, die Riban Leribin ihm anvertraut hatte, und eine rätselhafte Münze, wie sie noch keiner der Anwesenden je zu Gesicht bekommen hatte.
Die Geschichte, die Rodraeg zu erzählen hatte, war düster und entbehrte jeglicher würdevoller Selbstdarstellung. Dennoch lud er Jeron MeLeil Gabria und Seraikella sowie jeden Riesen, der sich dafür interessierte, ausdrücklich dazu ein, sie zu hören. Und es kamen so viele in die Höhle des Rates, dass die Luft sehr stickig wurde und die Fackeln blakten, sodass alle Schatten wie irrsinnig zu tanzen begannen. Noch vor Kurzem hätte Rodraeg es in diesem Rauch gar nicht ausgehalten – er wäre hustend zusammengebrochen. Immerhin das war vorüber, immerhin diese eine Schwäche nun Vergangenheit.
Rodraeg atmete tief ein und erzählte von dem unsichtbaren und unfassbaren Feind, der sich der Mann, der nicht geboren wurde genannt hatte und der ihn, Rodraeg, über ein fingiertes Attentat am Warchaimer Stadtgardekommandanten Gauden Endreasis ins Gefängnis manövriert hatte.
»… als ich wieder zu mir kam«, übertönte Rodraegs Stimme das Scharren und Schnaufen der Zuhörer, »als ich aufwachte, wie ich annahm, fand ich mich mit der Mordnadel in der Hand über den Kommandanten gebeugt. Es war … für einen Augenblick wusste ich nicht mehr, ob mein ganzes bisheriges, für verhältnismäßig anständig gehaltenes Leben in Wirklichkeit ein Traum war und ich tatsächlich nur ein Mörder, der unter Schlafwandlerei litt …«
Ende der Leseprobe