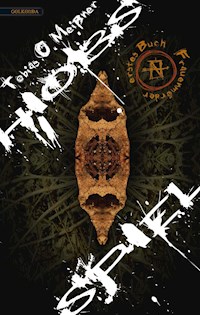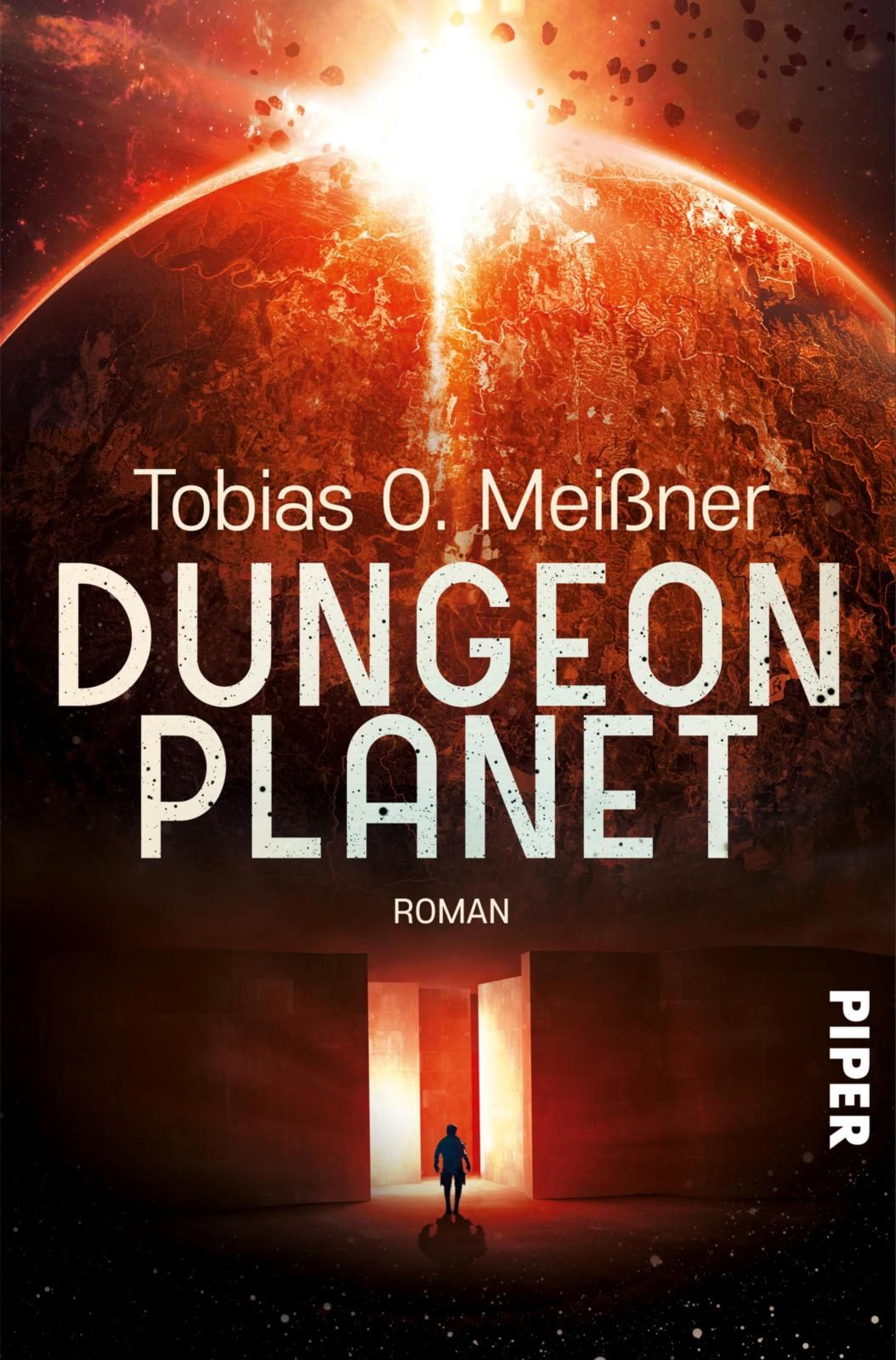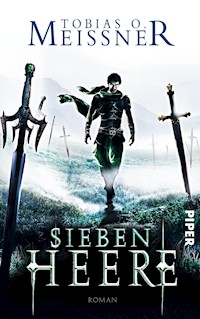Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wollen Sie die Gegenwart überschreiten und einen Blick in die Zukunft werfen, die Golkonda und Memoranda für Sie bereit halten? Stürzen Sie sich in das nächste Prognosticon, das Hiob Montag bevorsteht; wägen Sie mit Otmar Jenner ab, welche Folgen ein ewiges Leben auf die Gesellschaft haben könnte; besuchen Sie in einer außergewöhnlichen Weltraum-Operette von Erik Simon & Angela und Karlheinz Steinmüller den Trödelmond Toliman; durchforsten Sie mit Hellboy den Horror eines paranormalen Nebels. Mit exklusiven Leseproben erhalten Sie phantastische Einblicke in das Programm 2018 des Golkonda Verlags und dessen Imprint Memoranda. Dieses kostenlose E-Book enthält Leseproben zu: "Der Älteste" von Otmar Jenner "Hiobs Spiel 4: Weltmeister" von Tobias O. Meißner "Der Tag der Lerche" von Jo Walton "Hap & Leonard: Die Storys" von Joe R. Lansdale "Captain Future 06: Sternenstraße zum Ruhm" von Edmond Hamilton "H. P. Lovecraft: Leben und Werk" von S. T. Joshi "Der Himmel auf dem Mars" von Ray Bradbury (enthalten in "Science Fiction Hall of Fame – Die besten Storys 1948-1963" von Robert Silverberg (Hrsg.)) "Der vor dem Zaubrer flieht" von Peter Crowther (enthalten in "Hellboy 2: Eine offene Rechnung" von Mike Mignola & Christopher Golden) "Kane 3: Herrin der Schatten" von Karl Edward Wagner "Die Wurmloch-Odyssee" von Erik Simon & Angela und Karlheinz Steinmüller "Die Hugo Awards 2001 – 2017" von Hardy Kettlitz "SF Personality 26: Robert Silverberg – Zeiten der Wandlung" von Uwe Anton "Fortschritt und Fiasko – Die ersten 100 Jahre der deutschen Science Fiction" von Hans Frey "Die Überschreitung der Gegenwart – Science Fiction als evolutionäre Spekulation" von Wolfgang Neuhaus
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Phantastische Einblicke
Golkonda | Memoranda 2018
Die Leseproben
Mit diesem E-Book …
… möchten wir einen Vorgeschmack auf das darbieten, was im Laufe des Jahres 2018 in Buchform erscheinen wird: Kurze Zusammenfassungen einiger Bücher, die in diesem Jahr erscheinen sollen, Informationen zu AutorInnen und HerausgeberInnen sowie zahlreiche tiefe Einblicke in phantastische Geschichten, kultige Romane und lesenswerte Sachbücher.
Viel Spaß beim Schmökern!
Das Golkonda-Team
Inhalt
Inhalt
Otmar Jenner: Der Älteste
Tobias O. Meißner: Hiobs Spiel 4 – Weltmeister
Jo Walton: Der Tag der Lerche
Joe R. Lansdale: Hap & Leonard – Die Storys
Edmond Hamilton: Captain Future 6 – Sternenstraße zum Ruhm
S. T. Joshi: H. P. Lovecraft – Leben und Werk
Robert Silverberg (Hrsg.): Science Fiction Hall of Fame 2 – Die besten Storys von 1948–1963
Christopher Golden (Hrsg.) & Mike Mignola (Ill.): Hellboy 2 – Eine offene Rechnung
Karl Edward Wagner: Kane 3 – Herrin der Schatten
MEMORANDA-Bücher im Golkonda Verlag
Angela & Karlheinz Steinmüller: Werke in Einzelausgaben
Hardy Kettlitz: Die Hugo Awards 2001–2017
Uwe Anton: SF Personality 26 – Robert Silverberg – Zeiten der Wandlung
Hans Frey: Fortschritt und Fiasko – Die ersten 100 Jahre der deutschen Science Fiction
Wolfgang Neuhaus: Die Überschreitung der Gegenwart – Science Fiction als evolutionäre Spekulation
Impressum
Phantastik im Golkonda Verlag
Otmar Jenner
Der Älteste
Über den Autor
Otmar Jenner spielte in einer Rockband, arbeitete u. a. als Kriegsreporter und schrieb den viel besprochenen Roman Sarajevo Safari. Er lebt in Berlin und unterrichtet Sterbebegleitung. Neben eigenen Musikproduktionen beschäftigt er sich mit fotografischer Kunst. Mit Der Älteste wagt er zum ersten Mal den Schritt in die Science Fiction. Das Ergebnis: ein mitreißender Science Thriller über das beinahe ewige Leben und seine grotesken Folgen.
Der Roman
Wie alt kann ein Mensch werden, ohne seine Menschlichkeit zu verlieren?
Eine einfache Zeitungsmeldung führt Ole Meerzen über die Grenzen unserer Existenz hinaus: In Sevilla soll der älteste lebende Mensch entdeckt worden sein. Auf der Suche verliert er sich immer tiefer in einem bedrohlichen Labyrinth aus seltsamen Erscheinungen und Zweifeln an unserer Realität und merkt, dass der Älteste gute Gründe hat, sich und sein Leben verborgen zu halten.
Dieser Textauszug stammt aus:
Otmar Jenner
Der Älteste
Roman
560 Seiten | Geb. mit Schutzumschlag
€ [D] 24,90 / [A] € 25,60
ISBN 978-3-946503-22-4 | Auch als E-Book erhältlich: ISBN 978-3-946503-23-1
Originalausgabe
Copyright © 2018 by Otmar Jenner
PROLOG
Sie empfinden Schmerz. Sie verfügen über ein Nervensystem und Rezeptoren. Zwar schützt ihr Panzer sie und gibt ihnen Stabilität, doch ist dieser Panzer nach wenigen Tagen ausgebildet und wächst nicht weiter, der Körper darin allerdings schon. Alljährlich wird es ihnen in ihren Panzern zu eng, was schmerzhaft ist. Schließlich so schmerzhaft, dass sie im Frühsommer ein Versteck aufsuchen, sich darin auf die Seite legen, zusammenkrümmen und im Zuge der Häutung ihre Panzer verlassen. Innerhalb weniger Stunden schwellen die gestauchten Körper auf eine neue Größe an und neue Panzer bilden sich, um dann wieder zu eng zu werden, was ihnen erneut Schmerzen bereitet, weshalb sie im folgenden Frühsommer ihr altes oder ein neues Versteck aufsuchen und sich auf die Seite legen für die nächste Häutung.
Bei jeder Häutung wachsen sie um zehn bis zwanzig Prozent, den Großteil davon direkt nach Verlassen des Panzers. Man kann sich also ausrechnen, wie eingezwängt ihr Körper im Panzer war, wie sehr er dadurch Schmerzen erlitten hat und in welchem Ausmaß der Schmerz zu ihrem Leben gehört. Jahr für Jahr. Von Häutung zu Häutung.
Ihr Leben. Es tut ihnen weh.
Ein Dasein als Hummer ist von Natur aus schmerzhaft.
Europäische können eineinhalb Meter lang werden, amerikanische knapp fünfzig Zentimeter länger. Doch Hummer werden nicht nur groß, sondern auch alt, durchschnittlich siebzig Jahre, also ein Menschenalter, nicht selten aber auch über hundert Jahre. Angeblich wurde irgendwann ein hundertvierzig Jahre alter Hummer gefunden, älter als jeder imGUINNESS WORLD RECORDS BUCHverzeichnete älteste Mensch. Dieses alte Tier hatte demnach hundertvierzig qualvolle Zeiten wachsender Stauchungen und nur temporär erlösender Häutungen hinter sich.
Auszug aus Kapitel 4
Erlauben Sie mir, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Ole Meerzen, bin 54 Jahre alt, etwa fünf Jahre jünger, als meistens vermutet wird, hatte einmal rotblonde Haare, die inzwischen aber vollständig graublond sind, bin laut Pass einsachtzig groß, habe einen Bauch, was mich selbst oft sehr stört, aber ungewöhnlich große blaue Augen mit grünbraunem Rand, die manche Frauen schon als faszinierend beschrieben haben, weshalb ich mich ganz so hässlich nun auch wieder nicht finde und immer wieder sogar Freude am Leben habe, was leider durch eine in der Pubertät diagnostizierte psychische Störung beeinträchtigt wird. Es heißt, ich hätte ein Problem damit, mich als konsistentes Selbst zu erfahren und auch zu sehen und wäre ein Grenzgänger.
Das ist nicht die ganze Wahrheit, denn, um ehrlich zu sein, hatte und habe ich selbst kein Problem damit. Ich bleibe singulär, rede zwar immer wieder in der dritten Person über mich, aber nicht im Plural, wachse auch nicht manisch ins Königliche, um am nächsten Tag zur letzten Laus vorm Weltuntergang zu schrumpfen und in tiefer Depression zu versinken, bin also nicht bipolar im klassischen Sinne, sondern irgendwie, ja, dual, denn mir fällt selbst auf, dass ich immer wieder denke und auch sage »er« oder »der Ole« habe dies oder jenes getan. Er und ich – wir können prima Zwiesprache halten und sind gewissermaßen intern freundschaftlich verbunden, was natürlich auch für Befremden sorgen und auf Unverständnis stoßen kann. Aber im Ernst – wem geht das insgeheim eigentlich nicht so? Jedenfalls ist meine Dualität nur eine von vielen Seltsamkeiten in meinem Leben. Und sicherlich nicht die letzte. (…)
Auszug aus Kapitel 5
Fünfhundert? 500! Ein Mensch diesen Alters musste in seinem Leben schon viele Geburtsurkunden gefälscht haben, denn anders wäre wohl nicht zu erklären, warum er erst dieser Tage gefunden worden war. Einhundert, der Eintritt ins Reich der Dreistelligkeit, bisher umweht vom Hauch der Ewigkeit, schien mit seiner Existenz wie zurückgeworfen in die Zeit der Adoleszenz. Die Ältesten der Alten – auf einmal wirkten sie jung verblüht. Doch so weit war ich mit meinen Gedanken noch nicht, als ich an jenem trüben Berliner Morgen in einem Café sitzend Veroux aus der Hand legte und die Zeitung des Tages las.
Vor einigen Tagen hatte ich Johannes Elmang wiedergetroffen, mit 87 angeblich Berlins ältester Partyraver. Elmang stand am U-Bahnhof Kottbusser Tor am Gleis der U1 in Richtung Uhlandstraße und trat wegen der Kälte von einem Bein aufs andere. Wie immer trug er hautenge Röhrenhosen, dazu Schnürstiefel mit Budapester-Nähten und einen dunkelbraunen Ledermantel, allerdings nicht zugeknöpft, weswegen das oliv-grünblau karierte Sakko aus Harris-Tweed, das er darunter trug, sichtbar war, sowie eine pink-blau-schwarz gestreifte Fliege zu einem lila Hemd, kaum verdeckt von einem hellgrauen Schal.
»Ahoi, Elmang«, begrüßte ich ihn. Er nickte anstelle einer Antwort und drehte sich würdevoll einmal um die eigene Achse. Dann fuhr auch schon der Zug ein, und Elmang entschwand in einem Abteil. Weil ich in die Gegenrichtung musste, mein Zug aber erst in einer Minute kam, blieb ich auf seiner Seite des Bahnsteigs stehen, sah, wie er sich setzte und sofort von einer Gruppe junger, hübscher Mädchen angesprochen wurde. Man konnte neidisch werden bei dem Erfolg eines solchen Auftritts. Vor einigen Monaten hatte ihm das eine Einladung für Modeaufnahmen in Japan eingebracht und den Ruf des coolsten Alten aller Zeiten. Elmang ließ sich mehrfach in den Klubs »Burgschein« und »Le Mal« blicken und wurde regelmäßig im »Queen Victoria« beim Tanzen gesehen.
Während der Zug anfuhr, sah ich, wie eines der Mädchen, eine dunkelhaarige Schönheit, Elmang einen Stift und ein Stück Papier reichte, woraufhin er mit sichtlich erfreutem Gesichtsausdruck etwas daraufschrieb – wahrscheinlich eine Widmung und sein Autogramm. Ich gönnte ihm diesen späten Ruhm. Was sollte ich Johannes Elmang sagen, wenn ich ihn das nächste Mal traf? Vielleicht: He, Mann, nach dem jetzigen Stand der Gerontologie bist du gerade mitten in der Pubertät.
Er wandte sich in die Richtung, in der die Alfalfa liegen sollte, musste aber die Abzweigung, die man ihm genannt hatte, verpasst haben, denn er landete in einer ungewöhnlich breit angelegten Sackgasse mit Geschäften zu beiden Seiten. Rechts wies das sehr aufwändig gemalte Bild einer dunklen Schönheit in einem rotweißen Rüschenkleid mit wehenden Haaren und Kastagnetten in beiden Händen auf den Eingang zu einem Geschäft für Folkloreartikel. Der Laden schräg gegenüber wirkte dagegen heruntergekommen und irgendwie abstoßend, hatte aber den eigenartigen Namen »Matteo Perlheims Fantasie-Store«. Erst wollte er sich abwenden, überlegte es sich aber dann anders.
»Sie«, sagte er mit lauter Stimme, während er den Laden betrat und auf den Mann zusteuerte, der genauso mächtig wirkte wie der Schreibtisch, an dem er saß, »Sie müssen Matteo Perlheim sein.«
»Sie sagen es«, antwortete der Mann und hob seinen dicken Kopf mit einer solchen zeitlupenartigen Langsamkeit, dass er das Geschäft wieder verlassen hätte, wenn das Plakat im Rücken des Mannes nicht gewesen wäre.
»I teech yo whatewer yo wont«, stand dort.
»Sie können mir also alles beibringen? Mich lehren, was auch immer ich lernen will?«, fragte er daher den Mann.
»Sí«, brummte der daraufhin.
»Was Sie geschrieben haben, da oben«, er zeigte auf das Plakat, »ist aber falsches Englisch. Wenn Sie es selbst nicht beherrschen, wie könnten Sie mir richtiges beibringen, falls ich das von Ihnen verlangen wollte?«
Der Mann kniff sein linkes Auge zu und blickte den Besucher mit dem rechten an, während er sich mit beiden Händen vom Schreibtisch in eine stehende Haltung wuchtete und dabei mit einem seltsamen Schwanken in der Stimme fragte: »Spüren Sie es?«
»Was meinen Sie?«, erwiderte er, lauter, als er es beabsichtigt hatte.
»Schauen Sie auf die Straße«, kommandierte Kneifauge daraufhin.
Doch konnte er dort draußen beim besten Willen nichts Besonderes entdecken. Eine Möwe pickte am Boden. Eine zweite hockte auf einem Mauervorsprung und sah der ersten zu. Ein trostloser Anblick. »Was meinen Sie?«, wiederholte er ungeduldig.
»Es hat begonnen«, sagte der Mann mit einer ungewöhnlich tiefen und wohlklingenden Stimme. »Die Ankündigung.«
»Verstehe«, sagte er nun, um irgendetwas zu sagen und sein Gegenüber nicht zu verärgern, denn er hatte ja eine Frage, auf die er eine Antwort suchte. Möglich, dass dieser seltsame Mensch in diesem seltsamen Geschäft sie kannte. Oder ihn darin unterrichteten könnte, wie der Älteste am besten zu finden war.
Er wandte sich wieder zu Matteo Perlheim um, der sich mit seinen fetten Armen und der angesammelten Masse menschlichen Phlegmas auf die Tischkante stützte. Doch der Dicke ließ den Kopf auf die Brust sinken und sah vor sich auf den Boden.
Mit seiner Geduld am Ende, wollte er schon den Laden verlassen, als er erneut die Stimme des Inhabers hörte.
»Der Wind atmet, was die Leute noch nicht wissen«, sang der Mann hinter seinem Rücken. »Das ist das revolutionäre Pathos.«
»Was Sie nicht sagen.« Erstaunt blickte er sich nochmals zu dem Mann um. Der stand jetzt vollständig aufrecht, hatte nun sein rechtes Auge zugekniffen und stattdessen das linke aufgerissen. Mit dem linken hatte er einen Blick, der irgendwie lodernd und irre wirkte. »Schauen Sie genau her«, befahl der Mann und hob die linke Hand mit dem ausgestreckten, sehr dicken Zeigefinger. »Schauen Sie auf meinen Finger.« Er begann die Hand vor dem Gesicht des Besuchers zu bewegen. Hin und her. Schneller. Und noch schneller.
Und dann fand er sich draußen auf der Straße wieder. Im ersten Moment hatte er keinen weiteren Gedanken, sondern fühlte sich geradezu umhüllt und durchdrungen von der Verblüffung, plötzlich in der Sackgasse vor dem Laden zu stehen. Der Gedanke klebte an ihm und wollte ihn eine gefühlte Ewigkeit lang nicht loslassen. Doch dann fegte ein Luftzug durch die Gasse und blies auch in seinem Kopf etwas frei – und er dachte einen zweiten Gedanken. Warum hatte er den Ladeninhaber weder nach dem Ältesten gefragt noch ihm den abfotografierten Zeitungsartikel auf dem Handy gezeigt? »Wie dumm ist das denn?«, dachte er laut und versuchte, dies gleichzeitig auch leise zu sagen. Aber es wurde ein stiller Gedanke und ein lautloses Flüstern daraus.
Minutenlang rang er mit sich selbst. Der Laden war inzwischen dunkel. Wahrscheinlich hatte Perlheim das Licht gelöscht und vorzeitig geschlossen. Er nahm sich vor, morgen zu entscheiden, ob er wiederkommen und den Inhaber zur Rede stellen wollte, unterdrückte aufkommenden Ärger, zog schließlich sein Portemonnaie mit dem darin gefalteten Original aus der Hosentasche und entnahm den Ausschnitt. Vielleicht mit dem unbewussten Impuls, die Wahrhaftigkeit des darin Beschriebenen mit den Händen fühlen zu wollen. Anschließend stand er noch einige Minuten an eine Hauswand gelehnt neben dem Geschäft herum und dachte absolut gar nichts. Er, der auch ich ist.
»Geboren am 4. März 1517 in Cádiz, männlich, lebendig, ein medizinisches Wunder.«
Am selben Tag, einem Montag, erfuhr ich aus dem Internet, war Hernández de Córdoba von Kuba aus losgesegelt, um auf der Insel Guanaja vor Honduras Sklaven für die spanische Krone zu fangen. Die Seite mit dem Impressum der Zeitung hatte sich dann auch noch angefunden. Den Chefredakteur kannte ich nicht, dafür seine Stellvertreterin, Hannelore von Noretzki, meine ehemalige Kollegin, die ich einige Wochen lang auch nach der Arbeit getroffen hatte.
»Ah, Meerzen, lange nichts von dir gehört«, hatte Noretzki gesagt, als ich mich vor einigen Wochen schließlich überwunden hatte, sie anzurufen.
»¡Hola, Hanne«, grüßte ich zurück. »Wie läuft’s?«
»In die falsche Richtung.« Stille am anderen Ende der Leitung. »Gestern wurde eine Kollegin nicht weit vom Eingang erstochen. Deshalb und wegen möglicher Anschläge haben sie an der Pforte Kontrollen wie am Flughafen installiert.«
»Die Inghimasi?«
»Wie die Termiten«, erwiderte sie. »Stürzen sich für die Gruppe ins Feuer oder … Bombe, boom, puff, Brücke ins Himmelreich. Hat was Heroisches und Verlorenes zugleich.«
»Schlimm, das«, sagte ich.
»Kapitaler Mist, das«, sagte sie.
Ich hörte es zweimal in der Leitung krachen, bevor sie weitersprach. »Aber, ganz ehrlich, dir kann ich das ja sagen. Diese Stimmung hält mich irgendwie am Leben. Ich habe Angst, mich in Bedeutungslosigkeit und Langeweile aufzulösen.«
Ich verstand nicht so recht, was sie meinte, wollte aber auch nicht unhöflich sein und fragte deshalb weiter: »Und der Verlag?«
»Katastrophe. Die erste Entlassungswelle hat mich verschont, die zweite einige gute Kollegen aus dem Haus geschossen. Otmar Jenner, mit dem du ja auch gearbeitet hast, ist aber schon vorher gegangen. Ja, die Einschläge kommen näher. Vor der dritten Welle haben sie mir einen Auflösungsvertrag angeboten, um die Sache gütlich zu regeln. Ich habe mich geweigert, einen Anwalt genommen und konnte bleiben. Nun, o Wunder, bin ich sogar Stellvertreterin. Aber die guten Jahre sind vorbei. Alte Träume? Begraben. Hey, Meerzen, bist rechtzeitig gegangen.«
»Wahrscheinlich«, sagte ich.
»Spielst du noch?«
»Ja, manchmal mit dem Gedanken, wieder anzufangen.«
Noretzki war früher Bassistin in New-Wave-Bands gewesen, doch nie in derselben wie ich. Unsere frühere Freundschaft, aus der beinahe eine Beziehung geworden wäre, wurde in diesem Telefonat auf eine seltsame Weise reaktiviert. Für Sekunden öffnete sich die Leitung wie ein Kanal und Noretzki kam näher.
Doch genau das wollte er am wenigsten. Deshalb auch sein anfängliches Zögern.
»Hey, alles jammerschade, sowieso«, trompetete er in den Hörer und fragte sich gleichzeitig, was er mit »alles« eigentlich meinte. Sie redeten einige Minuten über alte und neue Zeiten und die Tatsache, dass der Journalismus von heute nur noch ein Schatten dessen sei, was sie beide einst kennengelernt hatten. Er hörte Melancholie in ihrer Stimme, während sie sprachen, einmal sogar den Klang echter Trauer. Der berufliche Ernst von einst, ihre Hingabe an die Sache hatte sich in einer Mischung aus Wehmut und Zynismus aufgelöst. Budgetkürzungen, Einschränkungen, Qualitätseinbußen, Niedergang, interne Querelen, nach außen hin hielt sie aber immer noch die Ehrenfahne hoch. Die Freiheitsstandarte des aufgeklärten Westens – eigentlich zum Kotzen. Wenn er richtig informiert war, hatte Noretzki vor Jahren geheiratet. Kurz nach seiner Kündigung, glaubte er zu wissen. Aus beruflichen Gründen hatte sie keine Kinder bekommen.
»Eigentlich zum Kotzen«, sagte Noretzki.
Nach einem kurzen, daran anschließenden vertiefenden Meinungsaustausch über die disparate Weltlage nannte er sein tatsächliches Anliegen, was sie ein bisschen zu enttäuschen schien. Doch stellte sie ihn zum Leiter des Kulturressorts durch, der ihn wiederum an den zuständigen Redakteur verwies. Beide klangen hektisch wegen der aktuellen Ereignisse, hatten eigentlich keine Zeit für einen Ex-Kollegen. Beide nuschelten die Überzeugung, dass die Meldung keine Falschmeldung, sondern ernst zu nehmen war, was immer das auch heißen mochte.
»Na ja, entweder oder«, sagte er.
Der Redakteur, ein Mensch mit einer leicht zittrigen, aber dabei sehr jungen Telefonstimme, erklärte ihm, er sei selbst so verblüfft wie skeptisch gewesen. Aber die spanische Agentur EFE hätte die Nachricht gebracht, dann auch Reuters und die Deutsche Presseagentur. Und auf die Agenturen sei ja grundsätzlich Verlass.
Da wäre er jetzt nicht so sicher, wollte er erst antworten, doch eine solche Diskussion hatte er ja gerade mit Noretzki gehabt.
Ob er ihm den Namen des Mannes sagen könne, fragte er, denn in der Zeitung hatte nur der Vorname und der erste Buchstabe seines Nachnamens gestanden, Angelo F.
Dabei sei tatsächlich ein Fehler passiert, erwiderte der Redakteur. Der Mann heiße Angelo Francisco Álvarez de Cádiz.
Warum Cádiz?, fragte er.
Weil der Alte dort geboren ist, so der Redakteur. Doch lebe er heute in Sevilla.
Also Andalusien, hatte er gedacht und aufgelegt.
Auszug aus Kapitel 7
Gegen 17 Uhr lag die Straße bereits im gelblichen Licht der Abendbeleuchtung. Er schritt die Alfalfa ab, um die Namen auf den Klingelbrettern zu lesen. Aber es standen dort keine Namen, nur Nummern. Etwa eine Stunde lang lief er die Straße auf und ab. Es gab einen Bäcker, einen Obst- und Gemüseladen, ein Schuhgeschäft und einen Krawattenladen, der auch Fliegen und Gürtel führte. Er ging in jeden Laden, zeigte das Foto von Álvarez, doch niemand wollte ihn gesehen haben. Also doch rüber zur Antonio Diaz. Kurz vor der Maestranza entdeckte er, dass ihm jemand folgte – ein Mädchen, vielleicht zwölf, dreizehn Jahre alt, in einen grauen Poncho gehüllt, aus dem ihre Arme dünn herausragten. Sie bewegte sich mit einer eigenartigen, fast katzenhaften Körperkontrolle und machte insgesamt einen wilden Eindruck auf ihn. Die schwarzen Haare quollen aus einer dunklen Wollmütze in ihr Gesicht und auf ihre Schultern. Als er sich umdrehte und ihr zuwandte, fror ihre Bewegung zu einer lauernden Haltung ein. Einen Moment lang blickten sie einander direkt an. Er meinte zu erkennen, dass sie orangeroten Lippenstift trug und sich die Fingernägel schwarz lackiert hatte.
Fast automatisch machte er ein, zwei Schritte auf sie zu, um sie zu fragen, warum sie ihm folgte. Sie stampfte aus irgendeinem Grund mehrmals mit dem rechten Fuß auf. Als er einen weiteren Schritt in ihre Richtung ging, drehte sie sich um und lief davon. Einige Straßen weiter entdeckte er sie wieder und rief ihr zu, dass er gern mit ihr sprechen würde. Daraufhin verschwand sie erneut. (…)
Auszug aus Kapitel 8
(…) Ich brauchte nur an den Ältesten zu denken und fühlte mich innerlich ruhiger werden. Als würden die Gedanken an ihn den Druck und die Hektik aus meinem eigenen Dasein nehmen. Hast konnte ich mir bei Álvarez jedenfalls nicht vorstellen. Nicht nach fünfhundert Jahren. Hektik und Stress, so dachte ich, mussten bei der Länge lange überwunden sein. Allerdings, nur weil eine Geschichte lang ist, muss sie ja nicht automatisch schön sein. Bei manchen Geschichten möchte man wünschen, dass sie möglichst schnell enden. Manche Biografien beginnen furchtbar, enden schrecklich und erscheinen auch dazwischen alles andere als erfreulich. Manchen Menschen tut das ganze Leben weh. (…)
Auszug aus Kapitel 10
(…) Die Zeit verlangsamt sich. In Zeitlupe erhebt sich das Unterbewusste, das magische Selbst aus dem Ozean der Selbstvergessenheit und ragt plötzlich wie ein Pickel aus der Oberfläche der Aufmerksamkeit in die Gegenwart. Seine Gegenwart.
Meine Gegenwart. Sie begann sich zu zersetzen. Meine Augen drifteten auseinander, meine Ohren fühlten sich an, als wären sie auf den Hinterkopf gewandert, und meine Nase hatte sich von meinem Mund auf eine sehr unangemessene, irgendwie despektierliche Weise distanziert. Man konnte sich natürlich fragen, was Nase und Mund miteinander zu tun hatten, über die Tatsache hinaus, dass durch beide geatmet werden konnte, manche Leute nasal sprachen, aber dafür den Mund benutzten, man mit der Zunge aber nicht riechen konnte, was, so gesehen, doch ziemlich willkürlich war. Mein Kopf fühlte sich an, als hätte er plötzlich Schlagseite, denn mein Gehirn schien nach rechts verrutscht und sorgte für Gleichgewichtsprobleme.
Ich blieb stehen und befühlte mit beiden Händen meine Ohren, legte die Handflächen auf die Augen, berührte mit den Fingerspitzen die geschlossenen Lider, fuhr mit den Flächen über die Wangenknochen hoch zu den Schläfen, strich mit den ausgestreckten Zeigefingern beider Hände über die Nasenflügel am Mund vorbei zum Kinn, befühlte das Kinn, fühlte mein Kinn, welches eindeutig als meines fühl- und erkennbar war und mir gleichzeitig fremd vorkam.
Es war der Zerfall der Vertrautheit. Ich erschien mir plötzlich unklar, wie in einem Nebel verschwindend. Mein Gesicht, eben noch konturiert, konkret in meinem Bewusstsein und fühlbar vertraut, verwandelte sich in etwas weniger Greifbares. Mein Gesicht wurde amorph. Ich ging trotzdem weiter, stolperte einmal über meine eigenen Füße, wäre beinahe hingefallen, blieb dann vor dem nächsten Schaufenster wieder stehen, blickte in die spiegelnde Scheibe, sah mein Spiegelbild, betrachtete mein Gesicht. Seltsam. Was noch? Weiß nicht. Ein Gefühl der Auflösung, der Fremdheit gegenüber dem eigenen Körper. Ich musste mich setzen, meinen schwindenden Bezug zu mir selbst überdenken, glitt an der Wand hinab und wäre beinahe in einer Urinlache, wahrscheinlich eines Hundes, gelandet. Sprang also wieder auf, lief weiter. Wie in einen Nebel. Ich wanderte im Dunst meiner nebulösen Gegenwart, starrte dabei auf meine Füße, um nicht erneut zu stolpern, und als ich schließlich den Blick wieder hob, stand ich vor dem Schuhladen und kam mir selbst zunehmend abhanden vor. Zu meinem eigenen Erstaunen machte es mir aber keine Angst.
Kapitel 11
Er besaß Beine aus Watte und Knie aus Gelee; seine Arme hingen am Rumpf und wedelten im Rhythmus seiner Schritte. Allerdings hatte er nicht das Empfinden, zu gehen, sondern in Gleitbewegungen einen Fuß vor den anderen zu setzen. Andere Menschen, die ihm entgegen kamen, wichen ihm aus, weil er sie in Gedanken dazu bewog, doch das Gefühl eines körperlichen Impulses fehlte. An Kreuzungen hielt er an und konnte sich gefühlte Ewigkeiten lang nicht überwinden, sie zu überqueren. Trotzdem gelang ihm immer wieder, was er beabsichtigte. Er wich aus, hielt an, ging weiter, bog um eine Ecke, fragte sich an der nächsten, wo er eigentlich war, ging im Kreis und über Kreuz, hatte sich verlaufen und wusste doch, wo er war: in einer fremden Stadt, in der er einen fremden Mann treffen wollte, der so unglaublich alt war, dass es ihn gar nicht geben konnte, was ihm, so gesehen, erst recht fremd, fremdartig und befremdlich erschien. Mit diesen Gedanken bewegte er sich im Kreis und auf eine zirkuläre Weise geradewegs voran, in eine Sackgasse nämlich voller negativer Erwartungen. Das alles war, als eine Art Gesamtkunstwerk gesehen, ganz interessant und auch amüsant, und er musste darüber lachen in genau diesem historisch absurden Moment …
Er befindet sich noch in der Calle Huelva, glaubt er wenigstens, zwischen einem Geschäft für Dekoration und der Los Palillos-Bar. Einige Leute treten aus dem Geschäft, sehen ihn am Bordstein sitzen und lachen. Eine Frau sagt etwas zu einem Mann, woraufhin der ebenfalls zu lachen beginnt und dann auch sie. Kurz darauf lachen auch andere in der Gruppe. Aus der Bar kommt ein weiß gekleideter Kellner, schaut mit einem angestrengten Blick auf die Straße, sieht die lachende Gruppe, dann ihn und stimmt in das Lachen mit ein. Ihrer aller Gelächter hallt in der Gasse zwischen den Häusern. Die unterschiedlichen Stimmlagen bilden akustische Texturen, die sich gegenseitig durchdringen, überlagern und wie in Klangspiralen auf dem Grundton seines plötzlich wieder aufgetauchten Ohrensausens tanzen.
»Biiiiieeeeeeep.« Er versucht, den Ton in seinem Kopf mitzusingen, trifft aber nicht mal die nächsttiefere Oktave.
Er hat das Empfinden, in Spiralen aus Klang einzutauchen, darin emporgehoben und getragen zu werden, als wäre er selbst ein Echo und würde, von seinem Körper gelöst, rein akustisch weiterbestehen und zwischen den Wänden der Häuser hin und her tanzen. Er besitzt ein waberndes Empfinden, während sich der Fluss seines Bewusstseins verlangsamt und er wie in Zeitlupe zwischen den Hauswänden tanzt.
Biiiiieeeeeeep.
Ein ganz herrliches, ja, irre gutes und auch wahnsinnig krankes Gefühl.
Er spürt eine Bewegung an seinem linken Arm. Ein älterer Mann, der einen Hut mit einer breiten Krempe trägt und ihm aus irgendeinem Grund bekannt vorkommt, hat sich direkt neben ihn gestellt, beugt sich mit bleichem, lediglich an den Wangen leicht gerötetem Gesicht herunter, versucht, ihn hochzuziehen.
»Kommmm…mennnnnn…Sieeeeee.« Die spanischen Worte kriechen wie Reptilien aus dem Mund des Alten. Das Gesicht zerknüllt sich mit den Lippenbewegungen wie ein Papiertaschentuch. Ah, »Kommen Sie.«
Wozu? Eigentlich will er nicht. Doch der Alte meint es gut mit ihm, das spürt er. Die Haut in seinem Gesicht und am Hals glänzt, und er denkt, dass es Liebe ist, die aus seinen Poren leuchtet. Er will ihm genau das sagen, sich bedanken, dem Mann zu verstehen geben, dass er erkenne, was für ein hilfsbereiter und herzlicher Mensch er sei, aber er kann nicht sprechen. Es kommt ihm vor, als habe er vergessen, wie das geht, wie man Laute so formt, dass sie Bedeutungen ergeben.
Er spürt einen Druck an seinem Arm, sieht den Mann nicken, weil er ihn zu verstehen scheint. Der Mann hält ihn untergehakt. Sie gleiten durch die Menge. Die Bewegung erinnert ihn ans Schlittschuhlaufen; sie geschieht lediglich durch Verlagerung des Gewichts. Passanten streifen an ihnen vorbei. Ihre flüchtigen Berührungen erzeugen ein Wohlgefühl in ihm.
Auf einer abgedunkelten Scheibe erblickt er im Vorbeigehen sein eigenes Spiegelbild. Er blickt in weit geöffnete Augen und ein sehr schmal wirkendes Gesicht. Der Zerfall hat sich nicht wie sonst ausgewirkt. Er möchte anhalten, sich eingehend betrachten, doch der ältere Herr zieht ihn sanft, aber entschieden voran. Sein eigenes Spiegelbild, das kann er flüchtig erkennen, ist nur ein Schatten seiner selbst.
Dann nimmt er wahr, wie ihn jemand am rechten Arm greift und unterhakt.
Hey! Bamma-bap-bap! Das Mädchen von gestern. Wie klein sie im Vergleich zu ihm ist! Ihr Kopf reicht gerade bis zu seinen Schultern. Sie hält und stützt ihn am Unterarm. Sie hat noch dieselben Sachen an. Ihre Haare sind so verfilzt, dass sie wie ein Gewächs auf ihrem Kopf sitzen. Sie trägt gelben Lippenstift, dazu goldenen Lidschatten und wirkt älter als gestern, wie siebzehn oder vielleicht schon achtzehn und ist auf eine wilde und ganz eigene Weise sehr schön.
Wie schön sie ist! Hu, hu, denkt er und fragt sich gleichzeitig, warum. Warum denkt er die Sachen, die er denkt, aber gar nicht denken will? Es denkt in ihm. Wozu denkt es in ihm, wenn er das eigene Denken gar nicht versteht? Gedanken sind in seinem Gehirn gefangen und versuchen sich nun zu befreien. Sein Kopf fühlt sich an, als müsste er platzen. Er hat so unglaublich viele Fragen, dass ihm der Schädel brummt, kriegt aber den Mund nicht auf.
Der Mann sagt etwas zu dem Mädchen. Sie antwortet mit hellen, kehligen Lauten in einer unbekannten Sprache, die wie eine Mischung aus Französisch und Russisch klingt und einen lückenlosen Fluss zu bilden scheint, denn nur hin und wieder bemerkt er Pausen, die auf Wortzwischenräume oder das Ende eines Satzes hindeuten.
Wie schön sie ist! Würde er ihr gern sagen. Doch seine Versuche, etwas zu sagen, eine Frage zu stellen? Ohne Erfolg. Jammerschade! Wer sind die beiden an seiner Seite? Warum kriegt er den Mund noch immer nicht auf? Wie zugeschnürt. Verflixt und zugenäht. Die Flüche hallen in seinem Kopf.
Doch plötzlich stört ihn seine Sprachlosigkeit nicht mehr. Von seinen beiden Begleitern flankiert, fühlt er sich nun geschützt und geleitet. Andere Passanten grüßen den Alten und das Mädchen. Sie antworten auf Spanisch, reden miteinander aber weiter in der fremden Sprache wie zuvor. Zunehmend spürt er seine Schritte, seine Gedanken scheinen sich in einem ruhigen Rhythmus dazu zu synchronisieren. Sie bewegen sich durch die schattigen Gassen im Herzen der Altstadt, erreichen dann einen quadratischen Platz, treten ins Sonnenlicht. Der helle Sandstein reflektiert das Licht. Er blinzelt mit den Lidern in die Helligkeit hinein, spürt Wärme sich in seinem Gesicht ausbreiten und möchte anhalten, um das Gefühl zu genießen, doch wieder zieht ihn der Mann auf eine sanfte Weise weiter.
»Kommen Sie«, sagt er nun auf Deutsch. »Wir bringen Sie in die Kathedrale. Sie müssen gereinigt werden. Sie haben einen Schatten.« Der Mann spricht mit einem sehr musikalischen Akzent. Die deutschen Worte kugeln nun eher aus seinem Mund, als dass sie kriechen. Oder fließen.
Er versucht zu sprechen, möchte so gern antworten, kriegt aber nur ein Stöhnen heraus.
»Schweigen Sie«, weist ihn der alte Herr mit leiser, sanfter Stimme an. »Der Schatten zehrt. Sie verlieren Kraft, wenn Sie versuchen zu sprechen.«
»Bibaxtalo«, hört er das Mädchen an seiner Seite sagen.
Das Wort hallt in seinem Gehirn.
»Kommen Sie«, wiederholt der Mann. »Wir müssen den Schatten vertreiben.«
Vor dem Haupteingang wartet eine lange Schlange von Touristen. Der Alte und das Mädchen führen ihn zu einem Seiteneingang. Der Wächter an der Tür lässt sie mit einem Lächeln hinein. Sie treten in einen langen Gang mit runder Decke. Die Wände strahlen Kühle ab und sind an einigen Stellen feucht. Das Mädchen geht voran, während der Alte ihn weiterhin am Arm hält. Der Gang mündet in eine Seitenkapelle. Vor dem Bild einer dunkelhäutigen Madonna bleibt das Mädchen stehen, dreht sich mit seltsam leuchtenden Augen zu ihnen um und bedeutet ihm mit einer Handbewegung, sich mit dem Rücken auf den Boden zu legen. Der Alte lässt seine Hand los und setzt sich wortlos an seine linke Seite, während er gleichzeitig spürt, wie Kälte aus dem Boden in seinen Körper kriecht. Das Mädchen setzt sich an seine rechte Seite und streicht mit einer langsamen Bewegung über die Augen und …
Ich … ich spüre das Mädchen an meiner rechten Seite. Sie streicht mit einer langsamen Bewegung über meine Augen, berührt mich dabei aber nicht, und ich nehme wahr, wie mir die Lider zufallen und ich trotz der Kälte müde werde.
Ihre Hände, so meine ich jedenfalls, halten mich nun an den Schläfen, während der Alte mir eine Hand auf die Stirn und eine auf mein Herz zu legen scheint, denn so fühlt es sich jedenfalls an. Ich spüre Wärme, die von den Händen ausgeht und sich in meinem Körper ausbreitet. Und ich habe das Empfinden, an den Händen hochgezogen zu werden und über dem Boden zu schweben. Mit diesem Gefühl schlafe ich ein.
Als ich wieder aufwachte, waren der alte Mann und das Mädchen verschwunden. Ich lag mit dem Bauch auf dem Boden. Der Wächter hockte neben mir und stieß mit einem Finger gegen meine Schulter.
»Atencíon«, sagte er, »bitte stehen Sie auf. Sie dürfen hier nicht liegen bleiben.«
Ich hob den Kopf vom Boden, sah ihn dankbar an, stemmte mich hoch und rappelte mich langsam auf. »Wie lange habe ich hier gelegen?«
»Bibaxtalo«, sagte der Wächter nur und schüttelte den Kopf.
Ich spürte, dass ich wieder gänzlich klar und bei mir war. Der bereits begonnene Zerfall meines Gesichtes musste durch die Anstrengungen des Alten und des Mädchens aufgehalten worden sein. Auch das Ohrengeräusch war verschwunden. Ich fühlte mich leicht und bewegte mich mit neuer Sicherheit durch die Touristenströme im Inneren der Kathedrale, um den Ausgang zu suchen.
Auf dem Vorplatz zog ich den Zettel, den mir die Concierge gegeben hatte, aus der Tasche. Die Kutscherpferde schnaubten hinter meinem Rücken, während ich den zerknitterten Zettel glatt strich und die Nummer las, die darauf geschrieben war. Sie begann mit +3495, der Vorwahl für Spanien und Sevilla. Ich fischte mein Handy aus der Hosentasche, wählte die Nummer, aber niemand nahm ab. Nach einigen Minuten versuchte ich es ein weiteres Mal, wiederum vergeblich. Ich wanderte durch Gassen zurück in Richtung Alfalfa, bog aber kurz vorher zur Plaza del Salvador ab. Sämtliche Tische vor den Bars waren schon besetzt. Ich wartete einen Moment, drückte nochmals auf Wiederwahl, hatte aber erneut kein Glück und stellte mich dann an einen frei gewordenen Tisch. Als der Kellner kam, bestellte ich ein Bier, Gambas und Bacalao. Ich trank und aß, ohne mit irgendwem außer dem Kellner zu kommunizieren, wählte ein weiteres Mal die Nummer, ließ es zehn Mal klingeln, doch wieder hob niemand ab. Ich trank ein weiteres Bier, bestellte Pinchos dazu und drückte einem Flamenco-Gitarristen einen Euro in die Hand, damit er nicht an meinem Tisch stehen blieb, sondern die Nachbarn beschallte, doch der Gitarrist verstand mich falsch und blieb extra stehen. Tatsächlich genoss ich seine Darbietung sogar und gab ihm einen weiteren Euro, damit er noch ein Lied für mich spielte. Als der Gitarrist fertig und weitergegangen war, drückte ich nochmals auf Wiederwahl. Diesmal war die Nummer besetzt. Als sie Minuten später erneut frei wurde, nahm jedoch wiederum niemand ab.
Doch ich wusste: Etwas war passiert. Die Schicksalslinien hatten sich verschoben, das war deutlich fühlbar. Ich glaubte, sogar die Menschen auf dem Platz spürten, dass etwas in ihrer unmittelbaren Umgebung in Bewegung geraten war und eine Konsequenz auch für sie haben würde, selbst wenn sie noch nicht die geringste Ahnung hatten, welche das sein könnte. Die Koordinaten waren an eine neue Stelle gerückt. Der Wind musste sich plötzlich gedreht haben, das Wetter umgeschlagen sein, obwohl die Sonne warm und hell schien wie zuvor, kein Wölkchen am Himmel stand und auch nicht der geringste Hauch zu spüren war. Jetzt hieß es abwarten, bis das Zeichen für den nächsten Schritt kam. Ich ging auf dem schnellsten Weg in mein Zimmer, tauchte in meine sorgfältig drapierte Unordnung ein, die durch ein Please-do-not-disturb-Schild an der Tür verteidigt wurde, schnappte den Veroux von einem Unterhosen-mit-Socken-Haufen und begann mit finsterer Entschlossenheit, darin zu lesen, vorangetrieben von der Hoffnung, durch die Lektüre noch weiter zu Verstand zu kommen.
Auszug aus Kapitel 12
(…) Ins Zentrum dieses Hochgefühls hinein hörte er das Klingeln eines Telefons. Seines Telefons.
Meines Telefons.
Ich starrte auf das Display. Die Nummer wurde nicht angezeigt. Plötzlich hatte ich Angst ranzugehen. Das würde Konsequenzen haben. Die Schicksalslinien hatten sich verschoben. Bibaxtalo. Die Koordinaten waren nicht mehr an der gleichen Stelle wie zuvor.
»¡Hola«, sagte ich.
»¡Hola«, höre ich eine männliche, sanft klingende Stimme am anderen Ende der Leitung sagen. Sie klingt verrauscht, als wäre der Anrufer sehr weit entfernt. »Wie geht es Ihnen?«
»Sehr gut«, antworte ich.
»Wir können uns treffen. Jetzt, da der Schatten weg ist.« Der Anrufer scheint zu zögern, jedenfalls macht er eine Pause. »Nun, da der Schatten weg ist, können wir reden.«
»Wer sind Sie?«
»Das wissen Sie«, entgegnet die Stimme.
»Álvarez de Cádiz«, sage ich.
»Seien Sie in einer Stunde im La Bodega«, sagt er und legt auf.
Wenn die Linien sich verschieben, darf man nicht zögern, man muss schnell sein, schnell und auf der Hut. Ich spüre, wie Wachsamkeit und Klarheit in Wellen aus meinem Gehirn in meinen Körper strömen. Ich spüre, wie der Alkohol in meinem Blut mit erhöhter Geschwindigkeit abgebaut wird, meine Muskulatur geschmeidig wird und mich in einen Zustand wachsender Achtsamkeit versetzt. Ich winke den Kellner herbei, bezahle, nehme einen Umweg über das Hotel, um mich schnell umzuziehen und zehn Minuten vor der Zeit im La Bodega einzutreffen.
Der ältere Herr wartet schon am Tisch beim Fenster. Den Hut hat er auf die Fensterbank gelegt. »Was möchten Sie trinken?«, fragt er und reicht mir die Karte. Und obwohl er jünger als erwartet aussieht, erkenne ich die Ähnlichkeit zu dem Menschen auf dem Foto und wundere mich, dass sie mir nicht sofort bei der ersten Begegnung ins Auge gesprungen ist. Seine hellgrauen, fast weißen Haare trägt er aus der Stirn gekämmt bis in den Nacken, ohne den geringsten Ansatz einer Glatze. Seine graublauen Augen sind von einem markanten schwarzbraunen Rand umgeben und wirken jetzt heller. Er hat das rundlich ovale Gesicht vieler Südländer und gleichzeitig scharfkantige Züge, weil sich seine Haut durchscheinend dünn über Stirn, Wangenknochen und Kinn spannt. Unter den Augen schimmern zu blauen Deltas verzweigte Äderchen, und an beiden Schläfen zeichnen sich blasse Altersflecken wie zu groß geratene Sommersprossen ab. Seiner gesamten Erscheinung nach würde ich ihn zwischen siebzig und achtzig schätzen, sehr gesunde siebzig oder achtzig, wenn man die Flecken nicht als Vorstufen von Hautkrebs sieht. Auch die ungewöhnlich kleinen Ohren wie auch seine kleine Nase lassen ihn jünger wirken. Bei Normalsterblichen wie mir wachsen Ohren und Nase im Alter weiter, wodurch sich seltsame und für den jeweiligen Besitzer damit leidvolle Unverhältnismäßigkeiten in der Gesichtssymmetrie ergeben können. Davon war ich bisher immerhin einigermaßen verschont geblieben. Der Älteste, wenn er es denn ist, sieht nicht alt aus, was auch an seinen blendend weißen Zähnen liegt, die er gerade mit einem Lächeln zeigt.
»Angelo Francisco Álvarez de Cádiz, angeblich geboren ebenda am 4. März 1517«, sage ich, »das wirft Fragen auf.« (…)
Auszug aus Kapitel 14
(…) Die Dinge hatten auf eine eigenartige Weise Fahrt aufgenommen. Womit hatte es begonnen? Mit dem Zeitungsausschnitt? Als er in Sevilla gelandet war und die Suche aufgenommen hatte? Mit der ersten Begegnung mit dem Mädchen? An dem mental derangierten Morgen und dem darauf folgenden Zerfall seines Gesichtes? Als Álvarez ihm aufgeholfen hatte? Auf dem Boden in der Kathedrale? Es gab so vieles, was nicht zusammenzupassen schien, aber bei genauerer Betrachtung einen Sinn ergeben musste. Er war nur noch nicht darauf gekommen, welchen.
Eine Gruppe Kinder kam ihm entgegen, singend, froh, sechste oder siebte Klasse, schätzte er. Der Nachmittagsunterricht musste gerade vorbei sein. Freude zu haben lernten sie offenbar auch hier in Sevilla. Ein Mann mit einem breitkrempigen Hut nickte ihm im Vorbeigehen zu, obwohl er ihn nicht kannte. An der Calle Argentina hatte ein Auto beim Einparken ein zweites seitlich gestreift, einer der Fahrer redete auf den gerade eingetroffenen Polizisten ein, während der andere sich Notizen machte. Ihm war plötzlich kalt, er knöpfte seine Jacke zu, schlug den Kragen hoch, die Revers übereinander, und beschleunigte seine Schritte.
Weil er plötzlich Vogelgezwitscher hörte, begann er langsamer zu gehen und nach Vögeln Ausschau zu halten, obwohl er eigentlich keinerlei ornithologische Interessen verfolgte. Er hörte sie, das wurde ihm jetzt bewusst, als würde er sich inmitten eines Schwarmes bewegen, entdeckte aber nicht einen von ihnen. Seltsam. Er hielt an, studierte Fenstersimse, Dachrinnen und Laternenmasten. Nichts. Einige Passanten blieben ebenfalls stehen, folgten seinen Blicken, einer fing an, sich lustig zu machen. Daraufhin ging er schnell weiter, begleitet von Pieptönen wechselnder Höhe, aber gleichbleibender Lautstärke. Da dämmerte ihm, dass das Gezwitscher in seinem Kopf stattfand. Der sehr hohe Pfeifton, bisher in einer konstanten Höhe, hatte sich in etwas anderes verwandelt, in eine ziemlich irre Sache, geeignet, ihn in den Wahnsinn zu treiben. Er neigte den Kopf nach links, nach rechts, nach vorn und nach hinten, konnte aber, anders als zuvor, keinerlei Veränderung in Folge feststellen.
Nun beeilte er sich, lief in Richtung der Bodega, verlief sich ein weiteres Mal in den bogenförmigen Gassen der Altstadt und rannte schließlich sogar, als er die Orientierung wiedergefunden hatte, überholte dabei eine vor ihm laufende, wahrscheinlich joggende Frau, stellte im Vorbeigehen fest, dass sie dem Mädchen ähnlich sah. Überrascht blieb er wie angewurzelt stehen und schaute sie direkt an.
»Was starren Sie mich so an?«, fragte die Frau und blieb auch stehen. Sie hatte das gleiche ovale Gesicht, ungewöhnlich symmetrisch, weit auseinander stehende Augen, dunkel wie ihre Haare, knapp schulterlang, war aber weniger auffällig geschminkt, dabei deutlich älter, wahrscheinlich um die vierzig und sehr schön, auch sie eine Gitana. Er hatte im Zuge eines Auftrags für eine Fotoreportage zu viel Zeit mit rumänischen Roma verbracht, um diese ethnische Herkunft zu übersehen. Ihre bloße Erscheinung ist wie ein Weckruf. Und so fühlte er sich auch jetzt: hellwach und gleichzeitig wie gelähmt. Die wilde, entschlossene Schönheit der Frau irritierte ihn.
»Verzeihen Sie«, nuschelte er, »hab Sie mit jemandem verwechselt.«
»Ah«, sagte sie und machte ein schnalzendes Geräusch mit der Zunge, was auf eine sehr merkwürdige Weise mit dem Gezwitscher in seinem Kopf harmonierte. »Und ich habe mir immer eingebildet, ich sei unverwechselbar.« Drehte sich um und verschwand mit einem rauen Lachen in einem Geschäft. Er beschleunigte seine Schritte, lief schließlich sogar und erreichte die Bodega gerade noch pünktlich.
Wie zuvor ist Álvarez schon da, erwartet mich als einziger Gast und wieder am gleichen Tisch und mit einer Karaffe Wasser und einer Flasche Tinto. Man könnte fast denken, der Wirt habe nur für ihn geöffnet.
»¡Hola«, sagt er und reicht mir zur Begrüßung die Hand. Ich erwidere seine Begrüßung, so höflich wie möglich, und setzte mich ihm gegenüber, so ruhig wie möglich, trotz der Vögel in meinem Kopf.
»Sie sehen … grau aus«, bemerkt er nach eingehender Betrachtung.
Seine weißgrauen Haare hängen ihm über die Schläfen in die Stirn. Zum ersten Mal sehe ich, dass er einen Mittelscheitel hat, eine fast jugendliche Frisur, bisher verborgen durch strenges Zurückkämmen. Er trägt ein dunkelblaues Sakko mit einem silberfarbenen Einstecktuch und eine hellblaue Fliege mit silbernen und roten Streifen zum weißen Hemd. Seine Kleidung sieht getragen aus, aber nicht abgetragen. Wie bei der Begegnung zuvor versuche ich, Anzeichen für sein hohes Alter zu finden, doch abgesehen von den dunklen Flecken an den Schläfen und kleineren, Sommersprossen ähnlichen Verfärbungen, die sich über Wangen, Stirn und Nase wie lockere Inselgruppen ziehen, wirkt seine Haut nicht alt und zeigt sich bei eingehender Betrachtung sogar ziemlich faltenlos. Zum ersten Mal bemerke ich einen kleinen weißen Strich unter seinem linken Auge, wohl eine Narbe. Seine sehr weißen Zähne waren mir bereits bei unserem letzten Treffen aufgefallen. Und wenn ich an die allererste Begegnung denke, erinnere ich mich an einen elegant wirkenden Herrn, der sich auch genau so bewegt – elegant, fast jugendlich dabei und umso mehr alterslos. All das registriere ich mit fast superrealistischer Klarheit, trotz des Lärms in meinem Gehirn.
»Was ist passiert, mein lieber Freund?«, fragt er weiter und klopft mit der Außenseite des rechten Daumens in die Innenfläche seiner linken Hand. »Sie sehen wirklich schrecklich aus.«
Ich berichte von dem Mann, der mich in der Calle Álvarez angerempelt hat, beschreibe das Haus, aus dem er gekommen ist, meinen Fund im ersten Stock und erwähne schließlich auch den Pfeifton in meinem Kopf, der sich mittlerweile in Vogelgezwitscher verwandelt hat.
Er hört mir mit hochgezogenen Augenbrauen zu, nimmt aufmerksam jedes Wort in sich auf. »Es ist wohl noch bedrohlicher, als ich ohnehin schon dachte«, sagt er nach einer Weile. »Eigentlich kein Wunder. Sie haben, wenn ich das bemerken darf, viel Lärm gemacht, um mich zu finden. Dadurch sind gewisse Kräfte auf Sie aufmerksam geworden und versuchen nun, Sie in ihre Angelegenheiten hineinzuziehen. Sie verfügen über Methoden der Manipulation, doch wir werden verhindern, dass sie weiteren Einfluss gewinnen.«
Ich will fragen, was für Kräfte und wie verhindern?, kann meine Zunge aber noch bremsen, weil mir meine Vereinbarung mit Álvarez gerade rechtzeitig wieder eingefallen ist. Er stellt die Fragen, ich gebe Antworten. Auf diese etwas einseitige Angelegenheit habe ich mich nun mal eingelassen.
Ohne eine weitere Erklärung streckt er den rechten Arm über den Tisch und platziert seine Hand mit der offenen Handfläche auf meiner Stirn. Ich spüre einströmende Wärme, dann Kälte – und dann verebbt das Zwitschern in meinem Kopf.
Wie haben Sie das gemacht?, will ich fragen, als er seine Hand schließlich von meiner Stirn löst, tue es aber wieder nicht.
»Gut«, sagt er, »sehr gut, mein lieber Besucher, Sie lernen schnell.« Dann schiebt er die Hände auf dem Tisch untereinander und lehnt sich zurück, während ein Kellner mir Wasser und Wein einschenkt. Als wir wieder allein sind, beugt er sich vor, betrachtet seine Hände und dann mein Gesicht: »Hier meine nächste Frage an Sie: Was hat Sie in Ihrem gesamten bisherigen Leben am meisten verletzt?«
Ich spüre, wie mir Tränen in die Augen treten, obwohl ich noch gar nicht weiß, was ich antworten werde. Die Vorahnung einer Antwort produziert bereits die Empfindung von Trauer. Dann fällt mir ein, dass mich meine Mutter einmal beim Einkaufen auf der Straße vor unserem Haus vergessen hat. Das erste Mal, dass ich mir wirklich verloren vorgekommen war. Ich hatte sehr geweint, war stundenlang nicht zu beruhigen gewesen. Es war schlimm gewesen, und ich kann mich heute noch sehr genau daran erinnern, doch … Als Jugendlicher hatte ich einen etwas älteren Widersacher, der mir auflauerte und mich mittels seiner körperlichen Überlegenheit quälte. Meine Eltern und mein älterer Bruder wussten davon, taten aber nichts, um mich dauerhaft vor dem Widersacher zu schützen. Ich erinnere heute noch seinen Namen, aber …
»Die Ignoranz meines Vaters«, antworte ich. »Wir mussten im Haus still sein. Ich durfte keine Geburtstage feiern, keine Freunde einladen, nicht laut sein, weil mein Vater Ruhe brauchte.« Ich mache eine kleine Pause, um meine Worte genau zu wählen. »Dass er meine Freude nicht sehen wollte, mein Lachen nicht hören wollte, das hat mich am meisten verletzt.«
Sollen sich gehackt legen. Der Gedanke an die Eltern weckt seine Wut. Ständig still sein. Was für ein Terror für einen Jungen. Und er hat ihn erlebt. Der Alte ihm gegenüber nickt. Warum nickt er? was weiß er davon? Der Besucher spürt die aufsteigende Trauer, den Innendruck von Tränen, die nach außen drängen. Nein, keine weiteren Gefühlsbekundungen. Keine emotionale Instabilität. Er unterdrückt die Tränen und ringt um seine Fassung.
Álvarez nickt. »Ich höre Ihre ehrliche Antwort und sehe Ihr Bemühen um Wahrhaftigkeit. Daher meine nächste Frage: Wen haben Sie am tiefsten verletzt?«
Ach, muss das sein? Dem Besucher fällt sofort ein Junge ein, dessen Namen er aber vergessen hat. Sie waren acht oder neun Jahre alt und auf der Terrasse des Elternhauses von dem betreffenden Jungen. Dieser hatte ihn irgendwie gereizt, woraufhin er ihn schlug, schließlich in den Schwitzkasten nahm und ihn würgte. Bis dessen Mutter aus dem Haus kam und die Kämpfer trennte. Er musste ihn fast erwürgt haben, denn der Junge war schon blau im Gesicht. Noch heute erinnert er sich an diesen Anblick und das Gefühl, sich über sich selbst zu erschrecken, doch weiß er aus irgendeinem Grund, dass der Schrecken für den Jungen vorübergehend war und er sich heute wahrscheinlich nicht mehr daran erinnerte.
»Meine erste Freundin, Rachel«, antwortet er daher und schaut zu Álvarez hinüber, abwartend, ob er weitersprechen soll.
»Erzählen Sie von ihr.«
»Ein schönes Mädchen, rote Haare, grüne Augen, selbst in großen Menschenmengen nicht zu übersehen. Jeder drehte sich nach ihr um. Auch unübersehbar intelligent, besonders, was die Lösung mathematischer Aufgaben anging. Über einen gemeinsamen Freund lernten wir uns kennen. Ich stand kurz vorm Schulabschluss. Mit ihrer Hilfe bekam ich bessere Noten. Sie hat mich sehr gemocht, doch ich misstraute ihr.«
»Misstrauen Sie Schönheit?«
»Wahrscheinlich«, erwidert er nach einigem Nachdenken.
»Was löst weibliche Schönheit bei Ihnen aus?«
»Sie reizt mich. Und macht mir gleichzeitig auch Angst.«
»Erzählen Sie weiter von Rachel. Womit haben Sie Ihre Freundin am meisten verletzt?«
»Damit, dass ich sie hingehalten habe«, antwortet er. »Ich habe mit ihrer Liebe gespielt, sie zeitweise angenommen und zeitweise abgelehnt. Das ging mit Unterbrechungen über Jahre. Sie konnte sich nicht von mir lösen. So habe ich über ihre Schönheit gesiegt.«
»Wie fühlen Sie sich damit?«
»Beschämt. Ich schäme mich für mein Verhalten. Ich glaube, ich habe etwas in ihr zerstört. Noch heute tut es mir leid. Und ich empfinde die Erinnerung an sie als Last.«
Álvarez nickt. »Eine Frage noch für heute: Haben Sie jemals versucht, Ihren Vater zu schlagen?«
»Nein.«
»Haben Sie mit dem Gedanken gespielt?« Kurzes Trommeln linker Hand: Ringfinger, Daumen, Ringfinger.
»Ja.«
Ja! Ja? Ich bin etwas verwirrt. Was wird das hier? Psychotherapie? Brauche ich eine Therapie?
»Wann war das?« Der alte Herr lehnt sich zurück, lässt seine Augen suchend an mir vorbei durch den Gastraum wandern.
Langweilt er sich mit mir? »Ich war dreizehn Jahre alt, meine Mutter lag mit einer Bauchfellentzündung wochenlang im Krankenhaus. Mein Vater brachte mich bei einer befreundeten Familie unter und blieb mit der Haushaltshilfe allein im Haus zurück. Die Familie war nett, aber ich wollte dort nicht sein. Bei meiner Rückkehr habe ich verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, ihm Gewalt anzutun. Ich dachte damals, ich bin stärker als er.«
»Warum haben Sie es unterlassen?«
»Weil er mich im Moment größter Wut zum Lachen brachte.«
Álvarez lächelt. »Sie können morgen wiederkommen, gleiche Zeit.«
Auf dem Weg zurück zum Hotel bemerkte er zwei Männer in Sichtweite hinter sich. Als er seine Schritte beschleunigte, folgten sie ihm in gleichbleibendem Abstand. Weil die Straße in engen Windungen zwischen den Häusern verlief, mussten sie ihn aber immer wieder aus den Augen verlieren. Von einem derartigen toten Winkel geschützt, bog er nach links ab, dann gleich wieder nach rechts und nahm die Parallelstraße in Richtung Hotel. Kurz bevor er es erreichte, sah er, dass sie ihm immer noch auf den Fersen waren. Er kümmerte sich aber nicht weiter um sie, sondern betrat das Hotel und schloss sich im Zimmer ein. Vom Balkon aus sah er die beiden noch einige Minuten allein auf dem Platz vor der Kathedrale stehen.
Auszug aus Kapitel 19
»Hey«, sagt eine Mädchenstimme, die mir bekannt vorkommt, während ich an einer Schulter wachgerüttelt werde.
»Selber hey«, sage ich und drücke mir mit der Hand das Kissen auf den Kopf, weil ich nicht wach werden will.