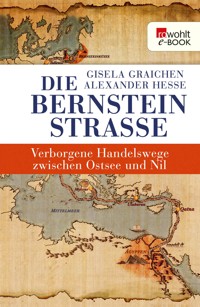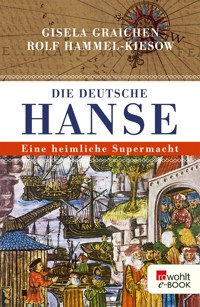
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die spannende, zweiteilige Terra-X-Dokumentation über die Deutsche Hanse ist jetzt auch auf DVD erhältlich. Laufzeit: ca. 90 Min. Januar 1358: Ein genialer Propaganda-Coup gelingt. Ein loser Handelsverbund von Fernkaufleuten und Städten gibt sich einen Namen: die DUDESCHE HENSE, als Eigenbezeichnung für eine nordeuropäische Supermacht des Geldes. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht gehören ihr bis zu 200 europäische Städte an. Wieso wurde die Hanse so stark, dass sie über fast ein halbes Jahrtausend die Welthandelsmärkte des Mittelalters von Russland bis Flandern prägte, von Island bis Venedig ein lukratives Handelsnetz aufbauen konnte und sogar Kriege gegen Könige führte? Was war das Geheimnis ihres Erfolges? Die Deutsche Hanse, das Imperium der Kaufleute, ist weit mehr als eine Geschichte von Pfeffersäcken und Piraten, Koggen und Karawanen, Raubrittern und Kaperfahrern. Dieses Buch erzählt von Wagemut und Betrug, von Spekulantentum und Finanzkrisen, von Abenteurern und Glücksrittern. Und es geht zugleich der Frage nach, wie modern die Hanse eigentlich war. Ein neues Standardwerk über die Geschichte der Hanse – anschaulich und spannend erzählt, durchgehend vierfarbig illustriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Gisela Graichen ∙ Rolf Hammel-Kiesow
Die Deutsche Hanse
Eine heimliche Supermacht
Unter Mitarbeit von Alexander Hesse
Informationen zum Buch
Januar 1358: Ein genialer Propaganda-Coup gelingt. Ein loser Handelsverbund von Fernkaufleuten und Städten gibt sich einen Namen: die DUDESCHE HENSE, als Eigenbezeichnung für eine nordeuropäische Supermacht des Geldes. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht gehören ihr bis zu 200 europäische Städte an. Wieso wurde die Hanse so stark, dass sie über fast ein halbes Jahrtausend die Welthandelsmärkte des Mittelalters von Russland bis Flandern prägte, von Island bis Venedig ein lukratives Handelsnetz aufbauen konnte und sogar Kriege gegen Könige führte? Was war das Geheimnis ihres Erfolges?
Die Deutsche Hanse, das Imperium der Kaufleute, ist weit mehr als eine Geschichte von Pfeffersäcken und Piraten, Koggen und Karawanen, Raubrittern und Kaperfahrern. Dieses Buch erzählt von Wagemut und Betrug, von Spekulantentum und Finanzkrisen, von Abenteurern und Glücksrittern. Und es geht zugleich der Frage nach, wie modern die Hanse eigentlich war.
Ein neues Standardwerk über die Geschichte der Hanse – anschaulich und spannend erzählt, durchgehend vierfarbig illustriert.
Informationen zu den Autoren
Gisela Graichen studierte Publizistik, Rechts- und Staatswissenschaften und ist Diplom-Volkswirtin. Für das ZDF hat die Buch- und Filmautorin unter anderem die erfolgreiche Archäologiereihe «Schliemanns Erben» und die Wissenschaftsserie «Humboldts Erben» entwickelt. Sie lebt in Hamburg. – Für das vorliegende Buch schrieb sie das Kapitel «Die Schicksalsmacht der Hanse».
Prof.Dr.Rolf Hammel-Kiesow ist stellvertretender Leiter des Archivs der Hansestadt Lübeck und Honorarprofessor an der Universität Kiel. Seit 1994 gehört er zum Vorstand des Hansischen Geschichtsvereins. Zahlreiche Publikationen, vor allem zur Geschichte der Hanse. Er lebt in Lübeck. – Für das vorliegende Buch schrieb er die Kapitel 1 bis 5, 9 bis 12, 14 und 15.
Alexander Hesse studierte Publizistik, Politikwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt und Mainz. Er ist verantwortlicher Redaktionsleiter für Geschichte und Gesellschaft beim Zweiten Deutschen Fernsehen und lebt in Wiesbaden. – Für das vorliegende Buch schrieb er das Kapitel «Bürger gegen Räte».
Dr.Natascha Mehler studierte Mittelalter- und Neuzeitarchäologie in Wien, Bergen und Bamberg. Seit 2008 lehrt sie Historische Archäologie am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien. Mitarbeit an zahlreichen Forschungsprojekten. Sie lebt in Wien. – Für das vorliegende Buch schrieb sie das Kapitel «Schiffe, Steine, Schlamm und Scherben».
Prof.Dr.Jürgen Sarnowsky lehrt Mittelalterliche Geschichte am Historischen Seminar der Universität Hamburg und ist Vorstandsmitglied des Hansischen Geschichtsvereins. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, vor allem zur Geschichte der geistlichen Ritterorden. – Für das vorliegende Buch schrieb er das Kapitel «Die Hanse und der Deutsche Orden».
Inhaltsverzeichnis
Die Hanse – Wegbereiter Europas?
1 Die Anfänge: Gotländer an der Elbe – Kölner in London
2 Gotland, Nowgorod und Riga – die frühe Hanse entsteht
3 Zwischen Konkurrenz und Bündnis: die Formierung des wendischen Städtebunds
4 Homines duri – harte Männer: die niederdeutschen Fernkaufleute
5 1358: die Ausrufung der hense van den dudeschen steden
6 Die Schicksalsmacht der Hanse oder: Der Bürgermeister auf dem Schafott. Johan Wittenborg gegen König Waldemar IV.
7 Die Hanse und der Deutsche Orden – eine ertragreiche Beziehung
8 Bürger gegen Räte – Kaufleute und Handwerker proben den Aufstand
9 Hildebrand Veckinchusen – ein Kaufmann an der Zeitenwende
10 Netzwerke – Städte – Kontore: die drei Fundamente der Hanse
11 Der Kopf des Ganzen: der Hansetag – die «Herren der Hanse» versammeln sich
12 Das System Hanse – Globalisierung im Mittelalter
13 Schiffe, Steine, Schlamm und Scherben – die Archäologie der Hanse
14 Konkurrenten, Territorialmächte und die stille Auflösung der Hanse
15 Das Nachleben der Hanse. Die Hanse in heutiger Sicht
Anhang
Literatur
Personenregister
Ortsregister
Bildnachweis
Ein hansischer Kaufmann des frühen 16.Jahrhunderts: der Lübecker Bergenfahrer Hans Sonnenschein; Gemälde von Hans Kemmer, 1534
Die Hanse– Wegbereiter Europas?
Das auf der Autobahn beliebte Spiel «Kennzeichenraten» gerät regelmäßig ins Stocken, wenn ein Wagen mit den Nummernschildern HRO oder HST auftaucht. Dass Rostock und Stralsund alte Hansestädte sind und stolz wie Bremen, Hamburg oder Lübeck das H für Hanse im Nummernschild tragen, mag immerhin noch bekannt sein. Aber es waren zeitweise über 200Städte, die im Zenit ihrer Macht zur Hanse gehörten. Deren Kaufleute so reich waren, dass Könige sich bei ihnen Geld borgten. Wie der Dortmunder Hansekaufmann Tidemann Lemberg, einer der Finanziers des englischen Königs. EdwardIII. – der mit dem Hosenbandorden – war aufgrund des Hundertjährigen Krieges mit Frankreich in ständiger Geldnot. Als Pfand gab er zwei Kronen und die englischen Kronjuwelen heraus. Die Juwelen verwahrte man in Köln, wo Lemberg das Bürgerrecht erworben hatte. Auch der König und spätere deutsche Kaiser Sigismund nutzte die Finanzkraft der hansischen Kaufleute. Seinem Darlehenswunsch konnten sie sich 1417 nicht entziehen, auch wenn er die Anleihen eher selten zurückzahlte. Was einen der Kaufleute in den Schuldturm brachte, nämlich Hildebrand Veckinchusen (Kapitel 9). Für den Dortmunder Lemberg ging es gut aus: Er konnte sich aus seinen Kreditgeschäften gleich acht Schlösser in England kaufen.
Die dudesche hense war eine Supermacht des Geldes. Der erste nordeuropäische Handelsverbund prägte fast ein halbes Jahrtausend die Welthandelsmärkte des Mittelalters von Russland bis Flandern, baute ein lukratives Handelsnetz auf von Island bis Venedig und schuf ein visionäres Imperium von Kaufleuten und Städten über politische Grenzen hinweg.
Doch die Hanse ist mehr als eine Geschichte von Geld, Gier und Pfeffersäcken, von Piraten, Koggen und Handelskarawanen, ist mehr als eine längst vergangene historische Periode für Archäologen, Geschichts-, Kultur-, Schifffahrts- und Bauwissenschaftler. Die Hanse geht uns heute an, meint Andrus Ansip, der Ministerpräsident von Estland, dem wirtschaftlichen Musterland aus dem hohen Norden. Als 17.Land der Euro-Zone hat Estland am 1.Januar 2011 als erste ehemalige Republik der untergegangenen Sowjetunion den Euro eingeführt. Als einziges von neun europäischen Ländern, die sich um den Euro beworben haben. Ansip führt den herausragenden Erfolg seines Landes auf das Vorbild der Hanse zurück. «Die EU ist eine neue Hanse», sagt er.
Wie modern ist die Idee der dudeschen hense? Auch Henning Voscherau, Altbürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, meint: «Die Hanse – die große Kaufmannshanse des Mittelalters und die politische Städtehanse – ist ein Vorbild für uns heute. Sie war so stark, weil sie ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus war in ihrer Idee der Freiheit des Handels und Wandels, also des Verkehrs, der Logistik. Die Vorteile der Grenzen überschreitenden Zusammenarbeit zum wechselseitigen Nutzen, heute nennt man das eine Win-win-Situation, die erkannten die Alten damals schon.»
Durch die Öffnung des Eisernen Vorhangs gab es eine stärkere Rückbesinnung auf die Idee der Hanse als Ausdruck europäischen Denkens. Die Wiederbelebung, die «Neue Hanse», begann mit den Hansetagen der Neuzeit. Zu diesem «Städtebund Die Hanse» zählen inzwischen 176Städte. Ihre Zusammensetzung zeigt, dass alte Feindbilder weitgehend verschwunden sind. Die Hanse wird als gemeinsame Tradition vieler Nationen gesehen. Besonders osteuropäische Städte haben großes Interesse: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Russland und Weißrussland übertreffen mit 50Mitgliedern die 28 teilnehmenden Städte aus west- und nordeuropäischen Staaten bei weitem.
Auch Altbürgermeister Voscherau betont, dass ein Großteil der Hansestädte hinter dem Eisernen Vorhang lag. «Hier herrscht ein immenser Nachholbedarf in hansischen Tugenden. Die ehemaligen Ostblockländer sind sich dieser wunderbaren Perspektive bewusst. Viel stärker als wir sehen sie das Erbe der Hanse als Chance zur Integration in Europa, für den wirtschaftlichen Aufschwung in Freiheit. Die ökonomische Idee der Hanse hatten wir im Westen ja schon vor 1990 zwischen Ostsee und Mittelmeer: Man nannte sie EWG.»
Die Schaffung eines seegestützten Wirtschaftssystems mit Ansätzen zu einem eigenen Handelsrecht, das innovative globale Handeln über den Binnenmarkt hinaus sind Kennzeichen der Hanse, von deutschen Kaufleuten und Städten ausgehend. Doch damit ergab sich auch eine Kulturgemeinschaft, eine Geisteshaltung und Lebensform jenseits nationaler Grenzen und religiöser Gegensätze, die nicht zuletzt ihren Ausdruck in der wunderbaren typischen Backsteinarchitektur der Hafenstädte an Nord- und Ostsee findet. Können wir aus diesem «europäischen» Denken lernen? Ja, sagt Voscherau: «Die Eigenverantwortung freier selbstbewusster Bürger, die sich selbst ernähren können, die wissen, dass jeder zunächst für sich selbst verantwortlich ist, und die nicht auf eine Hängematte schielen, auch das sollte eine Lehre aus der Hansezeit für uns sein. Bürgerstolz, faire Wahrung des gegenseitigen Vorteils, Austausch von Waren, Ideen, Kultur, Zusammenarbeiten und Respektieren über Grenzen hinweg, Verständnis für den anderen, voneinander lernen, dieses hansische Denken hat sich in der Gründung der EG und der EU Bahn gebrochen – insofern ist die Hanse ein Vorbild für das Zusammenwachsen in der Europäischen Gemeinschaft, der Grundgedanke der europäischen Integration von heute.»
Historiker sehen die Rolle der Hanse für uns heute deutlich distanzierter. Neben der Darstellung der Geschichte der Hanse – von ihren Anfängen als Zusammenschluss fernreisender Kaufleute bis zu ihrem Niedergang – will dieses Buch auch die Frage beantworten: Erleben wir heute einen verklärten Nostalgietrip schwärmerischer Europaenthusiasten? Wird die Hanse gar instrumentalisiert, wie wir es schon in den vergangenen Jahrhunderten vom aufstrebenden Bürgertum der 1848er-Revolution bis zu den Nationalsozialisten hatten? Beispiele dazu finden wir in Kapitel 15.Was ist mit der Inflation des Begriffes hanseatisch, der aus der Neuzeit stammt im Unterschied zum hansischen des Mittelalters? Dabei bezieht sich der Begriff hansisch auf die Hanse des Mittelalters und der frühen Neuzeit, der Begriff hanseatisch dagegen auf die Zeit seit dem 18.Jahrhundert und nur auf die drei «übrig gebliebenen» Hansestädte Lübeck, Hamburg und Bremen. Er wird verwendet, um Zuverlässigkeit, Korrektheit, Toleranz und Anstand zu demonstrieren. Dabei waren die Hansekaufleute in ihrem Geschäftsgebaren um keinen Deut besser als die heutigen, wie uns die Kapitel 6 und 9 zeigen. Es gab den ehrbaren Kaufmann, aber genauso den von Gier getriebenen Spekulanten und Betrüger.
In Japan und Südkorea besteht großes Interesse an der Geschichte der Hanse. An der Universität von Kioto zum Beispiel wird an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Hanseforschung betrieben. Koreanische Filmteams waren bereits mehrfach in Lübeck und drehten in Stadt und Archiv. Deutsche Hansehistoriker werden zu Vorträgen nach Japan und Südkorea eingeladen. Die Hanse gilt dort als ein wesentlicher Teil der europäischen Geschichte, als eine im Mittelalter zukunftsweisende Wirtschaftsorganisation, deren Kenntnis zum Verständnis der historischen Entwicklung Europas notwendig ist.
Lübeck, die ehemalige «Königin der Hanse», hat nun mit dem Bau des Europäischen Hansemuseums begonnen, das ab Frühsommer 2013 in moderner, heutige Sehgewohnheiten berücksichtigender Form, im Wechsel von Inszenierungen und inhaltlich vertiefenden Räumen, die herausragende Rolle dieser wirtschaftlichen und politischen Einigung darstellen wird.
Viele Einwohner anderer Städte wissen gar nicht, dass sie in einer alten Hansestadt leben. Die steinernen Zeugnisse der Hanse– Häuser, Kirchen, Straßen und Plätze – sind allzu oft Bomben und Abrissbirnen zum Opfer gefallen. Nicht ohne Grund ruft die Stiftung Denkmalschutz immer wieder zu einem achtsamen Umgang mit diesen Botschaften aus der Vergangenheit auf, die uns wie eine Zeitkapsel an eine Epoche erinnern mögen, die noch nicht abgeschlossen ist und ganz lebendig fortwirkt. Die Liste der historischen Hansestädte, die teilweise überraschen wird, findet sich in Kapitel 10.
Vielleicht mag mancher Autofahrer daran denken, wenn er auf dem uralten Hellweg von Duisburg nach Höxter unterwegs ist – den schon Drusus benutzte, als er im Jahre 11v.Chr. mit seinen Legionen Richtung Weser vorstieß–, unterwegs auf der dann mittelalterlichen Königs- und Kaufmannsstraße, der heutigen B1, und sich Dortmund nähert, dass hier einst ein Kaufmann lebte, der die englischen Kronjuwelen als Pfand nach Deutschland holte.
Visby auf Gotland. Die mittelalterliche Stadtmauer mit ihren Türmen ist gut erhalten, rechts im Bild die Marienkirche, seit 1225 auch die Pfarrkirche der deutschen Bürger Visbys
1 Die Anfänge: Gotländer an der Elbe– Kölner in London
Skriptorium der Abtei Echternach. Miniatur aus dem Evangeliar Kaiser HeinrichsIII., 1039/1040
18. Oktober 1161.Im Palas der Ertheneburg, dem Wohn- und Saalbau mit den Repräsentationsräumen, rund 30Meter über der Elbe beim heutigen Artlenburg, verliest Hartwig van Uthlede den Wortlaut des Friedensvertrags, den Herzog Heinrich der Löwe zwischen den Kaufleuten aus Gotland und den Kaufleuten aus dem Herzogtum Sachsen vermittelt hat. Um ehrlich zu sein: Wir lassen Hartwig den Vertrag verlesen. Möglicherweise war es auch ein Herold. Aber Hartwig ist Kaplan, ein Priester, und für die Kanzlei zuständig. Er ist einer der wenigen am Hofe des Herzogs, der lesen und schreiben kann. Außerdem hat er studiert, vermutlich in Frankreich, und trägt den Magistertitel. Seit drei Jahren ist Hartwig im Gefolge Heinrichs und hat noch eine große Zukunft vor sich. Obwohl er aus einer Familie von Bremer Stiftsministerialen stammt, ursprünglich unfreien Dienstmannen des dortigen Erzbischofs, wird er 1185 selbst Erzbischof in der Stadt an der Weser werden. Er kann die Aufstiegschancen nutzen, die der Hof eines großen Herrn im Hochmittelalter bietet, wo ein Kandidat jahrelang beobachtet und auf seine Eignung und Loyalität geprüft wird.
In der Kanzlei ist Hartwig für das Konzipieren und Formulieren der Urkunden zuständig, die als Beweis für sehr wichtige Rechtshandlungen des Herzogs angefertigt werden. Schriftliche Urkunden machen jedoch nur einen Bruchteil dessen aus, was tatsächlich anfällt, denn um die Mitte des 12.Jahrhunderts wird im regnum theutonicum, in Deutschland, fast alles mündlich geregelt. Umso wichtiger sind die Dinge, die der Nachwelt schriftlich überliefert werden sollen. Den «internationalen» Vertrag zwischen gotländischen und sächsischen Kaufleuten, den Hartwig verliest, hat er selbst diktiert. So nennt man das Verfassen, das Ausformulieren der Verhandlungsergebnisse, die damit bezeugt werden. Eine äußerst verantwortungsvolle Tätigkeit, die große Rechtskenntnisse und das Beherrschen der lateinischen Sprache voraussetzt – und ein besonderes Vertrauensverhältnis zu dem Herrn, für den man tätig ist.
Abschrift des Artlenburger Friedensvertrags von 1161 (um 1225)
Lübecker Stadtsiegel: rechts am Steuerruder ein seefahrender, links ein landfahrender Kaufmann aus dem Binnenland
In welcher Sprache die Verhandlungen geführt wurden, wissen wir nicht. Ob zunächst Dolmetscher zwischen der mittelniederdeutschen Sprache der (Nieder-)Sachsen um Heinrich den Löwen und dem gotländischen Schwedisch übersetzten und das Ergebnis dann ins Lateinische übertragen wurde oder ob man die Verhandlungen in lateinischer Sprache führte, ist nicht überliefert. Überliefert ist allein der lateinische Text in einer mit dem lübeckischen Stadtsiegel beglaubigten Abschrift aus den 1220er Jahren. Dieser Text erzählt die spannende Geschichte vom Anfang der Hanse oder besser: von einem der vielen Anfänge der Hanse. Denn es gibt viele Ursprungsorte, viele Handlungen und viele Ereignisse, die stattfinden mussten, bis in der Mitte des 14.Jahrhunderts die dudesche hense, die Deutsche Hanse im wahren Sinne des Wortes, ausgerufen wurde.
Übersetzungen aus den Volkssprachen ins Lateinische halten viele Fallstricke bereit, weswegen der Text der Urkunde von den Beteiligten beziehungsweise von ihren rechts- und sprachkundigen Begleitern geprüft und anschließend in einem feierlichen Akt öffentlich verlesen wird. Erst nach der öffentlichen Verkündung ist der Vertrag rechtskräftig.
Diese Verkündung findet soeben statt. Anwesend sind der Herzog, Grafen, Edelfreie und Ministerialen aus seinen Herzogtümern, die zurzeit an seinem Hof sind, sowie die gotländische Delegation. Von niederdeutschen Kaufleuten ist nicht die Rede.
Herzog Heinrich der Löwe ist noch keine 30Jahre alt, geboren um 1133/35.Er ist ein gutaussehender Mann von mittlerer Größe, mit großen, dunklen Augen, fast schwarzen Haaren, schlank und durchtrainiert. Sein bis zur Arroganz übersteigertes Selbstwertgefühl lässt er seine Umgebung immer wieder spüren. Schließlich ist er nach dem Kaiser (in seinen Augen eher neben dem Kaiser) als Herzog von Sachsen und Bayern der mächtigste Mann im Reich. Heute hört der Herzog ruhig zu, wie Hartwig vorliest. Wir wissen nicht, ob er Latein verstand, welche Fremdsprachen er überhaupt konnte. Sein Vetter, Kaiser FriedrichI.Barbarossa, verstand Latein, konnte es sogar ein wenig sprechen; Heinrichs Schwiegervater, König HeinrichII. von England, soll «eine gewisse Kenntnis aller Sprachen zwischen dem französischen Meer und dem Jordan» gehabt, aber nur Latein und Französisch gesprochen haben (Joachim Ehlers).
Die meisten Anwesenden verstehen jedoch kein Latein: weder die Mitglieder der gotländischen Delegation noch die als Zeugen des Friedens aufgebotenen weltlichen Würdenträger aus Heinrichs Herrschaftsbereich; und schon gar nicht seine Dienstleute, die damals auf der Schwelle zwischen Unfreiheit und niederem Adel stehen. Aber Lateinkenntnisse hin oder her, Verträge müssen in dieser Sprache festgehalten werden, um rechtsgültig zu sein. Deutsch gilt noch nichts. Es ist die Sprache des Volkes, auf Latein theodisca lingua, abgeleitet von diutisc und schließlich deutsch. Es wird noch zwei Menschenalter dauern, bis man um 1220/30 beginnt, in der Volkssprache zu schreiben, und noch rund 200Jahre, bis sie in fast allen Lebensbereichen üblich wird.
Die Einzigen, die tatsächlich verstehen, was Hartwig vorliest, sind die Zeugen aus der Geistlichkeit, die Bischöfe. Sie dürften alle eine Lateinschule besucht haben, der eine oder andere hat vielleicht – wie Hartwig – studiert. Auch der Priester, den wir als Mitglied der gotländischen Delegation voraussetzen, versteht den Text. Er wurde mitgenommen, um die Forderungen der Kaufleute gegebenenfalls ins Lateinische übersetzen zu können und um den Entwurf des Vertragstextes zu prüfen.
Und noch einer spricht Latein, ein Weltlicher: Graf AdolfII. von Holstein, in der Zeugenliste der über den Frieden ausgestellten Urkunde Atholfus comes genannt. Er hatte eine Ausbildung als Geistlicher begonnen, musste aber die Grafschaft übernehmen, nachdem sein Bruder 1126 auf einem Feldzug Kaiser LotharsIII. in Böhmen gefallen war. Der Chronist Helmold von Bosau berichtet, dass AdolfII. «nicht nur das Lateinische und Deutsche geläufig beherrschte, sondern auch die slawische Sprache konnte». Bei ihm ist eine abgebrochene Klerikerkarriere folglich der Grund für die für einen Grafen ungewöhnlichen Fremdsprachenkenntnisse und die Vorbereitung auf die Mission im Slawenland der Grund für die in diesen Kreisen noch ungewöhnlichere Kenntnis des Slawischen.
Das Herzogtum Sachsen unter Heinrich dem Löwen. Ein Herzogtum war eine Gemengelage vieler unterschiedlicher Herrschaftsrechte des Herzogs, der Adligen und der Kirche.
Ritter zu Pferd. Aquamanile, ein Wassergefäß zur Handwaschung bei Tisch, aus Bronze. Hergestellt in Hildesheim im 13.Jahrhundert
Graf Adolf und die anderen Großen aus den Herzogtümern Heinrichs des Löwen, die bei der Verlesung anwesend sind, sind die Zeugen der Rechtshandlung und damit des Vertragsinhalts. Ihre Anwesenheit bedeutet zugleich Rat und Zustimmung. Deswegen wird aufgeboten, wer von Rang und Namen gerade am Hofe weilt. Aufgeführt sind sie in der Zeugenliste am Ende der Urkunde in der üblichen Reihenfolge: zunächst die geistlichen Großen, die Bischöfe, und dann die weltlichen in der Abfolge ihres Ranges.
Bischof Gerold von Lübeck gehört dazu, der seit einem Jahr seinen Bistumssitz in Lübeck hat, der neuen Stadt des Herzogs. Vorher war der Sitz des Missionsbistums in Oldenburg in Holstein. Gerold war der Lehrer Helmolds von Bosau an der Schule von St.Blasius in Braunschweig. Ob er ihn schon zum Schreiben der eben erwähnten Chronik aufgefordert hat? Jedenfalls wird Helmold zwei Jahre nach dem hier geschilderten Ereignis mit der Niederschrift der Chronik beginnen. Sie ist die einzige erzählende Quelle zur Frühgeschichte Lübecks, der Stadt, die wie keine andere die Geschicke der Hanse prägen sollte.
Außerdem waren anwesend die Bischöfe Evermod von Ratzeburg und Bischof Berno von Mecklenburg. Das Bistum Ratzeburg war sieben Jahre zuvor, 1154, neu eingerichtet worden, der Sitz des älteren, aber lange Zeit untergegangenen Bistums Mecklenburg 1160 nach Schwerin verlegt worden. Das alles zeigt, dass der Herzog als weltlicher Fürst und die Bischöfe als Glieder der römisch-katholischen Kirche und des regnum theutonicum in dieser Zeit ihre Herrschaft in dem slawischen Gebiet nordöstlich der Elbe festigten. Der sächsische Adel war dort – neuen Forschungen zufolge – bereits seit rund einem Jahrhundert präsent (Günther Bock).
Der Markgraf von Vohburg (marchio de Vohburch) führt als Ranghöchster die weltlichen Zeugen an. Seine Markgrafschaft liegt an der Donau. Welche wichtigen Geschäfte ihn so weit in den Norden zu seinem Herzog führten, ist nicht bekannt. Anwesend sind außerdem zahlreiche Grafen. Graf Friedrich von Arnsberg, Graf Heinrich von Ravensberg aus einem Haus, das weit über sein Stammland in Ostwestfalen hinaus oft im Gefolge Heinrichs des Löwen zu finden ist, Graf Siegfried von Blankenburg und Volrad, der erste Graf von Dannenberg, einer neueingerichteten Grafschaft im Slawenland, die 1153 zum ersten Mal erwähnt ist. Graf Heinrich von Ratzeburg ist Heinrich von Badewide, der 1142/43 von Heinrich dem Löwen mit Ratzeburg und dem Land Polabien (in etwa der heutige Kreis Herzogtum Lauenburg) belehnt wurde.
Die folgenden drei Zeugen sind ohne Grafentitel genannt. Luthard von Meinersen, ein Edelfreier aus dem Raum zwischen Celle und Braunschweig, ist von 1142 bis 1169 häufig am Hof Heinrichs nachzuweisen; Luidolf von Waltingeroht ist Graf zwischen der oberen Oker und dem Fluss Innerste südlich von Braunschweig; und bei «Guncelin» wird es sich um den edelfreien Gunzelin von Hagen gehandelt haben. Er hatte im Jahr zuvor nach dem Feldzug Heinrichs des Löwen gegen die Abotriten die Grafschaft Schwerin erhalten und ist einer der engsten Vertrauten des Herzogs. 1172 wird er ihn nach Jerusalem begleiten. Der Kämmerer (camerarius) Anno und der Truchsess (dapifer) Liudolf sind Ministerialen des Herzogs, Inhaber wichtiger Hofämter, die zum Kernhof, zu den ständigen Begleitern, gehören. Anno von Heimburg, wie der volle Name des Kämmerers lautet, ist einer der führenden Ministerialen und 30Jahre lang, von 1143 bis 1173, am Hof. Derzeit ist er außerdem Vogt von Goslar (1152–1163). Männer wie er haben die herkömmliche Dienstmannschaft bereits verlassen; sie haben Eigengut, Lehen und können eigene Vasallen ausstatten.
Reinoldus, Graf von Lübeck, schließt die Zeugenliste. Es ist eigenartig, dass ein Graf nach den Ministerialen genannt wird. Aber vermutlich ist es eine Art Höflichkeitsgeste. Denn Graf Reinold dürfte der Gastgeber der Versammlung sein, ReinoldII. von Ertheneburg, vermutlich auch identisch mit Graf Reinold von Dithmarschen, und somit einer der ganz großen Herren im niederdeutschen Raum (Günther Bock). Zur Zeit der Verlesung soll Reinold außerdem Graf von Lübeck gewesen sein. Allerdings ist eine Grafschaft Lübeck in keiner anderen Quelle überliefert. Es müssen also noch einige Rätsel der Überlieferung gelöst werden. Drei Jahre später wird ReinoldII. gemeinsam mit AdolfII. von Holstein auf einem weiteren Kriegszug des Herzogs gegen die Abotriten fallen. Beide hatten keine Zeit mehr, ihre Rüstungen anzulegen, als ihr Lager frühmorgens überfallen wurde und sie die Angreifer abwehren wollten.
Es ist eine hochrangige, zum Teil hochadlige Gesellschaft, die den Frieden zwischen den Kaufleuten bezeugt. Das gibt uns einen ersten Fingerzeig auf die Bedeutung, die dem Frieden beigemessen wird. Und noch ein Zweites: Die gotländischen Kaufleute werden in diesem Vertrag als Rechtspartner anerkannt. Das setzt Kenntnisse des Lebens, des Verhaltens bei Hof voraus, will man nicht von vornherein scheitern. Denn schon im Hochmittelalter sind die Höfe Natterngruben. Die Adligen und die Ministerialen am Hofe Heinrichs des Löwen sind ehrgeizig und haben hohe gesellschaftliche Ansprüche. Ihr Dienst für den Herzog verlangt Härte. Er fördert die ohnehin vorhandene Gewaltbereitschaft und paart sie mit einer enormen Empfindlichkeit gegenüber persönlichen Kränkungen. Auf der einen Seite sind sie auf den Herzog angewiesen und er auf sie. Andererseits versucht Heinrich jedoch, die Adligen in ihrer Eigenständigkeit zu beschneiden und sie zu «seinen» Baronen zu machen. Seine Ministerialen führt er am kurzen Zügel. Einen lässt er wegen eines Vergehens wie einen Sklaven auspeitschen. Auch weltliche und geistliche Größen sind sich nicht grün und überwachen eifersüchtig, wer welche Stellung beim Herzog einnimmt (Joachim Ehlers). In dieser Schlangengrube müssen sich die Kaufleute dieser Zeit bewegen und zurechtfinden.
Hier auf der Ertheneburg sollen an diesem Tag im Spätherbst des Jahres 1161Mord und Totschlag beendet werden, die zwischen niederdeutschen Kaufleuten und ihren Konkurrenten aus Gotland stattgefunden hatten. Hartwig liest (wir übersetzen Hartwigs Latein und verkürzen den Text ein wenig): «Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit. Heinrich, durch Gottes mildtätige Gnade Herzog von Baiern und Sachsen. Alle gegenwärtigen wie zukünftigen Getreuen Christi sollen erfahren, dass wir aus Liebe zum Frieden und aus Verehrung der christlichen Religion, vor allem aber aus Betrachtung der ewigen Vergeltung den Streit, der seit langem verheerend zwischen den Deutschen und Gotländern geherrscht hat, zugunsten der Einigkeit und Eintracht beendet haben und dass wir auch die zahlreichen Übel, nämlich Hassausbrüche, Feindschaften und Morde, die aus der Uneinigkeit beider Nationen entstanden sind, unter helfender Gnade des Heiligen Geistes in ewiger Beständigkeit des Friedens beigelegt und daraufhin die Gotländer wohlwollend in die Gnade unserer Versöhnung aufgenommen haben.»
Wo Mord und Totschlag begangen wurden, ist seit langem zwischen deutschen und schwedischen Historikern umstritten. In der Urkunde lässt sich dazu nichts finden. Wenn man jedoch das übersteigerte Nationalbewusstsein vieler deutscher Historiker des späten 19. und frühen 20.Jahrhunderts nicht teilt, spricht mehr für das Herzogtum Sachsen als Schauplatz der Auseinandersetzungen als für die Insel Gotland. Dennoch: Die Überlieferung ist mehrdeutig und das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen.
Im Herzogtum Sachsen waren – auch das erfahren wir aus der Urkunde, die Hartwig verliest – die gotländischen Fernhändler, Nachfahren der schwedischen Wikinger, von Heinrichs Großvater Kaiser LotharIII. von Süpplingenburg privilegiert worden. Vermutlich auf dem Halberstädter Hoftag im Jahr 1134 wurde ihnen Schutz und Frieden zugesichert. Sie sollten in möglichst großer Zahl mit ihren Waren nach Sachsen kommen. Die Kaufleute des Herzogtums hatten nämlich nur indirekten Zugang zu den Schätzen des Nordens und Nordostens, zu Pelzen, Wachs und Walrosselfenbein aus dem östlichen Ostseeraum, und zu den Transitgütern Seide, Weihrauch und Gewürzen aus Indien, China und von den Molukken, die über die nördlichen Routen der Seidenstraße nach Nowgorod und von dort von den seefahrenden Kaufleuten in die Hafenstädte an der Süd- und Westküste der Ostsee gebracht wurden. In allen diesen Hafenstädten waren die niederdeutschen Kaufleute Fremde. In der Stadt Schleswig, die zum Königreich Dänemark gehörte, und auch in der slawischen Residenz Alt Lübeck. Alt Lübeck war Sitz Heinrichs, des Herrschers über die slawischen Abotriten. Sein Reich erstreckte sich vom Limes Saxoniae, der sächsischen Grenze, die von der Kieler Bucht bis zur Elbe bei Boizenburg verlief, bis zum heutigen Vorpommern. Heinrich von Alt Lübeck war mit Kaiser LotharIII. verbündet und wurde von ihm zum König der Abotriten gekrönt. Weil die Abotriten eine schriftlose Kultur hatten und ihr Reich seit Ende der 1130er Jahre von den Deutschen erobert wurde, ist erst aufgrund der Ergebnisse der Archäologie in den letzten Jahrzehnten erkannt worden, dass es ein reiches Land war. Zu Beginn des 12.Jahrhunderts hatte es bereits eine Münzgeldwirtschaft entwickelt. Zeitweise expandierten die Abotriten bis in den östlichen Ostseeraum. Dort scheinen sie sich an der Düna, in der Gegend des späteren Riga, niedergelassen zu haben (Nils Blomkvist).
König Heinrich von Alt Lübeck (1093–1127). Das ist die einzige von ihm überlieferte Darstellung. Mecklenburgische Reimchronik des Ernst von Kirchberg (†1379)
Alt Lübeck zur Zeit des Abotritenherrschers Heinrich (1093–1127). Die Durchstichskanten der Travebegradigung 1882 sind gestrichelt. Die Kaufleutesiedlung lag wohl auf dem Kesselbrink.
Das Abotritenreich war Teil einer blühenden Wirtschaftslandschaft, die Dänemark (wozu damals auch Südschweden gehörte) und die südliche Ostseeküste einschließlich des Gebiets der Pommoranen im späteren Pommern umschloss. Produkte von dort und Handelswaren aus dem östlichen Ostseeraum wurden an die deutschen, englischen, vermutlich auch die flämischen und an andere Kaufleute verkauft. Diese Kaufleute kamen nach Schleswig und nach Alt Lübeck, auch nach Wollin oder Stettin an der Odermündung, tauschten dort ihre mitgebrachten Waren gegen die Handelsgüter des Ostseeraums und die Transitgüter aus dem Fernen Osten.
Der sagenhafte Reichtum dieser Städte spiegelt sich bis heute in den Sagen vom Untergang Vinetas. So reich soll diese Stadt gewesen sein, dass ihre Stadttore aus Erz, die Glocken aber aus Silber hergestellt waren. Die Kinder spielten auf der Straße mit echtem Silbergeld, und ihre Eltern wischten ihnen den Hintern mit Semmeln. Es gibt verschiedene Versionen der Sage. Ob aber ein Streit zwischen den Bewohnern oder eine Sturmflut zum Untergang führte und ob Vineta bei Wollin in Pommern oder vor der Insel Usedom lag, das Ende ist immer das Gleiche: Die Gotländer kamen und nahmen mit, was sie von den Reichtümern der Stadt an sich reißen konnten. Die Stadttore aus Erz brachten sie nach Visby, der größten Stadt auf Gotland. Dorthin verlagerte sich auch der Handel nach dem Untergang Vinetas.
Die landseitige Stadtmauer von Visby vom Stadtinnern her gesehen. Die Halbschalentürme sind nach hinten offen, damit sich die Angreifer nicht in ihnen verschanzen können.
Hier hat sich in der Volkssage ganz offensichtlich die Erinnerung an die Vorgänge im 12.Jahrhundert erhalten, die Gotland die Schlüsselposition im Ostseehandel verschafft und zum Niedergang der slawischen Städte an der Südküste der Ostsee geführt hatten. Zu diesen Städten hatte auch das slawische Alt Lübeck gehört. Die gotländischen Kaufleute, die dort anlandeten, versuchte LotharIII. durch sein Halberstädter Privileg an sein sächsisches Herzogtum zu binden. Alt Lübeck lag in seiner Machtsphäre. Im selben Jahr, in dem er die gotländischen Kaufleute privilegierte, hatte er die Burg Segeberg errichten lassen, um von dort aus das slawische Gebiet zu kontrollieren. Angesichts der Unruhen, die dort nach dem Tod (der Ermordung?) Heinrichs von Alt Lübeck und der Ermordung seiner Söhne und Enkel sowie seines Nachfolgers, des Dänen Knut Lavard, herrschten, musste er die gotländischen Kaufleute unter seinen Schutz stellen, um sie nicht an Schleswig zu verlieren. Schleswig war damals der zentrale Umschlagplatz zwischen dem Ostseeraum und Mittel- und Westeuropa. Rechtssicherung als institutionelle Maßnahme zur Förderung der Wirtschaft gab es also bereits im 12.Jahrhundert.
Heinrich der Löwe setzte die neue «Ostpolitik» seines Großvaters erfolgreich fort. Auch und gerade in Bezug auf die Gotländer, deren Delegation gerade der Verlesung der Friedensurkunde zuhört. Die älteren Teilnehmer der Delegation mögen als junge Kaufleute bei der Privilegierung in Halberstadt rund 30Jahren zuvor dabei gewesen sein. Sie hatten anschließend erleben müssen, dass Alt Lübeck ein Jahr nach Lothars Tod (1137) im Verlauf innerslawischer Wirren zerstört worden war. Ohne den Schutz der Herrenburg zogen sich zumindest die niederdeutschen Fernhändler aus der Kaufleutesiedlung bei Alt Lübeck zurück und begaben sich weiter ins Landesinnere auf eine Halbinsel zwischen den Flüssen Trave und Wakenitz. Dort liegt Lübeck noch heute.
Lübeck von Nordosten, gerahmt von der Trave im Westen und dem Elbe-Lübeck-Kanal im Osten, der hier im Flussbett der Wakenitz verläuft
Unter den Feldzügen der Holsten und (Nieder-)Sachsen seit 1138 brach der westliche Teil des Abotritenreichs zusammen. Die Landschaft Wagrien, die etwa dem heutigen Kreis Ostholstein entsprach, und das Gebiet der Polaben bis Lauenburg an der Elbe wurden Teil des (Heiligen) Römischen Reiches. Das war der Beginn der Ostsiedlung nordöstlich der Elbe. Gewalttätige, blutige Eroberung und das Herbeirufen von Siedlern aus Deutschland und den Niederlanden durch slawische Fürsten zur friedlichen Besiedlung gingen zum Teil Hand in Hand.
In welchem Umfang der Handel der Gotländer während der mörderischen Kämpfe in Wagrien weiterlief, ist nicht bekannt. Dass er nicht abbrach, dürfen wir daraus schließen, dass die neue Siedlung auf der Halbinsel zwischen Trave und Wakenitz vom neuen Herrn des eroberten Landes, Graf AdolfII. von Schauenburg (das ist der, der Latein und Slawisch sprechen konnte), im Jahr 1143 das Stadtrecht erhielt. Er nannte sie Lubeke, «weil sie von dem alten Hafen und Hauptort, den einst Fürst Heinrich angelegt hatte, nicht weit entfernt war». Dies berichtet um 1170Helmold, Pfarrer in Bosau, in seiner Slawenchronik. Die neue Stadt entwickelte sich so gut, dass sie den Neid Heinrichs des Löwen hervorrief. Denn bislang war Bardowick der nordöstliche Grenzhandelsort des Reiches zu den Slawen gewesen. Bardowicks Stadtherr war Heinrich. Er profitierte durch Zolleinnahmen, Marktgebühren und anderen Einnahmen von den Handelsgeschäften, die dort abgeschlossen wurden, und von den Wagenzügen, die dort die Grenze passierten. Seitdem mit Lübeck aber eine Hafenstadt mit deutschem Recht zum ersten Mal direkt an der Ostsee lag, lief der Großteil des Handels mit den Slawen und vor allem auch der hohe Gewinne abwerfende Ostsee-Fernhandel über Lübeck. Die Kaufleute zogen an Bardowick vorbei, viele, die dort wohnten, verließen den Ort und zogen nach Lübeck. Die Einkünfte des Herzogs verminderten sich. Zunächst versuchte er, den Grafen Adolf (der sein Lehnsmann war) zu überreden, ihm die Hälfte der Einkünfte der neuen Stadt zu überlassen. Der aber sah keinen Grund, das zu tun, sodass der Herzog den Fernhandel in der neuen Stadt verbot und die Kaufleute anwies, nach Bardowick zurückzuziehen.
Damit war der neuen Stadt die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen. Sie war mehr als andere Städte auf den Fernhandel angewiesen, da das Umland wegen der Eroberungskriege der Sachsen und Holsten noch menschenleer war und erst langsam besiedelt wurde. Schließlich gelang es Heinrich den Grafen Adolf zu überreden, ihm die Halbinsel mit der inzwischen niedergebrannten Stadt zu übergeben: multa spondens, heißt es bei Helmold, indem er ihm viel versprach. Vermutlich viel Geld, das aber nicht Heinrich selbst, sondern die Kaufleute aufgebracht haben dürften, die an der Rückkehr interessiert waren.
Heinrich hatte Großes vor mit der Stadt an der Trave. Sie sollte Zentrum seiner Landesherrschaft nordöstlich der Elbe werden. Dort hatte er weit bessere Möglichkeiten, seine Macht auszubauen, als im linkselbischen Gebiet, wo die Adelsfamilien ihre angestammten Rechte hartnäckig verteidigten. Zusätzlich verfügte er in Lübeck über Einnahmen aus dem Fernhandel, die den Wert der agrarischen Abgaben, die er ansonsten aus dem Land erhielt, bei weitem überschritten haben dürften. Dies alles auszubauen, war sein Ziel. Deswegen, berichtet Helmold, schickte er «Boten in Hauptorte und Reiche des Nordens, nach Dänemark, Schweden, Norwegen und Russland, und bot ihnen Frieden und Zugang zu freiem Handel in seine Stadt Lübeck». Das bedeutete unter anderem Zollfreiheit für Dänen, Russen, Normannen, Schweden, Ölander, Gotländer, Liven und alle Völker des Ostens.
Sinn und Zweck der Botschaft waren klar: Das seit langem bekannte, früher slawische Handelszentrum steht nun unter der Herrschaft des mächtigsten deutschen Fürsten. Er kann in seiner vizeköniglichen Stellung in dem seit mehr als einem Jahrzehnt durch Kriegszüge erschütterten Gebiet die Sicherheit der Kaufleute gewähren.
Und dann diese Exzesse. Anstatt friedlich Handel zu treiben, schlagen Niederdeutsche und Gotländer sich gegenseitig tot.
Was mögen die Gründe gewesen sein? Drei Szenarien, die sich auch verschränkt haben können, sind möglich. Alle haben – selbstverständlich – mit Konkurrenz zu tun. Das erste Szenario: Der Aufruf des Herzogs, dessen Macht auch weit im Norden Europas bekannt war, veranlasste weit mehr gotländische Kaufleute, über Lübeck ins Herzogtum Sachsen zu fahren als früher. Dementsprechend größer war ihre Konkurrenz für die niederdeutschen Kaufleute in den Städten und auf den Märkten des Herzogtums. Es kam vermehrt zu Streitigkeiten und schließlich zu Mord und Totschlag.
Szenario zwei: Lübeck war die erste Stadt an der Ostseeküste, in der deutsches Recht galt. Die niederdeutschen und die gotländischen Kaufleute trafen hier nicht mehr als Fremde aufeinander, wie im dänischen Schleswig oder im slawischen Alt Lübeck. Dementsprechend war für die niederdeutschen Kaufleute keine aus dem fremden Recht heraus gebotene Zurückhaltung mehr nötig. Sie werden die Gotländer verstärkt unter Druck gesetzt haben, sie auf ihren Schiffen nach Gotland mitzunehmen und, wenn diese sich widersetzten, auch mal mit dem Schwert nachgeholfen haben. In den ersten Jahren oder Jahrzehnten waren die niederdeutschen Kaufleute auf den Schiffsraum der seefahrenden Ostsee-Fernhändler angewiesen. Sie selbst stammten ja aus dem Binnenland, vor allem aus dem Raum zwischen Niederrhein und Elbe. Sie besaßen folglich keine Schiffe. Wollten sie nach Gotland oder anderswohin im Ostseeraum, mussten sie eine «Mitfahrgelegenheit» finden. Außerdem muss die Zahl der in Lübeck ankommenden Kaufleute sehr groß gewesen sein. Bis zu den Kriegen in den späten 1130er Jahren konnten die Binnenkaufleute in Schleswig, in Alt Lübeck und an anderen Handelsplätzen an der Südküste der Ostsee mit den seefahrenden Ostseekaufleuten Handel treiben. Nun ballten sich wegen der Kriegszüge in den Slawenländern wohl fast alle Binnenkaufleute in Lübeck.
Szenario drei beruht auf der Zollfreiheit, die der Herzog den Kaufleuten des Ostseeraums zukommen ließ. Je mehr von diesen nach Lübeck kamen, desto heftiger die Wut derjenigen niederdeutschen Kaufleute, die Zoll zahlen mussten. Das waren vermutlich alle außer den Lübecker Bürgern. Außerdem, das ist auch für das Szenario eins zu berücksichtigen, verschaffte die Zollfreiheit der gotländischen Konkurrenz erhebliche Wettbewerbsvorteile.
Welches Szenario auch abgelaufen sein mag, der Zorn des Herzogs muss furchtbar gewesen sein. Die Verbrechen gefährdeten die wirtschaftliche Grundlage seines neuen, zum größten Teil noch zu erobernden Herrschaftsgebiets. Und mehr noch: Sie gefährdeten sein Ansehen als mächtiger Fürst, der fremden Kaufleuten Schutz gewähren kann. Deswegen lässt er – vermutlich zeitgleich mit dem Artlenburger Friedensvertrag – einen Befehl an einen gewissen Ulrich (Odalricus) schreiben. Er lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig:
«Ulrich, wenn du weiterhin in meiner Gnade bleiben willst, befehle ich dir, die Rechte mit aller Sorgfalt aufrechtzuerhalten, die ich zum einen den Gotländern in meinem gesamten Herrschaftsbereich gewährt habe und die zum anderen den Deutschen gelten, die zu leiten ich dich eingesetzt habe. Insbesondere dass alle, die zum Tode oder zu einer Verstümmelungsstrafe der Hände verurteilt wurden, diese Strafen auch erleiden. Die anderen Verbrechen sollen nach den Gesetzen abgeurteilt werden, die oben genannt sind». (nämlich im Text des Friedensvertrages).
Offensichtlich hat es Ulrich bislang an der notwendigen Konsequenz bei der Verfolgung der Täter fehlen lassen. Nun wird ihm unter Androhung des Verlustes der herzoglichen Gnade befohlen, dafür zu sorgen, dass überführte Täter auch bestraft werden. Vermutlich war die persönliche Nähe Ulrichs zu den Kaufleuten zu groß. Man kannte sich, war vielleicht sogar miteinander verwandt. Und schließlich wollte man ja nur die gotländischen Konkurrenten in die Schranken weisen. Da saß das Schwert eben bisweilen etwas locker.
Wer aber war nun eigentlich dieser Ulrich? Darüber haben sich bereits Generationen von Historikern den Kopf zerbrochen, manche sich fast bis aufs Blut befehdet. Wir müssen wohl zugeben, dass es nicht mehr genau festzustellen ist. Es gibt zu wenig Nachrichten über ihn, auch wenn er, abgesehen von diesem Befehl Heinrichs des Löwen, bis 1174 als Zeuge ministerialischen Stands in Urkunden der Erzbischöfe von Bremen genannt ist. Am plausibelsten scheint mir zu sein, dass er der von Heinrich eingesetzte «Hansegraf» über die Kaufleute seines Herzogtums war. Er hätte dann die Aufgabe gehabt, die Kaufleute im Namen des Herzogs zu schützen (als advocatus), ihrem genossenschaftlichen Gericht vorzusitzen, vor dem die internen Belange der Kaufleute verhandelt wurden (als iudex), und die Gebühren einzunehmen und an den Herzog abzuführen, die die Kaufleute dem Herzog schuldeten. Er wäre laut dem Befehl Heinrichs außerdem verpflichtet gewesen, die wegen Mordes oder Totschlags gemäß dem besonderen Marktfrieden verurteilten Kaufleute ihrer Strafe zuzuführen. Sicher können wir aber sein, dass er nicht der Ältermann (gewählter oder eingesetzter Vorsteher, «Ältester», einer Personengruppe) deutscher Kaufleute auf Gotland war, wie deutsche Hansehistoriker bis in die 1990er Jahre hinein meinten. Der Wortlaut des Friedensvertrages und der Befehl an Ulrich sprechen eine eindeutige Sprache.
Inzwischen hat Hartwig die in der Urkunde verbrieften Rechte fast fertig vorgelesen: dass die Gotländer im gesamten Machtbereich des Herzogs sicher sind, dass sie in allen seinen Städten vom Zoll befreit sind, dass auf Totschlag oder Verletzung durch scharfe Waffen in den Städten unter Sonderfrieden die Todesstrafe oder das Abhacken der Hand droht, wenn es aber außerhalb eines Sonderfriedens geschieht, ein Manngeld in Höhe von 40Mark gezahlt werden muss (eine hohe Summe, für die man damals sicherlich ein seegängiges Schiff erhalten konnte). Es folgte die fortschrittliche Regelung, dass beim Tod eines Gotländers im Herzogtum Sachsen seine Güter über einen Zeitraum von einem Jahr und einem Tag für seine Erben aufbewahrt werden mussten.
Aber der für die zukünftige Entwicklung des niederdeutschen Ostseehandels wichtigste Passus folgt noch. Zunächst verkündet Hartwig, dass die Gotländer die gleiche Gunst und die gleichen Rechte (graciam et iustitiam) wie die Kaufleute des Herzogs genießen sollen, und fährt dann fort: «und wir haben festgesetzt, dass dies für immer fest und unumstößlich gelten soll, vorausgesetzt die Gotländer gewähren unseren Leuten in dankbarer Wechselseitigkeit dasselbe».
Die Zukunftswirkung dieser Urkunde lag in der Gewährung der Gegenseitigkeit. Alle Rechte, die die Gotländer im Herzogtum Sachsen hatten, sollten die deutschen Kaufleute auf Gotland ebenfalls genießen. Das Erstaunliche daran ist, dass dieser Frieden auf der Basis der Gegenseitigkeit von Beginn an funktioniert. Zwischen Deutschen und Gotländern sind keine Auseinandersetzungen mehr überliefert. Im Gegenteil, die deutschen Kaufleute erschließen seit diesem Vertrag in den Fußspuren beziehungsweise im Kielwasser der Gotländer den Ostseeraum. Zwar werden auch von Schleswig oder von Alt Lübeck und vom Lübeck AdolfsII. aus einzelne niederdeutsche Kaufleute schon bis Gotland oder darüber hinaus gekommen sein. In großer Zahl sind sie aber erst nach dem Artlenburger Friedensvertrag im Ostseeraum nachzuweisen. Er bildet die Basis für eine rund 300Jahre dauernde Handelsgemeinschaft niederdeutscher Kaufleute zunächst mit allen Bewohnern Gotlands, später mit den gotländischen Bürgern der Stadt Visby. Das ist im Hinblick auf die Mitgliedschaft im Verband niederdeutscher Kaufleute der einzige «internationale» Zug der frühhansischen Geschichte.
Es ging zügig voran. Einen ersten indirekten Hinweis gibt es aus dem Jahr 1177.Damals ermutigte König WaldemarI. von Dänemark die Mitglieder der neugegründeten St.Knuts-Gilde, mit dem Bau ihres Hauses auf Gotland fortzufahren trotz der Schwierigkeiten, die ihnen ihre Konkurrenten machten. Bei diesen dürfte es sich um die deutschen Kaufleute gehandelt haben. Um 1180 schloss Heinrich der Löwe Handelsverträge mit dem König von Schweden und dem Fürsten von Nowgorod (allerdings streiten Historiker bis heute, ob es den Vertrag mit Nowgorod tatsächlich gab). Seit 1180 lassen sich Deutsche in Visby nieder, bilden dort im frühen 13.Jahrhundert eine selbständige deutsche Stadtgemeinde neben der gotländischen (beide werden sich 1288 zu einer Gemeinde zusammenschließen). Auf Gotland treffen die deutschen Kaufleute auf ihre «Kollegen» aus Schweden, aus dem (später so genannten) Baltikum, aus Russland und aus den slawischen Ländern. Von Visby aus folgen sie wiederum den Gotländern nach Nowgorod. Spätestens durch einen Boykott des Handels mit Nowgorod Ende der 1180er Jahre erzwingen sie einen Handelsvertrag und erhalten eine Handelsniederlassung in der Stadt am Wolchow: den Peterhof, das erste der später so genannten hansischen Kontore.
Nicht nur über Lübeck kommen deutsche Kaufleute nach Gotland. Vermutlich muss ihnen auch der dänische König als Stadtherr von Schleswig angesichts der Konkurrenz durch Lübeck die Weiterfahrt auf die Ostsee erlauben. Schleswig hatte seit der zweiten Hälfte des 11.Jahrhunderts Haithabu als zentraler Umschlagplatz des Handels zwischen Ost- und Nordseeraum abgelöst. Die seefahrenden Kaufleute vom Niederrhein, wie die Mitglieder der wohl aufs 12.Jahrhundert zurückgehenden fraternitas Danica, der Bruderschaft der nach Dänemark handelnden Kölner Kaufleute, und die Kaufleute von der niederländischen und friesischen Nordseeküste, fahren per Schiff an der Küste entlang bis zur Eidermündung, die Eider hoch und auf der Treene bis Hollingstedt. Dort müssen die Waren auf Transportwagen oder Saumtiere verladen und auf dem nur 16Kilometer langen Landweg nach Schleswig gebracht werden. Das Schleppen der Schiffe über diese Distanz ist übrigens ins Reich der Sage zu verweisen. Die Schiffe wären auseinandergebrochen. Für die Gruppe der seefahrenden Kaufleute aus dem Westen wäre der Weg über die neue Stadt Lübeck viel länger und umständlicher. Sie müssten die Elbe hoch bis Hamburg segeln und anschließend den mit rund 60Kilometern wesentlich längeren Landweg nach Lübeck zurücklegen. Es wird noch rund ein Jahrhundert dauern, bis Schleswig seine Funktion als Umschlagplatz verlieren und der Transithandel zwischen Ost- und Nordsee fast ausschließlich über Lübeck laufen wird.
Rekonstruktion der Hafenstadt Schleswig im 12.Jahrhundert. Schleswig war als Nachfolgerin Haithabus der zentrale Umschlagplatz im Handel zwischen Ost- und Nordsee.
Als sich um 1180 die ersten frühhansischen Kaufleute in Visby auf Gotland niederlassen, wird im Heiligen Römischen Reich Heinrich gestürzt. Er verliert seine beiden Herzogtümer, muss ins Exil, und die niederdeutschen Kaufleute haben keinen mächtigen Schutzherrn mehr. Sie sind weitgehend auf sich selbst gestellt. Ob der Verlust des Schutzes des großen Herrn die Initialzündung für den Zusammenschluss der niederdeutschen Kaufleute in Nowgorod war, wissen wir nicht. Plausibel ist es in jedem Fall.
Die Bedeutung Gotlands beruhte auf seiner geografischen Lage und darauf, dass die Gotländer ihre Insel in der ersten Hälfte des 12.Jahrhunderts dem «internationalen» Handelsverkehr geöffnet hatten (Nils Blomkvist). Zwar waren bereits die gotländischen Wikinger über Düna und Dnjepr bis nach Konstantinopel und ins Kalifat von Bagdad gelangt. Vor allem durch Sklavenhandel hatten sie große Reichtümer erworben. Gotland ist heute die Region mit der größten Anzahl an Schatzfunden in ganz Nordeuropa. Dirhems, das sind arabische Silbermünzen, sowie Silber- und Goldschmuck bestimmen bis zum Ende des 10.Jahrhunderts das Bild. Ihre Insel aber scheinen die Gotländer Fremden damals verschlossen zu haben. Erst seit dem 12.Jahrhundert laufen die Schiffe russischer, slawischer, baltischer und dänischer Kaufleute, seit spätestens 1161 auch deutscher Kaufleute, Gotland an. Wegen ihrer Lage war die Insel der natürliche Sammel- und Umschlagplatz in der Zeit der Küstenschifffahrt. Mit den rahbesegelten Schiffen konnte man bis ins 14.Jahrhundert hinein nicht gegen den Wind kreuzen. Es war folglich unmöglich, sich bei auflandigen Winden von der Küste freizusegeln. Deswegen hielt man sich möglichst nahe an der Küste, um bei widrigen Windverhältnissen schnell an einem geschützten Platz vor Anker gehen oder das Schiff an Land ziehen zu können. Außerdem erlaubten die navigatorischen Mittel noch keine langen Fahrten ohne Landsicht. Der Kompass kam im Ostseegebiet erst um 1400 in Gebrauch. Die Schiffe fuhren also von Schleswig oder von Lübeck aus unter Landsicht bis Bornholm, dann die Küste entlang bis Öland und weiter bis Gotland. In sternenklaren Nächten, wenn sie sich am Nordstern orientieren konnten, segelten die Schiffer dann in Richtung Ösel oder Kurland und hatten bei Sonnenaufgang wieder Landsicht. In Gegenrichtung verfuhr man ebenso. Man ersparte sich dadurch die lange Fahrt auf der «Route der Könige», die von Öland die schwedische Ostküste entlang zu den Åland-Inseln und von dort an die finnische Südküste führte. Die Navigation mit Hilfe des Nordsterns («Polarsternverfahren») war für die Seefahrt der Ostseestädte von so grundlegender Bedeutung, dass manche den Nordstern auf ihren Stadtsiegeln darstellten. Als die Navigation mit Kompass das Polarsternverfahren ersetzte, verschwand auch der Nordstern aus den Siegelbildern. Das Danziger Siegel von ungefähr 1400 ist das letzte Beispiel mit Polarstern (siehe Abbildung auf S. 174).
Die Direktfahrt über die offene See, die mit Hilfe des Kompasses seit Ende des 14.Jahrhunderts möglich wurde, war auch das Ende der wirtschaftlichen Bedeutung Visbys. Die Stadt und die Insel hatten ihre Funktion im Ostseehandel verloren. 1476 wurde Visby zum letzten Mal zu einem Hansetag eingeladen, schickte aber keine Delegation.
Die Hanse entstand aber nicht (nur) im Osten. Der zweite, zeitlich sogar frühere Brennpunkt ihrer Entstehung lag im Westen. Dort kam den Kaufleuten der Stadt Köln eine ähnliche Rolle zu wie den Lübeckern im Osten, sodass man den hansischen Raum auch als eine Ellipse mit den beiden Brennpunkten Lübeck und Köln definieren kann. Köln steht dabei stellvertretend für den niederrheinischen Wirtschaftsraum, mit dem die heute niederländischen IJssel- und Zuiderseestädte eng verflochten waren. Zwischen diesem Raum und dem östlichen Sachsen mit seiner Verbindung zum Ostseeraum lag als Drehscheibe und Brücke Westfalen. Die Kaufleute dieser Region hatten Handelsverbindungen nach Westen und Osten. Wir treffen sie in Lübeck, auf Gotland und anschließend im Baltikum genauso wie in England und den Niederlanden. Sie spielen im Handel nach Ost und West bis zum 15.Jahrhundert eine herausragende Rolle.
Köln ist im Mittelalter die größte und reichste Stadt Deutschlands, eine Kaufmanns-, Messe- und Exportgewerbestadt. Ihre Kaufleute haben Verbindungen über Regensburg zum Donauhandel, über Augsburg nach Venedig. Sie handeln im Westen mit Frankreich und Flandern, nach Osten mit den westfälischen Städten und bis Magdeburg an der Elbe. Die engsten Wirtschaftsbeziehungen bestehen den Rhein hinab nach England. Sie beruhen auf Gegenseitigkeit, denn viele englische Kaufleute leben in Köln, und englische Münzen gelten in der Rheinmetropole und in Westfalen als Zahlungsmittel. Köln beherbergt außerdem zahlreiche Exportgewerbe, die Tuche, Metallwaren, besonders Waffen, Pelz- und Lederwaren herstellen.
Das Danziger Stadtsiegel zeigt eine Kogge mit Vorder- und Achterkastell sowie oben links den Nordstern (zweite Hälfte 13.Jahrhundert).
Köln ist außerdem Sitz eines Erzbischofs, eines der mächtigsten Fürsten des Reiches (im 14.Jahrhundert wird er einer der sieben Kurfürsten werden, die den deutschen König wählen). In der Stadt stehen viele Kirchen und Klöster, wodurch eine große Nachfrage nach standesgemäßen Waren besteht. Ministeriale des Erzbischofs spielen in der Verwaltung, auch in der Wirtschaftsverwaltung, eine bedeutende Rolle und haben enge Kontakte und gemeinsame Interessen mit den reichen Kaufleuten der Stadt. Zusammen bilden sie im 12.Jahrhundert die Führungselite der Stadt. Sie greifen über ihren erzbischöflichen Stadtherrn mit ihrem Geld sogar in die Reichspolitik ein. 1198 finanzieren sie die Wahl des Welfen OttoIV., des dritten Sohnes Heinrichs des Löwen, zum deutschen König. Noch am Krönungstag erhielt die Stadt Köln ein Privileg von ihm.
Die engen Wirtschaftskontakte zu England werden bei diesem Vorgang eine wichtige Rolle gespielt haben. Denn die Welfen hatten gute Beziehungen zum englischen Königshaus. Heinrich der Löwe war nach seinem Sturz 1181 zu seinem Schwiegervater, König HeinrichII. von England, ins Exil gegangen. Der junge Otto wuchs an dessen Hof auf.
Die Kölner unterstützten dadurch die englisch-welfische Allianz gegen die Partei der Staufer. Denn 20Jahre zuvor hatten die Kölner eine Art Wirtschaftskrieg gegen Kaiser FriedrichI.Barbarossa führen müssen. Der förderte den Eigenhandel der flämischen Kaufleute, die ohnehin eine führende Rolle im Nordwesten Europas spielten. Flandern hatte sich seit dem 11.Jahrhundert zu einer reichen Produktions- und Handelsregion entwickelt.
Nun benötigten die Kölner einen mächtigen Verbündeten. Sie fanden ihn im englischen König. Vermutlich überzeugten sie ihn, dass die starke Stellung der flämischen Kaufleute im Handel mit englischer Wolle durch die zusätzliche Übernahme des Handels mit Rheinwein noch gestärkt würde. Dann hätten die Flamen den nordwesteuropäischen Handel vollkommen beherrscht, indem sie Wein vom Rhein nach England, von dort Wolle nach Flandern und von Flandern Tuche an den Rhein gebracht hätten. Das Kölner Vorgehen war erfolgreich. König HeinrichII. von England nahm die Kaufleute der Rheinmetropole 1175/76 unter seinen Schutz und verlieh ihnen die guildhall, die Gildehalle in London (aus der sich später der Stalhof – das Hansekontor – entwickeln sollte). Sein Sohn, RichardI.Löwenherz, gewährte ihnen im Jahr 1194 so weitreichende Privilegien, wie sie keine andere deutsche Stadt im 12.Jahrhundert irgendwo im Ausland erhielt. Richard Löwenherz war 1192 auf der Rückreise vom Kreuzzug gefangen genommen, an Kaiser HeinrichVI. überstellt und schließlich im Februar 1194 gegen ein immenses Lösegeld freigelassen worden. Nach seiner Freilassung hielt er sich drei Tage in Köln auf und stellte den Kölnern vor seiner Einschiffung nach England das Privileg aus. Wir können also sicher sein: Kölner Kapital war an der Auslösung des Königs beteiligt. Dieses Kapital kam von der Kölner Führungsgruppe, zu deren Spitzenvertretern Gerhard Unmaze gehörte. Er legte mit den Grundstein für die jahrhundertelange handelspolitische Ausnahmestellung Kölns im Englandhandel und wurde in der Erzählung «Der guote Gerhard» von Rudolf von Ems literarisch verewigt – als einziger Ministeriale und Kaufmann der deutschen Geschichte.
Evangeliar Heinrichs des Löwen, ca. 1185/88.Im Vordergrund Heinrich der Löwe und seine Gattin Mathilde. Hinter Mathilde ihr Vater, König HeinrichII. von England
Ansicht von London im 15.Jahrhundert. Die Szenen im Tower (rechts) zeigen Herzog Karl von Orléans, der 25Jahre in England gefangen gehalten wurde. Im Vordergrund Traitor’s Gate
Die Kölner Privilegien wiederum waren der Kern, an den sich im 13.Jahrhundert die Privilegien der Ostseestädte anschlossen, aus denen sich die Gemeinschaft der niederdeutschen Kaufleute, die hansa Alemanie, entwickeln sollte, die in London im Jahr 1282 erstmals so genannt wird.
Außer dem gezielten Einsatz von Kapital, um handelspolitische Vorteile zu erhalten, wird noch ein Zweites deutlich. Während die Geschichte des deutschen Lübeck in der Mitte des 12.