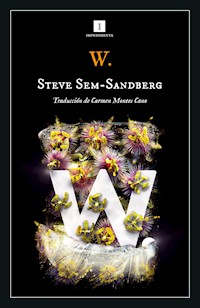12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Adrian Ziegler, der aus einem sozial und erbbiologisch "minderwertigen" Elternhaus stammt, wird im Alter von elf Jahren nach Steinhof gebracht. Dort gehen für die Kinder Phantasie und Wirklichkeit ineinander über. Der Anblick des Berges vor dem Fenster weckt bei ihnen die Hoffnung auf einen Schutzengel, der zur Rettung naht. Adrian Ziegler, der aus einem sozial und erbbiologisch "minderwertigen" Elternhaus stammt, wird im Alter von elf Jahren nach Steinhof gebracht. Dort gehen für die Kinder Phantasie und Wirklichkeit ineinander über. Der Anblick des Berges vor dem Fenster weckt bei ihnen die Hoffnung auf einen Schutzengel, der zur Rettung naht. Adrians Aufsässigkeit, einschließlich einer kurzzeitigen Flucht, lassen ihn sämtliche Stationen dieser Hölle des Nazi-Systems durchlaufen. Er kommt als Anschauungsobjekt in den Vorlesungssaal und schließlich auf die Krankenstation. Dort arbeitet Anna Katschenka, die den Umgang mit Kindern liebt. Doch Loyalität und Treue lassen sie fraglich erscheinende ärztliche Anweisungen strikt befolgen. Sie macht sich dadurch mitschuldig am Leiden und Tod zahlreicher Kinder. Steve Sem-Sandberg gelingt eine eindrucksvolle Schilderung des Lebens über mehr als sechs Jahrzehnte, wie es sich auch am finstersten Ort gestaltet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 807
Ähnliche
Steve Sem-Sandberg
Die Erwählten
Roman
Aus dem Schwedischen vonGisela Kosubek
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Wir danken dem Swedish Arts Council für die freundliche Förderung der Übersetzung.
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel
»De utvalda« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm
© 2014 by Steve Sem-Sandberg
Für die deutsche Ausgabe
© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlag: ANZINGER | WÜSCHNER | RASP, München
Unter Verwendung des Fotos eines Krankenzimmers aus der
NS-Jugendfürsorgeanstalt »Am Spiegelgrund«, © Dokumentationszentrum des österreichischen Widerstandes, Wien
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-93987-3
E-Book: ISBN 978-3-608-10830-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
IPflegekind
IIEin Seelendoktor braucht keine Augen
IIISpiegelgrund
IVDie Jungen und der Berg
VSchwarze Tasten, und weiße
VISchutzengel
VIIDer blutende Führer
VIIIGedanken über das Monströse
IXGulliver
XFlussfahrt
XIDie Blinden
XIIDie Mongolen fallen ein
XIIIGefangen
XIVEin anständiges Leben
XVDas Urteil
XVIÜberlebende
XVIITote ohne Namen
Schlusswort
Für See
decursus [lat.]:Lauf, Strom;[med.] Krankheitsverlauf
Man stellt allerorten Invaliden zur Arbeit an, man bemüht sich, die Arbeit für sie zuzurichten u. dgl., doch vergessen wir nicht, der Kampf ums Dasein ist nicht aufgebaut auf Mitleid und karitativer Tätigkeit, sondern ist ein Kampf, in welchem der Stärkere und Tüchtigere schon im Interesse der Erhaltung der Art siegen muss und siegen soll … Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass gerade durch den Umstand, dass infolge des Krieges so viele Untüchtige, also Minusvarianten, zur Reproduktion kommen, die Gefahr der Vermehrung dieser Minusvarianten für die nächste Generation noch größer ist als für die heutige, dass damit die nächste Generation noch mehr bemüht sein wird, diese Minusvarianten zu erhalten und zu stützen. So grausam es klingen mag, muss doch gesagt werden, dass die kontinuierlich immer mehr steigende Unterstützung dieser Minusvarianten menschenökonomisch unrichtig und rassenhygienisch falsch ist … Die Qualitätsverbesserung muss beim Kind anfangen. Können wir schon in der Reproduktion nicht qualitativ vorgehen, so sollen wir uns wenigstens bemühen, in der Aufzucht die Qualitäten zu fördern. Dazu gehört eine nach biologischen und sozialen Prinzipien geregelte Kinderfürsorge.
Julius Tandler: Krieg und Bevölkerung (1916)
Die Fürsorgeanstalt »Am Spiegelgrund« hat die Aufgabe, alle psychisch auffallenden Kinder und Jugendlichen vom Säuglingsalter bis zur Erreichung der Volljährigkeit nach genauester Beobachtung und Prüfung ihrer psychischen und physischen Kenntnisse und Fähigkeiten nach erfolgter Begutachtung in die für sie entsprechende Anstalt bzw. Pflegestelle einzuweisen. Außerdem sollen die hiebei gewonnenen Erfahrungen für spätere wissenschaftliche Arbeiten gesammelt werden.
Gegenwärtig führen wir 15 Gruppen mit je 30 Zöglingen und zwei Doppelgruppen mit je 60 Zöglingen. Dazu kommt noch eine eigene Säuglings- und Kleinkinderabteilung mit einem durchschnittlichen Belag von 50 Betten und zwei Gruppen mit je 30 psychopathischen Schulkindern. […]
Schon bei der Überstellung in unsere Anstalt […] werden von der zuweisenden Stelle, sei es wie bisher das Jugendamt oder ein Gesundheitsamt, eingehende Darlegungen des Überstellungsgrundes und eine genaue Familiengeschichte des Kindes verlangt, wobei besonderer Wert auf die Angaben aller erblichen Belastungen und Umweltschädigungen gelegt wird. Weiter wird auch, soweit es möglich ist, ein genauer Schulbericht eingeholt, um auch in dieser Hinsicht allfällige Erziehungsmängel oder sonstige Auffälligkeiten des Kindes genau erfassen zu können. […]
Gleich bei der Überstellung ist es Aufgabe des Anstaltsarztes, den status somaticus zu erstellen, Mängel in gesundheitlicher Hinsicht der entsprechenden Behandlung zuzuführen; falls eine solche schon stattgefunden hat, eine genaue Krankengeschichte einzuholen. Die Untersuchung erfolgt ganz besonders vom internistischen und neurologischen Gesichtspunkt aus. […] Weiters wird vom Anstaltsarzt bei gelegentlichen Vorsprachen der Eltern oder Angehörigen der Kinder oder nach erfolgter Vorladung mit diesen eine genaue Anamnese sowohl in erbbiologischer als auch in psychiatrischer und somatischer Hinsicht aufgenommen. Alle Zöglinge werden sofort, abgesehen davon, dass sie gemessen und gewogen werden, anthropologisch photographiert und ein kurzer anthropologischer Status aufgenommen. Späterhin, bis wir die hiezu nötigen Apparate und das erforderliche wissenschaftliche Hilfspersonal bekommen, soll dieser Status noch durch genaue anthropologische und phrenologische Messungen ergänzt und durch daktyloskopische Aufnahmen der Fuß- und Handleisten vervollständigt werden.
Nach erfolgter Eingewöhnung in das Leben in unserer Anstalt wird der Zögling einer psychologischen Prüfung unterzogen, die zum Teil auch noch als eine Art Intelligenzprüfung nach den gegenwärtig gebräuchlichen Methoden nur in wesentlichen Punkten besonders erweitert und ausgebaut ist, wobei es uns aber weniger auf die Erstellung eines Intelligenzquotienten (den wir wohl aus praktischen Gründen noch beibehalten haben) als vielmehr auf die Erfassung der Gesamtpersönlichkeit und auf eine Kontrolle des Funktionierens gewisser, für die Erziehung ausschlaggebender psychischer und physischer Fähigkeiten ankommt. In Zusammenhang mit der schriftlichen Ausarbeitung von sorgfältig ausgewählten Themen, welche im besonderen Maße geeignet sind, Einblick in das Seelenleben des Kindes oder Jugendlichen zu gewähren, und nicht selten wichtige Aufschlüsse über ihre charakterliche Entwicklung geben, gelangen wir auch in den Besitz vollkommen unbewusst erstellter Schriftproben, die sehr oft das Charakterbild des Zöglings auf das trefflichste vervollständigen. Diese psychologischen Prüfungen werden von eigens hiezu ausgewählten psychologisch geschulten und erfahrenen Fachkräften unter Leitung eines in pädagogischer Hinsicht erfahrenen Fachpsychologen durchgeführt. In gemeinsamen Besprechungen und ständig überprüfenden Kontrollen der Ergebnisse wird versucht, neue, für unsere besonderen Zwecke geeignete Methoden zu finden.
Hans Krenek: »Beitrag zur Methode der Erfassung von psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen«, aus: Archiv für Kinderheilkunde (1942)
Selbstverständlich ist es legitim, einer Geschichte der Strafen moralische Ideen oder juristische Strukturen zugrunde zu legen. Die Frage aber ist, ob man ihr auch eine Geschichte der Körper zugrunde legen kann, da die Strafen doch nur mehr auf die geheime Seele der Straffälligen abzielen wollen.
Michel Foucault: Überwachen und Strafen (1975)
I
Pflegekind
Die Anstalt Das erste Mal wurde er im Januar 1941 auf den Spiegelgrund gebracht, eines klaren kalten Wintermorgens, an dem das bleiche Licht über dem Boden vor Frost glitzerte. Adrian Ziegler sieht noch die kupfergrüne Kuppel der Anstaltskirche vor sich, die sich auf dem Berg oberhalb der Pavillons erhob, und dahinter den Himmel, so blau, wie kein Himmel in Wirklichkeit blau sein kann, nur auf einer Postkarte oder vielleicht auf einem Plakat. Der Wagen hielt direkt hinterm Tor bei den Direktions- und Verwaltungsgebäuden. Dort stand eine Schwester, die ihn als Erstes zum Direktor der Anstalt brachte, einem blassen, ernst blickenden älteren Herrn in dunklem Anzug, der sie in Empfang nahm und sämtliche Papiere unterschrieb. Dann ging es zu einem Pavillon links vom Haupteingang, wo ein Arzt wartete und eine andere Schwester Adrian zuschrie, er solle sich ausziehen und auf eine Waage stellen. Lange sollte Adrian behaupten, er hätte nicht die leiseste Ahnung, wer ihn am Spiegelgrund aufgenommen habe. Erst viel später, als er Einsicht in das Untersuchungsprotokoll erhielt und auf dem Dokument Name und Unterschrift von Doktor Heinrich Gross wiedererkannte, wurde ihm klar, dass es tatsächlich derselbe Mensch gewesen war, der ihn sein Leben lang verfolgen sollte, auch noch viele Jahre, nachdem er freigekommen war. Jetzt aber ist dieser Mann nur eine fremde, furchteinflößende Person im Arztkittel, die Adrian zwingt, den Mund möglichst weit aufzusperren, und dessen harte Finger seinen Schädel pressen und kneten und der sich dann seinen Nacken vornimmt und ihm Wirbel für Wirbel das Rückgrat hinunterfährt. Die Untersuchung dauert über eine Stunde, und Doktor Gross nimmt dabei Gegenstände zu Hilfe, die Adrian noch nie gesehen hat. So wird sein Schädel mit einem kreisrunden Instrument vermessen, das vorn in zwei Spitzen ausläuft. Er muss auf einem hohen Stuhl Platz nehmen, dessen Sitzfläche auf beiden Seiten mit Klappen festgestellt wird, und Doktor Gross lässt einen Gegenstand vor ihm herunter, um erst den Abstand zwischen seinen Augen, dann den zwischen Auge und Kinn zu messen. Anschließend streift sich Doktor Gross ein Paar Handschuhe über, betastet Adrians Testikel und drückt ihm den Finger in den Anus. Als die Untersuchung beendet ist, holt ihn die Schwester, die ihn in Empfang genommen hat, wieder ab. Es ist noch früh am Vormittag. Im Gang fällt das weiße Winterlicht auf das eintönige Rhombenmuster der Bodenfliesen, etwas, das er später oft vor sich sehen sollte: dieses seltsame Flimmern auf Wänden und Fußböden in Schlafsälen und Fluren, das ein eigenes Leben zu haben schien, ganz und gar unabhängig von den Kindern hier, wodurch es beständiger wirkte als sie. Die Schwester aber hat natürlich keine Geduld. Kommst du jetzt, oder willst du hier den ganzen Tag Maulaffen feilhalten? Sie gehen durch eine Tür an der Rückseite des Gebäudes nach draußen. Dort, zwischen hohen Bäumen, bekommt er nun die lange Reihe dicht nebeneinanderliegender Pavillons, die in den nächsten Jahren sein Zuhause sein sollten, das erste Mal zu Gesicht, sieht sie fahl und kompakt in dem langgestreckten frostweißen Bergschatten stehen. Die Pavillons sehen alle gleich aus mit ihren unregelmäßig unterbrochenen Klinkerfassaden und vergitterten Fenstern. Eine Anstaltsbahn scheint sie miteinander zu verbinden. Von weiter oben kommt eine kleine rotweiß gestrichene Lokomotive mit drei angehängten Waggons gefahren. Sie sieht aus wie eine Spielzeuglok. Pavillon Nummer 9, künftig sein Pavillon, liegt auf der linken Seite, zwei Reihen von der Mittelachse entfernt. Die Schwester zieht einen großen Schlüsselbund aus der Schürzentasche und wählt routiniert den passenden Schlüssel aus. Obgleich Vormittag ist, sind die Türen der Räume verschlossen. Falls es hinter den Türen andere Kinder gibt, so ist kein Laut von ihnen zu hören. Die Schwester führt ihn zu einem Schrank neben dem Waschraum, wo er ein Handtuch und ein Stück graubraune Anstaltsseife erhält. Nach dem Baden inspiziert sie seine Fingernägel und Ohren, dann bekommt er seine Kleidung zurück und ein Paar Filzpantoffeln als Hausschuhe. Auch eine kurze graue Wolljacke wird ihm ausgehändigt, doch darf er sie nicht überziehen, obwohl es im Gang lausig kalt ist. IV steht über der hohen weißen Tür des Saals, wohin ihn die Schwester jetzt bringt. Zuerst dachte er, die Kinder dort drinnen würden einfach nur dasitzen und den Atem anhalten. Später sollte er denken, dass sie bereits tot waren und nur seinetwegen so taten, als lebten sie. Damit er nicht gleich den Mut verlor.
Der Fluss Über die Jahre seines Heranwachsens sollte Adrian sagen, dass sie kaum zu seinen glücklichsten zählten, doch dass er immerhin auf sie zurückblicken könne, ohne sich zu schämen. Die Sommer verbrachte er für gewöhnlich mit seinem Lieblingsonkel, einem jüngeren Bruder seiner Mutter, die ihn Franz nannte, der eigentlich Ferenc hieß und draußen in Kaisermühlen wohnte. Alle Kinder in seiner Familie hießen Dobrosch, weil die Eltern damals nicht verheiratet waren. Dobrosch, sagte Ferenc, sei ein ungarischer Name, obgleich er kein bisschen ungarisch klang, und er erzählte, dass die gesamte Familie mütterlicherseits aus ein paar kleinen Dörfern in jenem Teil von Ungarn stamme, der jetzt zur Slowakei gehöre. Seine Mutter behauptete fest, dass es ein slowakischer Name sei, jedenfalls kein ungarischer, aber das spiele keine Rolle, denn er sei so gut wie jeder andere österreichische Name, weil in Österreich früher jeder Name so gut wie der andere war. Onkel Ferenc hatte keine Ausbildung, aber er war fleißig und rührig und lebte von verschiedenen Gelegenheitsarbeiten, die er eine Zeit lang mühelos auftreiben konnte. Im Sommer hütete er die Tiere der Kleingärtner, die damals oft Kühe oder Ziegen in der Anlage am Hubertusdamm hielten, dem alten Überschwemmungsgebiet zwischen Schutzdamm und Fluss. Adrian und sein jüngerer Bruder Helmut halfen ihm beim Füttern der Tiere, und zum Dank für die Mühe konnten sie eine Kanne frischer Milch mit heimnehmen. Bei den Tieren gab es Geborgenheit und Wärme. Wenn es regnete, standen sie stets eng beieinander, so als schliefen sie. Ferenc und er lagen rücklings auf der Erde, die voller Kot und übersät mit Resten von Gummireifen und Nägeln aus den Werkstätten an der Straße war. Wenn man hier barfuß umherrannte, musste man aufpassen, sich nichts einzutreten. Nach dem Regen war die Luft feucht, doch der Sommerhimmel war hoch und klar, und die Insektenwolken formten sich zu großen schwarzen Säulen über den schlammigen Pfützen. Ferenc trug Baskenmütze und Jackett, doch kein Hemd darunter, und seine behaarte sonnenverbrannte Brust war voller roter Insektenstiche. Die schlimmsten quetschte er mit den Fingernägeln aus und saugte sein eigenes Blut von den Fingerkuppen. Das tue überhaupt nicht weh, versicherte er. Er zeigte ihnen auch, dass man Grashalme kauen konnte, um den Hunger zu stillen. Dann lagen sie einfach nur da und blickten auf den Fluss hinaus. Der Fluss ist das Übel, sagte Ferenc. Früher einmal habe Kaisermühlen zum zweiten Bezirk gehört, und Bauern aus dem Umland seien hierhergekommen, um in den Wassermühlen am Fluss ihr Mehl zu mahlen. Dann aber habe der Kaiser verfügt, die alten Flussarme aufzustauen und zu regulieren und ein neues Flussbett querdurch zu graben, und so wären die Gebiete, die sich zuvor am linken Donauufer befanden, nun auf dem rechten hinter dem Fluss gelandet, von allem abgeschnitten. Der Volksmund nannte Kaisermühlen deshalb die Hungerinsel. Es kamen Leute her auf der Suche nach Arbeit, sie selbst kamen jedoch nie über den Fluss. Es sei wie beim Panamakanal, sagte Ferenc. Viele, die am Kanal mitgruben, ertranken. Adrian fragte Ferenc, ob er jemanden kenne, der ihn mitgegraben habe, und Ferenc antwortete, dass er dafür zu jung sei, doch auf seines Vaters Seite hätte es Verwandte gegeben, die dabei gewesen wären, meist jedoch hätte man ausländische Arbeiter genommen, eben weil es so gefährlich war. Die Leute starben an Typhus, oder der Fluss riss sie mit, und erst Monate oder gar Jahre später kamen sie wieder an die Oberfläche, ohne dass noch jemand wusste, wer sie waren oder wo sie herkamen. Adrian mochte den Fluss, besonders an klaren Tagen wie jenem nach dem Regen, wenn man frei in alle Richtungen schauen konnte. Der Kahlenberg war zu sehen und die Reichsbrücke und der Turm der Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläumskirche in der Leopoldstadt. Er mochte auch die gezügelte, aber unwiderstehliche Kraft in der Mitte des Stroms, mochte, wie sich das Licht von Fluss und Himmel von Stunde zu Stunde änderte, die Wassermassen im Morgengrauen noch schwer und vom Wind gekräuselt, um am Abend klar und still dazuliegen, so dass man meinte, auf ihnen wie auf einem Fußboden entlanglaufen zu können. Dann machten sie sich auf den Heimweg, Ferenc mit der Milchkanne vorneweg und er mit dem jüngeren Bruder hinterher. Helmut war zu der Zeit nicht älter als drei und musste kämpfen, um mit ihnen Schritt halten zu können. Er war klein und blauäugig und hatte glattes blondes Haar. Niemand, der ihn auch nur aus der Ferne sah, glaubte, dass er ein Kind Eugen Zieglers war, nicht einmal Ziegler selbst, der die Mutter beschuldigte, diesen Dobrosch mit jemand anderem gezeugt zu haben, obgleich Adrian, der Tag für Tag mit dem Bruder zusammen war, fand, er sei ganz der Vater: derselbe abwesende Blick und dasselbe einschmeichelnde Lächeln. Keiner von ihnen hatte Schuhe an den Füßen. Seine Mutter sagte, es wäre dumm, sie unnötig abzuwetzen.
Simmeringer Hauptstraße Adrian wuchs in Simmering auf. Nicht nur das, sollte er später sagen. Von der Zeit am Spiegelgrund abgesehen habe ich mein ganzes Leben in Simmering verbracht. Auch als man mich zu Pflegeeltern gab. Selbst im Gefängnis habe ich in Simmering gesessen. In Kaiserebersdorf. Er lachte, als er das sagte, doch wurde deutlich, dass er darin eher einen Fluch sah. Von manchen Orten kommt man einfach nicht los. Als Eugen Ziegler nach Simmering zog, hatten die Sozialdemokraten gerade mit ihren gewaltigen Bauprojekten begonnen, mit denen sie entschlossen waren, so stand es auf den Wahlplakaten, die Armut ein für alle Mal auszurotten, und die Simmeringer Hauptstraße war noch immer, was sie jahrhundertelang gewesen war: eine dicht befahrene Durchgangsstraße, die ein Netz kleiner Werkstätten, Läden und Schankwirtschaften miteinander verband. Das Haus, in dem die Familie wohnte, stammte aus dem vorigen Jahrhundert, und wie die meisten anderen größeren Häuser des Viertels wandte es der Straße eine »wohlanständige« Seite zu, während der Hof von schändlichem, minderwertigem Leben wimmelte. Das Gebäude hatte nur zwei Stockwerke, doch es war langgestreckt, hatte zwei separate Stiegenaufgänge und in der Mitte ein Tor, breit, aber auch wieder nicht so breit, sagte Adrian: In den beiden Eichenstämmen, die das Tor flankierten, saßen in Höhe der Ladeflächen tiefe Kerben, die anzeigten, wo Pferdefuhrwerke und Lastwagen bei der Einfahrt stecken geblieben waren. Im Nachbargebäude lag ein Wirtshaus, und der Gastwirt achtete stets darauf, dass die schweren Bierfässer auf dem Hof abgeladen wurden. Auch Kaufmann Streidl, der seinen Laden im Haus hatte, holte die Waren auf diesem Weg herein. Zu den Wohnungen gelangte man über schmale Laubengänge, die in beiden Stockwerken auf der Hofseite des Hauses entlangliefen. Die Familie Dobrosch-Ziegler wohnte im zweiten Stock ganz am Ende des rechten Laubengangs. Im Hof, hinten in der Ecke, wo sich unter einer hohen alten Kastanie die Latrinen befanden, gab es einen Anbau, der dem gesamten Haus als Waschküche diente. Tag für Tag, gleich zu welcher Jahreszeit oder wie die Witterung war, versammelten sich hier die Frauen des Hauses zum Waschen, oft mit einer Schar plärrender Kinder im Schlepptau. Eine von Adrians frühesten Erinnerungen ist, wie er an einem trüben Wintertag heimkommt und das große Zimmer voll feuchter Dämpfe steht und über dem Herd und draußen im Laubengang Wäsche zum Trocknen hängt, und Emilia und Magda heben die Kessel mit kochendem Wasser zu ihren schweißglänzenden Gesichtern empor und schreien mit schriller Stimme, er solle aus dem Weg gehen, um das heiße Wasser nicht abzubekommen. Emilia und Magda (Magdalena) waren die beiden jüngeren Schwestern seiner Mutter. Weil noch keine der Schwestern jemanden zum Heiraten gefunden hatte, ließ Adrians Vater sie gnädigerweise bei ihnen wohnen. Die Wohnung bestand eigentlich nur aus dieser Küche mit dem Herd und einem etwas größeren Zimmer dahinter, dessen eine Wand von Schimmel bedeckt war, und eigentlich war es unfassbar, dass hier so viele Menschen zusammen wohnten. In einem Alkoven in der Küche schlief noch der ältere Bruder der Mutter, Florian, der ein wenig »eigen« war, wie es zu jener Zeit hieß, und der sich nie zur Arbeitssuche aufraffen konnte, obgleich Adrians Mutter ihm ständig deswegen in den Ohren lag und Adrians Vater ebenfalls, wenn er mal daheim war, denn gelegentlich kam das vor, sagte Adrian, nicht dass er nach Hause kam – das zu tun, hätte er sich in jenen Jahren nie herabgelassen –, sondern dass er vorbeikam, wie er es nannte; und meist brachte er Schnaps mit, und zunächst war er spendabel und wollte jedem etwas ausgeben, doch dann wollte er es plötzlich nicht mehr und bekam heftige Wutanfälle, die sich fast immer gegen Mutters Schwestern und Brüder richteten, die er Parasiten und Ungeziefer nannte und die, wie er sagte, unerlaubt und noch dazu auf seine Kosten in der Wohnung lebten, was natürlich nicht stimmte, sagte Adrian, denn der einzige Bruder, der dort ständig wohnte, war Florian, und für ihn bezahlte Onkel Ferenc und legte, wenn möglich, noch etwas obendrauf, während der Vater trotz all der großen Geschäfte, die er angeblich am Laufen hatte, nie auch nur einen Heller dazugab. Onkel Florian gegenüber verhielt sich Eugen Ziegler besonders schlimm. Adrian erinnert sich an eine Szene, wie der Vater Florian bei seinem langen schwarzen Schopf packte und dessen Kopf gegen die Wand knallte wie einen Wurfhammer. Immer wieder: Es klang, als schlüge man mit der flachen Seite eines Beils auf einen Hackklotz: ein dumpfes Wummern. Onkel Florian aber leistete keinen Widerstand, die Augen verdrehten sich nur immer mehr zum Stirnbein hinauf. Es war eins der wenigen Male, dass Adrians Mutter zu protestieren wagte, sie sagte, wenn Eugen ihren Florian nicht in Ruhe lasse, werde sie ihn verlassen und zwar ein für alle Mal. Das ließ sich leicht sagen, was aber sollte mit all den anderen geschehen, wenn sie, Leonie, Eugen verließ? Sie waren schließlich allesamt von ihr abhängig: die Brüder und Schwestern und die immer größere Anzahl Kinder. Also wischte sie die Blutflecken vom Boden auf, verstaute die leeren Gläser im Abwaschtisch, und während Onkel Florian das Bein des Küchentisches, den Eugen zertrümmert hatte, wieder anleimte (auf einfache, praktische Dinge verstand Onkel Florian sich; alle ihm gegebene Geistesgegenwart saß in seinen Fingern), setzte seine Mutter die Baskenmütze auf, schloss die Knöpfe ihres braunen Baumwollmantels, den sie bei jedem Wetter trug, und nahm die 71, die Straßenbahn zum Schwarzenbergplatz, um den ganzen Tag mit Fußbodenscheuern und Teppichklopfen bei reichen Familien in Wieden, Josefstadt oder wo auch immer zu verbringen, zuweilen sogar in Salmannsdorf draußen in Döbling, und damals konnte sie sich nicht einmal die Straßenbahn dorthin leisten und musste den langen Weg zu Fuß zurücklegen. Was Leonie Dobrosch mit Putzen verdiente, reichte gerade für die Miete, oft brachte sie also Essensreste heim, die sie hatte erbitten können, Brot vom Vortag, auch Kartoffeln oder Knödel, die sich aufbraten ließen; Dinge, die am Tisch der reichen Familien übrig blieben; und weil zu Hause, sobald sie nicht da war, alles sofort verlotterte, musste sie nach der Heimkehr wiederum aufräumen und putzen, bevor sie mit dem Kochen beginnen konnte. Nur einen Tag in der Woche hatte sie für sich, das war der Sonntag. Da warf sie alle aus der Wohnung, ließ sich mit einem Wassereimer auf alle Viere nieder, scheuerte die Böden und legte Zeitungspapier aus, und hinterher durfte niemand herein, wehe dem, der sich auch nur in der Tür zeigte; sie saß dann am Küchentisch, allein oder mit Onkel Florian (er durfte als Einziger in der Wohnung bleiben), saß einfach nur da: ohne etwas zu sagen oder zu tun. Es gab keinen Platz, wo sich die Kinder aufhalten konnten, und wo immer sie sich befanden, wurden sie früher oder später verjagt. So sammelten sie sich zu einer Horde Rangen jeden Alters und taten nichts anderes, als von einem Ort zum anderen zu ziehen, um etwas Essbares zu erbetteln oder Dinge, die sich zu Geld machen ließen, und meist stahlen sie auch, oft aus den Gemüsekisten, die die Viktualienhändler auf dem Gehsteig stehen hatten. Adrian gehörte dieser Horde bereits mit drei oder vier Jahren an, seine Tanten hatten selten Zeit für ihn. Die Kinder streiften bei den alten Spitalbaracken in Hasenleiten herum oder unten am Donaukanal, der im Sommer unter dem Laub der Baumkronen ein Wunder an kühler Stille war, oder auf dem Gelände mit den großen Gasometern: den braunen Ziegelbauten, die seine früheste Kindheit gleich einem gewaltigen Monument überragten. Als sie in der Simmeringer Hauptstraße wohnten, war er oft der Jüngste der Herumtreiber, und nicht selten verlor er die anderen. Einer Geschichte zufolge, die oft in der Familie erzählt wurde (seine Schwester Laura erzählte sie), soll er einmal, mit vier Jahren, bewusstlos vor der Sankt-Laurenz-Kirche gelegen haben. Es war mitten im Winter, und es dauerte eine Weile, bis er entdeckt wurde: ein schneebedecktes Bündel am Fuß der Treppe. Der Kirchendiener hatte ihn gefunden, und da niemand wusste, wer er war, und man niemanden fragen konnte, erbarmte sich die Haushälterin des Gemeindepfarrers, nahm ihn mit heim, setzte ihn in die Wanne, gab ihm zu essen und ein Bett zum Schlafen. Es war das erste Mal, dass er ein Bett ganz für sich allein hatte und nicht am Fußende der Tantenbetten oder zusammen mit Helmut und Laura schlafen musste. Drei Tage durfte er bei der Haushälterin bleiben, bis seine Mutter voller Scham und Furcht erschien, um ihn abzuholen. Doch war die Mutter nicht beschämt, weil er beim Gemeindepfarrer gelandet war, der Grund war vielmehr, dass sie sehr wohl gewusst hatte, wo er sich befand, denn natürlich hatten die anderen Kinder sofort alles erzählt, sie aber hatte die Polizei nicht einschalten wollen (wie die meisten Menschen in ihrer Lage empfand Leonie Dobrosch eine ausgeprägte Furcht vor allem, was mit Behörden zu tun hatte), und da es nun schon so unglücklich gelaufen war, dachte sie, konnte ihr Sohn ebenso gut noch eine Weile dort bleiben und sich ein bisschen aufpäppeln lassen. Und Adrian Ziegler dachte viele Jahre später: dass die Mutter ihn gewissermaßen schon damals weggegeben hatte. Und wie leicht ihr das trotz allem gefallen war, denn hinterher konnte man immer sagen, wie es seine Mutter bestimmt schon damals, als er bei der Haushälterin des Pfarrers gelandet war, gesagt hatte, dass es allein seinetwegen geschah und vielleicht das Beste war, was ihm hatte passieren können. Auch noch viel später, als er am Spiegelgrund lag, sollte er Albträume von dieser Haushälterin haben, von ihrem Mund mit den harten schmalen Lippen und von ihren stechenden Augen, deren leuchtend blaue Iris alles aufzusaugen schien, doch nie etwas zurückgab. Eines Tages hatte sie ihn mit diesem blauen Blick streng angesehen und gefragt, ob er wisse, wer im Himmel wohne und wie dessen Sohn heiße, und als er darauf nichts zu antworten wusste, hatte sie nur hochmütig gelächelt, sich von ihm abgewandt und nichts mehr gesagt. Daheim sprachen sie weder über den Himmel noch über die Erde. Sie sprachen kaum über Dinge, die nichts mit dem zu tun hatten, was man gerade in Händen hielt. Ferenc war der Einzige, der lange Ergüsse über alles Mögliche von sich gab, was ihm seine Geschwister oft zum Vorwurf machten. Wenn die Psychologen, denen Adrian am Spiegelgrund begegnete, ihn fragten, was er über die Herkunft seines Vaters und seiner Mutter wusste, natürlich nur, um die Art des Blutes zu bestimmen, das in seinen Adern floss, so konnte er auch darauf keine Antwort geben. Wenn es etwas gab, worüber man bei ihm zu Hause nicht sprach, dann waren es Dinge von früher, weil sie erwiesenermaßen nur Unglück brachten. Dass seine Mutter viele Jahre als Näherin in einer Fabrik in Vorarlberg gearbeitet hatte, bevor sie nach Wien gezogen war und Kinder von diesem Ziegler bekommen hatte, erfuhr er erst viel später am Spiegelgrund, und das auch nur rein zufällig, als einer von denen, die ihn bestrafen sollten, laut aus der Patientenakte vorlas; und wer oder vielleicht was dieser Eugen Ziegler eigentlich war, also, was er im erbbiologischen Sinne war, sollte er erst begreifen, nachdem er vier Jahre in einer Pflegefamilie verbracht hatte und danach von den Pflegeeltern zurückgewiesen worden und in der Erziehungsanstalt von Mödling gelandet war und das Personal dort sagte, dass nie etwas aus ihm werden würde, weil in den Adern seines Vaters Zigeunerblut fließe. Doch dann geschah etwas. Eines Morgens wurde er ins Büro des Direktors gerufen, und der Direktor sagte, ich habe eine Überraschung für dich, und öffnete die Tür zu einem Nebenzimmer, von der Adrian geglaubt hatte, sie führe in eine Kammer oder einen Verschlag, und wer kam dort heraus wie das Kaninchen aus dem Hut, sein Zigeunerkönig von Vater, der mit breitestem Lächeln sagte, jetzt lassen wir alles hinter uns, was gewesen ist. Das war im Oktober 1939. Er hatte seinen Vater mehr als vier Jahre nicht gesehen und davor allenfalls wenige Male im Halbjahr. Nun war er zehn Jahre alt, und der Anstaltsdirektor sagte, er dürfe mit seinem Vater nach Hause gehen. Man erwartete, dass er glücklich war. Tatsächlich hatte er noch nie im Leben so viel Angst gehabt.
Porträt eines Vaters Eugen Ziegler war sehr auf sein Aussehen bedacht. Bevor er zu Bett ging, rieb er sein kräftiges schwarzes Haar mit Nussöl ein und zog einen Damenstrumpf darüber, damit es in Form blieb, und die Nächte, die er daheim schlief, legte Adrians Mutter immer ein Handtuch aufs Kopfkissen, um die Bettwäsche zu schonen. Zur Schlafenszeit ein Handtuch auf dem Kopfkissen hieß also, der Vater war auf dem Heimweg. Adrian erinnert sich, wie er morgens, gespannt vor Erwartung, aufstand, das Handtuch auf der Bettseite des Vaters meist jedoch unberührt dalag, und die Enttäuschung immer wieder groß war, weil der Vater stets großzügig versprochen hatte, beim nächsten Heimkommen etwas mitzubringen. Vielleicht ein Spielzeugauto, eine Metallkugel, eine Sammlung farbiger Flaschenetiketten, die der Vater ihm einmal gezeigt hatte, mit dem Versprechen, beim nächsten Mal genau so eine allein für Adrian dabei zu haben. Beim nächsten Mal und beim nächsten und wieder beim nächsten Mal. Obwohl es genauso schrecklich war, wenn der Vater tatsächlich kam, oft so tief in der Nacht, dass Adrian die Tür nie schlagen und krachen hörte. Am Morgen lag seine Mutter auf der Seite, halb auf dem Körper des Vaters, so als hätte sie ihn in der Nacht niederzuringen versucht oder als wäre etwas in ihr kaputtgegangen, weshalb es ihr nicht möglich war, sich aus eigener Kraft zurückzurollen. All seiner Dreistigkeit und Großmäuligkeit zum Trotz war Eugen Ziegler ungewöhnlich schweigsam, wenn es um seine eigene Person und die Familie auf seiner Seite ging. Zu Adrian sagte er, er heiße Ziegler, weil er der Nachfahre eines der Tschechen sei, die zu Tausenden nach Wien gekommen waren, um Arbeit in den Ziegeleien zu suchen und, wie er es ausdrückte, ohne deren Plackerei in dieser Stadt kein einziges Haus gebaut worden wäre. Ziegler habe er heißen dürfen, weil genau das die Tätigkeit der Tschechen gewesen sei, Ziegel schlagen und brennen. Doch wie Adrian ziemlich bald begriff, war diese Geschichte glatt erfunden. Ein andermal erzählte der Vater, dass er als Bahnarbeiter auf einem Bahnhof irgendwo im Osten der Slowakei beschäftigt gewesen und durch Zufall auf einen Zug geraten war, der ihn nach Donezk in die Ukraine brachte, wo er mehrere Jahre in einem Bergwerk arbeitete. Das sei direkt nach der Revolution gewesen, als Tausende Freiwillige nach Russland gekommen waren, weil sie sich für Lenin und den Aufstand der Massen begeistert hatten. In meinem Herzen bin ich immer Kommunist gewesen, sagte Eugen Ziegler und schlug sich an die Brust. Das aber war nichts anderes als eine pompöse Geste. Eugen Ziegler hatte kein Herz, glaubte indessen, er könnte ohne eines auskommen oder es zumindest durch seine fesche Erscheinung ersetzen. Ein Mannsbild, nach dem sich die Frauen den Hals verrenken, sagte Tante Magda. Frauen einer gewissen Sorte, präzisierte Tante Emilia. Als Adrian fragte, ob seine Mutter auch eine Frau von einer gewissen Sorte wäre, erwiderte Tante Emilia, dass Eugen zu der Zeit anders gewesen sei. Doch als Adrian fragte, wie er damals, also zu dieser Zeit gewesen sei, wurde alles von neuem diffus, weil man über das Gewesene nicht reden solle. Eugen Ziegler aber konnte erwiesenermaßen Russisch. Was dafür sprach, dass an der Geschichte von der Flucht nach Donezk zumindest ein Körnchen Wahrheit war. Übrigens hätte genau diese Sprachkenntnis sie beide eines Tages fast das Leben gekostet. Es war im Herbst 1939, nur wenige Wochen, nachdem der Vater ihn aus Mödling heimgeholt hatte und ein neues Leben beginnen sollte. Damals wohnten sie im dritten Bezirk in der Erdbergstraße, nur ein paar Häuserblocks vom Rochusmarkt entfernt, und tagtäglich ging der Vater aus dem Haus, um im Wirtshaus Geschäfte zu machen, und Abend für Abend bekam Adrian als ältester Sohn der Familie den Auftrag, ihn wieder heimzuholen. Wien aber war nicht mehr das, was es einmal gewesen war, wie der oft sternhagelvolle Vater auf dem langen, schlingernden Heimweg zu sagen pflegte; die Straßen waren voll mit Piefkes, Verrätern und Nazischweinen, sagte er, und am Rochusmarkt standen zwei von ihnen in Wehrmachtsuniform, und noch bevor Adrian reagieren konnte, hatte der Vater sich schwankend vor ihnen aufgebaut, und aus seinem Mund ergoss sich ein für die beiden Soldaten vermutlich völlig unverständliches Kauderwelsch aus russischen Schimpfwörtern und Obszönitäten. Doch dass der Vater Russisch sprach, begriffen sie. Spitzel, zischte der eine dem anderen zu und riss sich das Gewehr vom Rücken. Adrian packte den Vater bei den Schultern und konnte ihn hinter eine der noch aufgebauten Marktbuden ziehen. Dort duckten sie sich eng aneinander, während die beiden Soldaten mit knallenden Stiefelabsätzen und gegen das Koppel schlagenden Gewehren vorüberrannten, und der Vater strich sich mit der Hand durchs Haar, drehte ihm sein nach Schnaps stinkendes Gesicht zu und fauchte:
Wenn du dich jemals mit diesen Nazischweinen einlässt, schlag ich dich tot, ist das klar?
Es dauerte sechs lange Jahre, bis die Nazis aus Wien vertrieben wurden, doch als es dann endlich geschah, ging auch Eugen Ziegler, so unwahrscheinlich das klingen mochte, einem neuen Frühling entgegen. Zuvor hatte er seine Geschäfte mehr in improvisierter Form betreiben müssen. Für Eugen Ziegler war das Geschäftemachen stets ungeheuer wichtig. Kein Tag verging, ohne dass er sich ihm nicht widmete, und Adrian konnte sich nicht entsinnen, ihn jemals über etwas anderes reden gehört zu haben. Viel später sollte sich Adrian in vielem selbst wiedererkennen. Mein Vater, sagte er, ertrug nichts, das abgeschlossen, festgelegt oder entschieden war. Er konnte nur im noch Andauernden, in der Aussicht leben. Wenn das Geschäft erst getätigt war und er mit so und so viel Tonnen Koks oder Kubikmetern Holz dastand, wusste er nicht, was er mit dem erworbenen Posten anfangen, ja nicht einmal, wie er ihn transportieren sollte. Wenn er zu uns nach Hause kam, dann nicht, um mich oder Helmut, ja nicht einmal um Mama zu sehen, das gab er nur vor, sondern weil er meinen Onkel Ferenc überreden wollte, ihm finanziell unter die Arme zu greifen, damit er die erworbenen Briketts rechtzeitig liefern oder die Raten für dieses oder jenes bezahlen konnte, und die regelmäßigen Streitigkeiten zwischen meiner Mutter und ihm hatten immer Onkel Florian oder Ferenc zum Anlass, weil Mama nicht wollte, dass ihre Brüder sich auch nur an einem einzigen von Eugens Geschäften beteiligten. Du weißt nicht, was du tust, sagte sie zu Eugen. Weil Leonie stets dazwischenging, bekam sie auch die Schläge ab. Wenn Eugen Ziegler seine Frau misshandelte, ging er mit System vor. Zunächst wurde jedermann aus der Wohnung gewiesen, erst die Tanten und Kinder, danach Onkel Ferenc (falls er zufällig anwesend war) und Florian, Letzterer besonders, weil Florian empfindsam war und ebenfalls etwas abbekommen konnte, und dann standen alle unten im Hof und sahen, wie er die schreiende Mutter von Wand zu Wand schleifte. Das konnte zwanzig Minuten dauern oder auch mehr als eine Stunde, mit kurzen oder längeren Pausen, in denen alles vorüber zu sein schien, dann aber hörte man erneut einen fürchterlichen Schrei, und alles fing von vorn an. Wenn der Vater nicht wutentbrannt davonstürmte, war er zu betrunken und saß nur erschöpft in einer Ecke, während die Mutter sich humpelnd ans Aufsammeln und Wegräumen machte, so wie immer. Eines Tages ließ sich der Vater aus der Gastwirtschaft unten an der Straße ein Schnitzel und ein Bier kommen. Das Prügeln musste ihn hungrig gemacht haben. Wortlos legte die Mutter ein weißes Tischtuch auf, und alle standen um den Vater herum und sahen ihm beim Essen zu. So methodisch, wie er schlug, aß er auch, doch merkte man an der Art, wie er Gabel und Glas an die Lippen führte, dass er sternhagelvoll war. Als er ging, leerte er die Kaffeedose, in der die Mutter und Ferenc das Geld für die Miete aufbewahrten, und verließ die Wohnung ohne ein Wort. Ich weiß, dass es nicht Ihre Schuld ist, Frau Dobrosch, pflegte der Hauswirt, Herr Schubach, zu sagen, wenn sich die Mutter am nächsten Morgen demütig lächelnd bei ihm einfand und um einen Zahlungsaufschub bat, es ist dieser Ziegler, der keinerlei Anstand besitzt, aber so kann es nicht weitergehen.
Pflegefamilie Schließlich setzte man sie auf die Straße. Es war im Mai 1935. Er erinnert sich, dass es an dem Tag in Strömen regnete und Ferenc und Florian die wenigen Möbel, die sie noch besaßen, auf den Hof trugen. Das Bett seiner Mutter und das Bett, in dem alle Kinder der Reihe nach geschlafen hatten, den mehrmals zertrümmerten und von Florian wieder geleimten Esstisch, die Stühle und den Schrank mit den Kleidern der Mutter. Lauras, Helmuts und seine Sachen hatte die Mutter in einen großen Koffer gepackt. Sie hatten nichts zum Abdecken der Möbel, und es regnete so stark, dass die Tropfen mehrere Zentimeter hoch von den Holzflächen abprallten. Das hat Adrian noch immer vor Augen. Und dass sich alle Nachbarn ringsum in den Laubengängen versammelt hatten. Buben, mit denen Helmut und er durch die Straßen gezogen waren. Jetzt standen sie nur schweigend da und glotzten. Und ihre Väter neben ihnen im Unterhemd, lässig ans Geländer gelehnt, zwischen den Fingern dünne Zigaretten. Sie warteten darauf, dass Eugen mit dem Lastwagen erschien, den er angeblich bestellt hatte, Eugen aber kam nicht, auch das Auto nicht, und am Ende reichte es seiner Mutter, unter den Blicken all der Leute dazustehen, sie nahm ihre Kinder und ging. Laura durfte bei Tante Emilia wohnen, der es gelungen war, sich ein kleines Mietzimmer in der Taborstraße zu beschaffen. Mit Helmut und ihm ging die Mutter zum Zentralkinderheim in der Lustkandlgasse. Später erzählte sie ihm, dass sie auf dem Weg dorthin fast ohnmächtig geworden war. Sie hatte sich auf den Bordstein gesetzt, direkt vor dem Eingang zum Franz-Josephs-Bahnhof. Ein Mann war gekommen und hatte gesagt, geht es Ihnen nicht gut, und dann war er ein Glas Wasser aus einer Wirtschaft holen gegangen. Das war das einzige bisschen Freundlichkeit, das mir in dieser ganzen Zeit erwiesen wurde, hatte seine Mutter gesagt. Er selbst erinnert sich nicht daran. Obgleich sie fast den ganzen Sommer im Kinderheim verbrachten, hat er nur sehr wenige Erinnerungen an die Zeit in der Lustkandlgasse. Er weiß noch, dass er ständig in der Nähe seines Bruders geblieben ist, auf dem Spielplatz und wenn das Essen ausgegeben wurde. Sein kleiner Bruder war jedermanns Liebling, weil er blond und fröhlich war. Ein hübsches Kind. Die Kinderschwestern achteten darauf, dass sie sich gründlich wuschen, und eines Tages bekamen sie beim Kämmen und Anziehen Hilfe und mussten anschließend in einen großen Raum gehen, dessen Wände schwarz-weiß gefliest waren. Entlang der Wände standen hohe Bänke, und auf den Bänken standen Kinder. Er wurde aufgefordert, sich auf eine zu stellen, Helmut ordentlich an der Hand zu halten und dann brav zu warten, bis er an der Reihe war. Plötzlich war der Raum voller fremder Menschen. Er hatte so große Angst, dass ihm seine Beine wie aus Gelee vorkamen, und er dachte nur daran, sich bloß nicht in die Hosen zu machen, jetzt, wo so viele feine Leute hier waren. Die Erwachsenen bewegten sich langsam an den Bankreihen entlang und nahmen die Kinder in Augenschein. Eine Dame, die vor Helmut und ihm stehenblieb, trug ein rotes Kleid mit weißem Spitzenkragen. Die Frau musterte Helmut von oben bis unten und drehte sich dann zu der Kinderschwester um:
Und die rote Dame Den da nehme ich, er scheint lieb zu sein
Und die Kinderschwester In dem Fall müssen Sie aber den Großen auch nehmen, das ist sein Bruder; entweder Sie nehmen beide oder keinen
Und die rote Dame Nein, den da will ich nicht haben, er ist so schiach
Und die Kinderschwester Tut mir leid, aber Geschwister trennen wir nicht
Und die rote Dame Wenn es nicht anders geht, werde ich den Schiachen wohl auch nehmen müssen
Und so geschah es. Er saß zusammen mit Helmut und der roten Dame in der Linie 71. Es war August, er genoss den warmen Wind, der durch die halbgeöffneten Fenster in den Wagen wehte, und zunächst verstand er nicht, warum ihm auf einmal alles so bekannt vorkam. Dann begriff er: Die Straßenbahn fuhr die Simmeringer Hauptstraße hinaus. Er war buchstäblich zurück in Mamas Straße. Flüchtig meinte er auch Herrn Gabler, den Gemüsehändler, zu erblicken, der in seiner grauen Arbeitsschürze vor dem Laden stand und die Obstkisten bewachte, die er allmorgendlich auf den Gehsteig hinausstellte. Frau Haidinger, wie die Frau im roten Kleid hieß, saß auf dem Sitz ihm gegenüber, und als sie merkte, dass er den Kopf drehte, beugte sie sich vor und drehte ihn wieder zurück. Dann ließ sie ihn keine Sekunde mehr aus den Augen, so als befürchtete sie, er würde an der nächsten Haltestelle türmen oder weit schlimmer: sich auf sie werfen, um sie zu erwürgen. Aus der Nähe sah Frau Haidinger nicht mehr so überwältigend aus wie in dem gefliesten Raum. Die Beine, die unter dem roten Kleid hervorragten, waren breit und knochig, und wenn sie lächelte, war ihr Mund voller kurzer weißer Zähne, die Adrian an ein Krokodil erinnerten. Seinem Bruder gegenüber verhielt sie sich ganz anders. Sie befummelte ihn unaufhörlich, strich ihm übers blonde Haar, und als sie ausstiegen, um am Zentralfriedhof die Straßenbahn zu wechseln, ging sie in einen Laden vor dem Friedhofseingang und kaufte ihm für zehn Groschen Bensdorp-Schokolade. Er selbst bekam natürlich nichts, weil er so schiach war. In Kaiserebersdorf angekommen, waren es von der Haltestelle nur zehn Minuten bis zu Haidingers Haus, wenn man die Abkürzung über offene Felder und Brachen nahm. Jenseits der Felder ragten die Schlote von Schwechat in gezackter Linie in den Himmel, und wenn der Wind aus dieser Richtung blies, roch man deutlich den schweren Malzgeruch der dortigen Brauereien. Frau Haidinger wohnte in einem großen ebenerdigen Haus, das für zwei Familien errichtet worden war. Zur Linken wohnte Frau Haidinger mit ihrem Mann und ihren Eltern, rechts wohnte ihr Bruder Rudolf Pawlitschek mit seiner Familie. Die beiden Familien waren zerstritten, und der Umstand, dass Frau Haidinger zwei Pflegekinder anschleppte, konnte die Stimmung kaum verbessern. Herr Pawlitschek war ein Krüppel. Wo sein linker Arm hätte anfangen müssen, direkt unterhalb der Schulter, saß nur ein kleiner Hautlappen. Vielleicht lag es daran, dass er, wie Frau Haidinger die Sache bezeichnete, unbrauchbar war, dass er mit so viel Zorn und Bitterkeit reagierte. Die Kinder nannte er Pinscher, und er tat alles in seiner Macht Stehende, um sie zu erniedrigen und zu demütigen. Vom ersten Tag bei der Familie Haidinger an wurde Adrian mit Arbeit eingedeckt. Hinter dem Haus lag ein großer Garten mit einem Stall voller Kühe, Ziegen, Hühner und Kaninchen. Adrian hatte die Aufgabe, Futter für die Kaninchen zu sammeln, den Kot aus Hühner- und Kaninchenkäfigen zu kratzen und sie anschließend mit Soda sauber zu schrubben; wenn die Ziegen eine Stelle abgegrast hatten, sollten sie neu angepflockt werden, und wenn Herr Haidinger im Gemüsegarten stand, musste Adrian einen Eimer Wasser nach dem anderen aus dem Brunnen hieven und mit der Schubkarre zu Herrn Haidinger fahren, der Salat, Zwiebeln, Erdbeeren und Tomaten damit goss. Lohn für die Mühe erhielt er nie. Zu seinem Bruder hatte er nur wenig Kontakt, obgleich sie im selben Zimmer schliefen. Während Adrian arbeitete, durfte Helmut Frau Haidinger auf ihren Besuchen bei Verwandten und Freunden begleiten, und wenn er heimkam, hatte er neue Spielsachen oder Schokolade aus dem Konsum bei sich. Später sollte Adrian begreifen, dass die Stadt Wien viel Geld für Pflegekinder bezahlte, die ein richtiges Zuhause gefunden hatten, so viel, dass der Betrag nicht nur Nahrung und Unterkunft für das Kind deckte, sondern Frau Haidinger obendrein in die Lage versetzte, Helmut neue Kleidung zu kaufen, weil er »so rasch wuchs«, und ja, vielleicht auch für sich selbst. Diese Tatsache brachte Adrian noch Jahre später in Rage. Wenn so viel Geld zum Weggeben da war, hatte er seine Mutter gefragt, warum hast dann du das Geld nicht bekommen, so dass wir weiter daheim hätten wohnen bleiben können? Seine Mutter aber hatte nur die Schultern in Richtung Kinn gezogen, auf diese hilflos-kindliche Weise, die sie sich zugelegt hatte, und erwidert, das wisse sie auch nicht. Vielleicht seien die Behörden ja der Meinung gewesen, dass man bei der Kindererziehung nur eine Chance im Leben erhalte, und die hätte sie damals verspielt, als sie all ihre Habseligkeiten auf den Hof haben hinuntertragen müssen und Herr Schubach sie einfach im Regen stehen ließ, während die Nachbarn rauchend von oben zusahen.
März 1938 Bei der Familie Haidinger lief ständig das Radio. Wenn es nicht lief, lag es daran, dass die Batterien leer waren, und dann musste er sie zum Aufladen zu einem Elektriker nach Schwechat bringen. Die Batterien waren schwer. Und es waren immer mindestens zwei: die leere, die er nach Schwechat schleppte, und die zwischenzeitlich aufgeladene, die er wieder mit nach Hause nahm. Die einzige Gelegenheit, bei der die Familien Haidinger und Pawlitschek Frieden hielten, war, wenn sie um das Radio versammelt saßen. Sie lauschten den Reden von Bundeskanzler Schuschnigg und allerhand Debatten rund um den Verrat an Österreich und den Heimwehrverband in der Steiermark, der nicht bereit war, gegen seine deutschen Brüder Partei zu ergreifen. Am Tag von Hitlers Einmarsch fuhren sie zum Heldenplatz, Herr Haidinger, ein Nachbar, der Herr Christian genannt wurde und der Vaterländischen Front angehörte, sowie der alte Herr Pawlitschek, also der Vater von dem mit dem Armstummel. Der alte Herr Pawlitschek war ein hochgewachsener Mann mit borstigem Schnurrbart und kurzgeschorenem Haar und bezüglich seiner Einstellung das, was Frau Haidinger einen überzeugten Nazi nannte. So als gäbe es unter den Nazis auch welche, die nicht ganz überzeugt waren. Adrian durfte mit, weil sie jemanden brauchten, der den Proviant trug. Sie fuhren mit der Straßenbahn zum Schwarzenbergplatz und gingen dann die Ringstraße hinauf, vorbei am Hotel Imperial, von dem der alte Herr Pawlitschek behauptete, Hitler und sein Gefolge wohnten dort, anschließend an der Oper vorbei, wo er sagte, darin scharwenzelten bloß Juden herum. Der ganze breite Boulevard war gedrängt voll mit Leuten, die Fahnen und Taschentücher schwenkten und tosend Heil, Heil, Heil schrien. Als sie sich dem Heldenplatz näherten, mussten sie auf die Museumsseite der Straße wechseln, weil man vor lauter Gedränge nicht mehr vorankam, und als sie die Straßenbahnschienen endlich wieder überqueren konnten, waren sie von neuem so weit abgedrängt worden, dass Hitler nur noch als kleiner grauer Fleck auf dem fernen Balkon zu sehen war. Aber gesehen habe ich ihn, versicherte Adrian hinterher. Was heißt gesehen. In erster Linie musste es die Stimme des Führers gewesen sein, die ihn überwältigt hatte, als sie hoch über den Köpfen der Menge aus den Lautsprechern schallte, die Worte seiner Rede aber ließen sich kaum verstehen, da der Ton mal hierhin, mal dahin sprang und die ganze Zeit im Lärm Zehntausender Menschen unterging, die sich rundum versammelt hatten, johlten und schrien, Hakenkreuzfahnen schwenkten und wie er den Arm in die Luft streckten; und Adrian konnte nur noch daran denken, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen, damit er sich rasch ducken oder ausweichen konnte, wenn er niedergetrampelt zu werden drohte. Wenige Wochen darauf war ihr Klassenlehrer in der Schule am Münnichplatz ersetzt worden. Der neue Lehrer hieß Magister Bergen und war, nach allem was man wusste, überzeugter Nazi, vielleicht sogar Parteimitglied. Mit ihm bekam Adrian sofort Probleme. Es gab da ein Gedicht von Ottokar Kernstock, das mit besonders feierlicher Betonung am Ende jeder Zeile vorgetragen werden sollte, und Herr Bergen stand am Katheder und tönte, und dann mussten alle Schüler ihm nachsprechen.
Das Hakenkreuz im weißen Feld
Auf feuerrotem Grunde
Gibt frei und offen aller Welt
Die frohgemute Kunde
Wer sich um dieses Zeichen schart
Ist deutsch mit Seele, Sinn und Art
Und nicht bloß mit dem Munde.
Immer wieder wurde Adrian nach vorn ans Katheder gerufen, musste das Gedicht aufsagen und verhaspelte sich ständig. Zudem musste an der Art, wie er einige der Verse vortrug, irgendetwas gewesen sein, vielleicht geriet ihm die Zeile Wer sich um dieses Zeichen schart unfreiwillig komisch. Jedes Mal, wenn er an diese Stelle kam, bog sich die Klasse vor Lachen, und Magister Bergens Gesicht wurde rot wie die Nazifahne. Einige Tage später machte der Klassenlehrer einen Hausbesuch bei Herrn und Frau Haidinger und erklärte, dieses Bastardkind, das sie aufgenommen haben, sei derart dumm, dass man ihm unmöglich etwas beibringen könne. Magister Bergen sagte auch, es sei falsch von der Familie gewesen, diesen Buben zu nehmen. Der Lehrer musste gewusst oder von jemandem erfahren haben, wie sich die Sache zugetragen hatte. Er sagte auch, das würde Folgen für sie haben. Hinterher sorgte Herr Haidinger dafür, dass es für Adrian Folgen hatte. Das tat er auf die denkbar einfachste Weise, er befahl ihm, das Hemd auszuziehen und dann mit in den Schuppen zu kommen, wo sich neben den Werkzeugen auch die Kaninchenställe befanden, und wie bei einem Kaninchen, dem man das Fell abziehen will, band er Adrians Hände mit einem Strick zusammen und hängte ihn an einen Haken an der Wand; dann nahm Herr Haidinger den Gürtel ab und prügelte auf ihn ein, bis nicht nur Adrian, sondern auch er selbst schrie, beide wie wahnsinnig. Es drang Licht in den Schuppen, und in der Türöffnung sah Adrian Helmut stehen, der an etwas herumkaute, das ihm Frau Haidinger gegeben hatte, während er auf dieselbe ängstlich unterwürfige Weise lächelte wie der Vater, wenn ihm bange war.
Herrn Pawlitscheks Geld Über Rudolf Pawlitschek ist zu sagen, dass er unaufhörlich damit prahlte, was für ein toller Jäger er sei, obwohl er nur einen Arm hatte. Einmal wurde Adrian von Herrn Pawlitschek in sein Zimmer an dem langen Flur eingeladen, damit er ihm dabei zusehen konnte, wie er sein Gewehr einfettete. Das Gewehr hing an einem Haken überm Bett, und während Herr Pawlitschek von seinen Jagdabenteuern berichtete, nahm er das Gewehr herunter und legte es sich über die leicht gespreizten Schenkel, zog die Nachttischschublade auf und holte Schmierfett und Putzlappen hervor, alles mit einer Hand. Das Reinigen geschah wie folgt: Herr Pawlitschek steckte die Waffe in die linke Achselhöhle, und während er mit dem Putzlappen kräftig über das Gewehr fuhr, drehte er es, indem er es fortwährend losließ und mit seinem Stückchen Armstummel wieder festklemmte. Das sah lustig aus, wie ein unablässiges Freigeben und Einfangen des Gewehrs, während die rechte Hand zur gleichen Zeit an stets derselben Stelle rieb und rieb. Von der Anstrengung schwitzte Herr Pawlitschek erheblich, zugleich schien sich jedoch das Mürrische, Vergrämte in seinem Gesicht durch den Schweiß aufzulösen, und eine Grimasse breitete sich darin aus, die fast einem Lächeln glich. Als Herr Pawlitschek dann Schmierfett und Putzlappen in die Schublade zurückpackte, bemerkte Adrian, dass in der hintersten Ecke ein Bündel Geldscheine steckte. Nachdem er das Geld gesehen hatte, war es, als bisse es sich in seinem Kopf fest. Er dachte daran, wenn er sich morgens zur Schule am Münnichplatz schleppte und wenn er in der hintersten Bank des Klassenzimmers saß, wohin ihn Magister Bergen verbannt hatte und wo er ihn nun beharrlich und ausdauernd ignorierte, während er allen anderen Kindern Fragen stellte. Er dachte, eines Tages, wenn Herr Pawlitschek nicht zu Hause wäre, würde er da hineingehen und das Geld zählen. Nicht um etwas damit zu tun, sondern nur um zu wissen, wie viel es war. Der Tag kam früher, als er zu hoffen gewagt hatte. Eines Nachmittags, als er von der Schule heimkam, waren nicht nur Herr und Frau Haidinger und die beiden Pawlitscheks (der ältere und der jüngere) nicht zu Hause, auch das Gewehr war weg, das stets an seinem Haken überm Bett hing, und Adrian zog die Nachttischschublade auf, nahm das Schmierfett und den Putzlappen heraus, streifte den Gummi vom zusammengerollten Bündel und zählte die Scheine mit zitternden Fingern. Es waren sechzig Reichsmark. In dem Augenblick war nicht er es, der den Entschluss fasste, sagte Adrian, sondern der Entschluss wurde für ihn gefasst. Es war, als ginge es überhaupt nicht um irgendeinen Entschluss, sondern um etwas Unumgängliches, das eintreten musste, aus dem einfachen Grund, weil die Geldscheine dort in der Schublade lagen und bei Haidingers an dem Tag niemand anders daheim war als Kühe und Kaninchen. Innerhalb weniger Minuten hatte er sich das Geld in die Tasche gesteckt und das Bisschen, was er an Kleidung besaß, in seinen Schulranzen gestopft, und dann saß er erneut in der Straßenbahn Richtung Schwarzenbergplatz. An diesem Nachmittag waren weit weniger Menschen auf dem Ring unterwegs als an jenem Tag, an dem sich Hitlers Geleitzug seinen Weg durch die Menschenmassen gebahnt hatte, und es dauerte nicht lange, bis ihn ein Schutzmann anhielt. Damals war es eher unüblich, dass Kinder im Schulalter allein und ohne Aufsicht durch die Stadt streiften. Einen sonderlich überzeugenden Eindruck als Schulkind dürfte Adrian auch kaum hinterlassen haben, mit seinem dunklen Zigeunergesicht und der grasfleckigen Hose, die ihm Frau Haidinger daheim allein zu tragen erlaubte, da er ja die Kaninchenställe zu säubern hatte. Der Polizist, der ihn aufgriff, war vollkommen überzeugt, dass die Schultasche nur als Tarnung diente und er einen ausgebufften Taschendieb vor sich hatte, ein Eindruck, der sofort bestätigt wurde, als das gerollte Geldbündel zum Vorschein kam. Adrian musste mit aufs Revier, wo man das Geld erneut zählte und er alles gestand. Dass er Adrian Dobrosch heiße (noch immer hieß er so!), und was Herrn Pawlitscheks Geld anging, so habe er vorgehabt, die Hälfte davon für sich zu behalten, für Essen und Unterkunft, wie er sagte, und die andere Hälfte habe er seiner Mutter geben wollen, damit sie endlich die Miete bezahlen könne. Und wer also ist deine Mutter?, fragte der Polizist und sah ihn listig an, als wäre er im Begriff, eine ganze Bande dingfest zu machen, da aber war Adrian plötzlich verstummt.
Zigeunerbengel Doch zu diesem Zeitpunkt wussten sie natürlich längst alles. Frau Haidinger durfte er nicht mehr unter die Augen kommen, und als Herr Pawlitschek sein Geld zurückerhalten hatte, bat er freundlichst darum, keine Anzeige erstatten zu müssen. Gegen wen hätte er auch Anzeige erstatten wollen? Auf dem Papier, das in rechtlicher Hinsicht allein zählte, waren Herr und Frau Haidinger noch immer Adrians Eltern. Also musste er zurück in die Lustkandlgasse: zur KÜST, wie das offizielle Kürzel für die Kinderübernahmestelle im Alsergrund lautete. Nun war jedoch nicht mehr die Rede davon, sich wie ein Zirkustier auf eine Bank zu stellen, gemustert und hoffentlich von einer Dame in rotem Kleid mit Spitzenkragen ausgewählt zu werden, die einem im Konsum Schokolade kaufte. Nach zwei Wochen, die sicher der Zeit entsprachen, die seine Personalakte brauchte, um zur Annullierung der Vormundschaft vom einen Amt zum anderen zu wandern, brachte man ihn nach Mödling. Dort gab es schon seit langem ein Heim für elternlose Kinder, das Hyrtl’sche Waisenhaus, ein großer Ziegelbau, der einer mittelalterlichen Burg glich, mit hohen abgeflachtenTürmen und einer Kirche auf dem Innenhof. Kaum waren die Nationalsozialisten an die Macht gekommen, hatte man es in eine Erziehungsanstalt für Kinder mit Disziplinproblemen umgewandelt. Zweimal im Leben sollte er eine Zeit in Mödling verbringen. Das letzte Mal, im Spätwinter 1943, war das schlimmste. Vom ersten Aufenthalt im Herbst 1939 ist ihm nicht viel in Erinnerung geblieben, nur die großen zugigen Säle und die schier endlosen Gänge und Stiegenhäuser, durch die sie nur in Gruppen marschieren durften – in Einer- oder Zweierreihen, immer irgendwohin unterwegs, zum Speisesaal oder zur Turnhalle, vorneweg einer der älteren Buben als Gruppenleiter, der seine Befehle herausschrie –, und das Geräusch der heftig stampfenden Füße, das im tiefen Treppenhausschacht widerhallte. Die ersten Wochen plagten ihn schwere Schuldgefühle. Er hatte sich der Fürsorge der Familie Haidinger oder der irgendwelcher anderer nicht würdig erwiesen. Er wusste auch nicht, was mit Helmut geschehen war, ob Frau Haidinger beschlossen hatte, ihn zu behalten, oder ob Helmut seinetwegen ein noch schlimmeres Schicksal ereilt hatte. Er wusste nichts, und diese Ungewissheit plagte ihn mehr als die ständigen Kommentare der Jungen zu seinem Aussehen, seiner dunklen Hautfarbe und seinen komischen Ohren. Sie fragten ihn unaufhörlich, was für einen Kleister er benutzte, weil die Ohren ihm so dicht am Kopf anlagen. Eines Tages sagte ihr Gruppenleiter zu ihm, er solle sich in der Kanzlei melden. Der Anstaltsleiter hieß Heckermann und wirkte irgendwie gedrungen, wie er da hinter seinem breiten Schreibtisch saß. Er trug einen schmalen Schnurrbart auf der Oberlippe. Vermutlich war der Bart so schmal, damit er die noch schmaleren Lippen nicht vollständig auslöschte, Bart und Oberlippe waren wie zwei dünne Striche, die zusammen ein Schnäbelchen bildeten. Auch im Auftreten hatte Herr Heckermann etwas Vogelartiges an sich, das bedrohlich wurde, als er die Schultern hochzog und Adrian fragte, wie er heiße. Adrian zog ebenfalls die Schultern hoch, allerdings aus Angst, und antwortete in dem militärisch festen Ton, den jeder in der Anstalt anzuschlagen hatte:
Dobrosch!
Dieser hässliche, abartige Name hatte wohl noch nie so viel Abscheu erregt wie in diesem Augenblick. Wie wenn man eine längst überfällige Konservenbüchse öffnet und die gesamte faulige Masse daraus hervorquillt. Der Anstaltsleiter sah einen Augenblick drein, als setzte ihm der Gestank schwer zu. Der Schnurrbartschnabel öffnete sich von neuem, und Herr Heckermann sagte:
Du hast unrecht!
Was sagt man, wenn ein Vertreter der Obrigkeit einen nach seinem Namen fragt und, wenn man Antwort gibt, erwidert, du hast unrecht? Adrian schloss die Augen. Er war überzeugt, dass sein letztes Stündlein geschlagen habe.
Du hast unrecht, denn von nun an heißt du Ziegler!
Da wagte Adrian die Augen zu öffnen und sah, wie sich Herr Heckermann hinter seinem Schreibtisch erhob, und dann kam es also zu dem bereits erwähnten Moment, in dem ein breit lächelnder Eugen Ziegler zum Vorschein kam und den verlorenen Sohn an seine Brust drückte.
Onkel Florians warme Hände Es war wie eine Art Taufe. So jedenfalls wirkte auf Adrian, was nun geschah. Er trat aus dem Schatten seiner hilflosen Mutter hinaus in das strahlende Licht des Vaternamens. Zehn Jahre lang hatte Eugen Ziegler Leonie Dobrosch unablässig misshandelt, er hatte sie und ihre gemeinsamen Kinder derart oft verlassen, dass niemand mehr zählen konnte, wie viele Male es waren, noch viel weniger all die Male, die er betrunken oder vollkommen abgebrannt und deshalb reumütig nach Hause zurückgekehrt war. Als Vater und Sohn Mödling verließen, legte der Vater den Arm um die Schultern des Sohnes und sagte, nun würde sie nichts mehr trennen können, denn er und die Mutter seien jetzt richtig verheiratet. Mit dieser Freudenbotschaft sei er gekommen. Er habe sie persönlich überbringen wollen, sagte er, und der Arm, den er Adrian um die Schultern gelegt hatte und der fest und beschützend wirken sollte, war in Wahrheit nur eine einzige inständige Bitte, ihn selbst zu beschützen. Natürlich lag das am Krieg. Was sollte es sonst sein? Wenn Eugen Ziegler nicht nachweisen konnte, dass er sich um eine Familie zu kümmern hatte, lief er Gefahr, von der Straße weggeholt und an die Front geschickt zu werden oder an einen vielleicht noch schlimmeren Ort. Man hatte ihm eine Arbeit als Monteur in der Lokomotivenfabrik von Floridsdorf beschafft. Dort draußen wurde unter Hochdruck gearbeitet, man baute Loks für die Deutsche Reichsbahn. Doch unterlag die Anstellung einigen Bedingungen. Ziegler musste versprechen, mit der Lohntüte direkt heimzugehen, und die Mutter musste stets quittieren, dass sie den gesamten Betrag erhalten hatte. Ertappe ich dich auch nur einmal dabei, dass du betrunken zur Arbeit erscheinst oder mit dem Geld nicht schnurstracks nach Hause gehst, setze ich dich sofort vor die Tür, soll der Meister in der Fabrik gesagt haben. Und obgleich es mit der Nüchternheit abends und an den Wochenenden mal mehr, mal weniger gut bestellt war, hatten die Behörden ihn doch ständig am Gängelband, und solange der Krieg andauerte, schleppte sich Eugen Ziegler tagtäglich in die Fabrik nach Floridsdorf und half beim Bau von mehr als tausend Kriegslokomotiven der Baureihe 52. Damals wohnten sie im 3. Bezirk, in einer modernen Wohnung mit Bad und Klosett. Auch darum hatte sich die Sozialbehörde gekümmert. Ferenc wohnte weiter draußen in Kaisermühlen, obgleich er nun für einen Fuhrbetrieb in St. Pölten tätig war, der Kohle an Firmen und Fabriken lieferte, die, was Bestellscheine und Quittungen anging, nicht sonderlich penibel waren. Die Arbeit war gefährlich, weil nachts mit ausgestellten Scheinwerfern gefahren werden musste und man jederzeit in eine Polizeikontrolle geraten konnte. Adrians Mutter war seinetwegen vor Unruhe ganz außer sich, die meisten Sorgen aber machte sie sich um Onkel Florian. Solange sie zusammen wohnten, hatte es mit ihm nie Probleme gegeben. Zwar war er manchmal geistig abwesend und mit ihm zu reden war nicht leicht, weil er derart knödelte und nuschelte, dass man nur selten verstand, was er sagte. Zugleich war er lieb und nett, und hatten seine Hände nur etwas zu tun (doch nie durfte man ihm eine Arbeit vorsetzen), war er fleißig und tüchtig wie wenige sonst. Manchmal nahm Herr Gabler, der Gemüsehändler, ihn mit zum Großhändler nach Matzleinsdorf. Adrian weiß noch, dass er bei der Rückkehr von dort immer Arbeitshandschuhe und eine Schürze trug, mit denen er aussah wie ein richtiger Hafenarbeiter. Im Frühjahr half er Ferenc, die Boote im Yachthafen an der Alten Donau mit Schutzlack zu versehen. Er saß im weißen Sonnenlicht auf einem niedrigen Schemel und hielt den Pinsel weit vorn zwischen den Fingerspitzen, so als bemalte er eine kostbare Leinwand. Adrians Mutter sagte immer, Onkel Florian habe so warme, empfindsame Hände. Nachdem die Familie auf die Straße gesetzt worden war, hatte es damit ein Ende. Florian fand keine Arbeit mehr. Eine Zeit lang wohnte er in einem Junggesellenheim in der Brigittenau, unter den fremden Menschen aber kam er nicht zur Ruhe, veränderte sich, wurde rastlos, trieb sich oft auf der Straße herum, gab den Hanswurst