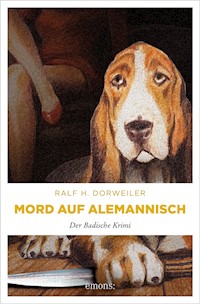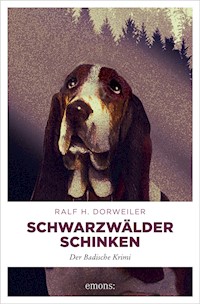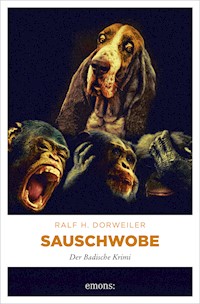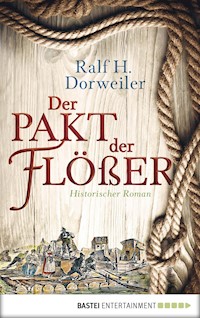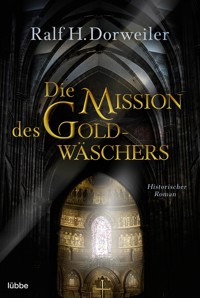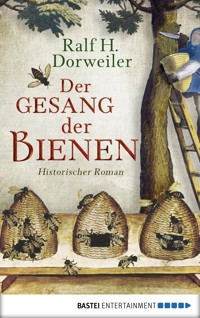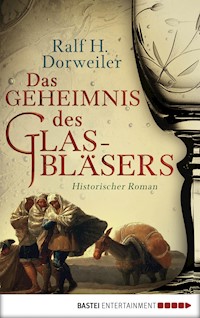9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Rieker und Ahrens
- Sprache: Deutsch
Hamburg 1887: Eine entsetzlich zugerichtete Leiche auf einem Fabrikgelände ist erst der Anfang einer mysteriösen Todesserie …
Hamburg 1887. Die Richterstochter Johanna Ahrens hat sich Hals über Kopf in einen Sozialisten verliebt. Als sie ihn zu einer Protestaktion vor einer Tapetenfabrik begleitet, wird sie Zeugin, wie zwei Männer eine Leiche aus einem Nebengebäude tragen. Schockiert wendet Johanna sich an Criminalcommissar Hermann Rieker. Der kann vor Ort zunächst keine Spur eines Verbrechens finden, wird aber hellhörig, als auf einem nahe gelegenen Brachgelände ein grausam zugerichteter Toter entdeckt wird. Während Johanna auf eigene Faust inkognito in der Fabrik ermittelt, forscht Rieker nach der Identität des Toten. Schon bald stößt er auf weitere Leichen, die ähnlich entstellt sind …
Düster, atmosphärisch, atemberaubend spannend – der zweite Fall für Criminalcommissar Hermann Rieker und die Richterstochter Johanna Ahrens.
»Ein spannender und im besten Sinne unterhaltsam konstruierter historischer Kriminalroman.« www.krimi-couch.de (über »Der Herzschlag der Toten«)
»Ein atmosphärischer und spannender historischer Krimi. Die Protagonisten überzeugen und ergänzen die Handlung mit Charme und Charisma.« www.histo-couch.de (über »Der Herzschlag der Toten«)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Hamburg 1887. Erst vor Kurzem hat der junge Criminalcommissar Hermann Rieker seinen ersten eigenen Mordfall aufgeklärt, mit tatkräftiger Unterstützung der Richterstochter Johanna Ahrens. Rieker staunt nicht schlecht, als Johanna erneut in seinem Büro auftaucht, weil sie beobachtet hat, wie zwei Männer einen Toten aus einem Fabrikgebäude getragen haben. Tatsächlich wird bald darauf ganz in der Nähe der Tapetenfabrik eine grausam zugerichtete Leiche gefunden. Während Rieker mit der Ermittlung beginnt, lässt Johanna sich in der Fabrik anstellen, um so an weitere Informationen zu kommen. Der Commissar ist gar nicht erfreut, dass sich die junge Frau erneut in seinen Fall einmischt, kann jedoch nicht leugnen, dass sie ihm hilfreiche Hinweise liefert. Und die sind bitter nötig, denn es bleibt nicht bei einer Leiche …
Weitere Informationen zu Ralf H. Dorweiler sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Ralf H. Dorweiler
Die Farbe des Bösen
Historischer Kriminalroman
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe November 2025
Copyright © 2025 by Ralf H. Dorweiler
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotive: United Archives/Universal Images Group via Getty Images; Yolande de Kort / Trevillion Images; FinePic®, München
Redaktion: Beate De Salve
LS · Herstellung: ik
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-32780-4V001
www.goldmann-verlag.de
Prolog
Hamburg. Mittwoch, 25. Mai 1887
Bente warf im Lauf einen gehetzten Blick über die Schulter. Ihr Mann, Gerd Olsen, folgte ihr so dichtauf, dass sie das Weiße in seinen zu Schlitzen verengten Augen erkennen konnte. Obwohl jede Faser ihrer Muskeln nach einer Pause flehte, trieb die Angst Bente weiter. Die Oberschenkel brannten, der Atem jagte röchelnd, das Herz raste. Ihr wurde schlecht vor Anstrengung. Die rechte Seite ihres Kopfes pochte stechend. Zwei Wochen war es her, dass Gerd ihr wegen einer Lappalie das Veilchen verpasst hatte, das gerade erst zu einem gelblichen Schatten verblasste. Wenn er sie jetzt in die Finger bekam, würde es nicht bei einem blauen Auge bleiben.
»Bente!«, dröhnte seine wütende Stimme viel zu nah hinter ihr. Sein Keuchen klang wie nachts, wenn er sich besoffen auf sie legte: erschöpft, aber entschlossen. Bente kannte seine unbändige Kraft zur Genüge.
Die Brücke über den Kanal führte sie weg von den Wohnhäusern, hin zu den alten Fabriken. Während der Schicht war hier kaum jemand unterwegs. Der Großvater, der einen uralten Handkarren über das holprige Pflaster zerrte, konnte ihr gegen Gerd keinen Schutz bieten, und zwei jüngere Männer taten so, als hörten sie ihre Hilferufe nicht.
Bentes Kräfte gingen zur Neige, aber auch ihr Mann wurde schwächer. Die Erkenntnis, dass der Abstand zwischen ihnen wuchs, verlieh ihr neuen Mut. Das städtische Steinlager musste sich in der Nähe befinden. Dort gab es starke Männer, gegen die anzugehen Gerd nicht wagen würde.
Als Bente sich der Einmündung einer Seitenstraße näherte, drangen von dort laute Stimmen an ihre Ohren. Das war die passende Richtung. Sie bog ab und sah direkt vor sich eine Gruppe von sicher zwanzig oder dreißig Männern, die mit Schildern vor einem lang gezogenen Fabrikbau protestierten. Trempin und Cie. Tapetenfabrik stand in geschwungenen Lettern über dem Eingang.
»Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will«, skandierten die zum Teil vermummten Demonstranten einer deutlich kleineren Gruppe von Wachleuten und Vorarbeitern entgegen. Die Verteidiger hielten Knüppel und übergroße Schraubschlüssel bereit.
»Bleib stehen!«, hörte sie Gerd schwer atmend hinter sich.
Bente schob sich zwischen den Männern hindurch, um in deren Mitte zu gelangen. Ihr Verfolger konnte es nicht mit allen aufnehmen.
»Was ist mit dir?«, fragte eine weibliche Stimme neben ihr. Sie gehörte zu einer schwarzhaarigen Frau in Bentes Alter, die sie besorgt anblickte.
Bente stützte sich auf den Knien ab und versuchte verzweifelt, Luft zu bekommen. Sie spürte die Hand der Frau auf dem Rücken.
Die Demonstranten wiederholten ihren Schlachtruf. Mittendrin erklang eine gellende Trillerpfeife. Ihr folgte der Ruf: »Udel! Udel! Udel!«
Sofort ging ein Ruck durch die ganze Gruppe.
»Nehmt die Beine in die Hand!«, rief ein Kerl, der sich ein Tuch vor Mund und Nase gebunden hatte.
Die Schwarzhaarige sah Bente aus geweiteten Augen an und murmelte: »Schiet! Wir müssen weg! Komm!«
Ein Holzschild landete klappernd vor ihren Füßen auf dem Pflaster. Bente starrte es entsetzt an. Ihr blieb keine Zeit zum Durchatmen. Die andere Frau lief los, folgte den Männern, die in die Richtung stoben, aus der sie gekommen war.
Ihnen folgen konnte Bente nicht, sonst würde sie Gerd direkt in die Arme laufen, und weiter vorn blockierten Polizisten den Weg. Wenn die sie zu fassen bekamen, würde sie ganz sicher an Gerd ausgeliefert. Schließlich hackte eine Krähe der anderen kein Auge aus. Rechts jubelten die Wachleute, die den Weg auf das Fabrikgelände absperrten, also blieb Bente nur die Mauer zur Linken.
Um darüber zu klettern, war sie zu hoch, aber das rostige Gittertor hing schief in den Angeln. Bente glitt durch den Spalt, der sich zwischen den beiden Flügeln aufgetan hatte. Vor ihr lag ein Platz. Gras und Unkraut schossen aus den Fugen der Pflastersteine empor. Dahinter moderte ein Backsteinbau mit Reihen von meist eingeschlagenen Fenstern vor sich hin – vermutlich ein altes Lager.
Das Tor rappelte. Bente musste mit ansehen, wie Gerd sich – wenn auch mit deutlich mehr Mühe als sie – durch den Spalt quetschte. Hinter ihm liefen Schutzpolizisten die Straße entlang. Ihr Mann schien mit seiner Jacke festzuhängen, doch das würde ihn nicht lange aufhalten.
Bente rannte auf die Seite des Gebäudes zu. Gerd fluchte laut, dann erklangen seine schweren Schritte hinter ihr.
Sie erreichte die Ecke des Lagers. Links stand eine Seitentür offen. Etwas weiter entfernt begrenzte dichtes Gestrüpp das Areal.
Kurz entschlossen riss Bente sich das Kettchen vom Hals, das Gerd ihr zur Hochzeit geschenkt hatte. Sie schleuderte das Silber in Richtung der Tür, wandte sich selbst allerdings zu den Büschen und rutschte in eine Lücke zwischen einem von Brombeerranken überwachsenen Haselnussstrauch und einer Hainbuche. Das Grün schloss sich hinter ihr wie ein dichter Vorhang. Sie verharrte regungslos.
Genau in dem Moment stürmte Gerd um die Ecke. Er beugte sich vor und stützte sich mit den Händen auf die Knie. Sein Atem ging schnell.
Dann richtete er sich wieder auf. Als sein Blick suchend die Hecke abfuhr, hielt Bente die Luft an. Gerd schien nachzudenken. Er keuchte noch immer. Ihr Körper rang um Sauerstoff, aber sie zwang sich zu völliger Regungslosigkeit. Hilflos beobachtete sie aus ihrem Versteck, wie er einen Schritt auf sie zutrat. Ihre Muskeln verkrampften. Dann hielt er in der Bewegung inne und drehte den Kopf zur Seite. Offenbar hatte ein Lichtreflex seine Aufmerksamkeit auf die Kette gelenkt. Er lief darauf zu, bückte sich und grunzte zufrieden, als er das Schmuckstück erkannte. Er ballte eine Faust darum.
»Bente, du hast deine Kette verloren«, rief er in einem Singsang, der ihr einen eiskalten Schauer über den Rücken jagte. Gerd sah durch die offene Tür in das Lagergebäude und trat dann ein. »Komm schon raus. Mach mich nicht noch wütender!«, hörte sie seine Stimme aus dem Inneren.
Bente sog gierig die Luft ein und stieß sie gleich wieder aus. Ihre List hatte funktioniert! Aber er konnte jederzeit zurückkommen, wenn er sie drinnen nicht fand. Sie war noch nicht in Sicherheit.
Tiefer im Gestrüpp entdeckte sie das matte Rot der Backsteinmauer, die das Grundstück begrenzte. Sie bahnte sich den Weg darauf zu und versuchte dabei, so wenige Geräusche wie möglich zu machen. Doch dafür war das Grün hier zu dicht. Brombeerranken zerrten an ihr und rissen ihr schmerzhaft die Haut an den Armen und Wangen auf. Sie biss die Zähne zusammen, als sie durch Brennnesseln musste, und bog den dazwischen wachsenden Ast einer Stechpalme zur Seite, der hinter ihr mit einem lauten Rascheln zurückschnellte.
Endlich erreichte sie die Mauer. Sie nutzte eine niedrige Astgabelung, um sich mit letzter Kraft auf deren Krone hochzuziehen und darüber zu schauen. Das Dickicht setzte sich dahinter fort, doch in der Ferne machte Bente schemenhaft ein weiteres Gebäude aus.
Kurz entschlossen schwang sie ein Bein hoch, zog den Rest des Körpers nach und ließ sich auf die andere Seite rollen.
Ihr Kleid riss ein, als sie an einem Ast hängen blieb, doch sie scherte sich nicht darum, kam auf die Füße und lauschte angestrengt. Außer Vogelgezwitscher war nichts zu hören. Wahrscheinlich durchsuchte Gerd noch das alte Lagerhaus.
Sie eilte weiter und erreichte eine Freifläche vor dem offenbar ebenfalls verlassenen Gebäude. Das Dach war nach einem Brand zum Teil eingestürzt. Verkohlte Balken ragten wie das Skelett eines riesenhaften Tieres in die Höhe. Baumsprösslinge klammerten sich an schmutzigen Fenstersimsen fest oder reckten ihre Kronen aus dem Inneren des Baus.
Anders als bei dem Lager war die Fläche um die Ruine ungepflastert. Schafgarbe, Kamille und Ampfer konkurrierten mit Gräsern, Brennnesseln und Brombeeren um Licht.
Bente fluchte innerlich. Wenn Gerd auf das Gelände kam, würde er ihre Spur in dem hohen Bewuchs sehen und ihr folgen können. Es sei denn, sie blieb auf dem gepflasterten Weg, den sie nun entdeckte. Er führte zu einem Loch in der Ruine, wo einst eine Tür gewesen sein musste. Die verblichene Schrift darüber konnte Bente nicht lesen. In das Fabrikgebäude hineinzugehen, war die einzige Möglichkeit weiterzukommen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Sie schlüpfte durch das Loch in der Mauer und fand sich in einem Gang wieder, an dessen Ende eine offene Tür in eine Halle führte. Von oben schien die Sonne durch das kaputte Dach herein. Darunter bildeten Schutt und Ziegelscherben einen unmöglich zu begehenden Untergrund.
Bente hielt sich am Rand und steuerte so auf die gegenüberliegende Seite zu, wo das Dach noch etwas Schutz vor den Naturgewalten bot. Eine Tür führte tiefer in die alte Fabrik hinein.
Bente blieb alarmiert stehen und lauschte in den Gang. Sie hatte etwas gehört! Die Quelle des dumpfen Knurrens konnte sie allerdings nicht ausmachen. Hatten sich hier etwa Wildschweine oder Füchse einquartiert? Oder verwilderte Hunde? Ihr blieb nur zu hoffen, dass ihre Anwesenheit die Tiere verscheuchte.
Als sie ein im Dämmerlicht liegendes Treppenhaus erreichte, hörte sie erneut ein Geräusch. Diesmal war es allerdings kein Knurren, sondern vielmehr ein dumpfes Wimmern, das von unten an ihr Ohr drang. Sie würde sich hüten, die Treppe hinabzusteigen! Stattdessen probierte sie die Tür vor sich.
Im nächsten Raum – einer zweiten großen Halle – war es wieder hell. Das Dach schien noch intakt zu sein, dafür waren die meisten der hohen Sprossenfenster geborsten. Jemand hatte verstaubte Tische und rostige Eisenmaschinen an einer Wand zusammengeschoben. Daneben begann eine schmale Stahltreppe, die auf eine Galerie führte. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich ein Zugang ins Untergeschoss.
Bente steuerte geradeaus auf den Ausgang an der Rückseite des Gebäudes zu. Eine Schar Spatzen stob auf und flog durch ein herausgefallenes Fenster. Bevor sie weiterhetzte, musste sie sich einen Moment ausruhen.
Unwillkürlich legte sie sich eine Hand auf den Bauch. Es war zu früh, um etwas zu spüren, dennoch verstärkte die Geste für sie die Bindung zu dem Leben, das in ihr heranwuchs. Ginge es um sie allein, hätte sie Gerds Launen und Anfälle, die Beschimpfungen und Prügel vielleicht über sich ergehen lassen. Aber seit sie guter Hoffnung war, galt es, das kleine Leben vor ihm zu beschützen.
Warum nur war Gerd ausgerechnet heute früher aufgetaucht? Er hatte die gepackten Beutel gesehen und sofort verstanden, dass sie ihn verlassen wollte. Als er die Hand gegen sie erhoben hatte, war er mit einem Fuß in den Tragegriffen ihrer Tasche hängen geblieben und direkt vor ihr zu Boden gestürzt. Und sie war losgerannt.
Das war der Anfang ihrer Flucht gewesen, die sie bis in diese Ruine geführt hatte. Und sie war noch nicht zu Ende …
Bevor Bente die Türklinke herunterdrückte, prüfte sie mit einem Blick durchs Fenster, ob die Luft rein war – und zuckte panisch zusammen. Draußen schlich Gerd genau auf die Tür zu, hinter der sie sich verbarg! Am liebsten hätte sie vor Verzweiflung geschrien, doch stattdessen lief sie zurück und eilte zu der Tür, durch die sie in diese Halle gekommen war.
»Ich werde dich kriegen!« Die wütende Stimme ihres Mannes wurde von den leeren Fabrikwänden zurückgeworfen und verstärkt.
Bente erreichte die Treppen. Einem Impuls folgend sprang sie die Stufen hinab und drückte sich in der fast vollkommenen Dunkelheit hinter der nächsten Ecke an die Wand.
Gerds Schritte näherten sich bedrohlich schnell, doch direkt über ihr wurde er langsamer. Einen Augenblick fürchtete sie, er würde ihr folgen, aber dann rannte er weiter. Die List war aufgegangen.
Bentes Herzschlag beruhigte sich ein wenig. Sie stand in einem Kellergang, an dessen Ende sie einen leichten Lichtschimmer ausmachen konnte. In der Hoffnung auf einen Ausgang eilte sie los. Einmal stolperte sie über etwas Weiches, fing sich dann aber. Unbeirrt ging sie durch die Schatten weiter, mit nach vorne tastenden Händen auf den heller werdenden Lichtschein zu.
Sie gelangte in einen Raum, in dem wieder Einzelheiten zu erkennen waren. Die Türen, die von hier abgingen, standen allesamt offen, nur die nach rechts war angelehnt.
»Hhhm!«
Bente schrak zusammen. Ihr Blick schnellte zu der Tür. Von dort musste das leise Geräusch gekommen sein.
»Hilfe!«, hörte sie nun jemanden rufen, lauter diesmal.
»Psst!«, flüsterte sie zurück.
»Bitte«, erklang eine flehende Männerstimme.
»Seien Sie still«, raunte sie in den Raum. Wer immer sich dort aufhielt, musste leise sein, um Gerd nicht herzulocken! »Ich komme ja.«
Beim Aufziehen quietschte die Tür, und ein streng süßlicher Geruch drang ihr in die Nase. Das wenige Licht aus dem Nebenraum ließ Bente einen Tisch voller Flaschen, Tiegel und Werkzeuge erahnen. Daneben stand ein großer, von der Tür abgewandter Sessel nahezu in der Mitte des Raums. Ohne die Stimme eben hätte sie bei einem schnellen Blick niemanden gesehen.
Hin- und hergerissen trat Bente ein. Mit jedem Schritt auf den Sessel zu wurde der süßliche Geruch unangenehmer. Hinter der Lehne konnte sie nun zwei Arme ausmachen. Ein Strick hielt die Handgelenke zusammen.
»Hallo?«, flüsterte sie, bekam aber außer einem Stöhnen keine Antwort.
Beim Herumgehen um den Sessel rutschte sie in einer Pfütze aus und wäre beinahe gestürzt. Zu dem eigenartig süßlichen Geruch gesellte sich der Gestank von Blut und Urin.
Bente sah sich die schemenhafte Gestalt an. Es handelte sich um einen Mann. Sein Kopf war nach hinten überdehnt, der Mund stand weit offen. Er bewegte sich nicht.
»Hallo? Sie?«, hauchte sie, bekam aber keine Antwort.
Irgendwo oben schlug eine Tür und erinnerte Bente an ihren Verfolger. Sie musste sich beeilen.
Über den Handgelenken des Fremden ertastete sie einen groben Strick und feste Knoten. Sie versuchte, sie zu lösen, kam jedoch nirgends dazwischen. Sie brauchte Werkzeug.
Ihre Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Auf dem Tisch lagen Hämmer, Zangen und Sägen penibel nebeneinander angeordnet. Zu welchem Zweck sie gebraucht wurden, darüber wollte sie lieber nicht nachdenken. Dahinter bemerkte sie einen Haufen zerknüllten Papiers.
Hastig setzte sie eine der Sägen so an, dass ihr scharfkantiges Blatt den Strick, aber nicht das Fleisch aufreißen würde.
In dem Moment erklang über ihr ein unbestimmtes Brüllen. Vor Schreck ließ sie die Säge fallen. Das Klirren auf dem Steinboden kam ihr unfassbar laut vor.
Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Sie konnte dem Mann jetzt nicht helfen. Sie musste sich selbst schützen. Sich und ihr Kind!
Entschlossen trat sie auf die Tür zu, dann zögerte sie einen Moment und drehte sich kurz um.
»Ich hole Hilfe«, flüsterte sie leise, obwohl sie nicht wusste, ob der Gefesselte überhaupt noch bei Bewusstsein war. Dann verließ sie die Kammer und lief weiter auf das Licht zu.
Mit zusammengepressten Lippen nahm sie die Treppe nach oben und spähte hinaus, aber von Gerd war nichts zu sehen. Sie glitt durch die Tür ins Freie und rannte auf das Gestrüpp zu, das bald in ein Wäldchen überging.
Als sie sich das nächste Mal umdrehte, nahm sie wahr, wie Gerd aus der Fabrik lief. Er entdeckte ihre Spur im hohen Gras.
Bente rannte weiter.
1. Kapitel
Zwei Wochen zuvor. Hamburg. Mittwoch, 11. Mai 1887
Im Verhörraum des Untersuchungsgefängnisses roch es nach Schweiß, Lügen und Ausflüchten. Criminalcommissar Hermann Rieker rümpfte die Nase und breitete sein Taschentuch auf der Sitzfläche des Holzstuhls aus. Auf der anderen Seite des nüchternen Tisches wartete ein zweiter Sitz auf den Delinquenten, dem er gleich ein Geständnis abzuringen hoffte.
Zusammen mit einem Gefängniswärter führte Criminalsekretär Manuel Kracht den in Hand- und Fußschellen gelegten Mann herein. Raphael Schmidts Bauch war so umfangreich, dass er beim Blick an sich hinab die Füße nicht sehen konnte. Selbst die größte verfügbare Häftlingskluft spannte darüber. Zufälligerweise hatte die verblichene graue Jacke die gleiche Farbe wie die Haare auf dem Kopf des Siebenundvierzigjährigen.
Rieker hatte das Vorführen in Fesseln befohlen, um den Mann einzuschüchtern. Den hektischen Blicken nach zu urteilen, ging sein Plan auf.
»Nehmen Sie Platz«, forderte Rieker betont emotionslos und zeigte auf den freien Stuhl.
»Hinsetzen!«, wiederholte Kracht schärfer und drückte den Inhaber der Hamburger Walzlagerfabrik in den Sitz.
»Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nichts damit zu tun habe«, beteuerte Schmidt weinerlich. An seinem Akzent hörte man deutlich, dass er aus Süddeutschland stammte.
»Gesagt haben Sie es, aber überzeugt haben Sie mich nicht«, erwiderte Rieker. Er drehte sich zu dem vergitterten Fenster, das nicht viel mehr als eine Scharte in der Wand war. Der Innenhof, auf den man von hier aus blickte, lag im Schatten der meterhohen Mauern. Eine Gruppe von Häftlingen marschierte in Reih und Glied über den platt getretenen Rasen.
Der Himmel war blau. Ein schöner Tag im Mai.
Rieker strich mit den behandschuhten Fingern über das Revers seines Anzugs und setzte sich Schmidt gegenüber. Kracht blieb im Rücken des Mannes stehen, wie sie es besprochen hatten.
»Sie wissen, warum Sie hier sitzen?«
»Das ist ja das große Geheimnis! Sie denken offenbar, dass ich mit dem Mord zu tun habe.«
Rieker nickte. »Und? Haben Sie?«
»Nein. Wie oft soll ich das noch wiederholen?«
»So lange, bis Sie bereit sind, uns die Wahrheit zu sagen.«
»Das ist die Wahrheit.«
»Sprechen wir über Jörn Steeker«, legte Rieker fest.
Sein Gegenüber presste die Lippen zusammen.
»Er hat für mich gearbeitet. Wie fast fünfzig andere.«
»Vor sechs Jahren aus Bremen nach Hamburg gekommen. Seit vier Jahren verheiratet mit Trude Steeker. Zwei Kinder. Das eine drei Jahre alt, das andere hat gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert.«
»Wie gesagt, ich kannte ihn nicht gut.«
»Er hat ein Jahr lang den Maschinenbereich der Kugelschleifer geleitet.«
»Ja und?«
»Sie waren doch bis Anfang ´85 in leitender Position bei der Kugelfabrik Fischer in Steinfurth beschäftigt. Sie wissen also, wie entscheidend die Güte der Kugeln für die Zuverlässigkeit von Kugellagern ist.«
»Ja, aber das heißt nicht, dass ich viel wusste über …«
»… den Mann, der die für Ihre Fabrik bedeutendste Produktionslinie leitete?«, fiel Rieker ihm ins Wort. »Wer soll Ihnen das glauben?«
Langsam wurde Schmidt wieder selbstbewusster.
»So war es eben«, antwortete er bockig. »Suchen Sie lieber denjenigen, der ihn umgebracht hat, um an die Löhne zu kommen.«
Rieker schlug mit der Faust auf den Tisch, was Schmidt zusammenzucken ließ.
»Ein Raubmord. Ja, zu Beginn ging ich auch von einem Raubmord aus. Aber dann habe ich mich gewundert. Wer konnte denn wissen, dass das Opfer die Gelder bei sich führte?«
»Da kommen mehrere Leute infrage«, fuhr Schmidt ihn an.
»Kracht?«
»Ja, Herr Commissar?«
»Wie viele Leute waren es?«
»Vier Personen. Plus der hier anwesende Herr Raphael Schmidt.«
»Danke, Kracht.«
Rieker wandte sich wieder dem Verhörten zu. Er spürte einen winzigen inneren Triumph, weil sich alles so fügte, wie er es geplant hatte. Jetzt durfte er nur nicht nachlässig werden.
»Alle außer Ihnen hatten ein sehr überzeugendes Alibi. Aber Sie haben angegeben, allein in Ihrer Kammer gewesen zu sein.«
»Das war ich nun einmal. So ist das, wenn man eine Fabrik leitet. Es gibt viel zu tun, auch zu ungewöhnlichen Zeiten.«
Rieker nickte. »Das habe ich mir auch zuerst gedacht. Also blieb die Möglichkeit, dass jemand der vier anderen einen Mörder angeheuert haben könnte. Oder dass es reiner Zufall war, dass ein Räuber Herrn Steeker ausgerechnet zu dem Zeitpunkt in einer dunklen Gasse vor seiner Wohnung auflauerte, als er ein kleines Vermögen an Löhnen bei sich hatte.«
Schmidt nickte bekräftigend und sah Rieker hoffnungsvoll, aber gleichzeitig skeptisch an.
Der fuhr fort: »Trotzdem wollte ich sichergehen und habe gestern Morgen ein Telegramm nach Schweinfurt geschickt.«
Die vor Schreck geweiteten Augen des Mannes bekräftigten Rieker in der Annahme, dass der Kampf bald entschieden sein konnte.
»Und als ich daraufhin die Wohnung des Opfers durchsuchte, fand ich das hier.« Er zog die Schublade des Tisches auf und mehrere Bögen Papier hervor.
Schmidts Atem ging schneller. Seine Hände begannen zu zittern.
»Ist Ihnen kalt?«, fragte Rieker.
Statt ihm zu antworten, verschränkte der Mann die Arme über dem Bauch.
»Patentpläne Ihrer Kugelschleifmaschine zur Fertigung gängiger Stahlkugeln für den Betrieb in einem Wälzlager«, las der Commissar die Überschrift vor.
Die Zeichnungen sagten ihm kaum etwas, doch die waren auch nicht wichtig. Von höchster Bedeutung waren allerdings ein paar durchgestrichene Worte.
»In den Unterlagen, die ich bei Jörn Steeker gefunden habe, standen F. Fischer und W. Höflinger als Urheber des Plans. Die von Ihnen im kaiserlichen Patentamt eingereichten Papiere gleichen diesen in entscheidenden Punkten bis aufs Haar. Allerdings steht da R. Schmidt als Erfinder, also Sie. Wie können Sie das erklären?«
Der Tatverdächtige presste erneut die Lippen zusammen.
»Sie wollen nicht reden?«, fragte Rieker. »Dann will ich Ihnen darlegen, wonach es aussieht: als hätten Sie in Schweinfurt Durchschläge der Pläne der Erfinder gestohlen und eine leicht abgewandelte Maschine hier bauen lassen. Ich vermute, das Opfer hat diese Durchschläge irgendwie in die Hände bekommen und gedroht, Ihr Geheimnis nach Schweinfurt zu melden, wo man derzeit von Schwierigkeiten berichtet, das Patent zu erhalten, weil es noch einen zweiten Patentantrag gibt – Ihren.«
Schmidts Schultern verrieten seine innere Anspannung. Rieker beugte sich vor und sah ihm in die Augen.
»Gestehen Sie!«, forderte er, doch Schmidt blieb still und starrte an seinem Gegenüber vorbei.
Der Commissar lehnte sich wieder zurück.
»Sie mussten Steeker loswerden, ohne selbst in den Fokus der Ermittlungen zu geraten. Da war es ideal, die Tat als Raubmord zu inszenieren«, fuhr Rieker fort.
»Dafür haben Sie keine Beweise.«
»Sie leugnen ja nicht einmal mehr.«
»Das hat nichts zu sagen.«
»Ich denke schon. Nebenbei: Dass wir keine Beweise hätten, stimmt so nicht.«
Das war eine Finte, aber Rieker wollte sehen, wie Schmidt darauf reagierte.
»Was soll das heißen?«
»Nun, ein Zeuge hat in der Gasse einen Mann gesehen, dessen Beschreibung genau auf Sie passt.«
Schmidt blickte sich gehetzt um. »Das könnte jeder gewesen sein.«
»Ich zitiere: Ein dicker Mann, eher fein gekleidet. Das Opfer schien ihn zu kennen …«
»Sie lügen!«, ging Schmidt wütend dazwischen. »Da war niemand!«
»Ach, und woher wollen Sie das wissen?«, fasste Rieker sofort nach. »Dass ich mir das ausgedacht habe, kann nur der Täter wissen. Quod erat demonstrandum, wie mein Lehrmeister gesagt hätte – Was zu beweisen war.«
Der Mann vor ihm erinnerte Rieker an einen Boxer, der sich durch mehrere Runden gequält und bereits so manchen Treffer eingesteckt hatte. Irgendwann brachte ein linker Haken oder eine rechte Gerade die Deckung ins Wanken. Konnte man dann den Druck aufrechterhalten, folgte bald der Moment, in dem der Kampfgeist den Sportler unweigerlich verließ. Wenn der Gedanke an die Niederlage zum ersten Mal ins Bewusstsein drang und sich im Kopf festsetzte, war man längst besiegt.
Rieker hatte Schmidt nun genau an diesem Punkt. Und es gab keinen Gong, der den Fabrikanten retten konnte. Er sah dem Mann an, wie er brach. Sein Widerstand fiel in sich zusammen wie eine altersschwache Mauer.
»Steeker hat Sie wegen des Ideendiebstahls erpresst«, fasste Rieker zusammen. »Sie haben ihm das Geld gegeben, sind ihm gefolgt und haben ihn in der Gasse totgeschlagen, in der Hoffnung, dass man Ihnen nicht auf die Schliche kommt.«
Das Geständnis begann mit einem zögerlichen Nicken.
Als Rieker mit Kracht zurück zur Polizeibehörde im Stadthaus kam, begab er sich gleich in sein winziges Bureau. Der Criminalsekretär ging direkt weiter. Er war seit dem letzten Fall bei Riekers Kollegen, Commissar Emil Breiden, angegliedert. Dass die Ausbildung des jungen Polizisten aus Riekers Verantwortung genommen worden war, bedeutete eine gewisse Degradierung, gegen die anzugehen ihm bisher nicht gelungen war.
Während Breiden einer wohlhabenden – und damit angesehenen – hanseatischen Familie angehörte, war Rieker der aus der Art geschlagene Spross eines Berliner Gauners, was natürlich niemand wissen durfte. Im Franzosenkrieg hatte er einem Vorgesetzten das Leben gerettet, und Alexander von Welmensiel hatte ihm im Gegenzug zu der Anstellung bei der neu gegründeten Hamburger Criminalpolizei verholfen. Dort war er dem alten Kleinschmidt zur Seite gestellt worden. Der damals schon betagte Commissar hatte über einen gewaltigen Fundus an Lebensweisheiten verfügt – und vor allem über einen untrüglichen Instinkt, wenn es um das Aufspüren von Verbrechern ging. Rieker war dankbar, durch seine strenge, aber stets gerechte Schule gegangen zu sein.
Nach Kleinschmidts Tod Anfang des Jahres war der mittlerweile zum General beförderte von Welmensiel überraschend wieder auf die Bühne getreten, um Rieker für die Beförderung vorzuschlagen. Doch dass der jüngste Criminalcommissar der Geschichte Hamburgs ein Parvenu war, gefiel niemandem in der Inspektion so recht. Kleinschmidt, der oft Sprichworte bemüht hatte, hätte gesagt: Gleich und Gleich gesellt sich gern.
Rieker musste grinsen, als er sich vorstellte, wie der Alte dabei über den Rand seiner runden Lesebrille geschaut hätte. Aber so war es im Kaiserreich nun mal. Emporkömmlinge wie Rieker, die sich nur einen einzigen Anzug leisten konnten, wurden wie Splitter im Fleisch behandelt: Man versuchte, sie herauszuziehen.
Rieker blieb nur, mit Erfolgen zu punkten. Dass er mit dem Steeker-Fall in Rekordzeit seine zweite Mordermittlung zu einem überraschenden Ende gebracht hatte, würde bei von Stresenbeck, seinem direkten Vorgesetzten, sicher Eindruck machen.
Bevor er aufbrach, um ihm Bericht zu erstatten, strich er mit der Kleiderbürste über sein Sakko und polierte mit einem Lappen den staubigen Schleier weg, der sich auf den Glanz seiner Oxford-Schuhe gelegt hatte. Auch das war eine Lehre Kleinschmidts gewesen: Kleider machen Leute. Natürlich verhalf einem die Garderobe nicht zu einem anderen Stand, aber sie machte die Unterschiede doch immerhin weniger sichtbar.
»Herr Rieker!«, begrüßte Elisabeth Böll ihn mit einem Lächeln. Die Vorzimmerdame des Inspektors legte den Federhalter ab und stand auf.
»Guten Tag, Fräulein Böll«, erwiderte Rieker. »Ist das eine neue Bluse?«
Das Lächeln wurde breiter, und ein roter Schimmer legte sich über ihre Wangen.
»Sie sind der Einzige, dem es aufgefallen ist«, bemerkte sie. Ungewöhnlich kokett fügte sie hinzu: »Gefällt sie Ihnen?«
Bevor Rieker antworten konnte, öffnete sich die dunkel gebeizte Tür, und Criminalinspektor Karl-Wilhelm von Stresenbeck blickte ungeduldig ins Vorzimmer. Zigarrenrauch zog herein.
»Rieker, endlich!«, sagte er und fügte hinzu: »Kommen Sie!« Mit diesen Worten ging er zurück in sein großes Bureau.
Elisabeth Böll verdrehte die Augen.
Rieker grinste und drehte sich in der Tür noch einmal kurz zu ihr um.
»Sehr schön«, formte er tonlos mit den Lippen als Antwort auf ihre letzte Frage.
Von Stresenbeck ließ sich in seinen dunklen Ledersessel sinken. Vor ihm stand eine leere Teetasse auf dem ausladend großen Palisander-Schreibtisch. Von der krummen Zigarre, die in einer flachen Porzellanschale lag, kräuselte sich eine dünne Fahne weißen Rauchs empor, der sich mit der trüben Luft im oberen Drittel des Raums vereinigte. Rieker musste sich räuspern.
»Kommen wir gleich zur Sache, Rieker«, begann der massige Mann mit hoher Stirn und Backenbart. »Wie können Sie es wagen, Raphael Schmidt in Untersuchungshaft zu nehmen? Er ist ein ehrenwertes Mitglied der Gesellschaft und selbst ein Opfer dieses Raubmordes!«
»Offenbar nicht, Herr Criminalinspektor. Er hat soeben gestanden, seinen Untergebenen erschlagen zu haben.«
»Sehen Sie …«, polterte von Stresenbeck weiter, bevor der Sinn von Riekers Worten bis zu ihm durchdrang. »Was hat er getan?«, fragte er dann konsterniert.
»Gestanden, Herr Criminalinspektor. Schmidt hat die Pläne für die Kugelschleifmaschine gestohlen. Steeker hat davon Wind bekommen und versucht, ihn zu erpressen. Um ihn zum Schweigen zu bringen, hat Schmidt den Raubmord inszeniert.«
»Das kann ich kaum glauben! Haben Sie Beweise?«
»Sonst hätte er nicht gestanden«, erwiderte Rieker.
Von Stresenbeck griff nach der Zigarre und fachte sie mit starkem Paffen richtig an. Er dachte nach.
»Ich möchte einen ausführlichen Bericht«, forderte er schließlich.
»Selbstverständlich«, sagte Rieker.
»Wer hätte das gedacht?«, murmelte der Inspektor. Zu Rieker aufsehend fuhr er fort: »Das heißt wohl, der Fall ist abgeschlossen. Umso besser! Dann sind Sie im Moment ja frei.«
»Sie meinen …«
»Sie haben keinen Fall mehr.«
»Ja, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis …«
Der Criminalinspektor schnitt ihm mit einer Geste der Hand, die die Zigarre hielt, das Wort ab. Etwas Asche rieselte auf den Schreibtisch.
»Weitere Fälle kann Breiden übernehmen.«
Rieker bemühte sich, nicht die Augen zu verdrehen. Breiden hatte bisher einige Mühe auf sich genommen, um Rieker aus seiner Stellung zu drängen. Auch wenn sie mittlerweile stillschweigend eine Art Waffenstillstand geschlossen hatten, bedeutete das noch lange nicht, dass sie sich mochten.
»Für Sie habe ich nämlich eine andere, besonders wichtige Aufgabe«, sagte der Vorgesetzte und bekräftigte seine eigene Aussage mit einem bestimmten Nicken. »Wir müssen derzeit verstärkte Aktivitäten der Sozialisten in Hamburg feststellen. Trotz des Verbots durch unseren verehrten Reichskanzler versuchen ihre Rädelsführer, einfache Leute zu ihrer schändlichen Ideologie zu verführen.«
»Sie haben aber hoffentlich nicht vor, mich zur Sozialistenjagd einzusetzen?«, ging Rieker dazwischen.
»Und ob«, brummte der Inspektor. »Sie stammen doch selbst von der Straße und wissen sich dort zu bewegen. Mischen Sie sich inkognito unter die Leute, und finden Sie die Anführer!«
Rieker wusste, dass bereits einige Commissare ihre Dienstzeit in Kneipen verbrachten, um dort Menschen mit sozialistischen Tendenzen zu bespitzeln. Das war das Letzte, was er tun wollte.
»Ich wurde speziell dazu ausgebildet, die Täter von Kapitalverbrechen aufzuspüren«, argumentierte er. »Ich bin kein Spitzel, der Leute verrät, die sich einfach ein besseres Leben für die Armen wünschen.«
»Passen Sie bloß auf, dass Sie nicht selbst wie ein Sozialist klingen!«, warnte von Stresenbeck mit erhobener Stimme. »Vor allem nicht mit Ihrer Vergangenheit!«
Rieker spürte Wut in sich aufsteigen, doch er wusste genau, dass er ihr nicht freien Lauf lassen konnte. Nicht vor diesem Mann. Als Criminalinspektor entschied von Stresenbeck über Gedeih und Verderb seiner Untergebenen. Er musste klug vorgehen.
»Nach der Aufklärung meines ersten Falles hat mir General von Welmensiel persönlich gratuliert und die Erwartung geäußert, dass ich weiterhin viele Kapitalverbrechen aufklären möge. Soweit ich weiß, wollte er diesen Wunsch auch an Sie weitergeben«, brachte Rieker vor, obwohl er ungern seine Beziehungen ausspielte.
Nun, letztlich war von Welmensiel sein einziger Kontakt in der besseren Gesellschaft. Als General war er zwar nicht von Stresenbeck vorgesetzt, besaß jedoch einen im Reich sehr einflussreichen Status.
Riekers Einwand zeigte Wirkung. Von Stresenbeck sah einen Moment aus wie ein Knirps, den man beim Klauen erwischt hatte. Seine Gedankengänge standen ihm förmlich ins Gesicht geschrieben.
Von Welmensiel hatte nach Riekers erstem aufsehenerregenden Erfolg als Commissar vorgeschlagen, man möge seinen Schützling für schwierige Ermittlungen einsetzen, die unkonventionelles Vorgehen verlangten. In der Zeit zwischen zwei Fällen könne man ihn mit einer Erneuerung und Standardisierung der criminalistischen Arbeitsweisen betrauen. Zu diesem Zweck hatte Rieker damit begonnen, den Kontakt zum Chemischen Staatslaboratorium in Hamburg zu intensivieren. Dessen wissenschaftliche Methoden konnten auch bei der Polizeiarbeit von Nutzen sein.
»Herr General von Welmensiel hat keine Befugnisse in Zusammenhang mit der Hamburger Criminalpolizei«, brachte von Stresenbeck endlich hervor. Aber sein Blick war anders als vorher, versöhnlicher. »Ich weiß nicht, warum Sie sich so dagegen sträuben, Rieker. Machen wir es so: Wenn Sie mit einem Mordfall beschäftigt sind, geht das vor. Sollten dem aber keine anderen Ermittlungen entgegenstehen, wird Breiden Ihnen ein paar Lokalitäten nennen, wo Sie sich mal umhören können.«
»Meinen Sie das ernst?«
»Das ist ein Befehl, Rieker!«, schimpfte der Inspektor. »Und jetzt raus!«
Rieker rauschte aus dem Büro. Mit einem entschiedenen Nicken verabschiedete er sich von Fräulein Boll, dann ließ er die schwere Tür mit Schwung ins Schloss fallen.
2. Kapitel
Hamburg. Samstag, 14. Mai 1887
»À votre santé«, prostete Emilie Hogenstedt ihnen mit erhobener Champagnerschale zu. Die Wangen der Gastgeberin leuchteten rosig.
»À la tienne«, erwiderten ihre Gäste.
Johanna Ahrens nahm einen vorsichtigen Schluck. Sie wusste, dass ihr das prickelnde Getränk sonst schnell zu Kopf steigen würde.
Mit ihren dreiundzwanzig Jahren war sie genauso alt wie Emilie. Die anderen Mädchen, die sich vom Trubel des Festes kurz in das Privatzimmer der Gastgeberin zurückgezogen hatten, waren alle jünger. Die kichernden Thienemann-Zwillinge wurden im Juni volljährig, Tanja Hagedorn war zwanzig und Roswitha Amsinck mit achtzehn das Nesthäkchen. Johanna erinnerte sich, wie sie früher bei den Gartenfesten ihrer Eltern in weißen Kleidchen zwischen Rosen Verstecken gespielt oder mit ihren Käschern Schmetterlinge gejagt hatten. Sie waren Freundinnen gewesen, doch das Erwachsenwerden hatte für jede von ihnen andere Richtungen vorgesehen.
»Ist dir morgens übel?«, fragte Tanja.
Emilie verdrehte die Augen. »Manchmal ist es wirklich arg«, klagte sie. »Aber eine gute Ehefrau nimmt solche Beschwernisse für ihren Gemahl und die Familie mit Freuden in Kauf.«
»Hoffentlich wird es ein Stammhalter«, sagte Margarete Thienemann. Ihre Schwester Patrizia nickte zustimmend.
»Ein Junge wäre natürlich ideal als Erstgeborener«, schwärmte Emilie. »Dann kann er später auf seine Schwestern achtgeben.«
»Wie viele Kinder wollt ihr denn?«
»So viele, wie der Herrgott uns schenken mag!«
»Wenke bekommt bald ihr viertes«, meldete sich Tanja zu Wort.
Wenke war ihre Cousine und früher Johannas engste Freundin gewesen. Sie hatte mit gerade achtzehn Jahren Patrick von Weppenberg geheiratet und war bisher, bis auf kurze Pausen nach den Geburten, während ihrer gesamten Ehe schwanger gewesen.
»Wie schön!«, jubelten die Zwillinge.
Johanna sank, samt ihrer Champagnerschale, missmutig in die opulente Kissenpracht zurück. Sie bemerkte Roswithas gelangweilten Blick und war froh, dass sie offensichtlich nicht die Einzige war, die auch über andere Dinge als Ehe und Schwangerschaft sprechen wollte.
»Habt ihr gelesen, dass Reichskanzler Bismarck sich erneut gegen einen besseren Schutz von Wöchnerinnen ausgesprochen hat?«, fragte Johanna in die Runde.
»Ach, du immer mit deiner Politik«, erwiderte Emilie gelangweilt.
»Wenn eine Arbeiterin ein Kind zur Welt bringt, bekommt sie gerade mal drei Wochen lang die Hälfte ihres Lohns fortgezahlt. Drei Wochen!«
»Aber man darf es auch nicht übertreiben«, schaltete Tanja sich ein. »Papa sagt, die Frauen sollten sich glücklich schätzen, dass sie weiterhin einen Teil ihres Lohns erhalten, obwohl sie nichts leisten.«
»Meinst du wirklich, eine Frau würde nach einer Geburt nichts leisten?« Johanna bemühte sich, ruhig zu bleiben.
»Dass eine von denen schwanger wird, ist doch nicht die Schuld des Fabrikanten«, erwiderte Tanja mit einem Funkeln im Blick. »Für Papa bedeutet jede schwangere Arbeiterin große Verluste, weil sie schon Wochen vor der Geburt viel schlechter arbeitet. Und dann muss er sie auch noch dafür bezahlen, dass sie zu Hause bleibt. Wenn es mehr Männer gäbe, würde er gar keine Frauen mehr nehmen. Oder nur alte.«
Johanna sprang so empört auf, dass der Champagner aus ihrer Schale auf den Teppich spritzte.
»Wir werden jetzt dieses Gespräch über Politik beenden!«, fauchte Emilie und funkelte Johanna an.
Sie atmete tief durch. »Ich komme selbstverständlich für die Reinigung des Teppichs auf«, versprach sie. »Verzeih bitte das Missgeschick.«
»Ach, es ist ja nur Champagner«, gab Emilie zurück. Sie klang schon wieder etwas freundlicher. »Das soll uns heute nicht stören. Das Mädchen soll sich darum kümmern. Aber wir wollen feiern! Lasst uns zur Gesellschaft zurückkehren!«
Das Fest zur offiziellen Verkündigung, dass Bert Hogenstedt und seine Gemahlin Emilie ihr erstes Kind erwarteten, fand in der Villa des jungen Paares und in deren großzügigem Garten statt. Auf dem Rasen hatten Diener weiße Sonnensegel über Sitzgruppen mit Korbmöbeln aus den Kolonien aufgespannt. Die älteren Gäste saßen an konventionelleren Tischreihen oder standen in kleinen Gruppen zusammen, die Kinder tobten herum.
Johanna machte die stattliche Gestalt ihres Vaters, Richter Hans Ahrens, aus. Er rauchte etwas abseits mit Gleichgesinnten und gönnte sich einen Weinbrand. An seinem Bauchumfang erkannte man, wie wichtig ihm gutes Essen war.
Ihre Mutter hingegen, die sich unweit von ihr mit mehreren Frauen austauschte, achtete sehr auf die schlanke Linie. In ihrem blauen Kleid mit dem weißen Spitzenkragen sah sie jünger aus, als sie war.
Als hätte sie Johannas Blicke gespürt, drehte sie sich zu ihr um. Sie entschuldigte sich bei den Damen und kam umgehend auf Johanna zugeeilt.
»Du sollst doch Bescheid sagen, wohin du gehst!«, flüsterte sie und hielt ihre Tochter am Arm zurück.
»Ich war nur kurz mit den anderen weg, Maman«, erwiderte Johanna. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.«
»Es ist noch keine drei Wochen her, dass man dich …« Sie schaute sich gehetzt um und sprach erst weiter, als sie sich vergewissert hatte, dass niemand in Hörweite war: »Wie soll ich mir da keine Sorgen machen!«
Johanna sah ihre Mutter verwundert an. Minna Ahrens hatte es schon immer als wichtigste Aufgabe einer guten Ehefrau verstanden, Haus und Familie vor Skandalen und Gerede aller Art zu bewahren. Schlimm genug, dass ihre Tochter mit dreiundzwanzig Jahren drohte, ein ältliches Fräulein zu werden, statt einem Ehemann das Leben zu versüßen und ihr endlich Enkel zu schenken. Aber dass ihr einziges Kind sich zu allem Überfluss für feministische und gar sozialistische Ideen begeisterte, störte sie ungemein.
Minna Ahrens empfand es geradezu als Schande für die ganze Familie, dass ihre Tochter sich jüngst von zu Hause fortgestohlen und in den Hamburger Gängevierteln arme Frauen unterrichtet hatte. Nach dem Verschwinden einer der Schülerinnen war Johanna einem brutalen Verbrecher auf die Spur gekommen und selbst in dessen Fänge geraten. Die Einzelheiten dessen, was vor drei Wochen geschehen war, hatten Johanna und ihr Vater für sich behalten. Ihre Mutter hatte sie auch gar nicht erfahren wollen. Stattdessen hatte sie Johanna nach der Rettung durch Criminalcommissar Hermann Rieker weinend in die Arme genommen, ihr anschließend eine Ohrfeige verpasst und dann darauf bestanden, dass von nun an nicht mehr darüber gesprochen werden solle. So war Maman nun einmal: In ihrer Welt hielt man das Böse außen vor, indem man es nicht zum Thema machte. Umso erstaunlicher fand Johanna es, dass sie ihre Sorge nun offen aussprach.
»Ich finde es immer noch falsch, dass du nicht mitkommst zu deinem Onkel Fred«, sagte sie.
»Maman, wir haben doch schon darüber gesprochen, dass ihr fahren könnt, ohne euch Gedanken machen zu müssen.«
»Ich werde verrückt, wenn ich nicht weiß, wo du steckst«, sagte ihre Mutter ganz leise und umfasste Johannas Hände.
»Ich weiß, aber deine Sorgen sind unbegründet. Ich werde mich außer zum Reiten oder zu Besorgungen nicht aus dem Haus entfernen. Ihr könnt wirklich fahren.«
»Ach, hättest du wenigstens einen Mann, dann wäre es leichter für mich. Was ist mit Löhnig? Seine Frau ist jetzt seit einem Jahr tot. Er will bestimmt nicht länger Witwer sein als nötig.«
»Louis-Bertram Löhnig?«, fragte Johanna ungläubig. Doch das Nicken ihrer Mutter zeigte, dass sie genau diesen meinte. »Maman! Er hat eine Glatze und zwei Kinder.«
»Ach, die lieben Kinder sind ja noch klein. Und wenn er sein Haar über den Kopf legt, fällt die hohe Stirn kaum auf. Bert ist auch fast fünfzehn Jahre älter als Emilie, und sieh nur, wie glücklich die beiden sind! Jetzt rede doch einfach mal mit ihm!«
»Nein.«
»Ich habe ihm aber avisiert, dass du dich über eine Aussprache freuen würdest.«
»Was hast du getan?«
»Er ist ein angesehener Steuerrevisor …«, erklärte ihre Mutter, ohne den Satz zu beenden.
»Steif wie ein Stockfisch ist er!«
»Ach was! Du kennst ihn doch kaum. Er hat einen sehr guten Ruf. Viele hier wenden sich vertrauensvoll an ihn.« Sie zeigte in die Runde, bis sie ihn fand. »Sieh doch! Er schaut gerade her!«
Reflexartig blickte Johanna zur Seite – und bereute es im gleichen Moment. Löhnig senkte kurz den Kopf und winkte ihnen mit einem schüchternen Grinsen.
»Mach schon!« Ihre Mutter stach ihr mit einem Finger in den Rücken.
»Das hat wehgetan!«, flüsterte Johanna und deutete in Richtung des Mannes einen Knicks an.
»Dann benimm dich!«, raunte ihre Mutter und schenkte dem nun Herantretenden ein aufmunterndes Lächeln.
»Es ist immer so schön, Sie zu sehen, verehrtes Fräulein Johanna«, sagte er und hob eine Hand, um ihre zu ergreifen, die sie noch gar nicht vorgestreckt hatte. Ihr blieb nichts anderes übrig, als sie ihm für den Handkuss zu reichen, den er durchaus geübt zu geben verstand.
»Das Vergnügen liegt auf meiner Seite, Herr Löhnig.«
»Herr Löhnig«, wiederholte er. »Das klingt so … so steif. So formell. Nennen Sie mich doch Louis-Bertram!«
Johanna nickte, ohne etwas zu erwidern. Eine kurze Pause entstand.
»Wenn man mich besser kennenlernt, staunen viele, wie … wie unkonventionell ich sein kann«, bemerkte er. »Manchmal denke ich, dass man es beinahe extravagant nennen könnte.«
»Wirklich?«, fragte ihre Mutter erstaunt. »Ach, bitte entschuldigen Sie, lieber Löhnig. Man erwartet mich.«
Johanna hatte weder ein Rufen gehört noch ein Winken wahrgenommen, doch Louis-Bertram Löhnig überprüfte die Aussage ihrer Mutter nicht, sondern wandte sich nach der kurzen Verabschiedung wieder Johanna zu.
»Ihre Frau Mutter sagte, Sie seien eine gute Reiterin?«
»Sie übertreibt. Ich reite höchstens ganz passabel. Ein wenig versuche ich mich in der Dressur.«
»Oh, die hohe Kunst des rittigen Pferdes. Ich wusste gar nicht, dass Damen sie ausüben.«
»Wieso sollten sie nicht?«
»Weil die Hilfen im Damensattel ganz andere sind?«
»Ihrer Expertise entnehme ich, dass Sie selbst Reiter sind?«
Er grinste und schob eine Haarsträhne, die sich im leichten Wind selbstständig gemacht hatte, zurück an ihren Platz.
»Früher habe ich die Pferde öfter bewegt. Doch seit …« – er stockte, als überlege er, ob er den Satz fortsetzen sollte – »… meine selige Frau Gemahlin verstorben ist, hat sich vieles verändert.«
»Ihr Verlust tut mir leid«, sagte Johanna weicher.
»Ich danke Ihnen von Herzen. Sie starb vor etwas mehr als einem Jahr. Aber … ich wollte unser so fröhliches, so sorgloses Gespräch eigentlich nicht mit einem Schatten belegen. Ich muss sagen, es ist äußerst erquicklich, sich mit Ihnen zu unterhalten.«
»Hmmm«, brachte Johanna hervor. Dem schloss sich eine weitere Pause an.
»Ich muss sagen, liebe Johanna, dass dieses Kleid Ihnen ausgesprochen gut steht.«
Johanna lächelte zaghaft. Sie bemühte sich, dem Mann keine falschen Hoffnungen zu machen.
»Ich möchte gar so kühn sein zu sagen, dass Sie eine außergewöhnliche Schönheit sind.«
»Herr Löhnig!«, warf Johanna mahnend ein.
»Wir waren doch bei Louis-Bertram«, erinnerte er sie.
»Herr Löhnig. Ich weiß nicht, was meine Mutter Ihnen gesagt hat, aber ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich sie nicht dazu ermutigt habe. Es liegt mir fern, bei diesem Fest neue Bekanntschaften zu machen.«
»Oh. Ich wollte Ihnen auf keinen Fall zu nahe treten. Bitte verzeihen Sie meine Kühnheit, mein inneres Drängen, liebes Fräulein.«
»Selbstverständlich. Bitte entschuldigen Sie, ich habe gerade eine Bekannte entdeckt, die ich begrüßen möchte. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen.«
»Natürlich«, sagte Löhnig mit einer zackigen Verbeugung, die die über die kahle Stelle gelegte Haarsträhne wieder in Bewegung brachte.
Johanna rauschte davon. Den Witwer so vor den Kopf gestoßen zu haben, tat ihr leid. Aber manchmal war es besser, für klare Verhältnisse zu sorgen. Was hatte sich ihre Mutter bloß dabei gedacht?
Als sie sich umblickte, stellte sie fest, dass Löhnig ihr noch nachblickte. Er winkte, doch sie tat so, als habe sie es nicht bemerkt, und wandte sich den übermannshohen Rhododendren zu, deren Blüten farbprächtig das dichte, dunkle Blattwerk bedeckten.
Der Kiesweg führte zwischen den Büschen hindurch in den etwas wilderen Teil des Gartens. Hier gefiel es ihr besser. Johanna mochte Emilie und ihre Freundinnen gerne. Sie gönnte ihr das Glück mit Bert und dass es bald mit einem ersten Kind gekrönt werden würde, aber heute war es ihr zu viel. Ständig spürte sie die Blicke auf sich, mit denen die anderen Gäste sich vergewisserten, ob sie wieder allein oder nur mit den Eltern gekommen war. Jeder fragte, ob sie endlich jemanden kennengelernt habe. Johanna kam sich fast ein wenig wie eine Aussätzige vor.
Sie stutzte. Vom Kiesweg ging ein schmalerer Pfad ab, der sich zwischen zwei Büschen zu einem geschützten Platz schlängelte. Dort stand – etwas versteckt – eine Bank, und auf dieser saß ein junger Mann, der in ein Buch vertieft war. Er hatte wohl Johannas Schritte gehört, denn er sah auf und schloss den dicken Wälzer, beließ aber einen Finger als Lesezeichen zwischen den Seiten. Dann erhob er sich.
»Verzeihen Sie«, sagte sie. »Ich habe Sie vom Weg aus gesehen.«
Der Mann war keine dreißig Jahre alt, schlank und trug einen modernen Anzug, der an seinem breit gebauten Oberkörper richtig verwegen wirkte. Wache blaue Augen saßen in einem nicht unbedingt schön zu nennenden Gesicht und fuhren blitzschnell ihre Gestalt ab, um sich dann auf ihr Antlitz zu konzentrieren.
»Sie wünschen?«
Johanna wurde sich der Ungehörigkeit bewusst, als junge Frau einen Mann anzusprechen.
»Ich habe mich gefragt …«, antwortete sie etwas beschämt. Sie musste sich räuspern. »Verzeihen Sie bitte. Ich habe mich gefragt, welches Buch Sie so in seinen Bann zieht.«
Er sah sie etwas interessierter an. »Sie werden es nicht kennen«, prophezeite er und hielt es hoch. Auf dem Leinenumschlag stand Die Elenden und als Name des Autors Victor Hugo.
»Ich habe von ihm bisher nur Notre-Dame in Paris gelesen«, gab Johanna zurück.
»Ah, die Geschichte von Quasimodo und Esmeralda. Das ist etwas ganz anderes.«
»Worum geht es in diesem Werk?«
»Um dramatische Schicksale von Proletariern, die von der Obrigkeit in Armut, Leid und Unterdrückung gezwungen werden.«
Johanna horchte auf. »Das klingt interessant.«
»Mit dieser Meinung dürften Sie auf diesem Fest recht allein dastehen.«
Johanna lächelte scheu. »Ich denke nicht. Immerhin sind wir schon zu zweit.«
Er lächelte zurück und verbeugte sich. »Jan Freisfeld. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen.«
»Johanna Ahrens. Ich freue mich ebenfalls sehr.« Sie reichte ihm die Hand, und er ergriff sie. Allerdings hauchte er ihr keinen Kuss darauf, sondern führte sie zu der Bank und forderte sie auf, sich zu ihm zu setzen.
Mit klopfendem Herzen nahm Johanna neben ihm Platz.
3. Kapitel
Hamburg. Dienstag, 24. Mai 1887
Die Plätze an den Tischen im Nebenzimmer des Barmbeker Hofs waren ausnahmslos von Männern besetzt. Neuankömmlinge trugen Stühle heran und stellten sie an der Wand mit dem übergroßen Gemälde eines pflügenden Bauern auf.
Vor Rieker stand ein halb volles Glas Winterhuder Bier. Zwei Kellnerinnen, sichtbar Mutter und Tochter, huschten mit je einem riesigen Bierkrug um die Tische und füllten leere Gläser nach.
»Woher kommst du?«, fragte der bärtige Mann, der neben Rieker Platz genommen hatte.
»Aus der Stadt.«
»Bist du mit dem Wagen gekommen?«
»Mitgenommen worden«, antwortete er kurz angebunden.
Als Rieker zum Criminalcommissar befördert worden war, hatte er all seine Ersparnisse aufgebraucht, um sich bei Frantzen am Großen Burstah einen Anzug samt Weste, Stock und Schuhen zuzulegen. Doch mit dieser Kleidung hätte man ihn hier sicher nicht hereingelassen, also trug er seinen alten, schlichten Anzug, der an den Schultern etwas kniff.
Der Bärtige ließ sich von der Kürze der Antworten nicht abschrecken.
»Und wo arbeitest du?«, setzte er seine Befragung fort.
Rieker vermutete, dass er es mit einem Wächter zu tun hatte. Seit die Hamburger Polizei sich inkognito in Kneipen herumtrieb, um rote Machenschaften aufzudecken, steuerten die Sozialisten dem entgegen. Sie platzierten eigene Leute im Publikum, die Polizisten erkennen und aus dem Saal verweisen sollten, bevor die illegalen Reden begannen.
»In Altona«, antwortete er. Das war weit genug weg von Barmbek, doch dem Mann reichte das nicht.
»Ah, da wohnt mein Bruder«, sagte er. »Wo genau arbeitest du denn, Genosse?«
»Bei der Actien Brauerei«, log Rieker. Die war ihm als Erstes eingefallen, weil er von seiner Wohnung über der Kneipe Dree Düwel deren Türme sehen und nahezu ständig den Sud riechen konnte.
Riekers Gegenüber zeigte sich interessiert. »Und? Wie findest du das Winterhuder?«
»Besser als sein Ruf«, scherzte Rieker und hob dem Bärtigen sein Glas entgegen. »Hermann«, nannte er seinen echten Vornamen und ergänzte den ersten Nachnamen, der ihm einfiel: »Hermann Schmidt.«
»Wilhelm Metzger, Hamburger Bürgerzeitung. Es ist gut, Genossen aus dem Brauwesen in der Bewegung dabeizuhaben. Zum Wohl!«
Rieker kannte die Hamburger Bürgerzeitung. Das Blatt war eng verbunden mit der SAP, der Sozialistischen Arbeiterpartei. Offenbar hatte er den Test bestanden, denn Metzger trank, klopfte auf den Tisch, stand auf und zog weiter. Ein anderer Gast nahm den frei gewordenen Platz ein.
Heute war Riekers erster unfreiwilliger Einsatz als Sozialistenjäger. Bei zwei anderen Anforderungen war etwas dazwischengekommen, was ihm ganz recht gewesen war. In der Zwischenzeit hatte er begonnen, Pläne für ein stadtweites Verbrecherverzeichnis zu erarbeiten. Doch gestern hatte jemand von Stresenbeck gesteckt, dass hier eine bedeutende Versammlung stattfinden sollte, und Rieker hatte sich dem Befehl nicht widersetzen können.