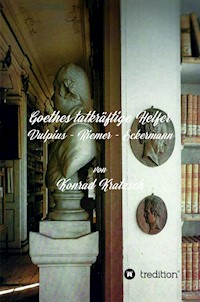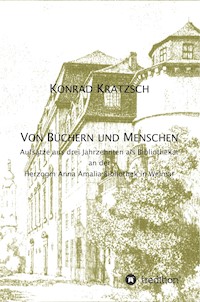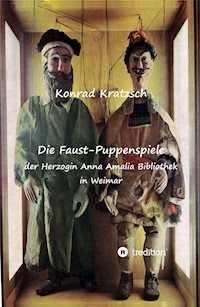
5,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Konrad Kratzsch, langjähriger Mitarbeiter der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, der sich auch durch die Betreuung von Faksimile-Drucken wie der "Schedelschen Weltchronik", der Weimarer "Biblia pauperum" und anderen Kostbarkeiten um die Zimelien des Hauses verdient gemacht hat, legt hier einen bisher ungehobenen Schatz aus der "Faust-Sammlung" vor, von dem er vor Jahren auch eine Transkription angefertigt hat. Die "Puppenspiele von Doktor Faust" aus der Sammlung Dr.Stumme, die nicht in die grundlegende Faust-Bibliographie von Hans Henning aufgenommen worden waren, sollen so in ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung etwas mehr in den Blickpunkt gerückt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Konrad Kratzsch
Die Faust-Puppenspiele der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar
© 2021 Konrad Kratzsch
Autor: Konrad Kratzsch
Erstveröffentlichung in: Aurora. Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft. Bd. 62. - Tübingen: Niemeyer 2002.
Umschlaggestaltung: Martin Holtzhauer unter Verwendung der Abb. „Faust und Mephisto. 2 mechanische Puppen.“ aus: H. Holtzhauer. Goethe-Museum. Berlin u. Weimar: Aufbau-Verl. 1969
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:
978-3-347-28291-9 (Paperback)
978-3-347-28292-6 (Hardcover)
978-3-347-28293-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Puppenspiel führt neben den großen Theaterproduktionen nur ein bescheidenes Dasein. Seine Art der Darbietung lässt, wenn man von Fernsehaufführungen absieht, nur einen kleinen Zuschauerkreis zu, was dann auch zu einer geringeren Wirkung und Verbreitung führt.
Der Zugang zu den großen Dramen der Weltliteratur ist heute leicht, sie liegen in vielfältigen Original- und Übersetzungsausgaben in unterschiedlichsten Editionen bis hin zum Hörbuch vor. Anders ist es mit dem Puppenspiel. Da es über eine lange Zeit nur mündlich überliefert wurde, sind handschriftliche oder gar gedruckte Zeugnisse recht selten.
In der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu Weimar befinden sich zweiunddreißig solcher Texte, die handschriftlich - nur wenige Abschriften wurden mit der Schreibmaschine geschrieben - aufgezeichnet, wertvolle Zeugnisse dieser alten Kunst darstellen. Sie sind ein Bestandteil der „Faust-Sammlung“, die mit ihren mehr als 13 000 Sammlungsstücken eine einmalige Kollektion von höchstem kulturgeschichtlichem Wert darstellt.
Ausgehend von diesem Bestand hat Hans Henning, der frühere Direktor der Bibliothek, bereits vor Jahren seine große, grundlegende Bibliographie zum Faust-Stoff vorgelegt.1
Nachdem bereits in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die Sammlung des Faustforschers Alexander Tille, der sich vornehmlich mit den sogenannten „Faust-Splittern“ und mit Erwähnungen Fausts in der Literatur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert beschäftigt hatte, von der Goethe-Gesellschaft erworben worden war, konnte in den fünfziger Jahren auch die umfangreiche bedeutende Sammlung zum Faust-Thema des 1955 verstorbenen Leipziger Arztes Gerhard Stumme2 durch die damalige „Zentralbibliothek der deutschen Klassik“ bei den „Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur“ erworben werden. Diese Sammlungen bilden den Grundstock für jenen Sonderbestand der Herzogin
Anna Amalia Bibliothek, die damit heute wohl eine der größten Kollektionen zum Faust-Thema in aller Welt besitzen dürfte.
Aus dem Besitz Gerhard Stummes stammen nun jene zweiunddreißig handschriftlich aufgezeichneten Texte von Faust-Puppenspielen. Hans Henning hat sie aus unerklärlichen Gründen damals leider nicht mit in seine Bibliographie aufgenommen, so daß von ihrer Existenz bis heute nicht allzu viel bekannt ist.
Stumme beschreibt in seinen Erinnerungen, wie er zu diesen Texten kam: „In der Nachkriegszeit wurde vieles veräußert, was bisher in festen Händen war. So gelang es mir, von Puppenspielern Manuskripte zu erhalten und dadurch eine Lücke der Sammlungfast zu schließen. Zwar war das Faust-Puppenspiel schon in zahlreichen Drucken vorhanden, deren Zahl in allen möglichen und unmöglichen Fassungen bis auf achtzig anwuchs, doch fehlten Handschriften so gut wie völlig. Von Johann August Billes altem Buche aus dem Jahre 1813, in Ehrhardts3 Besitz befindlich, hatte ich schon 1906 eine Abschrift nehmen können, ebenso 1907 von der weniger wichtigen Ulmer Dokken-Komödie. Ich kannte die Namen zahlreicher Puppenspieler durch die von Ehrhardt erworbenen Zettel. Dies weckte den Wunsch nach den echten Spielbüchern. Im Jahre 1920 kam ich, - ich weiß nicht mehr, auf welche Weise - mit dem Puppenspielergehilfen Kirmse in Wilkau bei Zwickau in Verbindung, der schon lange Zeit vorher Ehrhardt in Zwickau und Plauen beim Sammeln von Puppenspielen geholfen hatte. Kirmse hatte zwar, wie er sagte, von anderen Stücken im Original oder in Abschrift hunderte bereitliegen, hielt aber bei „Doktor Faust“ die Sache für wenig aussichtsreich. Allmählich gelang es ihm mit meiner Hilfe und durch Reisen im Vogtlande und in der Chemnitzer Gegend, neun Originalbücher aufzutreiben. Darunter befanden sich auch zwei ältere, das von Constantin Bonneschky aus dem Jahre 1850 und das von Zapf aus dem Jahre 1865. Kirmse nahm darüber hinaus von anderen Stücken Abschriften4. Kirmse ging wenige Jahre später zum Kino über, in dieser Zeit für einen Puppenspieler nichts Ungewöhnliches. Seit 1929 hörte ich nichts mehr von ihm. […] Den Schluß bildeten meine lesbare Übertragung eines Faust-Puppenspiels aus dem Repertoire des deutsch-ungarischenPuppenspielers Johann Hinz. Nach dessen Aufzeichnungen hatte seine Familie in den Jahren 1842 bis 1895 in Ungarn, Bosnien, Serbien und Rumänien gespielt. Das Manuskript befindet sich in der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest. Es wurde 1925 von Robert Gragger in der Josefstädter Mundart phonetisch veröffentlicht Die Wiedergabe in verständlichem Schriftdeutsch gelang mir nach achtmaligem Durchlesen bzw. Lautlesen.“5
Stumme berichtet dann weiter von seinen Bekanntschaften mit den Puppenspiel-Sammlern Professor Oertel aus Schweinfurt und dem Apotheker Löwenhaupt in Offenburg, sowie dem Senior der Puppenspielforscher, Professor Kollmann.
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Puppenspieltexten hat erst in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eingesetzt und gipfelt vorerst in der Dissertation von Gerd Eversberg von 1988.6
Auf Hennings Bibliographie zum Fauststoff wie auf Eversbergs Dissertation sei nachdrücklich hingewiesen.
Eine der frühesten zusammenfassenden Darstellungen und Aufbereitungen des bis dahin vorliegenden Textmaterials legte Johann Scheible in Zelle 19 „Faust auf der Volksbühne“ seiner großen kulturgeschichtlichen Darstellung „Das Kloster“ von 18477 vor. In der Abhandlung V über die älteste dramatische Bearbeitung der Faustsage aus dem Jahre 18368 bietet der Verfasser den Inhalt eines Faust-Spiels aus dem Gedächtnis, das er der „romantischen Poesie“ (S. 719) zuordnet. Unter VI. wird eine Arbeit Friedrich Heinrich von der Hagens aus dem Jahre 1841 geboten9, in der dieser den Puppenspieler Schütz nach der Überlieferung seines Puppenspiel-Textes befragt und jener behauptet, diese erfolge nur mündlich, was von der Hagen anzweifelt und berichtet, wie Zuhörer solche Stücke aufgeschrieben hätten: „Indessen hatten sich schon im J. 1807-8 mehrere Bekannte verabredet, den Faust, während dessen häufiger Wiederholung aufzuschreiben;
[…]“ (S. 732). Anhand solcher Quellen hat schließlich Karl Simrock eine mehr oder weniger kompilierte, überarbeitete „Ur“-Fassung hergestellt10. Er beschreibt das in der Vorrede zu seiner Ausgabe von 1846 mit ähnlichen Worten: „Bekanntlich lehnte Schütz alle Anfragen über das Manuskript seines Puppenspiels mit der Versicherung ab, daß es nur im Gedächtnis aufbewahrt würde. Sollte gleichwohl einmal eine schriftliche Aufzeichnung zutage kommen, so wird sie von der meinigen schwerlich in Hauptzügen abweichen.“11 Von solcherart Überlieferung vermittelt Karl von Holtei, der selbst genügend Erfahrungen mit fahrenden Leuten besaß, in seinem Roman „Die Vagabunden“12 einen Eindruck. Er beschreibt das so: „Lassen Sie mich, rief er aus, gleich heute mein Probestück ablegen; vertrauen Sie mir einige Röllchen an. Wo ist das Buch, aus welchem Sie spielen? Ich will‘s eiligst überlesen, und dann mögen Sie entscheiden, ob Sie mich gebrauchen können.
Ein Buch? antwortete Herr Dreher; ein Buch, mein Lieber, giebt es nicht; weder die Belagerung von Bethulia, noch irgend ein ander Stück ist aufgeschrieben. Wir Puppenspieler sind eine alte Zunft, ein Ueberbleibsel aus ‚die finstere Zeiten!‘ Bei uns erbt sich‘s von Vater auf Sohn, Einer lernt vom Andern auswendig, und hernach trägt er die ganze Geschichte im Kopf mit sich herum. Jeder von uns hat müssen einen Schwur ablegen, daß er niemals eine Zeile niederschreiben will, damit‘s nicht in unrechte Hände kommt, die uns das Brot wegnehmen. Jetzund leben unserer vielleicht noch vier, oder drei, von der Nürnberger Schule. Wenn wir ausgestorben sind, sterben unsere Komödien mit uns aus, Denn das Gelübde müssen wir halten, Bei mir findet sich nach meinem Tode auch nicht eine Sylbe vor, nicht von gedruckt. nicht geschrieben, In Berlin freilich haben sie einen Collegen von mir garstig betrogen. Da sind die Gelehrten hinterd‘rein gewesen und haben sich den Doctor Faust so oft vorspielen lassen, daß sie endlich das ganze Stück mit Bleifedern während der Aufführung auf Papier gebracht, und einer - Horn, glaub ich, war sein Name - hat‘s gar drucken lassen. Das nenn ‘ ich gestohlen.“
Solcherart Übermittlung des Textes ist sicher der Anlaß dafür, daß in den erhaltenen, gegen Ende des vorigen und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts aufgezeichneten Texten sich einige Grundmuster erkennen lassen, die Stücke sich aber in so manchen Details unterscheiden. Betrachtet man die zweiunddreißig Stücke der Stummeschen Sammlung und vergleicht sie mit den frühen gedruckten Zeugnissen aus dem „Kloster“, so wird das offensichtlich. Bearbeitungen von Germanisten wie Karl Simrock oder Carl Höfer folgen mehr einem artifiziellen Interesse, in dem sie die Szenen der einzelnen Stücke auseinandernehmen und wie Versatzstücke einander neu zuordnen und verbinden, um so ein „Ur-Stück“ zu rekonstruieren, das der gültigen Dramentheorie entspricht. Damit drohen sie jedoch die Perspektive zu verschieben, weil sie die Logik des Aufbaus und die sprachliche Ausformung zu sehr glätten.
Folgt man den bei Scheible abgedruckten Texten, so ergibt sich folgende Grundstruktur des Faust-Puppenspiels: 1. Faust hadert mit seinem Schicksal. - Nur im Ulmer und im Straßburger Puppenspiel setzt die Handlung mit der Beschwerde des Charon13 ein, der sich über den Rückgang seines Fährlohns beklagt, weil zu wenig Menschen in die Unterwelt gebracht werden müssten. - 2. Faust erhält eine Zauberanleitung. - 3. Kasper wird als Diener angestellt. - 4. Faust beschwört die Unterirdischen, befragt sie nach Namen und Schnelligkeit. Daraus wählt er den geschwindesten, Mephistopheles, aus, der angibt, so schnell wie des Menschen Gedanken zu sein. - 5. Kasper beschwört ebenfalls die Teufel, mit denen er dann Schabernack treibt, sich selbst aber nicht für die Hölle gewinnen läßt. - 6. Faust schließt einen Vertrag mit dem Teufel auf eine bestimmte Zeit. - 7. Faust am Hofe des Herzogs von Parma. Er läßt historische oder biblische Gestalten erscheinen. - 8. Faust muß vor einem Mordanschlag aus Parma fliehen. - 9. Kasper, zur Strafe von Faust in Parma zurückgelassen, weil er dort den Namen seines Herrn preisgegeben hatte, kehrt mit teuflischer Hilfe nach Wittenberg zurück, wo er dann als Nachtwächter tätig ist. Der Weg dorthin führt ihn durch die Hölle, wo er die Höllenstrafen kennenlernt und sieht, welche Marter dereinst Faust erwartet. - 10. Faust versucht am Ende seines Lebens den Weg zurück zum Heil zu finden. - 11. Mephistopheles gewinnt wieder Gewalt über Faust, in dem er diesem eine Verbindung mit der schönen Helena vorgaukelt, die sich aber dann in eine höllische Furie verwandelt. - 12. Fausts Wehklage und jämmerliches Ende.
Diesem Grundschema folgen die bei Scheible abgedruckten Texte: die von Johann Leutbecher 1838 veröffentlichte Fassung, die Franz Horn in seiner „Geschichte der deutschen Poesie und Beredtsamkeit“ erwähnte (1), die von der Gesellschaft von Schütz und Dreher aufgeführte Fassung, die Friedrich Heinrich von der Hagen 1841 vorstellte (2); jenes Spiel, das Emil Sommer in Ersch/Grubers „Allgemeiner Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste“ 1845 (3) beschreibt; das Geißelbrechtsche Puppenspiel, das bereits 1832 durch Oberst von Below in 24 „buchstäblichen Abdrucken“ veröffentlicht worden war (4), weiter der Text des Ulmer Puppentheaters (5), die Bearbeitung Christoph Winters für das Kölner Puppentheater (6) und die Fassungen für das Augsburger (7) und das Straßburger Puppentheater (8).
Bereits im 1. Akt unterscheiden sich die Texte, der jeweiligen Intention ihrer Spieler folgend. Wie gravierend das sein konnte, belegt eine Notiz im Textbuch Geißelbrechts, der gegen Ende seines Lebens solche Stellen aus der Aufführung gestrichen wissen wollte, die gegen den christlichen Glauben verstießen. Faust sucht zunächst den Weg über die Nekromantie, über die Geisterbeschwörung, zu den Unterirdischen, um Reichtum zu erwerben, der seine mißliche wirtschaftliche Lage verbessern soll, dann erstrebt er mit Hilfe der Unterirdischen in der Wissenschaft zu höchstem Ruhm und Gelehrsamkeit zu gelangen, um damit Reichtum zu erwerben. Dabei geht die Aktivität von Faust aus. Ein anderer Aspekt aber ist der, daß der Fährmann Charon sich bei Pluto, dem Herrn der Unterwelt (Hades), beschwert, daß sein Fährlohn immer weniger würde, weil er nicht mehr so viele Sünder über den Acheron zu bringen habe, worauf Pluto seine Teufel beauftragt, mehr verworfene Seelen zu gewinnen, um für Charon einen höheren Gewinn zu sichern.
Damit geht die Aktivität auf den Teufel über, Faust ist hierbei nur noch Opfer, er ist damit von vornherein verloren, denn er ist nur Spielball der höllischen Mächte. Er wird somit unschuldig schuldig. So strebt Faust danach, sich mit Hilfe des Teufels „höhere Genüsse zu bereiten und in die Geheimnisse einzudringen“. (1) - Faust, verlacht, ohne wissenschaftlichen Erfolg, ist am Ende. Da erklärt ihm ein Abgesandter des Plutonischen Reiches, daß er ihn glücklich und vollkommen auf der Oberwelt machen wolle. (2) - Als Faust sich über die Vergeblichkeit seiner Studien beklagt, verspricht ihm die höllische Stimme Ruhm. (3)
Geißelbrecht beginnt die Situation mit einem Vergleich, nach dem der Tagelöhner besser entlohnt werde als der Wissenschaftler. Mit dem Tagelöhner aber wolle sich Faust nicht gleichstellen. Sein Hochmut verlangt, „in das verborgene einen tiefen blick zu machen, um die natur zu ergründen denn sein bisheriges Forschen habe ihn nur bis zum Schuldturm gebracht. Und später formuliert er sein Ziel: „nun zittert vor mir, ihr unterirdischen geister, zittert vor mir, ihr bewohner des tiefen Tartarus, Faust wird euch zwingen, die verborgenen schätze zu liefern, die so viele iahre in der erde gemodert haben.“ (4)
Im Ulmer Spiel taucht zuerst Charon auf und fordert eine höhere „Gasche“ [Gage]. Pluto will daraufhin das „höllische Reich vermehren“. Er schickt seine Teufel aus, um die Laster der Welt zu vermehren, es sollen „die Sekten unter einanderfalsch disputieren, das Vorderste zum Hintern kehren; die Kaufleute, falsche Gewicht, falsche Ellen führen; das Frauenzimmer hoffärtig seyn, Unkeuschheit treiben; auf den Universitäten, wo die Studenten zusammenkommen, lehret sie fressen, saufen, schwören, zaubern, zanken und schlagen, das sie mit ihren Seelen in die Hölle fahren.“ Dafür ist Faust ein willkommener Partner, weil er bereit ist, die Theologie aufzugeben, um mit Hilfe der Magie alles (in der Natur) „zu sehen und mit Händen zu greifen“. Dabei ist anzumerken, daß dies nur für eine bestimmte Zeitspanne gedacht ist und daß alles seinem Willen unterliegen solle: „Fauste, entsetze dich nicht, es geht alles nach deinem Willen.“ (5)
Im Kölner Spiel (6) fordert Faust sogleich, ohne großes Vorspiel: „So sage mir ohne weitere Umstände, ob du mir in allen vierundzwanzig Jahren dienen und mich zum ersten Schwarzkünstler der Welt machen, auch mir alles, was ich nur denken und wissen mag, wirst verschaffen können.“
Das Augsburger Spiel (7) zeigt einen Faust, der die Bestimmung des Menschen darin sieht, in der von ihm einmal gewählten Profession Höchstleistungen zu erzielen. Mit Hilfe der unterirdischen Höllenmacht sucht Faust seine „Lust, koste es Leib und Seele.“ Seine Haltung drückte höchste Hybris aus.
Während im Ulmer Spiel (5) die Klage Charons zu einem noch allgemeinen Aufruf Plutos führt, „das höllische Reich zu mehren“, verbindet der Text des Straßburger Spiels (8) das Bemühen Plutos, Charon zu helfen mit einer Faustgestalt, die, den Teufeln gleich, gegen Gott aufbegehrt. Charon hatte vorher über die minderwertige Teufelsware geklagt: „Was nützt mich dann und wann ein Banqueroutier? Diese sind meine Mühe nicht werth.“ Da wird berichtet: „Johannes Faust, ein kühner Sterblicher, der die Kunst erfunden, die Bücher, das gefährliche Spielzeug der Menschen, die Verbreiter vieler Irrthümer, auf eine leichte Art tausend- und tausendmal zu vervielfältigen, hadert gleich uns mit dem Schöpfer […]“ Sogleich erteilt Pluto an Mephistopheles folgenden Auftrag: „Dich, den geschmeidigsten Verführer, den grimmigsten Hasser der Menschheit, fordre ich auf, mir die Seele des Kühnen durch deine Mühe zu erkaufen; fahre hinauf, verjage den Durst der Weisheit aus seinem Gehirn, senge durch das üppige Feuer der Wollust die edlen Gefühle seiner Jugend aus seinem Herzen. Treibe ihn hastig ins Leben, daß er sich schnell überlade: Wenn dann der Sinn der Wollust und des Genusses in ihm verdampft ist und der innere Wurm erwacht, so zergliedere ihm mit höllischer Beredtsamkeit die Folgen seiner Thaten; ergreift ihn dann Verzweiflung, so schleudre ihn herunter, undkehre siegreich in die Hölle zurück.“ Damit ist Faust bereits ein Teufelsbraten, noch bevor er über den Zustand der Welt klagt und sich an die Hölle wendet, weil er zu verarmen droht. Die Aktivität geht von der Hölle aus, Faust reagiert nur noch auf ihre Verlockungen.
Anhand des ältesten Textes der Stummeschen Sammlung, dem von Johann August Bille, soll zunächst in einer umfassenderen Inhaltsangabe ein Stück vorgestellt werden, dessen Text etwas weiter verbreitet ist.
An den zweiunddreißig Texten der Stummeschen Sammlung wird deutlich, daß sich eine Grundhandlung durch alle diese Stücke hindurch zieht, wie sie anhand der gedruckten Texte beschrieben wurde, daß aber die Texte jeweils eigene Ausprägungen erfahren haben. Auch wenn diese auf den einen oder anderen Grundtext zurückgeführt werden können, so wird im originalen Spielbuch die Freude am Fabulieren ebenso deutlich, wie das teilweise Unverständnis dessen, der den Text aufgezeichnet hat. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Da ist zunächst die Unbeholfenheit dessen, der den Text aufzeichnete, aber die Schriftsprache so wenig beherrschte, daß er nur phonetisch nachzuschreiben vermochte, was er da hörte, sei es nach Diktat des Spielers, sei es als Aufzeichnung aus dem Gedächtnis nach einoder mehrfach besuchter Vorstellung oder als Aufzeichnung während des Spieles selbst. Der jeweilige Sprachduktus, der sich bei einigen der Aufzeichnungen erst beim lauten Lesen erkennen läßt, weist zwar auf die Landschaft hin, aus der der jeweilige Spieler herkam, gibt aber noch lange keinen sicheren Hinweis auf die Herkunft und die Quelle des Stückes. Auch über das intellektuelle Vermögen oder Unvermögen des Spielers vermag der Text keine sichere Auskunft zu geben, weiß man doch nicht, wie eng sich der Spieler an den geschriebenen Text gehalten hat, zumal in einigen Stücken auf freie Improvisation des Schaustellers hingewiesen wird durch ein ausdrückliches „Ex tempore“. Logik in der Gesamtanlage der Handlung ist nicht besonders ausgeprägt. Man kann aber durchgängig sagen, daß die alte Warnung vor dem Teufelsbündnis die Tendenz des Faust-Spieles bestimmt. Jedoch die Akzentsetzungen, die sowohl im Handlungsaufbau, wie auch in der Struktur der Personen angelegt sind, sind dem jeweiligen Puppenspieler verpflichtet, denn dargestellt wird die Handlung nicht durch Charaktere, sondern durch Typen.
Bei den vorliegenden Stücken sind es vierundzwanzig, die dem ähneln, was Simrock auf der Grundlage des ihm zur Verfügung stehenden Textmaterials kompiliert hatte. Dennoch sind auch hier wiederum drei verschiedene Grundmuster zu erkennen:
1. Eine kleine Zahl beginnt mit dem Charon-Vorspiel. Hier beklagt sich der höllische Fährmann Charon, der aus der antiken Mythologie übernommen wurde. Daraufhin ruft Pluto seine Teufel herbei, die künftighin fleißiger danach trachten sollen Menschenseelen für die Hölle einzufangen, damit sich Charons Fahrten wieder lohnen. Wichtig ist dabei, daß es weitaus lukrativer für die Hölle ist, die Seele eines Wissenden wie Faust zu gewinnen, als die eines straffällig gewordenen „armen Teufels“, der ohnehin in die Hölle muß.
2. Am Beginn tritt zunächst Kasper mit seinen lustigen Sprüchen auf und sucht eine Beschäftigung als Diener, die ihm reichliches Essen und Trinken bei geringster Arbeit verspricht. Der Einstieg mit Kasper am Beginn der Exposition, bei der Faust erst später hinzukommt, setzt sogleich Prioritäten.
3. Die Handlung setzt mit Fausts Wehklagen über seine missliche Lage ein, aus der ihn nur Magie, das bedeutet, ein Pakt mit den höllischen Geistern retten kann. Auch hierbei gibt es wieder drei Ausgangssituationen: Faust klagt allgemein über Armut; Faust klagt über seine Erfolglosigkeit als Wissenschaftler, die ihn nicht zu Ruhm und Ehre kommen lässt und schließlich klagt Faust darüber, daß seine wissenschaftliche Leistung zu gering honoriert würde, er deshalb in Armut gefallen sei, ein Tagelöhner verdiene mehr als der Forscher.