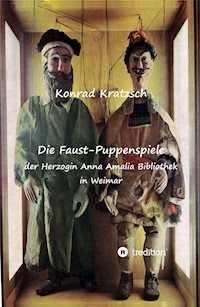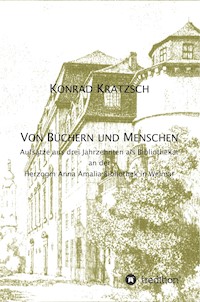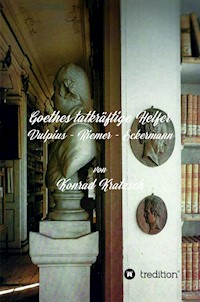
5,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von drei Männern ist hier, im "Nachtrag" zum "Klatschnest Weimar", die Rede, die in engster Beziehung zu Goethe standen, Männer, die unterschiedlicher kaum sein konnten: der vorwiegend bibliothekarisch tätige Schriftsteller Christian August Vulpius, der Philologe Friedrich Wilhelm Riemer und der Freiberufler Johann Peter Eckermann. In ihrem Wirken mit und für Goethe spiegelt sich neben ihren Arbeiten für den verehrten Meister auch das Alltägliche, das zutiefst Menschliche, die Not der Zeit wider. Das zu zeigen ist Anliegen dieses Bändchens, das sich auf die Quellen stützt und so einen eigenen Zugang zur Geschichte der klassischen Zeit zu geben bemüht ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Konrad Kratzsch. Goethes tatkräftige Helfer
Goethes tatkräftige Helfer
Vulpius – Riemer – Eckermann
Ein Nachtrag zum „Klatschnest Weimar“
von
Konrad Kratzsch
© 2020 Konrad Kratzsch
Umschlag und Gestaltung: Martin Holtzhauer
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 42, 22359 Hamburg
https://tredition.de
ISBN
978-3-347-19564-6 (Paperback)
978-3-347-19565-3 (Hardcover)
978-3-347-19566-0 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung
Inhalt
Vorwort
Christian August Vulpius, ein besonderer Helfer Goethes
Der Altphilologe Riemer
Johann Peter Eckermann, der treue Vertraute und Gesprächspartner, die Ausgabe letzter Hand und die Gespräche mit Goethe
Personenverzeichnis
Christian August Vulpius23. Januar 1762 - 26. Juni 1827
Christian August Vulpius, ein besonderer Helfer Goethes
Die Familie Fuchs, die sich später Vulpius nennen sollte, war in den thüringischen Landen weit verstreut. Die verwandtschaftlichen Zusammengehörigkeiten vermögen die Familienforscher nicht mit letzter Sicherheit zu belegen, aber da war der um 1570 in Wasungen bei Meiningen geborene Melchior Fuchs, ein Komponist, der zunächst Lehrer, dann Kantor in Schleusingen gewesen war, bis er 1596 zum Stadtkantor von Weimar berufen wurde, wo er 1615 verstarb. Dieser bedeutende evangelische Kirchenmusiker latinisierte seinen bürgerlichen Namen dem damaligen Brauch entsprechend. Das geht aus dem Taufregister von 1597 hervor.1 So wurde aus Fuchs Vulpius und dabei sollte es auch künftig bleiben. 1752 verstarb in Weimar der 1695 geborene Advokat ohne Gehalt in herzoglichen Diensten Johann Friedrich Vulpius. Er besaß ein Freigut, wie auch seine Frau, Sophie Dorothea geb. Hecker, eine Pfarrerstochter, die nicht unerheblichen Grundbesitz in Weimar in die Ehe eingebracht hatte.
Die Familie lebte von der Substanz, mußte aber die Immobilien nacheinander verkaufen, um leben zu können. Das war die Situation der Familie, als Johann Friedrich Vulpius 1725 als zweites Kind von sechs geboren wurde. Vor ihm war bereits eine Tochter geboren worden, der noch vier weitere folgen sollten. 1739 mußte zum ersten Male Familiengut veräußert werden, dennoch nahm Johann Friedrich in Jena ein Jura-Studium auf, ohne fremde Unterstützung, allein vom Vater finanziert. Aber nachdem auch der mütterliche Besitz verkauft worden war, brach Johann Friedrich Vulpius 1748 sein Studium in Jena aus wirtschaftlichen Gründen ab und kehrte nach Weimar zurück, wo er sich jahrelang erfolglos um eine Anstellung bei Hofe bemühte. Als 1752 der Vater stirbt, hat der Sohn immer noch keine Anstellung gefunden. Erst 1759, nach zehn Jahren des Bittens, erhält Vulpius eine Stelle als Copist mit einem festen Jahresgehalt von 50 Reichstalern beim Fürstlichen Amt in Weimar. Ein Jahr darauf heiratet er, nunmehr 35 Jahre alt, die 18jährige Christine Margarete Riehl. Da die Braut aus einer wohlhabenden Familie stammt, ist Dank einer beachtlichen Mitgift und einer ständigen Unterstützung durch den Brautvater die Familie zunächst abgesichert. Doch das endet mit dem Tode von Johann Philipp Riehl im Jahre 1769.
Am 23. Januar 1762 war Christian August Vulpius geboren worden. Als seine Mutter 1771 stirbt, ist er neun Jahre alt und besucht das Gymnasium in Weimar. 1774 heiratet der Vater erneut. Musäus, Herder, Wieland und Jagemann, die Lehrer und Nachbarn in der Luthergasse, wo die Familie ein kleines Haus bewohnte, hatten den jungen Gymnasiasten beeinflußt, seine literarischen Interessen angeregt und seine schriftstellerischen Anlagen befördert.
Bereits 1777 war das erste erhaltene literarische Zeugnis des jungen Christian August Vulpius entstanden, ein Bilderbuch: „Geschichte der auf der Insul Brolingshbrog errichteten Kolonie“, das er zusammen mit Schulfreunden geschrieben und gezeichnet hatte. Als er 1781 das Gymnasium verläßt, gehört er zu den ausgezeichneten Schülern, die eine Abschiedsrede halten dürfen: „Lob, Leben und Thaten Bernhard des Großen, Herzogs von Weimar“. Mit Erreichen des zwanzigsten Lebensjahres - Voraussetzung, um ein Jurastudium aufnehmen zu können - geht er an die Landesuniversität in Jena und studiert dort, mit landesherrlicher Unterstützung in Höhe von 12 Talern jährlich, zunächst Jura, wendet sich aber bald den Geschichtswissenschaften zu. Zur gleichen Zeit beginnt er sich auch schriftstellerisch zu betätigen. 1783 erscheint beim Hofbuchhändler Hoffmann in Weimar sein erster Text: „Oberon und Titania oder Jubelfeier der Wiederversöhnung, ein Vorspiel bey der Höchsterfreulichen Geburt des Durchlauchtigsten Erbprinzen zu Sachsen-Weimar und Eisenach etc.“ Es folgen im Jahr darauf kleinere Arbeiten, die keine hundert Seiten umfaßten: „Geschichte eines Rosenkranzes“, „Abentheuer des Ritters Palmendos“. Sie entsprachen so ganz jener Literatur, die die Lektüre des jungen aufblühenden Bürgertums bestimmte und eine günstige Marktsituation vorfand. Allerdings gehören die schriftstellerischen und herausgeberischen Erzeugnisse seiner Frühzeit nicht der hohen Literatur an. Er schrieb, um Geld zu verdienen und bediente so den Buchmarkt mit gängigen Texten.
In diesen Jahren war Vulpius auf einen alten Codex gestoßen, den er zusammen mit Jagemann begutachtet. Sie fanden den Band so interessant, daß an eine Veröffentlichung gedacht wurde. Doch zunächst wurde nur ein Auszug daraus in Reichards „Taschenbuch für die Schaubühne auf das Jahr 1785. - Gotha: Ettinger 1784“ abgedruckt: „Theatralische Nachrichten aus Italien. (Aus einer Handschrift des vorigen Jahrhunderts.)“ Hier berichtet er im Begleittext über den Codex: „Ich besitze als ein Familienstück eine Reisebeschreibung nach Italien eines meiner Anverwandten, welche er 1689, 1690 und 1691 gethan hat. Es ist ein starker Quartband voll der merkwürdigsten Nachrichten, welche sich aus den damaligen Jahren nur denken lassen.“2
Im September 1785 fragt Vulpius bei dem Berliner Verleger Friedrich Gottlob Unger an, ob Unger wohl an einer Herausgabe dieses Werkes interessiert sei: „Weimar den 19. Sept. 1785. Wohlgeborener Hochzuverehrender Herr. Ich besitze als Familienstück eine Reisebeschreibung nach Italien, vom Jahre 1690 - 1691. Welche noch nie gedruckt u vielleicht die erste ist welche ein Teutscher beschrieben hat. Die Dedikation zeigt an, daß sie hat gedrukt werden sollen, es ist aber nie geschehen. Was ich im 85. Theaterkalender draus habe einrüken laßen, ist alles was draus gedrukt ist. Erst wollte ich die ganze Reise ediren, u Berichtigungen dazu druken laßen. Als ich aber die Sache mit Herrn. Jagemann überlegte sahen wir daß der Abstand der Zeiten zu groß war. Aber als Auszug wär es überaus interessant. … Könnten Sie den Auszug, den ich draus machen werde in Ihrer Sammlung von Reisen brauchen, so hoffe ich, werden wir bald einig werden. Ich würde mich außerordentlich freuen, Ihre Bekanntschaft zu machen.“3 Eine solche Verbindung kam jedoch nicht zustande.
1782 war der Vater wegen eines Amtsvergehens zunächst suspensiert, dann entlassen worden. Es handelte sich dabei um einen heute nicht mehr aufklärbaren Rechtsfall, weil die Akten ein Opfer des 2. Weltkrieges geworden sind: Der Jenaer Bürgermeister und Kaufherr Johann Christian Jakob Paulsen hatte gegen den Amtsarchivarius Johann Christian Vulpius und den Amtsdiener Georg Caspar Graf wegen eines „durch Fertigung eines falschen Konsenses zu Schulden gebrachten Falsums“ geklagt. Das führte zu Amtsenthebung und kurzzeitiger Haft. Das Verfahren wurde wohl wegen Geringfügigkeit niedergeschlagen. Vulpius erhielt einen Gnadensold von 12 Reichstalern und 12 Scheffeln Korn mit der Verpflichtung, sich für Arbeiten beim Wegebau zur Verfügung zu halten, und wurde auch gelegentlich zu Hilfsarbeiten in der herzoglichen Verwaltung herangezogen.
Im Jahre 1786 starb der Archivar Johann Friedrich Vulpius. Bereits 1784 hatten Christian August und seine Schwester Christiane das Bürgerrecht in Weimar erworben. Mit dem Tod des Vaters änderte sich alles. Christian August mußte nun für die Schwestern sorgen. Er beendete sein Studium, kehrte nach Weimar zurück und versuchte seine literarische Karriere auszubauen, mit der er bereits als Student begonnen hatte.
Goethe, im November 1775 nach Weimar gekommen, weiß Anfang 1776 schon von seiner Einbindung in die Hof- und Regierungsgeschäfte zu berichten4. „… Ich bin nun ganz in alle Hof- und politische Händel verwickelt und werde fast nicht wieder weg kommen. Meine Lage ist vortheilhaft genug, und die Herzogthümer Weimar und Eisenach immer ein Schauplatz, um zu versuchen, wie einem die Weltrolle zu Gesicht stünde. Ich übereile mich drum nicht, und Freiheit und Genüge werden die Hauptconditionen der neuen Einrichtung seyn, ob ich gleich mehr als jemals am Platz bin, das durchaus Scheisige dieser zeitlichen Herrlichkeit zu erkennen. Eben drum Adieu! …“
Goethe war im Juni des gleichen Jahres zum Geheimen Legationsrat ernannt und in das Beraterkollegium des Herzogs, das Geheime Consilium berufen worden. Im Januar 1779 übertrug Carl August Goethe die Direktion des Landstraßenbaus und die des Stadtpflasterbauwesens, die Wegebaudirektion, und am 11. Juni 1782, nachdem er den Kammerpräsidenten von Kalb entlassen hatte, auch die Leitung der „Kammer“, der obersten Finanzbehörde des Herzogtums, allerdings ohne ihm den Präsidententitel zu verleihen. Durch diese amtlichen Stellungen war Goethe sicher über die Causa Vulpius informiert.
Christian August Vulpius ist gezwungen, eine Anstellung zu finden, die es ihm ermöglicht, seine Familie zu versorgen. Seine literarischen Produktionen reichten dafür nicht aus. Goethe unterstützt ihn, wohl mehr von Amtswegen als aus persönlichem Interesse, wie er später in einem Brief an Jacobi schreibt, als er diesem Vulpius als Sekretär und Erzieher seiner Kinder empfiehlt.
Im April 1786 versuchte Vulpius erneut, für den bereits im Vorjahr dem Verleger Unger in Berlin angebotenen Text einen Verlag zu finden. Obwohl sich Goethe in seinem Brief vom 26. Januar 1786 an Charlotte von Stein kritisch über den Schriftsteller Vulpius geäußert hatte: „Der Theaterkalender, den ich gelesen hat mich fast zur Verzweiflung gebracht … niemals ist er mir und sein Gegenstand so leer, schaal, abgeschmackt und abscheulich vorgekommen. … Mit den Exkrementen der Weimarischen Armuth würzt Herr Reichardt seine oder vielmehr die deutsche Theater Miserie…“5, unterstützt er ihn doch bei dem Versuch, Göschen als Verleger zu gewinnen. Vulpius wendet sich am 11. April 1786 mit einem Schreiben an Göschen: „Hochedelgeborener Herr! Ohne alle Umschweife, denen ich herzlich feind bin, sage ich Ihnen daß ich ein Büchlein schreiben will genannt: Theatral. Reisen. Zur Probe sende ich Ihnen den Bogen derselben mit u biete Ihnen den Verlag dieses Werkchens an. Wenn Sie glauben, daß es Ihrer Spekulation zuträglich ist u dem Ungefähr, oder sonst anderen Umständen auch etwas zutrauen, so können wir denn den Handel bald abschliesen.
Zugleich sende ich Ihnen den Bogen eines Schauspiels mit, welcher am leserlichsten geschrieben ist. Dieses Schauspiel ist auf einigen Bühnen im Mspt. gut aufgenommen worden Es könnte sich aber leicht zutragen daß einer das Stück drucken lies, ohne daß ich selbst die lezte Hand ans Werk legen könnte. Wenn Sie dies Schauspiel verlegen wollen, gebe ichs Ihnen unter folgenden äußerst billigen Bedingungen.
1) Daselbe ist 10. geschr. Bogen stark u davor verlange ich nicht mehr als 1. Karlin Honorar, welchen ich zu einem gewissen Gebrauche bestimmt habe. Diesen Karlin aber, erhielt ich gleich nach Übersendung des Mspts. 2.) Nach Abdruck desselben, 12 postfreie Exempl. auf Schreibpapier.“6
Vulpius ist in arger Bedrängnis, da mit dem Tod des Vaters die Familie in Weimar keine herzogliche Unterstützung mehr erfährt, von der Familie auch keine weiteren Zuwendungen erfolgen und der schriftstellerische Erfolg keineswegs gewinnbringend genug ist. Vor einer solchen Situation hatte bereits Herder die jungen Gymnasiasten gewarnt. 1778 hatte er in einer seiner Schulreden gesagt: „Zu viele … wollen Buchstabenmänner werden. O werdet Geschäftsmänner, liebe Jünglinge, Männer in vielerlei Geschäften. Die Buchstabenmänner sind die unglücklichsten von allen; ihre Achtung nimmt ab, die der anderen nimmt zu. Jene werden bald verhungern müssen. Nehmet den Meßkatalog. Die Mehrzahl der Bücher hat der Hunger diktiert. Zaubereien, Streitschriften, Revolutionsschriften lehrt der Hunger bellen. …“7 Vulpius verläßt Weimar, um in Süddeutschland eine irgendwie geartete Anstellung zu finden, gleichzeitig sucht er immer weiter nach Kontakten zu Verlegern.
Weimar im Jahr 1824
Melchior Fuchs: Geistliche Lieder. Erfurt 1610
Geburtshaus von Christian August und Christiane Vulpius, Weimar, Luthergasse
So nimmt er zunächst in Nürnberg die Stelle eines Sekretärs bei Julius von Soden an, der hier seit 1781 in Ansbachischen Diensten als Gesandter des Fränkischen Kreises8 akkreditiert war. Gegen eine schmale Entlohnung war er hier tätig, wurde jedoch alsbald gegen einen für noch geringes Gehalt arbeitenden Angestellten ausgetauscht. Die Charakterisierung des Herrn von Soden, die der verzweifelnde Vulpius aus Erlangen an Sophie von La Roche am 7. Oktober 1788 schreibt, spricht für sich: „Hr.v.S.ist der gefälligste Mann auf Gottes Erdboden, wenn’s nicht sein Interesse, nicht sein Geld betrift … - Seine Betriebsamkeit, ist unermüdlich, aber sein Geiz, geht bis zur äussersten Niedrigkeit. Seine Briefe scheinen Evangelia zu seyn, seine Versprechungen sind himmlisch - seine Erfüllungen - teuflisch. Mich kostet dieser Mann, Freunde, beinahe Vaterland, all mein Geld, Gesundheit u. Ruf. Des wegen halte ich mich nicht mehr zu Nürnberg auf, gieng auf Herders Rath, u Göthens Befehl fort - bis sich ein ander Unterkommen für mich zeigt. Ich werde aber wohl dazu verdammt seyn, unglücklich bleiben zu müssen. Dies ist das Geständniß meines unglücklichen Herzens - ob ich gleich den Hrn. v. S. wenn er es erführ, zu fürchten habe, denn er ist mächtig genug. - Wenden Sie diese Nachricht, liebste Freundin, nicht zu meinem Nachtheil an. Er hat Geld und Güther genug - aber sein Herz ist keiner edlen Empfindung fähig, er kann keine edle That thun, wenn er nur 30 Kr. ins Spiel gebracht sieht.- Ach! Gott! - Ich weis am besten, was der Mann mir vor Unglück zubereitet hat!“9
In dieser Zeit wurde Vulpius mit zwei bedeutenden Wissenschaftlern in Nürnberg bekannt, die sich auch in sein Stammbuch eintrugen: den Polyhistor Christoph Gottlieb Murr10 und den Erlangener Historiker, Lexikograph und Bibliograph Johann Georg Meusel11.
Inzwischen war Goethe aus Italien zurückgekehrt und hatte am 12. Juli 1788 den Bittbrief von Christiane Vulpius entgegengenommen, in dem um Unterstützung für den Bruder und die gesamte Familie gebeten wurde. Christian August Vulpius hielt sich zu dieser Zeit in Erlangen und Nürnberg auf. Am 19. August 1788 schreibt Johann Gottfried Herder, der sich als Begleiter von Herzogin Anna Amalia auf deren Italienreise in Nürnberg aufhält, an seine Frau Caroline: „Ich kam nach Hause und fand den armen Vulpius auf mich warten. Erinnere doch Goethe an ihn; aus dem Menschen wird hier nichts, und er geht hier verloren. Er hat mir Goethes Brief an ihn gewiesen und hat alle Hoffnung auf ihn gerichtet, ob ich gleich auch nicht sehe, wo man in Weimar mit ihm hin will. …“12
Man scheint in Weimar durchaus Anteil am Schicksal der Familie Vulpius genommen zu haben, auch wenn Goethe in seinem Brief vom 26. Januar 1786, in dem er hart mit der Weimarer Literaturszene ins Gericht geht, Vulpius nicht gerade begeistert erwähnt.
So lange Goethe in Italien weilt, kümmert er sich verständlicherweise nicht um den jungen Modeschriftsteller. Doch zurückgekehrt, nach der Entgegennahme der Bittschrift und sicher auch durch die nun einsetzende Beziehung zu Christiane, unternimmt Goethe einiges, um Vulpius zu helfen. So überweist Goethe am 26. November 1788 Geld nach Nürnberg an Willhelm Friedrich Hufnagel13. Er bedauert, Hufnagel in Weimar nicht getroffen zu haben, um ihm einen jungen Mann empfehlen zu können „der sich gegenwärtig in Erlangen aufhält. Er heißt Vulpius und ich nehme mir die Freyheit einen Brief an denselben, mit einigem Gelde beschwert, hier bey zu schließen. … Er hat Fähigkeiten, ist fleißig gewesen, und nur ein Zusammenfluß von Umständen hat verursacht daß er weder in seinem Vaterland noch auswärts bisher hat sein Glück finden können. Ew. Wohlgeb. mir bekannte menschenfreundliche Gesinnungen flößen mir das Vertrauen ein Ihnen diesen jungen Menschen zu empfehlen. Er ist bescheiden genug um nicht überlästig zu seyn, könnten Sie aber bey Ihren mannigfaltigen Connexionen irgend etwas für ihn würcken, das ihm auf eine Zeitlang oder gar auf sein ganzes künftiges Leben Vortheil brächte; so würden Sie gewiß keinen Undanckbaren verbinden und mich zu angenehmen Gegendiensten dadurch auffordern. Gönnen Sie ihm indessen einigen Zutritt, stehen Sie ihm indessen mit gutem Rath bey und lassen mich von seiner Aufführung einige Nachricht hören. …“14 Der Begleitbrief ist nicht erhalten.
Im Herbst 1788 hatte Goethe seinen Verleger Göschen auf den jungen Theaterdichter Vulpius hingewiesen, der „ein Paar Bändchen Operetten“ geschrieben habe.15 – „Der Schleier. - Elisinde. - Operetten. Erstes Bändchen. I. Der Schleier. II. Bella und Fernando oder die Satire. III. Elisinde.“ Alle erschienen bei Johann Andreas Lübecks Erben in Bayreuth und Leipzig.
Bereits im September 1788 hatte Goethe seinem Freund Friedrich Heinrich Jacobi16 Vulpius als Sekretär empfohlen: „… Du verlangst einen jungen Mann zum Sekretair und zum Unterricht deiner Kinder, und ich habe eben einen, den ich gar gerne unterbringen möchte, ich wünschte nur daß er auch dir recht wäre. Sonderbar ists daß ich neulich ihn dir empfehlen wollte, auch etwa der Fürstinn17, weil euch doch manches vorkommt und daß eben mit deinem Brief einer von ihm ankommt, worinn er mir seine Noth klagt und meine Intercession [Fürbitte] anruft. Er hat von Jugend auf Dispositionzu den Wissenschaften gezeigt und hat früh aus Neigung und Noth geschrieben und drucken laßen. Er heißt Vulpius, du hast seinen Nahmen irgendwo gelesen. Das ist nun nicht eben die beste Rekommandation [Empfehlung]. Wir erschröcken über unsre eigne Sünden, wenn wir sie an andern erblicken. Es ward ihm sauer genug auf eine solche Weise sich und seinen Geschwister zu unterhalten, er kam nicht zeitig genug hier in eine gewiße Carriere, sehnte sich nach einem Posten und ward Sekretair bey einem Kreisgesandten von Soden in Nürnberg, der ihn als einen ächter Geizhals behandelte und ihm nun den Abschied giebt, weil ein andrer für weniger Geld noch mehr Arbeit im Hause übernehmen will. Er schreibt eine Hand, die nicht schön aber gemüthlich ist. Von seinem französisch kann ich nicht sagen wie weit es geht, er versteht es, soviel weiß ich daß er artig Italiänisch kann. Er hat eine gute Bildung und aus seinen Handlungen und Äusserungen schließe ich ein gutes Gemüth. Ich habe mich seiner schon vor einigen Jahren angenommen, in meiner Abwesenheit verlohr er jede Unterstützung und ging wie schon gesagt nach Nürnberg. Freylich kann ich nicht sagen, daß ich ihn genau kenne. Ich habe mich für ihn interessirt ohne ihn zu beobachten, ich habe ihm einige Unterstützung verschafft, ohne ihn zu prüfen. Seit mehr als zwey Jahren habe ich ihn nicht gesehen und kann dir Ihn also nur bedingt empfehlen. So viel kann ich sagen daß ich ihn, wenn ich einen solchen Menschen brauchte, zum Versuch selbst nehmen würde, das ist aber noch nicht genug für dich. Bedenke nun was ich da gesagt habe, ich will ihm schreiben, dich nicht nennen, ihn über sein latein französisch u. s. w. befragen. Für ihn wäre es ein großes Glück wenn du ihn nähmst, aber es ist die Frage ob du auch bedient wärest. …“18
Einen Monat später, am 3. Oktober, nimmt Goethe das Thema wieder auf. Er schreibt nun erneut an Jacobi: „Ich erinnere mich kaum ob ich dir versprochen habe von dem jungen Mann den ich dir empfahl noch einige Nachricht zu geben. Ich erhalte einen Brief von ihm, sein voriger Patron hat ihm auf eine sehr unwürdige Weise mitgespielt und ihm das übertriebenste Zeugniß zum Abschied gegeben. Er wartet nun in Erlangen auf Entscheidung seines Schicksals und bezeigt sich gar vernünftig obgleich sehr niedergeschlagen. Von seinem Französisch schreibt er: er könne soviel um sich fortzuhelfen, andre zu lehren getraue er sichs nicht. Eher ein wenig Italiänisch, Geographie, Historie, Mythologie pp. will er mit den Kindern gern tracktieren. Übrigens hoffte ich solltest du mit ihm zufrieden seyn. Laß mich bald etwas hören, er ist in einer gar klemmen Lage, wenn er für dich nach der Beschreibung nicht wäre; so such ich ihn sonst zu empfehlen und sehe mich für dich weiter um. …“19 Doch Jacobi lässt sich Zeit, antwortet nicht, während Vulpius vergebens hofft. Goethe drängt: „Alles betrachtet mein lieber, so sehe ich an deinem Briefe, daß du so sehr nicht eilst einen solchen jungen Mann zu haben: Deßwegen hab ich noch einmal an Vulpius geschrieben und erkundige mich noch um verschiedenes. Ich möchte dir nicht falsch rathen aber ich möchte auch nicht versäumen einem guten jungen Menschen ein Glück zu verschaffen, denn wenn du ihn auch nur mäßig bezahlst, wenn du ihn auch nur einige Jahre behältst; so ist es keine Kleinigkeit in deiner Nähe gelebt zu haben … Die Menschen werden nur von Menschen gebildet, die Guten von Guten.“ So schreibt er am 31. Oktober20.
In Erlangen war Vulpius seinem Jenaer Kommilitonen Christian Diedrich von Egloffstein wiederbegegnet, der hier seine Studien fortsetzte. Dessen Familie nahm sich im Frühjahr 1789 des mittellosen Vulpius an. Seine Dankbarkeit dafür, „einige Monate im Schooße einer edlen Familie“21 geborgen gewesen zu sein, zeigt Vulpius als Verfasser von Theaterstücken, in dem er das Trauerspiel „Serafina“22 und die Operette „Der Schleier“23 „Der Frau Gräfin Henriette von Egloffstein geborene Freyin von Egloffstein Hochgeboren“ widmete.
Gleichzeitig bemühte sich Goethe immer wieder, Vulpius beim Verleger Georg Joachim Göschen in Leipzig unterzubringen, zunächst als Autor, dann als Mitarbeiter. Wie Goethe am 15. April 1789 an Hufnagel schreibt, ist Vulpius wieder in Erlangen, hat aber die Absicht, nach Leipzig zu gehen: „… Es thut mir leid daß Ihre gütigen Bemühungen für den jungen Vulpius, sowie die meinigen bißher fruchtloß gewesen sind. Wie er mir schreibt, will er Erlangen verlaßen und sich nach Leipzig wenden. Wollten Sie die Güte haben, da er es wahrscheinlich bedarf, ihm zwey Carolin24 bey seinem Abschied reichen, ich werde nicht verfehlen Ew. Wohlgeb. sogleich zu remboursiren [hier soviel wie „begleichen“]. … Ich werde gehindert Herrn V. selbst zu schreiben und ihm einen Empfehlungsbrief nach Leipzig zu schicken. Wenn er dort anlangt, so soll er sich bey Herrn Göschen melden dort soll er Briefe finden.“25
Wenige Tage später schreibt Goethe an Göschen: „In einiger Zeit wird sich ein junger Mann bei Ihnen melden, der Vulpius heißt und dem ich den einliegenden Brief einzuhändigen bitte. Er ist von guter Art und nicht ohne Talente; können sie ihm, da er sich in Leipzig aufzuhalten gedenkt, Arbeit verschaffen, ihm durch Empfehlung oder sonst nützlich sein, so werden Sie mich verbinden. Da ich mich seit langer Zeit für ihn interessire, ihn aber in einigen Jahren nicht gesehen habe, so wünschte ich: Sie schrieben mir ein Wort, wie Sie Ihn finden. Aus seinen Briefen muß ich vermuten, daß sein Gemüth durch verdrießliche Schicksale gelitten hat. …“26
Doch es sollte auch jetzt noch einige Zeit ins Land gehen, bis Vulpius in Leipzig eintraf, vermutlich war er eine Zeit in Weimar, bei der Familie, verlässliche Zeugnisse aus dieser Zeit sind nur spärlich, die benannten Briefe nicht mehr erhalten, ihr Inhalt nur aus sekundären Quellen zu erschließen. Auf jeden Fall berichtet Göschen am 17. Juni 1789 von einem Brief von Vulpius, den er zur Weitergabe an Goethe erhalten habe und damit beifüge, ansonsten wolle er nach Goethes Befehl handeln, wie er auch inzwischen eine Unterkunft für Vulpius gefunden habe.27
Nach zwei Wochen wiederholt Goethe seine Versicherung, wie sehr er Göschen verbunden sei, wenn dieser Vulpius unterstütze: „… Was Herrn Vulpius betrifft, wiederhole ich, daß mir eine Gefälligkeit geschieht, wenn Sie diesem jungen Mann Ihren Rat und Beistand gönnen wollen. Er hat manche gute Eigenschaften und es fehlt ihm nicht an Talent. Bei den weitläufigen Bedürfnissen der Buchhandlung sollte es mich wundern, wenn er nicht, gut geleitet, sich einen mäßigen Unterhalt sollte verdienenkönnen. Ich bin auch nicht abgeneigt, ihm von Zeit zu Zeit einige Unterstützung zu gönnen, nur was seine Einrichtung betrifft, darein kann ich nicht reden; das ist ganz seine Sache. …“28 So am 22. Juni 1789. Mit Vulpius selbst scheint Goethe keinen direkten Kontakt gehabt zu haben, die Post geht über Göschen und das scheint auch zu dauern, denn am 29. Juni heißt es an Göschen: „… Schicken Sie mir den Brief an Herrn Vulpius zurück; er ist nun zu alt geworden; mit der nächsten Post erhalten Sie einen andern.“29 Am 1. Juli sendet Göschen den Brief zurück, am 2. August meldet Göschen, daß Vulpius immer noch nicht in Leipzig eingetroffen sei. Am 15. August 1789 endlich weiß Göschen von der Ankunft von Vulpius in Leipzig zu berichten, doch klingt das nicht sehr hoffnungsvoll. Er sei „mißmutig über sein Schicksal“, an einer buchhändlerischen Tätigkeit oder an der eines Übersetzers nicht interessiert und für Korrekturlesen nicht geeignet. Für andere Arbeiten im Verlag aber fehlten ihm die nötigen Kenntnisse. So könne er denn nicht allzuviel für ihn tun, dennoch sei es ihm, Göschen, vorerst gelungen, eine kleine Arbeit für Vulpius zu finden. Er wolle auch weiterhin versuchen Vulpius zu unterstützen.30 Goethe bedankt sich umgehend am 20. August: „…Ich danke Ihnen, daß Sie Herrn Vulpius so viel als möglich wollen behilflich sein; ich wünsche sehr, daß er sich in die Arbeiten, welche dort einen Unterhalt geben, schicken möge.“31
Doch damit waren noch nicht alle Möglichkeiten in Leipzig ausgeschöpft, am 31. August 1789 schrieb Goethe ein Empfehlungsschreiben an einen anderen Leipziger Verleger, an Johann Gottlieb Immanuel Breitkopf: „Im Zutrauen auf unsre ehmaligen guten Verhältnisse, nehme ich mir die Freyheit Ihnen einen jungen Mann zu empfehlen, der Ihnen diesen Brief überreichen wird. Er wünscht in Leipzig zu bleiben und dort ein besseres Schicksal zu finden als er bisher hat erfahren müssen. Ich hoffe er wird Ihnen nicht beschwerlich seyn. Haben Sie die Güte ihm zu erlauben daß er Sie manchmal sehe, sich Ihnen eröffne. Verschaffen Sie ihm möglich einige Bekanntschaften und Connexionen [vorteilhafte Beziehungen], damit er durch litterarische Arbeiten etwas verdienen könne. Er heißt Vulpius und ist mir als ein gutartiger junger Mann bekannt.“32
Im Oktober trifft dann ein, was Goethe im Juni in Aussicht gestellt hatte: „Wenn H. Vulpius bey seiner vorhabenden Veränderung etwas Geld benötigt seyn sollte, so bitte ich ihm biß auf 25 rh vorzuschießen welche so gleich wiederzuerstatten nicht verfehlen werde. …“33 schreibt er an Göschen.
Die Beurteilung, die Göschen über die Arbeitsleistung von Vulpius abgegeben hatte, war keineswegs so vorteilhaft für diesen, wie die, die Goethe in seinen Empfehlungsschreiben formuliert hatte. Die Erklärungen dafür können in der Notlage der Familie und dem Zwange zum Geldverdienen gelegen haben, aber auch in den unterschiedlichen Interessenlagen, die schließlich die Wirksamkeit bestimmten, bis endlich die geeignete Stelle, die in der Herzoglichen Bibliothek, gefunden ward.
Johann Karl August Musäus
Christoph Martin Wieland
Johann Gottfried von Herder
Christian Joseph Jagemann
Was hier in Leipzig so deutlich zu Tage trat, hatte sich schon in der Schulzeit in Weimar und während des Studiums in Jena angedeutet. Roberto Simanowski34 hat aus den Akten des Wilhelm-Ernst-Gymnasiums ermitteln können, daß der junge Vulpius keineswegs ein Muster an Disziplin und Arbeitseifer gewesen sei, es wurde ihm jede Fähigkeit für wissenschaftliches Arbeiten abgesprochen, überhaupt seien seine Leistungen nur mittelmäßig gewesen. Wenn man ihm, 1781 zumindest, bescheinigt, daß er nicht dumm wäre und sich sein Betragen gebessert habe, so zeigt sich doch wenigstens der Ansatz zu Besserung. Über seine Studienzeit in Jena ist anhand seiner Vorlesungsnachschriften nachweisbar, daß er sich bald vom Brotstudium Jus ab und den schönen Wissenschaften, Geschichte und deren Hilfswissenschaften, Heraldik und Diplomatik zugewandt hatte. Zur gleichen Zeit begann Vulpius, um Geld zu verdienen, zunächst mit der Edition fremder, dann auch eigener Texte. Hier wirkte wohl der Einfluß seiner Weimarer Nachbarschaft, dem Bibliothekar der Herzogin Anna Amalia, Christian Joseph Jagemann, einem bedeutenden Italianisten, und Christoph Martin Wieland nach. Doch bot diese Tätigkeit keine sichere Basis für den Lebensunterhalt, so daß er über Jahre ohne rechten Erfolg nach einer festen Anstellung suchte, die seinen Ambitionen und Kenntnissen gemäß war. In Leipzig hatte er sie jedenfalls nicht gefunden, aber er hatte Bekanntschaften geschlossen, die ihm hilfreich waren: bei Göschen den späteren Verleger Johann Heinrich Gräff, bei dem nach anderen Werken 1799 der Erfolgsroman „Rinaldo Rinaldini“ erscheinen sollte, dann war er mit der Secondaschen Schauspielergesellschaft zusammengetroffen, für die er drei Stücke schrieb, die einen beachtlichen Erfolg erzielten. Hier lernte er auch den Arzt und Theaterschriftsteller Johann Friedrich Ernst Albrecht kennen, dessen Frau als Actrice in der Bondinischen Theatertruppe auftrat. Weitgereist verstarb Albrecht nach einem wechselvollen und ereignisreichen Leben als Militärarzt in Altona. In dieser Zeit begegnete Vulpius auch dem Leipziger Kaufmann und Verfasser von bürgerlichen Bühnenstücken Christoph Friedrich Bretzner und Karl Gottlob Cramer, den erfolgreichen Verfasser von zahlreichen Ritter- und Räuberromanen. So tummelte sich Vulpius unter den Modeschriftstellern seiner Zeit und fand wohl in den Produktionen seiner Bekannten so manche Anregung für sein eigenes Schaffen. Andreas Meier hat, um diese Zeit zu erschließen, in akribischer Kleinarbeit die Stammbücher des Christian August Vulpius, die sich heute im Goethe-und-Schiller-Archiv der Klassik Stiftung Weimar befinden, ausgewertet und die genannten Schriftstellerkollegen als Einträger gefunden.35
Die Situation sollte sich für Vulpius aber erst ändern, als sich im Theaterwesen Weimars grundlegende Veränderungen abzeichneten. Bisher hatte Vulpius zu den verschiedenen Theatergesellschaften nur lose Verbindungen, sei es, daß diese Stücke von ihm aufführten, sei es, daß er Stücke ins Deutsche übersetzte und dramaturgische Hilfestellungen gab, indem er Stücke aufführungspraktisch einrichtete. Zuletzt, von Leipzig nach Weimar zurückgekehrt, war er vorwiegend für die Bellomosche Truppe tätig. Doch erfuhr das Theaterwesen bald harrsche Kritik. So hatte bereits Karl Ludwig von Knebel am 11. Januar 1790 an seine Schwester Henriette Magdalene geschrieben: „Ich habe anjetzo des wirklichen Theaters so satt, daß ich beinahe ein Gelübde gethan, so bald nicht wieder hinzugehen. Mittelmäßige und schlechte Vorstellungen machen das Gemüth mehr unruhig und ermüden es, als daß sie Genuß verschaffen sollten. In Deutschland ist so bald nichts Vorzügliches dieser Art zu hoffen, doch negligiren [vernachlässigen, beachten nicht] sich auch unsere Schauspieler in diesem Winter mehr noch als sonsten.“36 Sowohl Anna Amalia als auch Carl August hatten sich schon seit längerer Zeit mit einer Umgestaltung des Weimarer Theaters befaßt. Nach dem Weggang Bellomos37 in das österreichische Graz wird Goethe mit der Leitung des Hoftheaters betraut (17. Januar 1791), nachdem einige Versuche, die Intendanz mit einem Theatermann zu besetzen, gescheitert waren. Für die Verwaltung und die Finanzen war ihm Franz Kirms38 zur Seite gestellt worden. Vulpius ist auch jetzt weiter als freiberuflicher Dramaturg für das Hoftheater tätig, eine nur spärlich dotierte Tätigkeit, die nach erbrachter Arbeitsleistung entlohnt wurde, was zu zahlreichen Bittgesuchen um Aufbesserung des Honorars führte:
„Ich bin überzeugt, daß die Billigkeit, mit welcher ich bei meinen Forderungen für die Theaterarbeiten für hiesige Bühne, bisher zu Werke gegangen bin, eben so einleuchtend, als mein Diensteifer zum allgemeinen Besten für unser Theater zu würken bemerkbar geweßen ist. So weit nun mein beschränkter Würkungskreis sich erstreckte, so weit habe ich auch nach Kräften, und nach meiner besten Überzeugung von Thätigkeit, gehandelt. Von dabei für andere, meinem Lebensunterhalte gewidmeten Arbeiten, verabsäumte Stunden u Tagen, soll hier die Rede nicht seyn. Wenn auch auf meine, Unkosten, so habe ich sie dennoch in meiner Vaterstadt aufgewandt, u man thut ja immer lieber mehr für ein einheimisches, als für ein fremdes Publikum! Bei dem allen nun, habe ich nur Einen Wunsch. Dieser ist: ‚Daß es der verehrungswürdigen Ober Direktion des hiesigen Hoftheaters, gefallen möchte, mir durch einen festgesetzten u bestimmten Gehalt, die Sorgen für Nahrung und Unterhalt erleichtern zu helfen.‘ Ich werde mich dagegen denkbar bemühen, mich immer mehr und mehr Ihres und des Publikums Wohlgefallen zu versichern. Alle mir bisher übertragenen Gattungen von Theaterarbeiten, z.B. die neuen Bearbeitungen der Opern, die Durchsicht u Abänderung für unsere Bühne, die Verfertigung der gebräuchlichen TheaterReden, die Korrespondenz in Schauspiel Angelegenheiten pp. werde ich dann noch vielmehr mit freudiger Thätigkeit verrichten, wenn ich meinen häuslichen Einrichtungen eine gewiße bestimmte Festigkeit geben kann. Ein Umstand, dessen Einfluß auf Arbeiten der Art,wie die Bühne sie fordert, nur gar zu sichtbar und unbezweifelt ist. Daß der Theater Kasse dadurch mehr Vortheil als Schaden erwachsen kann, will ich gar nicht erwähnen, da selbst ihre Bestimmheit dadurch so gar in einem Falle vermehrt wird, wo Zufall und Umstände auf ihre Rechnung ungewiß spielen konnten. Ich schmeichle mir daher die Gewährung meines Gesuchs und harre Ew. Hochwohl- u Wohlgeb. unterthäniger Diener „39
Als jedoch die neue Oberaufsicht für die Bibliothek eingesetzt wurde, sollte sich alles ändern. Unter dem 1. März 1797 macht sich Voigt in einem Brief an Goethe Sorgen um den Geheimrat Schnauß: „Das Geheime Consilium hat Bericht von der Akademie gefordert; der alte Schnauß ließ sich nicht abwegig davon machen. Er kam gestern selbst darum in die Session und man ist elend mit ihm dran, weil man sich wegen der Taubheit nur auf eine Art verständlich machen kann, die bis auf die Gasse erschallet.“40
Am 5. März 1797 überlegte Vulpius noch, was mit seinen Büchern, seinen guten Freunden geschehen solle, wenn er nach Leipzig oder Wien ginge, denn er sieht für sich keine Möglichkeit einer festen Anstellung an der Herzoglichen Bibliothek, ohne einen anderen Mitarbeiter zu vertreiben. Am 14. März schreibt Vulpius in einem Brief an Goethe verzweifelnd: „Der Hr.Hof K. R. hat mit mir gestern wegen meinen Hoffnungen gesprochen. Es macht mich aber das, was er sagte, nicht ruhiger. Schon seit ein paar Wochen bin ich nun in einer Lage, in der ich, so übel wie’s auch zuweilen gieng, noch nicht leicht geweßen bin. Es fehlt mir, im strengsten Sinn des Ausdrucks, beinahe an allem, was zu den unentbehrlichsten Lebensnothwendigkeiten gehört, vom Gelde bis zum Holze.“41
Eine Woche später schrieb Voigt den bereits angeführten Brief über die mögliche Verwendung von Vulpius in der Bibliothek. Auch Kirms hatte sich für Vulpius beim Herzog eingesetzt, wie er an Goethe schrieb, der Herzog sei auf Kirms nochmaligen Antrag hin nunmehr geneigt, Vulpius als Bibliotheksregistrator einzustellen und wolle nur noch mit Voigt sprechen. Am 18. März 1797 ist die Anstellung schließlich sanktioniert, am deren Zustandekommen so viele Vulpius gut Gesinnte beteiligt gewesen waren: „Die bewußte Sache ist nun dergestalt in Ordnung, daß Serenissimus mir gestern befohlen haben, daß Dekret und übrige Ausfertigung, …, expediert und von mir dem Geheimen Consilio Erläuterung, statt weiteren Vortrags, gegeben werden soll.“42
Am 20. März 1797 schreibt Vulpius an Goethe in Jena, daß das Hoftheater in Wien sein Stück „Karl XII.“ zur Aufführung angenommen habe, 100 Gulden solle er dafür erhalten, habe sie aber noch nicht, so daß er außer Stande sei, die 16 Reichstaler zu bezahlen, die er für das Dekret, das ihn zum Bibliotheksregistrator ernenne, aufzubringen habe. Kirms könne ihm auch nicht helfen, denn auch der sei nicht gut bei Kasse. Dann macht Vulpius seine Antrittsbesuche, der Herzog sei recht gnädig gewesen, Schnauß recht gut, er lud den neuen Mitarbeiter zum Speisen ein, aber immer weiter plagen den Geldsorgen, er müsse borgen. So hoffe er denn auf Nebeneinkünfte durch Sonderaufträge, die ihm Voigt in Aussicht gestellt habe und Vulpius die Möglichkeit gäbe dem Herzog zu zeigen, daß er über die Arbeit für das Theater hinaus auch wissenschaftliche Aufgabe zu erfüllen wisse. Nach Wien wolle er nun nicht mehr gehen zumal Jünger, ein Lustspieldichter in Wien, mit dem Vulpius bekannt war, verstorben sei „… die Folianten der Geschichtsschreiber auf der Bibliothek, sind mir lieber. - Ich freue mich, in diesen Schätzen wühlen zu können, u mir wohl seyn zu lassen. … August hat sich, glaube ich, am meisten über meine Bibliotheks Erhöhung gefreut.“43
Neben der neuen Arbeitsaufgabe bleibt Vulpius ein strenger, aber redlicher Kritiker und Berichterstatter in Theater-Angelegenheiten, jedoch dabei ein schlecht bezahlter, der immer wieder versuchen muß, einen Weg zu finden, um sein Gehalt, das er aus dem Theater-Budget erhält, aufzubessern. Doch der Herzog willigt nicht in eine Gehaltserhöhung ein. Am 31. Juli 1797 stellt Vulpius Goethe, der in Frankfurt seine Mutter besucht, seine Lage vor, wie sie ihm Kirms erklärt hat. „Ew. Excellenz melde ich das, was mir heute der Hr. HofKammer Rath gesagt hat. Er habe noch gestern Abend mit Durchl. Herzog meiner Angelegenheiten wegen gesprochen u ihm alles gehörig vorgestellt. Der Herzog habe hierauf gemeint, er könne sich aus der Theaterkasse zu einer bestimmten Besoldung für mich, nicht resolviren. Hierauf habe der Hr. HKR. gemeint, so würde man das Quantum, welches ich für die Theaterarbeiten bisher erhalten habe, verdoppeln müßen, weil ich sonst unmöglich leben könne. Und in diesem Falle würde das Honorar für dieselben, meine jährl. Besoldungsforderung weit übersteigen u könne als dann wohl 300 rth. betragen. - Durchl. Herzog habe gesagt, er werde bei eintretendem Falle sorgen, daß auf eine gute Vermehrung meiner Bibliotheks Besoldung Rücksicht genommen würde, u er wünsche, daß ich den Theaterverdienst nur als ein Nebengeld ansehen möchte. Das erstere Versprechen für mich habe sich der Hr. HKR. zu seiner Legitimation u meiner Beruhigung, schriftlich ausgebeten, u er erwarte nun bestimmte Resolution, die er Ew. Exzellenz sogleich mitteilen würde.“44
21 Jahre alt war Vulpius gewesen, als er in Weimar sein erstes Werkchen hatte drucken lassen. Da wollte ein junger Weimarer auf sich aufmerksam machen. Bereits in der Schulzeit hatte er mit seinen Schulkameraden zusammen eine erste Bildergeschichte geschrieben. Hier zeigten sich bereits seine vielfältigen Interessen und seine Literaturkenntnis: die Geschichte basiert auf Johann Gottfried Schnabels Abenteuerroman „Wunderliche Fata einiger Seefahrer …“ (1732), gemeinhin später als „Insel Felsenburg“ bekannt. Die räumliche und literarische Nachbarschaft zu Musäus, Wieland und Jagemann zeigt schon früh ihre Früchte.
Im Jahr darauf erscheinen kleine, keine 100 Seiten umfassende, Arbeiten und die Mitarbeit an Heinrich August Ottokar Reichards „Bibliothek der Romane“, die von 1778 bis1794 erschien, beginnt. Heute ist diese Sammlung fast vergessen, Andreas Meier schreibt dazu: