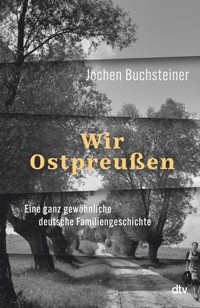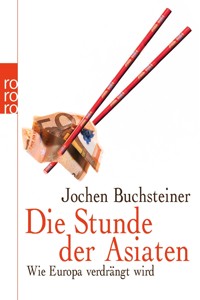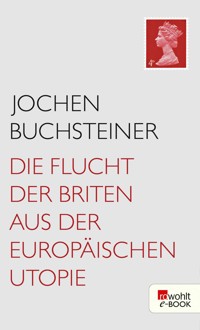
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Europa irrt, wenn es den Brexit als Betriebsunfall betrachtet. Die Briten, heißt es auf dem Kontinent, befinden sich auf einem Irrweg. Mit dem Abschied von der EU hätten sie ihren Ruf als vernünftige, pragmatische Nation verspielt. Stimmt das? Oder erleben wir gerade das Gegenteil: dass unsere Nachbarn ihren sprichwörtlichen «Common Sense» nur neu und kühn vermessen? Jochen Buchsteiner nimmt in diesem pointierten Buch den Brexit unter die Lupe und kommt zu dem Ergebnis, dass er gar nicht so irrational ist. Auch wenn er die Geschäfte auf beiden Seiten des Kanals erschwert – er fußt auf nachvollziehbaren und redlichen Motiven, die in der Nationalgeschichte und in der Geographie des Königreichs wurzeln. Buchsteiner analysiert dieses «Anderssein», das die Briten leidenschaftlicher auf die Freiheit und kühler auf Europa blicken lässt. Der Brexit, so eine These des Essays, ist nicht das Resultat einer «populistischen Verführung», sondern folgt berechtigter Kritik am Zustand der EU und wehrt sich gegen Fehlentwicklungen des «liberalen Modells». Indem die Briten ihre Souvernität und Identität über den Wohlstand stellen, kehren sie die Prioritäten einer europäischen Einigungslogik um, die in der Krise steckt. Niemand, schreibt Buchsteiner, kann wissen, wohin der Aufbruch der Briten führt. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Insel eine Entwicklung vorwegnimmt, die dem Festland noch bevorsteht. Die Europäer sollten mit Neugier und Demut reagieren, nicht mit Spott und Strafe. Großbritannien den Abschied so schmerzhaft wie möglich zu machen, ist unsouverän und kurzsichtig. Die Skepsis am Status quo, die dem Brexit zugrunde liegt, wächst auch in den Reihen der verbleibenden Mitgliedstaaten. Wenn der britische Abschied nicht das Ende der EU einleiten soll, muss sie Lehren aus ihm ziehen und umsteuern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jochen Buchsteiner
Die Flucht der Briten aus der europäischen Utopie
Über dieses Buch
Europa irrt, wenn es den Brexit als Betriebsunfall betrachtet.
Die Briten, heißt es auf dem Kontinent, befinden sich auf einem Irrweg. Mit dem Abschied von der EU hätten sie ihren Ruf als vernünftige, pragmatische Nation verspielt. Stimmt das? Oder erleben wir gerade das Gegenteil: dass unsere Nachbarn ihren sprichwörtlichen «Common Sense» nur neu und kühn vermessen?
Jochen Buchsteiner nimmt in diesem pointierten Buch den Brexit unter die Lupe und kommt zu dem Ergebnis, dass er gar nicht so irrational ist. Auch wenn er die Geschäfte auf beiden Seiten des Kanals erschwert – er fußt auf nachvollziehbaren und redlichen Motiven, die in der Nationalgeschichte und in der Geographie des Königreichs wurzeln. Buchsteiner analysiert dieses «Anderssein», das die Briten leidenschaftlicher auf die Freiheit und kühler auf Europa blicken lässt. Der Brexit, so eine These des Essays, ist nicht das Resultat einer «populistischen Verführung», sondern folgt berechtigter Kritik am Zustand der EU und wehrt sich gegen Fehlentwicklungen des «liberalen Modells». Indem die Briten ihre Souveränität und Identität über den Wohlstand stellen, kehren sie die Prioritäten einer europäischen Einigungslogik um, die in der Krise steckt.
Niemand, schreibt Buchsteiner, kann wissen, wohin der Aufbruch der Briten führt. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Insel eine Entwicklung vorwegnimmt, die dem Festland noch bevorsteht. Die Europäer sollten mit Neugier und Demut reagieren, nicht mit Spott und Strafe. Großbritannien den Abschied so schmerzhaft wie möglich zu machen, ist unsouverän und kurzsichtig. Die Skepsis am Status quo, die dem Brexit zugrunde liegt, wächst auch in den Reihen der verbleibenden Mitgliedstaaten. Wenn der britische Abschied nicht das Ende der EU einleiten soll, muss sie Lehren aus ihm ziehen und umsteuern.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung f8 archive/Alamy Stock Photo
ISBN 978-3-644-00219-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Something there is
that doesn’t love a wall.»
Robert Frost, Mending Wall
«Good fences make
good neighbors.»
Robert Frost, Mending Wall
I. Der missverstandene Brexit
Die Briten fordern die Ordnung Europas nicht zum ersten Mal heraus. Als König Heinrich VIII. vor einem halben Jahrtausend entschied, dass er «niemanden außer Gott» über sich respektieren wolle, brach er nicht nur mit dem Papst in Rom, sondern mit dem Konsens, den Europa bis dahin teilte. Er stellte das Königreich außerhalb des kontinentalen «Mainstreams». Schon damals stimmte das Volk auf der Insel zu, nicht in Form eines Referendums, sondern nach hitzigen Debatten in beiden Häusern des Parlaments, und schon damals fassten sich viele kluge Leute an den Kopf. Einigen wurde er dafür sogar abgeschlagen, unter anderem dem Lordkanzler Thomas More, dem Autor der berühmten Utopia.
Mores Einwände wurden später in Winston Churchills History of the English Speaking People beleuchtet, und wenn man das Wort «Christenheit» durch «Europäische Union» ersetzt, liest es sich, als hätte er die heutigen Brexit-Gegner porträtiert: «Sie hassten und fürchteten den aggressiven Nationalismus, der die Einheit der Christenheit zerstört», schrieb er über More und dessen Weggefährten. Churchill fuhr fort: «Heinrich VIII. hatte nicht nur einen weisen und begabten Berater enthauptet, sondern ein System, das, auch wenn es in der Praxis seinen Idealen nicht gerecht geworden ist, die Menschheit lange Zeit mit seinen hellsten Träumen versorgt hatte.»[1]
Man kann darüber streiten, ob Heinrichs Alleingang wirklich die Geburtsstunde des aggressiven Nationalismus in Europa darstellt, und auch darüber, wie einig die Christenheit im Jahr 1532, also fünfzehn Jahre nach Martin Luthers Reformationsthesen, noch gewesen ist. Sicher ist, dass Heinrichs Entscheidung eine Zeitenwende markierte, und es ist keineswegs abwegig, die eine oder andere Linie zum Brexit zu ziehen. Denn heute bündelt sich wieder etwas auf der Insel, das auch auf dem Festland umhergeistert. Wieder wirft das kontinentaleuropäische Establishment dem Königreich Verantwortungslosigkeit vor, und wieder muss man für möglich halten, dass die Häretiker mehr Tuchfühlung mit den Zeitläuften aufgenommen haben als die Dogmatiker.
Das Vierteljahrhundert, das zwischen Heinrichs umstrittenen Entschluss und dem Beginn des «Elisabethanischen Zeitalters» lag, zählte nicht zu den glänzendsten in der Geschichte Britanniens; es war von Machtwechseln, inneren Kämpfen und Tumulten geprägt. Das klingt vertraut. Denn auch der unerhörten Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, folgt gerade, wenngleich in anderen Dimensionen, eine unerquickliche Phase. Die Loslösung von der EU sollte das Königreich ja eigentlich wieder groß machen, stolz und unverwechselbar. Darauf zielten die Parolen von der Befreiung aus der europäischen Bevormundung und dem «Zurückgewinnen der Kontrolle». Doch der Abschied von Brüssel scheint eher den Prozess zu beschleunigen, den umzukehren die Hoffnung gewesen war.
Britannien, das lässt sich seit dem EU-Referendum kaum noch bestreiten, schrumpft – jedenfalls auf politisches Normalmaß. Seit dem 24. Juni 2016, dem Tag nach der Volksabstimmung, erleben die Briten Krisen, die sie nicht gewohnt sind. Sie spüren, dass Freunde auf dem Kontinent auf Abstand gehen. Sie machen die erstaunliche Erfahrung, dass über sie gelacht und sogar gespottet wird. Die elegante Überheblichkeit, mit der die Briten ihren Nachbarn zuweilen auf die Nerven gegangen sind, ist einer gewissen Verunsicherung gewichen.
Die Zeit, in der das Königreich «über seiner Gewichtsklasse boxt», wie es oft hieß, scheint fürs Erste vorüber, und vielleicht ist es eine weitere Pointe der Geschichte, dass sich die Anpassung in dem Augenblick vollzieht, da das «Zweite Elisabethanische Zeitalter» seinem Ende entgegengeht. In dem, was vielerorts als politischer Niedergang wahrgenommen wird, steckt auch ein Stück Normalisierung, und das muss nichts Schlechtes sein, weder für das Vereinigte Königreich noch für den Kontinent. Britannien, das wird manchmal vergessen, bleibt ja eine gutartige Mittelmacht. Es geht nicht im Groll, es bettelt geradezu um Zusammenarbeit. Die Regierung in London wirbt für freien Handel, will keine Konflikte mit seinen Nachbarn und verspricht auch nach innen, eine weltoffene, liberale Demokratie zu bleiben. Manchmal möchte man beinahe fragen, warum sich alle so aufregen.
Die Nachteile, die den Brexit begleiten, liegen auf der Hand: Die Europäische Union verliert nach außen an Strahlkraft und im Innern an Balance. Das Gleiche gilt, zumindest bisher, für das Vereinigte Königreich. Vor allem aber bindet die komplizierte Entflechtung der in mehr als vierzig Jahren geknüpften Bande kostbare politische Energien auf beiden Seiten des Kanals, die für die Bewältigung wichtigerer Aufgaben fehlen. All das ist bedauerlich, erklärt aber nur einen Teil der Erregung, mit der über den Brexit gestritten wird. Der Abschied von der EU polarisiert so stark, weil er größere Fragen berührt als die, wie viele Banker die Londoner City verlassen oder wie hoch die Einbußen europäischer Exportunternehmen werden könnten. Nicht einmal die strategischen Auswirkungen – ob sich Britannien auf der Weltbühne marginalisiert oder zu einer neuen Rolle findet, ob die EU durch den Austritt Schaden nimmt oder wieder Schwung entfaltet – können das Ausmaß der Verbitterung erklären, das im alten Herzen der EU, in Berlin, in Paris und in Brüssel, zu spüren ist.
Das Verstörende des Brexit liegt tiefer. Es wurzelt in seinem rebellischen Antrieb, seinem weltanschaulichen Kern. Die freiwillige Entscheidung, der Europäischen Union den Rücken zu kehren, ist ein Angriff auf den modernen europäischen Dreifachkonsens: dass die EU als zivilisatorisches Fortschrittsprojekt, als «immer engere Union», wie es im Gründungsvertrag heißt, weiterzuentwickeln ist; dass es den Nationalstaat zu schwächen und nicht zu stärken gilt; und dass aufgeklärte demokratische Gesellschaften Wohlstand über kulturelle Identität stellen. Der Brexit, könnte man auch sagen, ist ein Anschlag auf das, was der überwältigende Teil der europäischen Eliten als Vernunft begreift.
Was ist bloß in die Briten gefahren?, fragen sich viele. Was ist geschehen mit der Nation, die John Locke, Adam Smith und David Hume hervorgebracht hat und seit Jahrhunderten als Synonym für Pragmatismus und «Common Sense» gilt? Müssen wir die Briten nach ihrer Brexit-Entscheidung neu denken? Oder ist ihnen nur ein Lapsus unterlaufen, der sich wieder richten lässt? Sind sie Opfer des europaweit grassierenden «Populismus» geworden, oder ist die Entscheidung, die EU zu verlassen, am Ende gar nicht so unnachvollziehbar, wie das so vielen Kontinentaleuropäern und den Verlierern der Volksabstimmung vorkommt? Steckt in der britischen Unlust, den Argumenten «überzeugter Europäer» zu folgen, womöglich sogar eine höhere Rationalität?
Der Philosoph Roger Scruton hält den europäischen Klagen einen subversiven Gedanken entgegen: «Beobachter auf dem Kontinent beschuldigen uns oft mangelnden Respekts für die Vernunft und einer Unwilligkeit, die Dinge zu Ende zu denken. Aber wenn das Durchdenken der Dinge im Ergebnis paradox ist, warum sollte es dann die Vernunft gebieten?»[2] Das ist natürlich ein exzentrischer, zutiefst britischer Einwand, aber er entlarvt die Banalität, mit der viele auf diesen bemerkenswerten historischen Einschnitt reagieren. Es kommt ihnen gar nicht in den Sinn, Britanniens Abschied von der EU außerhalb ökonomischer Nutzenrechnungen zu begreifen. Man muss den Brexit nicht gleich wie Scruton als Triumph des Pragmatismus sehen, als Kontinuum des britischen Misstrauens in alles Zuendegedachte. Gleichwohl hilft es, die historische, philosophische, kulturelle, auch ästhetische Dimension einzubeziehen, um diese nationale, auch europäische Zäsur zu begreifen. Als die Briten durch ihre letzte große Krise gingen – den wirtschaftlichen Abstieg in den 1970er Jahren –, bescheinigte ihnen Karl Heinz Bohrer «ein bisschen Lust am Untergang». Er sah nachgerade einen melancholischen Akt der Rebellion am Werke, «zusammengeflickt aus Empire-Würde und Altersschönheit, gemischt mit dem Explosivstoff britischer Hemmungslosigkeit und Vabanque-Haltung».[3] Wo sind die Europäer, die mit ähnlicher Offenheit und kritischer Zuneigung auf das Königreich von heute blicken?
Die Wahrnehmung Britanniens leidet unter einem Mangel an Neugier und einer zweckgebundenen Denkblockade. Deshalb bleiben zwei Fragen ungestellt: Lassen sich die tieferen Motive des Brexit vielleicht aus der Geschichte des Landes heraus erklären, aus dem historischen «Anderssein» der Briten, das vierzig Jahre lang von Brüssel zumindest in Schach gehalten wurde? Und zweitens: Haben die Briten das Wesen der Europäischen Union womöglich gar nicht missverstanden, sondern vielmehr durchdrungen, und zwar auf eine Weise, die der maritimen Nation gar keine Wahl ließ, als ein weiteres Mal Anker zu lichten?
«Seefahrendes Volk ist an größere Schwankungen gewöhnt», hielt Ernst Jünger fest, als er im Zweiten Weltkrieg vom besetzten Paris aus über die Briten nachdachte. Manchmal meint man, den Lotsen, die gerade das britische Schiff losmachen, eine fast seeräuberische Freude über das bevorstehende Abenteuer anzusehen. Man hat eine Entscheidung getroffen, und wie oft bei Entscheidungen weiß man nicht, ob sie richtig gewesen ist, aber jetzt wird nach vorne geblickt, improvisiert und gehofft. «Something must be left to chance», sagte Admiral Nelson vor der Schlacht von Trafalgar. Etwas muss immer dem unberechenbaren Augenblick überlassen bleiben, in einer Seeschlacht wie in der Politik.
Zwischen Briten und Kontinentaleuropäern hat sich Sprachlosigkeit breitgemacht. Man versteht einander nicht mehr, am wenigsten, wenn man miteinander redet. Nach einigen Monaten am Verhandlungstisch machte ein Foto der beiden Delegationen Furore. Links am Tisch sitzt EU-Delegationschef Michel Barnier mit zwei Mitarbeiterinnen. Sie wirken freundlich-angespannt, die Hände auf den Papierstapeln, die sie zu den Gesprächen mit dem Brexit-Minister mitgebracht haben. Gegenüber grinsen David Davis und seine Mitarbeiter frech in die Kamera. Der Tisch vor ihnen ist leer; nur ein iPad liegt geschlossen da. In Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten wurde das Foto rasch gedeutet: Die Briten gehen die Sache unvorbereitet und fast ein bisschen unernst an. In London interpretierten die Brexit-Freunde das Dokument hingegen mit schelmischem Witz. Zeige es nicht, wie bürokratisch und «old school» die Europäer verhandeln – und wie modern und aufgeräumt die Briten? Ja, illustriere das Foto nicht geradezu einen der Gründe, aus denen man den Club verlassen müsse?
Humor, gerade auch in den unmöglichen Momenten, gehört zu den britischen Konstanten, denen auch der Brexit nichts anhaben kann. Er wird die Briten wohl auf ewig vom Kontinent trennen. Selbst am Tag nach dem EU-Referendum wurden im Unterhaus gallige Scherze gemacht, und die unzähligen Comedians im Königreich feiern seit Juni 2016 Feste auf den Bühnen. Wie anders und eigen die Briten geblieben sind, zeigte sich in der Haltung, mit der sie in die Brüsseler Austrittsverhandlungen gezogen sind. Davis und seine Leute wollten, ohne dass sie oft das Ziel kannten, zum jeweils nächsten Punkt vorstoßen und setzten dabei auf Flexibilität. Die Europäer pochten auf Verfahren und Prinzipien. Die Briten sahen die Lage, in die sie sich durch das Referendum gebracht hatten, sportlich und versuchten gewissermaßen das Beste aus ihr zu machen. Die Europäer fühlten sich verletzt und schwankten zwischen Beleidigtsein und Bestrafen. Es begegneten sich, einmal mehr, «Cool Britannia» und der steife, manchmal etwas schwermütige Kontinent.
Was, um die Frage umzudrehen, ist eigentlich in die Europäer gefahren? Warum reagieren sie nicht souveräner und demonstrieren nach innen wie nach außen, dass sie jeden, der so töricht ist, mit einem mitleidigen Kopfschütteln ziehen lassen? Wenn die Europäer richtigliegen und die Briten einen Fehler begangen haben – sind sie dann nicht bestraft genug? Der Versuch der Europäischen Union, dem Königreich den Austritt so teuer und schmerzhaft wie möglich zu machen, ist unübersehbar. Kühl bezeichnen ihre Vertreter das Post-Brexit-Britannien als «third country», so als käme dem Königreich trotz gemeinsamer Unionsgeschichte derselbe Status zu wie Algerien oder Marokko. Die Haltung manifestierte sich in der Drohung, Britannien aus dem Sicherheitsbereich des europäischen Galileo-Systems zu werfen, eines Satellitenprojekts, das die Briten maßgeblich mitfinanziert haben. Derart zur Schau gestelltes Misstrauen spiegelt Bitterkeit und Kleinmut wider. Nur wer nicht mehr an sich selbst glaubt, macht anderen den Abschied so schwer.
An diesem Glauben fehlt es in der Europäischen Union. Hinter ihrem geeinten und scheinbar starken Auftritt in den Verhandlungen lauert die klamme Angst, dass die eigene Attraktivität nachlässt und die Briten daraus als Erste die Konsequenz gezogen haben. Die Angst ist umso größer, als das Königreich schon mehrmals in der Geschichte Vorstöße gewagt hat, die den Zeitzeugen ungeheuerlich und chancenlos vorkamen – und im Rückblick als Vorzeichen einer neuen Ära erschienen. So war es nicht nur bei Heinrichs Bruch mit dem Papsttum, sondern schon vorher, bei der Beschränkung königlicher Allmacht durch die Magna Carta im 13. Jahrhundert. Auch im vergangenen Jahrhundert verblüfften die Briten die Welt, als sie dem militärisch weit überlegenen Hitler-Deutschland den Krieg erklärten. Viele sahen das Königreich damals in seinen Untergang rennen; es kam dann bekanntlich anders. Und standen die Europäer nicht ein weiteres Mal kopf, als Margaret Thatcher vierzig Jahre später (gemeinsam mit Ronald Reagan) die neoliberale Revolution entfesselte?
Keines der Beispiele ist mit dem Brexit vergleichbar, und doch rufen sie in Erinnerung, dass sich die Nation über die Zeit den Ruf eines furchtlosen Pioniers erworben hat – und die Insel eine Reputation als politisches Laboratorium. All dies spielt in die Beziehungen zum Königreich hinein. Es sind die heimlichen und stummen Sorgen, die den Umgang mit den Briten so verhärten: Sehen sie womöglich etwas, das andere noch nicht sehen? Nehmen sie einmal mehr eine Entwicklung vorweg, die Schule machen könnte?
Schon um diese Ängste zu verscheuchen, versuchen viele Europäer die Entscheidung der Briten als irrational, als politischen Betriebsunfall erscheinen zu lassen – und die Verlierer des Referendums helfen gerne mit. Es gibt gute, nachvollziehbare Argumente gegen den Brexit, aber den meisten Kritikern reicht schon der Hinweis auf «populistische» Untertöne, um den Befürwortern des EU-Austritts Anstand und ehrenhafte Motive abzusprechen. Deutsche Politiker, die in den Monaten nach dem Referendum die britische Hauptstadt besuchten, brachten es zuweilen nicht einmal fertig, ihren Kollegen auf Empfängen die Hand zu schütteln oder einen höflichen Smalltalk zu führen.
Diese Verachtung hat die Atmosphäre nicht weniger vergiftet als der Versuch vieler Brexiteers, «das Volk» gegen «die Eliten» in Stellung zu bringen. Populismus ist ein unscharfer Begriff, aber folgt man der Definition, dass er seinem Wesen nach antipluralistisch ist, dann haben wir es zurzeit mit zwei populistischen Bewegungen zu tun, einer volkspopulistischen und einer elitenpopulistischen. Die erste beruft sich auf die Weisheit des Volkes und lässt keine andere gelten. Die zweite beruft sich auf eine höhere Vernunft und auch eine höhere Moral, zwei Kategorien, die keinen geringeren Ausschließlichkeitsanspruch in sich tragen. Auf beiden Seiten des Grabens sind Echokammern entstanden, in denen man nur noch hört und glaubt, was in der unmittelbaren Umgebung gesagt wird. Nicht nur Argumenten, selbst Zahlen und Fakten wird misstraut, sobald sie über die medialen Resonanzböden der anderen Kammer verbreitet werden.