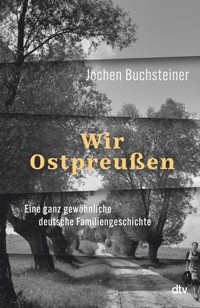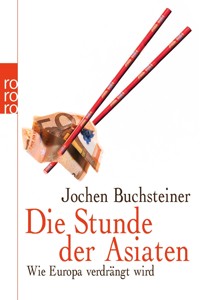
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Asien verändert sich – und damit die Welt. Chinas Aufstieg zur Großmacht und Indiens rasches Erwachen, Nordkoreas Massenvernichtungswaffen – dies sind nur einige Anzeichen dafür, wie uns die Region herausfordert: nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Asien hat, was uns verlorengegangen ist: Zuversicht, Ehrgeiz, Wachstum. Und es probt mit Erfolg, was wir überwinden wollen: Machtdenken und Ungleichheit, Nationalismus und Konkurrenz. «Die Stunde der Asiaten» analysiert diese neuen Kräfte und Konstellationen. Gespickt mit Fakten und Eindrücken aus einer Region im Aufbruch, mündet das Buch in eine verstörende These: Europa ist auf die Welt von morgen nicht vorbereitet und droht langsam ins Abseits zu geraten. Jochen Buchsteiner hat «Die Stunde der Asiaten» für diese Taschenbuchausgabe vollständig durchgesehen und aktualisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Jochen Buchsteiner
Die Stunde der Asiaten
Wie Europa verdrängt wird
Für Anton
Einleitung
Die heute Vierzigjährigen sind als erste Generation mit Asien in Berührung gekommen. In ihren Jugendzimmern standen Stereoanlagen von Sony oder Onkyo, vor den Schulen parkten Honda-Mofas und Suzuki-Mokicks, und zu den gängigen Sportangeboten gesellte sich Judo. Noch war es weit bis zu den ersten Sushi-Snacks und Billigreisen nach Bali oder Phuket, und unvorstellbar schien, dass ein Traditionsunternehmen wie Volkswagen nur eine Generation später mehr Autos auf dem chinesischen Markt absetzen sollte als auf dem heimischen deutschen. Die späten siebziger und frühen achtziger Jahre markierten so etwas wie den sichtbaren Anfang des asiatischen Wiederaufstiegs. Er kam daher in Form eines Kaufangebots, als harmloses Hallo aus einer fernen Welt.
Für die Jugend, die heute in den Städten Europas und Amerikas lebt, ist Asien zum festen Bestandteil der Alltagskultur geworden. Das Spiel mit japanischen Tamagotchis und Pokemons wird ihre Kindheitserinnerungen ähnlich prägen wie die Lektüre des ersten Harry-Potter-Buches. Sie arbeiten an taiwanischen Computern und bedienen in Indien programmierte Software. Der Restaurantbesuch beim Thailänder hat seine Exotik ebenso sehr verloren wie der Power-Yoga-Kurs. In den Regalen der Jugendzimmer stehen neben den einschlägigen Musik-CDs aus dem Westen die Hits von Punjabi MC, in den Buchläden liegen Werke von Haruki Murakami, Khalid Husseini oder Arundhati Roy, in den Kinos laufen Filme von Ang Lee oder Wong Kar Wai. In nur zwanzig Jahren ist aus dem zarten Gruß ein kräftiges ‹Wir sind hier› geworden.
Noch wird der beachtliche Konsum- und Kulturexport als schöne Bereicherung wahrgenommen. Er ist da, so wie der Strom aus der Steckdose, und nur wenige interessieren sich für die Quelle, für die Kraft im Hintergrund.
Das ist erstaunlich, denn der asiatische Kontinent hat sich in den vergangenen Dekaden zu einem gewaltigen Erzeuger aller denkbaren Energien entwickelt, und der Westen bekommt längst nicht mehr nur die angenehme Abwärme zu spüren. Der rasante wirtschaftliche Aufstieg am anderen Ende des eurasischen Kontinents bietet eben nicht nur vielbesungene ‹Chancen›, sondern bedrängt die Alte Welt auch mit immer stärkeren Zumutungen. Unternehmer fühlen sich gezwungen, ihre Geschäfte in den Osten zu verlagern, weil dort niedrigere Kosten und mehr Käufer warten. Zugleich drückt der direkte Wettbewerb auf die Arbeits- und Produktionsbedingungen in den (noch) reichen Ländern. Während Löhne und Gehälter fallen, steigen die Preise für Öl und andere Stoffe, die vermehrt aus Asien nachgefragt werden. Die Bedürfnisse der neuen asiatischen Verbraucher erhöhen die Umweltbelastung, auch im Westen. Von der ‹Win-win-Situation›, die Unternehmer und Politiker beschwören, wird bald nicht mehr viel zu sehen sein. Die Globalisierung bringt Asien voran – auf Kosten Europas und langfristig wohl auch auf Kosten Amerikas.
Längst hat sich der ökonomische Aufschwung in politische Macht übersetzt. Schon heute üben Länder wie China und Indien mehr Einfluss auf die Weltpolitik aus, als den meisten Europäern bewusst ist. Die typische ‹Tagesschau-Haltung›– Was sagt Berlin? Was sagt Brüssel? Was sagt Washington? – vermag die Zusammenhänge in der Welt nicht mehr ausreichend zu erklären. Fast alle absehbaren Herausforderungen, die den Erdball in den kommenden Jahren und Jahrzehnten politisch in Atem halten werden, sind im Fernen Osten zu Hause: das strategische Mächteringen zwischen China, Indien und Amerika um die Vorherrschaft in Asien; die Krisenherde Kaschmir, Taiwan und Korea; das nukleare Wettrüsten; die Gefahr frei verfügbarer Massenvernichtungswaffen; die Brutstätten des islamischen Fundamentalismus in Pakistan und Afghanistan.
Schon in einer Generation könnte die internationale Nachrichtenlage ganz anders aussehen. Weltpolitik wird im Jahr 2040 vermutlich von den Großmächten China, Amerika und Indien geprägt, die dann unter sich ausmachen, ob sie etwa in Europa intervenieren, wenn Massenproteste arbeitsloser Demonstranten die Lage in Berlin und Paris außer Kontrolle geraten lassen. Die Wirtschaftsmagazine berichten vielleicht über die erfolgreiche Übernahme des Siemens-Konzerns durch die indische Reliance-Gruppe. Und die Feuilletons wiederum könnten erstaunt registrieren, dass die internationalen Filmfestspiele in Taipeh erstmals seit langem wieder einen Beitrag aus Europa im Wettbewerbsprogramm zeigen, während das «Goldene Pferd» – die dann höchste Auszeichnung der Kinowelt – an eine koreanisch-malaysische Koproduktion gegangen ist.
Europa gleicht zu Beginn dieses Jahrhunderts einem Dorf, das von wuchtigen Neubausiedlungen bedrängt wird. Lange profitierte es von den Fremden am Rand, die zum Einkaufen ins alte Zentrum kamen. Doch inzwischen hat sich in den Siedlungen eigenes Leben entwickelt. Mehr und mehr Dorfbewohner zieht es an den Stadtrand, wo Gründerstimmung herrscht und Güter und Dienstleistungen noch billig zu haben sind. Gleichzeitig beginnen sich die reicher werdenden Neulinge ins alte Dorf einzukaufen. Immer höher schießen die Siedlungen in den Himmel und tunken das alte Zentrum in ihren Schatten. Das Dorf wird langsam nervös, aber seine Handlungsmöglichkeiten sind begrenzt: Umkehren kann es die Entwicklung nicht mehr – in seinen Händen liegt jetzt nur noch, welchen Platz es in der neuen Großraumsiedlung einnehmen will: den des schicken Altstadtviertels oder den des Slums.
In fünfzig oder hundert Jahren wird das Emporkommen Asiens mit einiger Wahrscheinlichkeit als wichtigste Zäsur unserer Zeit betrachtet werden, womöglich folgenreicher als die Repolitisierung des Islam. Noch fehlt das symbolische Datum, gewissermaßen der «11.September» des Wiederaufstiegs. War es womöglich ein unscheinbarer Tag wie der 8.Dezember 2004, als die Computersparte des amerikanischen Traditionsunternehmens IBM an die chinesische Linovo-Gruppe verkauft wurde? War es jener Tag im Mai 2005, als die ersten 200Billigautos aus chinesischer Produktion im Hafen von Rotterdam ausgeladen wurden? Wird es ein prächtiges Ereignis wie die gigantomanisch geplante Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking? Wird es ein Krieg?
Die Umwälzungen erfassen uns schleichend, so wie die Entwicklung Amerikas zur Weltmacht das Europa des frühen 20.Jahrhunderts zunächst nicht zu berühren schien. Erst mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg wurde den meisten klar, dass sich die Verhältnisse verändert hatten.
Den Aufschwung Asiens als Epoche machenden Wandel zu begreifen ist auch deshalb so schwer, weil es Asien, streng genommen, gar nicht gibt. Im Vergleich zu Europa und erst recht zu den Vereinigten Staaten handelt es sich um einen fragmentierten Kontinent. Zurzeit gibt es mindestens ‹zwei Asien›, das helle und das dunkle, den duftenden Café au Lait vor der Oper in Hanoi und die verstümmelte Hand, die in Delhi ans Autofenster klopft, das lebenslustige Gelächter der Jugendlichen in Singapur und die Hassgesänge der Mullahs in Quetta. Es gibt das prosperierende, weltoffene, friedliche Asien – und das bitterarme, religiös-fanatische, gewalttätige Asien. Oft befinden sie sich in ein und demselben Land.
Wollte man eine Trennlinie durch den Kontinent ziehen, verliefe sie von Nord nach Süd, zwischen dem pazifischen und dem subkontinentalen Asien. Die Küstenregionen Chinas, Japan, Korea und das südöstliche Asien befinden sich im Großen und Ganzen auf einem konstruktiven Weg und schicken sich an, die Welt wirtschaftlich und eines Tages politisch zu dominieren. Die Regionen westlich des Golfs von Bengalen haben in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend Unheil ausgebrütet. Sie bringen Fanatismen hervor, muslimische wie hindunationalistische, und sie zeigten sich lange Zeit unfähig, ihre ideologischen, ethnischen und sozialen Probleme zu lösen – erst die jüngere Entwicklung Indiens zur neuen Wirtschaftsmacht korrigiert das Bild. (Das weiter westlich anschließende, arabisch geprägte Gebiet, das die Inder «Westasien» nennen, gehört zwar geographisch zum Kontinent, wird aber in diesem Buch als Naher und Mittlerer Osten nur am Rande behandelt.) Was die etwa dreißig Länder verbindet, die hier als «Asien» beschrieben werden, ist ihre gemeinsame ethnische und religiöse Heterogenität, ihre Prägung durch die hinduistisch-buddhistische Kultur – sie behauptet sich selbst im größten muslimischen Land der Welt, Indonesien – und ihr regionales Wir-Gefühl. Auch wenn sich Thailänder in erster Linie als Thailänder bezeichnen und Inder als Inder, so akzeptieren sie doch als nächste Bezugsgröße das «Asiatische». Auf eine derartige Idee kämen Iraker oder Syrer kaum.
Die Wucht, die vom modernen Asien ausgeht, steckt in seinen widersprüchlichen Kräften. Die Menschen zwischen Bangalore und Schanghai drängen den Westen nicht nur mit ihrem wirtschaftlichen Ehrgeiz in die Defensive. Sie bedrohen ihn auch mit religiöser Radikalität und mit Terror. Vor allem aber konfrontieren sie ihn mit einem flächendeckenden Nationalismus, der die zahlreichen Krisenherde im Osten weiter befeuern wird. Dass sich überdies inmitten einer Phase nuklearen Aufrüstens in Asien zwei neue Großmächte– China und Indien – herausbilden, kündigt nicht nur neue Konflikte an, sondern auch eine Verschiebung der weltpolitischen Kraftfelder, deren Auswirkungen derzeit nur zu erahnen sind.
Mit der Stunde der Asiaten, die gerade anbricht, beginnt für uns keine einfache Zeit. Sie wird die Geschichte verändern und die Europäer zu einem neuen Selbstverständnis zwingen. Schon die Kinder der heute Vierzigjährigen, spätestens aber ihre Enkel drohen als Zaungäste am Weltgeschehen teilzunehmen. Im stolzen Bewusstsein, brave und friedfertige Multilateralisten zu sein, werden sie ihre Interessen in Anlehnung an eine oder mehrere der großen Mächte zur Geltung bringen müssen; die Geschicke können sie dann nicht mehr aus eigener Kraft steuern. Die Chancen Europas, in der Welt von morgen einen angemessenen Platz zu finden, schwinden mit jedem Tag, den es weiterhin nach innen schaut und die Augen vor der asiatischen Revolution verschließt.
WIEDERAUFSTIEG - Der Osten im Blick des Westens
Dass Asien eines Tages Europa und vielleicht sogar Amerika den Rang als führende Weltregionen ablaufen wird, ist keine neue These. Im Gegenteil, sie hat Tradition, wenn auch keine sehr erfolgreiche. Schon im 19.Jahrhundert stimulierte Asien, das seiner Geschichte und Größe wegen nie aus der Weltgeschichte wegzudenken war, die Phantasien von Politikern und Vordenkern. Nicht nur der deutsche Kaiser WilhelmII. beschwor die «gelbe Gefahr». Karl Marx setzte sich mit der wiederkehrenden Dominanz des Kontinents auseinander, und Oswald Spengler fühlte sich nicht zuletzt von Asien zu seiner These vom «Untergang des Abendlandes» inspiriert. Sogar der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt, zu dessen Zeit die Vereinigten Staaten als Weltmacht heranreiften und fast ganz Asien in westliche Protektorate eingeteilt war, warf zu Beginn des 20.Jahrhunderts einen erstaunlichen Blick in die Zukunft: «Die Geschichte der Menschheit begann mit einer mediterranen Epoche; sie hat sich in einer atlantischen Epoche fortgesetzt; und sie tritt gegenwärtig in eine pazifische Phase ein.»
Sie waren alle etwas früh dran. Das 20.Jahrhundert blieb ein atlantisches – und vor allem ein nordamerikanisches. Auch der Versuch, das 21.Jahrhundert zum «asiatischen» oder «pazifischen» zu erklären, schien zunächst von den Realitäten widerlegt zu werden. Die Wissenschaftler, Politiker und Journalisten, die vor zehn Jahren Derartiges prophezeit hatten, mussten ihre Parolen während der «Asienkrise» der späten neunziger Jahre kleinlaut zurücknehmen. Zum Schluss waren es doch immer die nackten Zahlen, die über die akademischen, oft schwärmerischen Projektionen triumphierten. Ende der neunziger Jahre, inmitten der aufkommenden China-Euphorie, platzierte der renommierte Politikwissenschaftler Gerald Segal einen Artikel in Foreign Affairs – dem Zentralorgan der internationalen Debatte–, der die Prediger von der neuen Welt ein für alle Mal zum Schweigen bringen sollte. Unter dem trockenen Titel «Does China Matter?» dekonstruierte Segal in allen relevanten Bereichen– Politik, Wirtschaft und Militär – die Idee einer chinesischen Überlegenheit. Segal bestärkte, vielleicht zum letzten Mal, all jene, die den Verkündern des asiatischen Jahrhunderts vorhielten, die Wirklichkeit aus dem Blick zu verlieren.
Nach der Millenniumwende wurden die «Realisten» leiser. Segals Aufsatz ist heute in fast allen Punkten widerlegt. China hat sich politisch wie militärisch zur unbestrittenen Vormacht in Asien entwickelt. Seine Wirtschaft – vom Markt bis zu den Devisenreserven – hat eine derart überragende Bedeutung erlangt, dass die immer noch stärkste Ökonomie der Welt, Amerika, keine wirklich unabhängige Politik mehr betreiben kann. In den Planungsstäben Washingtons herrscht kein Dissens mehr darüber, dass der einzig ernst zu nehmende Gegner – der strategische Rivale um die globale Hegemonie – in Peking sitzt.
Umgeben ist das Reich der Mitte von zwei Dutzend asiatischen Ländern, die sich, bei allen Konflikten und Verwerfungen, tendenziell in einer Aufwärtsbewegung befinden. Selbst notorische Troublespots wie Indonesien oder Sri Lanka erfreuen sich Wachstumsraten von über 5Prozent. Geeint sind die so unterschiedlichen Länder Asiens in ihrem Wunsch, voranzukommen. Dass allerorten von «verstärkter Zusammenarbeit» mit Europa und Amerika die Rede ist, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Region den eigenen Vorteil anstrebt – und damit die sukzessive Verdrängung des Westens als dominanten Spieler in Weltwirtschaft und globaler Politik. Selbst der traditionsbewusste Weltendeuter – und dem Atlantizismus verhaftete – Henry Kissinger erblickt inzwischen im asiatischen Aufstieg den folgenreichsten Vorgang der internationalen Politik. Die Verschiebung von Weltmachtpotenzialen nach Asien, sagt er mittlerweile, sei «viel bedeutender» als die momentane militärische Überlegenheit Amerikas.
In beachtlichem Missverhältnis zu den tektonischen Transformationen, die sich im Dreieck Peking– Tokio– Delhi abspielen, steht die europäische Wahrnehmung des Kontinents. Die wenigen, die Asien überhaupt auf ihrer inneren Landkarte verzeichnen, schwanken noch immer zwischen spiritueller Verklärung und politischem Hochmut. Asien, das ist zum einen der romantische Hort der Weisheit, von Konfuzius und Laotse in China bis zu den modernen Ashrams Indiens; andererseits ist es der arme Kontinent der Überbevölkerung, der religiösen Konflikte und der korrupten Eliten.
Die klischeehafte Wahrnehmung Asiens hat eine lange Tradition. Durch das gesamte Mittelalter hindurch bis zu den Kolonialisierungen speiste sich das westliche Bild Asiens aus antiken Quellen. Das um 400v.Chr. geschriebene Indienbuch des Ktesias erzählte Geschichten über sagenhafte Reichtümer und eigentümlich gestaltete Menschen und Tiere. In den hundert Jahre später verfassten Indienbeobachtungen des Megasthenes wurden erstmals Sitten und Gebräuche des fremden Volkes beschrieben. Die größte Fundgrube der Asieninteressierten war vermutlich der Alexanderroman, der im 3.Jahrhundert n. Chr.– etwa 600Jahre nach dem Indienfeldzug Alexanders des Großen – kompiliert wurde. Das Werk, in dem sich Erlebtes und Märchenhaftes auf untrennbare Weise verbinden, beeinflusste die westliche Wahrnehmung Indiens und Asiens für viele Jahrhunderte. Erst die Renaissance mit ihren Eroberungen und die einsetzende Kolonialisierung verpassten dem Asienbild größeren Realitätsgehalt. Kühl beobachtende Prosa wie E.M.Forsters A Passage to India oderV.S.Naipauls India blieben gleichwohl die Ausnahme – typischer sind romantisierende Chronisten wie Joseph Conrad oder Tiziano Terzani, der seine letzten Jahre gewandet und frisiert wie ein heiliger Sadhu im indischen Himalaya verbrachte.
Geographische Distanz, erschwert durch politische Barrieren, wie sie das Osmanische Reich zwischen Europa und Asien schob, blockierte viele Jahrhunderte lang den direkten Austausch. Abgesehen von Alexanders Truppen und einigen Randeuropäern, die den mongolischen Reiterhorden kurzzeitig in die Augen blickten, hat die Alte Welt keine direkten Erfahrungen mit «den Asiaten» gemacht. Nie standen die Chinesen vor den Toren Wiens, nie führte ein Mogulherrscher Elefanten über europäische Bergketten. In den Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts bildeten sich zwar europäisch-asiatische Allianzen, aber wohl die wenigsten Deutschen hatten eine Vorstellung von ihren japanischen Kampfgefährten oder von geistig Verbündeten wie Sublash Chandra Bose, der mit Hitlers Billigung die Briten aus Indien vertreiben wollte.
Direkte europäisch-asiatische Begegnungen waren den wenigen Abenteurern vorbehalten, die als Wissenschaftler, Literaten, Handelsreisende, Soldaten oder Kolonialverwalter ostwärts gezogen waren. Um einen Asiaten in Europa zu sehen, musste man schon in Oxford oder Paris leben, in Lissabon oder in Amsterdam, wohin es gelegentlich einen Studenten aus den kolonialisierten Gebieten verschlug. Die Entkolonialisierung mit ihren politischen Wirren brachte erste asiatische Flüchtlinge nach Europa, aber sie blieben lange Zeit Exoten, die oft zurückgezogen lebten. Erst der wirtschaftliche Aufstieg Japans und wenig später Südkoreas, Hongkongs und Singapurs mischte den asiatischen Touristen und gelegentlich den Geschäftsmann ins europäische Straßenbild.
Dass zwischen Indus und Pazifik Hochkulturen zu Hause waren, als die Menschen dort, wo heute Berlin steht, noch unmotiviert im märkischen Sand stocherten, ist nicht vielen bekannt. Allenfalls historisch interessierte Asienreisende haben gelernt, dass die Menschen zwischen Java und Burma in zivilisierten Königreichen lebten, als die Europäer im innovationsfernen Mittelalter versanken. Kaum jemandem ist geläufig, dass noch zu Beginn der Neuzeit das China der Ming-Dynastie oder das Indien der Mogulherrscher dem Europa der Renaissance in vielerlei Hinsicht überlegen waren. In seinem Buch Aufstieg und Fall der großen Mächte dokumentierte der Historiker Paul Kennedy, dass zu Beginn der Neuzeit das mogulische Indien technisch mindestens auf Augenhöhe mit Europa stand. Dass in den folgenden Jahrhunderten Europa den Fortschritt vorantreiben würde, schrieb der Historiker, sei damals «keineswegs offensichtlich» gewesen. Politisch an den Rand gedrängt, hielt Asien noch bis ins 19.Jahrhundert hinein einen höheren Anteil an der Weltwirtschaft als Europa und Amerika zusammen. Erst Mitte des 19.Jahrhunderts veränderte sich dieses Verhältnis.
Auf dem politischen Radarschirm des Westens tauchte Asien auf, als es sich langsam aus der kolonialen Umklammerung löste. Der chinesische Boxeraufstand oder die indische Unabhängkeitsbewegung gaben den europäischen Mächten zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts einen Vorgeschmack auf die Wiederkehr einstmals großer, stolzer Völker. Von da an dauerte es noch mehr als ein halbes Jahrhundert, bis sich Asien in Eigenregie reformieren sollte.
Nach 150Jahren Betäubung ist der Kontinent wieder da – nicht als monolithisch zuckender Muskel, sondern als komplexer, aber vitaler Organismus. Leben eingehaucht hat ihm Amerika, das nach dem Zweiten Weltkrieg die erste Erfolgsgeschichte des Kontinents begründete: Japan. Wie meistens in der amerikanischen Außenpolitik, mischten sich in der Unterstützung der besiegten Macht idealistische Motive mit geostrategischen Interessen. Japan, später Südkorea und Taiwan sollten strahlende Gegenmodelle zum kommunistischen Asien werden, das vor allem in China, später in Nordkorea und Vietnam zu Hause war. Bis heute sind in Japan und Südkorea die größten amerikanischen Militärkontingente in Asien stationiert.
Anfang der siebziger Jahre, ein Vierteljahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte Japan wirtschaftlich Anschluss an den reichen Westen gefunden. Sein Bruttosozialprodukt erreichte den Umfang des bundesrepublikanischen. Danach eilte es den Ländern Europas in schnellen Schritten davon. Selbst die über zehn Jahre anhaltende Rezession, die erst im Jahr 2003 in ein leichtes Wachstum übergegangen ist, hat Japans Rang als zweitgrößter Wirtschaftsnation nichts anhaben können. Lange waren die Länder Asiens auf den japanischen Leuchtturm ausgerichtet. Tokio zeigte den anderen Hauptstädten, wie man als asiatisches Land Erfolg haben konnte. Die «Tigerstaaten» – Südkorea, Taiwan, Singapur und die damals britische Kronkolonie Hongkong – schlossen als Erste auf. In den späten achtziger Jahren setzte die zweite Tigergeneration zum Sprung an: Thailand, die Philippinen, Malaysia, Indonesien.
Vor fünfzehn Jahren hatte sich der asiatische Boom auch in Europa herumgesprochen. Große Konzerne wie Siemens oder Bayer, die immer in Asien aktiv gewesen waren, bauten ihre Geschäfte aus. Neue Investoren machten sich auf den Weg. Banken und Versicherungen versuchten, einen Fuß in die Tür zu bekommen, die von der neuen Mode der Liberalisierung geöffnet wurde. Unternehmer wie der Siemens-Vorsitzende von Pierer und der damalige deutsche Botschafter in Peking, Seitz, antichambrierten bei der Regierung Kohl und forderten Unterstützung ein. Lobbygremien wie der «Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft» wurden gegründet, Beratergruppen eingesetzt, die damalige Bundesregierung verabschiedete das erste deutsche «Asienkonzept».
Die nötige Wucht verlieh dem Thema aber erst die gesellschaftspolitische Diskussion. Politiker wie der Gründer von Singapur, Lee Kuan Yew, oder der langjährige malaysische Premierminister Mahathir formulierten provokante Thesen von der Überlegenheit «asiatischer Werte» gegenüber dem angeblich zersetzenden Liberalismus des Westens. Konfuzianische Tugenden wie Gehorsam, Disziplin und familiärer Zusammenhalt seien besser geeignet, moderne Volkswirtschaften effektiv zu entwickeln, behaupteten sie – und trafen im Westen nicht nur auf Widerspruch. Neben autoritär geneigten Law-and-Order-Politikern zeigten sich auch liberale Intellektuelle wie Sir Ralf Dahrendorf fasziniert und «herausgefordert» von den Stimmen aus der neuen Welt.
Dass die breite Mehrheit in Deutschland gleichwohl wenig mit diesen Ideen anfangen konnte, zeigte sich nach der großen Asienreise des sichtlich beeindruckten Bundespräsidenten Roman Herzog. Seinem Appell, sich etwas mehr von der Dynamik in Asien abzugucken, schlug die gleiche Entrüstung entgegen, die schon den Apologeten des «amerikanischen Modells» vertraut war. Als dann im Juni 1997 in Thailand die Währungskrise ausbrach und binnen weniger Monate beinahe den ganzen Kontinent ökonomisch in die Knie zwang, war die Genugtuung in westlichen Politikerkreisen nicht zu überhören. Der Parvenü hatte überdreht! Der Oppositionspolitiker Joschka Fischer, der sich damals für Außenpolitik zu interessieren begann, instrumentalisierte die Vorgänge für seine grüne Menschenrechtspolitik. Andere verwiesen schlicht auf die ehernen Stärken der sozialen Marktwirtschaft. Der «Rheinische Kapitalismus», so verschlafen er auch sein mochte, schien einen Sieg davongetragen zu haben. Seine Ausrichtung auf demokratische Teilhabe und soziale Kohäsion wirkte dem asiatischen «Raubtierkapitalismus» auf Dauer überlegen.
Lange hielt diese Gewissheit nicht an. Asien erholte sich rasch – ohne dabei «europäisch» zu werden. Viele Länder beherzigten die Ratschläge des Internationalen Währungsfonds, ordneten ihre Bankensektoren neu und schufen mehr Transparenz im Wirtschaftssystem. Andere, wie Malaysia, gingen eigene Reformwege und schotteten sich für einige Jahre von den internationalen Kapitalmärkten ab; auch sie kamen wieder auf die Beine. Das «gute Regieren» wurde zum Schlagwort, Werte wie Rechenschaftspflicht und Partizipation machten Karriere. In Indonesien wurde Asiens dienstältester Diktator– Suharto – von der «Reformasi»-Bewegung aus dem Amt gedrängt; es entstanden ein plurales Parteiensystem und eine freie Presse. Thailand verabschiedete eine Verfassungsreform, die – zumindest vorübergehend – die demokratischen Elemente stärkte. In Südkorea wurde der langjährige Dissident und Demokratieaktivist Kim Dae Jung zum Präsidenten gewählt.
Zum Star der Jahrtausendwende stieg aber der kapitalistische Einparteienstaat China auf, der von der Krise unberührt geblieben war. Die wachstumsverliebten Parteisekretäre in Peking entwickelten das Reich der Mitte in atemberaubendem Tempo. Auf dem chinesischen Sonderweg wurde das Land zum größten Absatzmarkt Asiens und zugleich zur Werkbank der Welt. Was noch wenige Jahre zuvor für Zukunftsmusik gehalten wurde, erfüllte plötzlich mit einem Paukenschlag den Raum: China forderte Japan auf Platz eins in Asien heraus.
Während sich die Asiaten im Südosten wieder berappelten, betrat ein weiterer Akteur die internationale Bühne: Indien. Zwar war schon seit Anfang der neunziger Jahre das «Potenzial» der weltgrößten Demokratie gerühmt worden, aber erst mit den Wirtschaftsreformen der konservativen BJP-Regierung sprach man vom Erwachen des «zweiten Giganten». Indien baute seine «strategische Partnerschaft» mit den Vereinigten Staaten aus und begann, seine schwierigen Beziehungen mit China zu entspannen. Die Politiker des Westens, vom amerikanischen Außenminister Powell bis zum EU-Kommissionspräsidenten Prodi, schwärmten von der zweiten «werdenden Supermacht» und verstärkten ihre Reisetätigkeiten. Heute steht Asien als Ganzes im Blickfeld – als Kontinent der Zukunft.
ASIENS KRÄFTE
EHRGEIZ - Von Menschen und Zielen
Unter Delhis Vermietern ist man sich ziemlich einig, dass die besten Mieter aus dem Westen kommen. Sie tun, was indische Mieter nie täten: das Doppelte des Marktüblichen zahlen, das Geld für ein Jahr im Voraus in Plastiktüten auf den Tisch stellen, auf eigene Kosten renovieren und Kündigungsfristen einhalten. Die Zeiten, da der «weiße Mann» hofiert, geachtet und bewundert wurde, sind auf dem Subkontinent lange vorbei. Man muss schon aufs Land hinaus, um noch einen Abglanz der alten Ordnung von oben und unten zu erhaschen. In den Städten, auf Behörden, in den Restaurants und bei der Arbeit werden Europäer bestenfalls freundlich behandelt, oft pragmatisch – und nicht selten von oben herab.
Das ist in Shanghai, Singapur und Kuala Lumpur nicht viel anders. Kaum ein Europäer, der in den Boomstädten Asiens beruflich unterwegs ist, bleibt von der Erfahrung einer gewissen Kühle verschont. Die Aufholerfolge der vergangenen Jahre haben das Selbstbewusstsein der Asiaten gestärkt und zumindest in den Eliten eine Kultur der Überheblichkeit begründet. Ein frühes und zugleich prominentes Opfer asiatischer Arroganz war Klaus Kinkel, Kohls zweiter Außenminister. Als er im Jahr 1997Malaysia besuchte, richtete der damalige stellvertretende Premierminister Anwar Ibrahim ein Abendessen für den Gast aus. Nach Kinkels etwas hölzerner Rede, die aus dem Deutschen übersetzt werden musste, sprang der jungenhafte Anwar auf die Bühne und erteilte dem Minister eine Lektion in elegantestem Englisch. Er wisse, dass die deutsche Wirtschaft strauchele, sagte er und krempelte grinsend die Hosentaschen nach außen. Dann forderte er Kinkel persönlich auf, nach der Rückkehr den arbeitslosen deutschen Facharbeitern die Auswanderung nach Malaysia anzubieten. «Hier gibt es genug zu tun, hier verdient man gutes Geld.» Kinkel war nicht nur positiv beeindruckt, nahm die Angelegenheit aber sportlich; kurze Zeit später brach die Asienkrise aus, und Anwar verschwand für viele Jahre im Gefängnis.
Die Herablassung, mit der viele Europäer behandelt werden, mündet aber zuweilen auch in handfester Missstimmung. Ein deutscher Spitzenbeamter verriet unlängst in privater Runde, warum der frühere deutsche Wirtschaftsminister Clement so unerklärlich lange brauchte, bis er das erste Mal den Boden des Boomlandes Indien betrat. Clements Reiseunlust entstand auf der Welthandelskonferenz in Cancun, wo die deutsche Delegation eines Abends – als die Verhandlungen ins Stocken geraten waren – um ein informelles Gespräch mit den Indern bat, die auf dem gleichen Stockwerk wohnten. «Die Inder hielten es nicht mal für nötig, auf unsere Anfrage zu reagieren», empörte sich der Beamte noch Monate später und fügte an: «Warum sollte Clement über das Mittelmeer und den Hindukusch fliegen, wenn die Inder uns nicht mal über den Flur entgegenkommen?»
Nicht nur europäische Politiker, auch Diplomaten, Geschäftsleute, Journalisten und Wissenschaftler wissen von solchen Erlebnissen zu berichten. Oft gründet die Arroganz der Eliten im Bewusstsein einer sprachlichen und biographischen Überlegenheit. Viele asiatische Erfolgsmenschen wurden an amerikanischen Universitäten ausgebildet oder bedienen sich – wie Inder und Singapurer – des Englischen als Muttersprache. Auch sind sie oft erfahrener im internationalen Geschäft als die Kontinentaleuropäer, die manchmal erst im fortgeschrittenen Alter den ersten «Expat-Job» antreten. Während in Asien Auslandserfahrung als unverzichtbar für den Weg nach oben betrachtet wird, gelten in Deutschland, Frankreich oder Italien längere Aufenthalte fern der Heimat eher als Karrierebremse. Grundiert wird das asiatische Selbstbewusstsein von der Gewissheit, aus einer Weltregion zu stammen, der die Zukunft gehört. Vor allem Inder und Chinesen lieben es, den Europäern vorzurechnen, wie der Globus von morgen aussieht, wenn sich die wirtschaftlichen und demographischen Parameter weiter linear entwickeln. Sie stehen wie der fröhlich-ambitionierte Student vor dem soignierten Herrn, der seinen Wohlstand nicht mehr lange wird genießen können.
Triumphalismus, Leistungsethik, intellektuelle Ungeduld – das sind nicht unbedingt die Eigenschaften, die den Asiaten traditionell zugesprochen werden. Die Moderne hat von den ehrwürdigen Theorien des Westens über den Osten nicht viel übrig gelassen. Kohorten von Denkern meinten, eherne Gegensätze zum Osten ausmachen zu können. Asien war statisch – Europa dynamisch; Asien autoritär – Europa freiheitlich; Asien spirituell – Europa materialistisch. Allzu oft reflektierten die Theorien bestenfalls historische Momentaufnahmen. Hegels These von der «geschichtlichen Unwandelbarkeit» Chinas wurde spätestens mit der Kulturrevolution ad absurdum geführt; im Zeichen der Glitzerfassaden von Pudong wirkt sie geradezu aberwitzig. Auch Max Webers religionssoziologische Erklärungen, die etwa Hinduismus und kapitalistische Leistungsethik als unvereinbar darstellen, lassen sich aus dem modernen Bangalore betrachtet nur noch schwer begründen.
Selbst der jüngere Blick auf Asiens Erfolge ist oft verzerrt. Die Japan-Euphorie der achtziger Jahre produzierte den Topos des leistungswütigen, unmenschlich disziplinierten Arbeitsroboters. Moderne Japaner entsprechen diesem Bild so wenig, wie chinesische Arbeiter das Klischee bedienen, zentral gesteuerte Zwangsarbeiter ohne individuelle Eigenschaften zu sein. Asiaten sind sich in der Regel der Härten ihres Erwerbsalltages durchaus bewusst und ziehen individualisierte Arbeitsplätze dem Massenerlebnis am Band oder im Großraumbüro allemal vor.