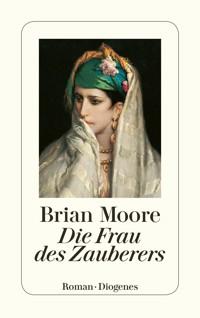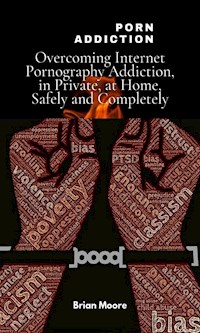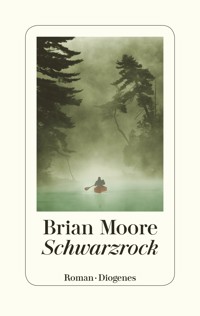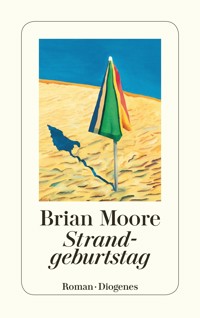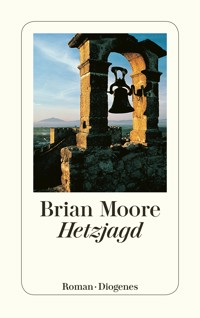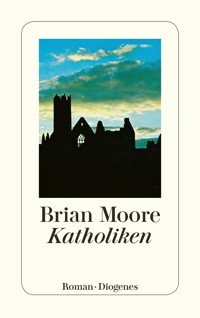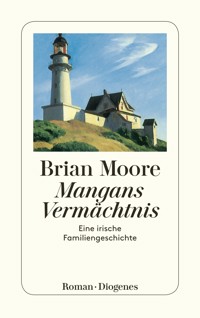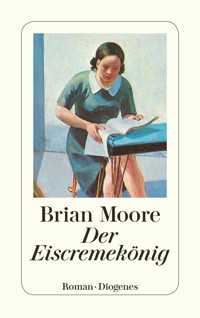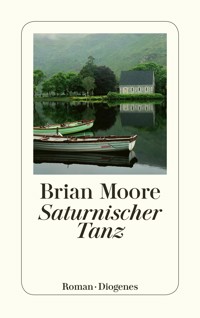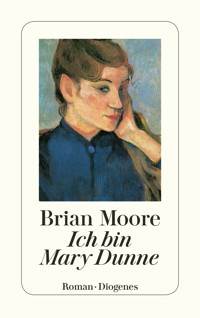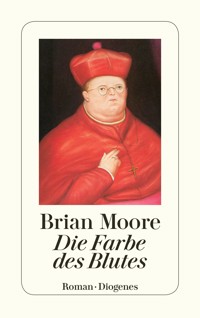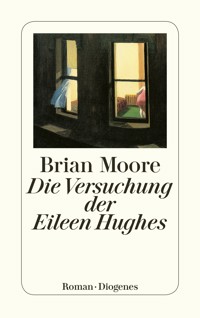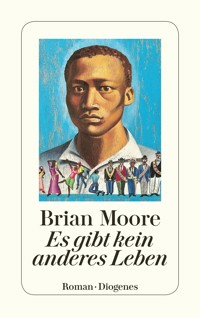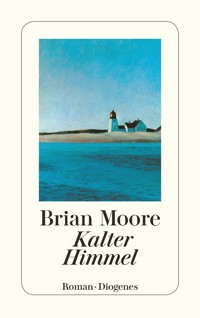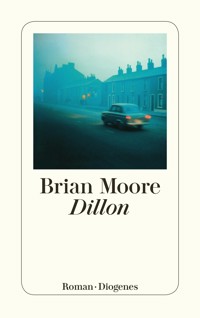9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sheila Redden reist ihrem Mann, einem erfolgreichen Arzt, nach Frankreich voraus. In Paris lernt sie den jüngeren Amerikaner Tom kennen. Nach Tagen des Zögerns und der Selbstzweifel lässt sich Sheila schließlich auf diese Liebe ein und erlebt nie gekanntes Glück. Tom bedrängt sie, alles aufzugeben und mit ihm nach Amerika zu gehen. Sheila muss sich entscheiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Brian Moore
Die Frau des Arztes
Roman
Aus dem Englischen von Jürgen Abel
Diogenes
Für Jean
{5}Die Maschine aus Belfast landete pünktlich, aber die Passagiere mußten lange auf ihr Gepäck warten. »Dieser Flug ist jeden Tag ausgebucht«, sagte ein junger Mann, der neben Dr. Deane stand und beobachtete, wie die ersten Koffer wackelnd das Förderband herunterkamen. »Es ist die einträglichste Route im Bereich der Britischen Inseln«, sagte der junge Mann. Dr. Deane nickte, er war nicht sehr gewandt in der Konversation mit Fremden. Er sah seine weiche Canvas-Reisetasche die Rampe heruntergleiten. Sie wirkte etwas abgeschabt – kein Wunder. Sie war ein Hochzeitsgeschenk von den anderen Assistenzärzten gewesen, vor zwanzig Jahren. Er nahm die Tasche, ging hinaus und stieg in den Bus zum Terminal 11, wo er mit der Zwölfuhrmaschine nach Paris weiterfliegen wollte. Hier in London regnete es. Es war sehr stürmisch gewesen, als er am Morgen aus dem Haus gegangen war, aber der Wetterbericht hatte wolkenlosen Himmel über dem südöstlichen Teil der Britischen Inseln vorhergesagt. In der Flughafenhalle, nach dem Einchecken, beschloß er einen kleinen Whiskey zu trinken. Es war noch früh am Tag, aber er dachte an das alte irische Ausschankgesetz. Ein redlicher Reisender darf sich auch außerhalb der üblichen Schankstunden ein Glas genehmigen.
Auf dem Weg zur Bar blieb Dr. Deane am Zeitungsstand stehen und kaufte nach kurzem Stöbern den Guardian und das Time-Magazin. Dann ging er weiter und stellte sich, eine hochgewachsene, einsame Gestalt, an die lange, moderne Theke.
{6}»John Jameson sagten Sie, Sir?« fragte der Barkeeper und suchte die Flasche. Als Dr. Deane den Fingerhut voll Whiskey in dem Glas sah, fiel ihm wieder ein, daß er in England war. »Geben Sie mir lieber einen doppelten«, sagte er.
»Einen doppelten, sehr wohl, Sir.«
Er trank einen Schluck von dem Whiskey. Über den Lautsprecher sagte eine Stimme Flüge nach Stockholm, Prag und Moskau an. Er fand es immer noch seltsam, zu denken, daß Leute aus dieser Halle hinausspazieren und in Städte fliegen konnten, die für ihn nur Namen in der Zeitung waren. Als er seinen Whiskey ausgetrunken hatte, nahm er zwei Gelusil-Tabletten. Er hatte mit Magengeschwüren zu tun – ein Familienleiden – und zweimal im Lauf der Jahre Blutungen gehabt. Eigentlich sollte er vorsichtig sein. Aber in der letzten Zeit war er genau das Gegenteil gewesen. Natürlich tranken in Irland heutzutage alle Leute mehr als früher. Das war klar.
Als sein Flug aufgerufen wurde, stieg er als einer der ersten in den Bus, der die Passagiere zu der wartenden Maschine brachte. Im Bus knöpfte er seinen Regenmantel auf. Darunter trug er einen grünen Tweedanzug, ein gelbes Hemd und eine grüne Krawatte. Die Farben ließen sein Gesicht eingefallen und grau erscheinen. Seine Frau suchte ihm gern die Sachen, die er anzog, aus. Sie hatte keinen Geschmack. Er wußte es, aber er ließ sie gewähren. Er war friedlicher als sie.
Vorn krochen mehrere Flugzeuge hintereinander wie aufgezogene Spielzeuge zum Startpunkt. Dr. Deane beobachtete, wie ein riesiger amerikanischer Jet in den regenschweren Himmel abhob, und fragte sich, ob er selbst vielleicht in die falsche Richtung startete. Und dann, unter {7}dem Aufheulen der Triebwerke, war seine eigene Maschine in der Luft, und er betrachtete die englische Landschaft unter sich. Soweit man es noch Landschaft nennen konnte. So viel mehr Häuser und Straßen und Menschen als daheim! Fünfzig Millionen auf dieser Insel, und kaum fünf Millionen in ganz Irland.
Das Flugzeug stieß durch Regen und Wolken in den klaren Himmel, den der Wetterbericht am Morgen vorhergesagt hatte, und nach einer Weile kamen die Stewardessen und verkauften Zigaretten und Getränke. Er ließ sich einen Haig geben und stellte fest, daß der zollfreie Drink ein Viertel von dem kostete, was er in der Flughafenbar für den Jameson bezahlt hatte. Er löste den Sicherheitsgurt, nahm das Glas und betrachtete den blaßgelben Scotch. Seine Frau war entschieden gegen diese Reise gewesen: Stecknadel im Heuhaufen, vergebliche Mühe – all die Klischees, die sie immer parat hatte. Er hatte sie gebeten, es niemandem zu erzählen, aber vielleicht war das zuviel verlangt von ihr. Er blickte nach unten, sah, daß die Maschine bereits über Wasser war, und drehte den Kopf nach hinten, um noch einen Blick auf die weißen Klippen von Dover werfen zu können. Die Stewardessen kamen wieder durch den Gang, brachten Tabletts mit kaltem Lunch. Er dachte an den Brief, der vor zwei Tagen in Paris angekommen war. Ein Brief von dem Amerikaner, an Sheila gerichtet, c/o Peg Conway. Seine Tachykardie setzte ein. Es sind nur die Nerven, mit meinem Herzen ist alles in Ordnung. Mir fehlt nichts. Ich fliege nach Paris, um Peg zu besuchen und mit diesem Priester zu sprechen. Um zu sehen, was ich herausfinden kann.
Die Stewardeß beugte sich zu ihm herab und gab ihm ein Plastiktablett: ein Teller mit kaltem Braten, ein {8}Cremetörtchen und ein Schälchen mit grünem Salat. »Möchten Sie etwas essen, Sir?«
Dr. Deane hatte keinen Hunger, aber das Geschwür mußte gefüttert werden. Er nahm das Tablett.
Peg Conway, eine zierliche Frau, kam wieder aus der Diele ihrer Wohnung und stand wie ein kleines Mädchen vor Dr. Deanes einsamer Höhe. Altmodisch wie er war, hatte er sich vom Sofa erhoben, als sie in das Wohnzimmer zurückkehrte. »Bleiben Sie doch sitzen«, ermunterte sie ihn. »Hier ist er.«
Dr. Deane drehte den Brief in den Händen, nahm die amerikanischen Luftpostbriefmarken zur Kenntnis und die Adresse, an die er gerichtet war:
MME SHEILA REDDEN
C/O CONWAY
29, QUAI SAINT-MICHEL
PARIS, 75005
FRANCE
Faire suivre, s.v.p. – Urgent. Please forward
Dann las er den Namen und die Adresse des Absenders:
T. LOWRY
PINE LODGE
RUTLAND, VERMONT05701
USA
»Sie sehen, er ist am zweiten in Vermont aufgegeben worden. Also vier Tage, nachdem sie Paris angeblich verlassen hatten.«
{9}Dr. Deane ließ sich wieder auf das abgeschabte braune Samtsofa sinken. Er tippte mit dem Zeigefinger auf den Umschlag, der jetzt auf seinem Knie lag.
»Warum machen Sie ihn nicht auf?« sagte Peg.
Er lächelte nervös und blickte wieder auf den Brief. »Ach nein, ich glaube, lieber nicht. Es wäre nicht richtig.«
»Es ist schließlich ein Notfall.«
»Ich weiß.«
»Hören Sie«, sagte Peg. »Sie soll in Amerika sein. Aber ist sie es? Sehen Sie sich das Datum auf dem Umschlag an. Wenn er ihr den Brief geschrieben hat, bedeutet das, daß sie nicht mehr zusammen sind.«
»Nicht unbedingt.« Dr. Deane nahm eine Gauloise aus einer zerknitterten Packung und zündete sie sich an. »Vielleicht hat sie an dem Abend kalte Füße bekommen und ist ihm dann später nachgereist.«
»Als der Brief schon aufgegeben war?«
»Genau.« Er machte einen Lungenzug und atmete den Rauch durch die Nase aus.
»Ich dachte, die meisten Ärzte rauchen heutzutage nicht mehr.«
»Ich bin rückfällig geworden.«
»Und was haben Sie jetzt als nächstes vor?«
»Ich überlege gerade«, sagte Dr. Deane. »Es ist durchaus möglich, daß sie jetzt bei ihm ist, in Vermont. Ich könnte versuchen, sie dort anzurufen.«
»Sie meinen, in Amerika anrufen? Bei dieser Adresse?«
»Ja.«
»Das würden Sie lieber tun, als den Brief zu öffnen?«
»Ja.«
»Na gut, also los«, sagte Peg. »Immerhin eine Idee. Hören Sie zu, ich gehe jetzt in die Küche und bereite das {10}Abendessen vor. Dann sind Sie ungestört, falls Sie Sheila erreichen. Das Telefon steht da drüben.«
»Ich lasse mir die Gebühren durchsagen.«
»Machen Sie sich darum keine Sorgen.«
Er stand auf, als sie hinausging, und hörte gleich darauf, wie sie geräuschvoll die Küchentür schloß, um ihm zu bedeuten, daß niemand zuhören würde. Eine große, gefleckte Katze kam aus dem Flur hereinstolziert, machte einen Buckel und schmiegte sich dann an sein Hosenbein. Er betrachtete wieder die Adresse auf dem Briefumschlag und ging zu dem Schreibtisch hinüber, auf dem das Telefon stand. Durch die Balkontür konnte er tief unten die Seine sehen, wie sie sich durch die Innenstadt wand; zu seiner Linken sah er den angestrahlten Turm der Sainte-Chapelle hinter dem Justizpalast, und flußabwärts die ehrfurchtgebietende, feierliche Fassade von Notre-Dame. Und mit dieser Aussicht vor Augen – so anders als jede Aussicht daheim – den Telefonhörer abzunehmen und Worte zu sprechen, die durch ein Unterseekabel zu dem riesigen Kontinent liefen, den er nie gesehen hatte! Es war, als lebte er nicht mehr sein eigenes Leben, sondern spielte plötzlich in einem Film mit, als Detektiv, der eine Vermißte suchte, oder eher noch als Verbrecher, der seinem Opfer Schadenersatz leisten wollte. Und jetzt wählte er und sprach mit der Auslandsvermittlung und hörte, ehe eine Minute vergangen war, ein fernes, aber deutliches und ganz selbstverständliches Läuten, als riefe er jemanden am anderen Ende der Straße an.
»Pine Lodge«, sagte eine amerikanische Stimme.
»Ich habe hier ein persönliches Gespräch aus Paris, Frankreich«, sagte das Fräulein von der Vermittlung. »Für eine Mrs. Sheila Redden.«
{11}»Tut mir leid, bei uns wohnt keine Mrs. Redden.«
Dr. Deane unterbrach. »Wohnt dort ein Mr. Tom Lowry?«
»Einen Moment, Sir, möchten Sie statt dessen Mr. Tom Lowry sprechen?« fragte das Fräulein von der Vermittlung.
»Ja, bitte.«
»Danke. Hallo, Vermont? Wohnt bei Ihnen ein Mr. Tom Lowry, bitte?«
»Ja, Augenblick«, sagte die amerikanische Stimme. »Tom? Paris! Apparat zwei.«
»Hallo« – eine Stimme, jung, sehr aufgeregt.
»Mr. Lowry, ich bin Sheilas Bruder und rufe aus Peg Conways Wohnung in Paris an. Mein Name ist Deane, Owen Deane.«
»Oh.« Die Stimme wurde kühl. »Ja?«
»Ich versuche, Sheila zu erreichen. Es geht um Geld, das ich ihr schicken soll. Ist sie dort?«
Ein kurzes Zögern. »Tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht helfen.«
»Ich rufe an, weil hier ein Brief von Ihnen ist, ein Brief an Sheila. Wir dachten, sie sei bei Ihnen. Wir machen uns natürlich Sorgen um sie.«
»Tut mir leid.«
»Hören Sie, falls Sie wissen, wo sie ist, würden Sie ihr dann bitte etwas ausrichten? Würden Sie ihr bitte sagen, sie möchte mich auf meine Kosten im Hotel Angleterre in Paris anrufen? Ich gebe Ihnen die Nummer.«
»Tut mir leid. Guten Tag«, sagte die Stimme des Jungen. Dann klickte es.
Dr. Deane stand da, den Hörer in der Hand, und sein Herz fing wieder mit der Tachykardie an, die ihn plagte, {12}seit diese Sache begonnen hatte. Er legte den Hörer auf, sah sein blasses Gesicht im Spiegel und dachte wieder an die Worte, die sie an jenem Tag zu ihm gesagt hatte: Vergiß mich. Ich bin wie der Mann in der Zeitungsstory, der ganz normale Mann, der zur nächsten Ecke geht, um Zigaretten zu kaufen, und von dem man nie wieder etwas hört. Wenn er sich vorstellte, daß sie erst vor vier Wochen hierher nach Paris gekommen war, um einen ganz normalen Sommerurlaub zu beginnen! Sie war in dieser Wohnung gewesen, hatte in diesem Zimmer gestanden. Seine Augen blickten forschend in den Spiegel, als könnte, hinter ihm, seine Schwester plötzlich wieder erscheinen. Aber der Spiegel zeigte ihm nur sein eigenes Bild, sein Judasgesicht.
{13}Erster Teil
1
»Stell Deine Sachen ins Gästezimmer«, hatte Peg geschrieben, »und mach es Dir gemütlich, ich werde vor sechs nicht zu Hause sein.« Sheila Redden setzte ihren schweren Koffer ab und tastete unter dem Läufer auf der obersten Treppenstufe nach dem Schlüssel, der dort laut Pegs Brief liegen sollte. Sie zog ihn hervor, steckte ihn ins Schloß, und die Tür öffnete sich ächzend nach innen. Als sie sich nach dem Koffer bückte, sauste eine große, gefleckte Katze an ihr vorbei und sprang in die Wohnung. Ob das Pegs Katze war? Mrs. Redden ging hinein, rief »Puss, Puss, Puss« – auch wenn Puss einer französischen Katze vermutlich nicht viel sagte. Wurden französische Katzen nicht Minou genannt? Sie trat in die Diele, rief immer noch »Puss, Puss, Puss«, verflixtes Biest, aber dann sah sie die Katze, wie sie, ganz zu Hause, Wasser aus einem kleinen Schälchen in der Küche schlappte. Das hatte also seine Richtigkeit. Sie zog ihren Mantel aus.
Es war still hier: so hoch oben verschwammen die Straßengeräusche zu einem fernen monotonen Summen. Im Wohnzimmer dachte sie, daß man von dem kleinen Balkon aus eine herrliche Aussicht haben mußte. Sie öffnete die mittlere Glastür und trat hinaus. Unter ihr wand sich die Seine durch Straßen, die so reich an Geschichte waren {14}wie keine irische Stadt, und während sie hinabblickte, glitt ein Touristendampfer aus dem schattigen Dunkel unter dem Pont Saint-Michel ins Sonnenlicht, und die dichtgedrängt an Deck sitzenden Leute starrten nach oben, in ihre Richtung. Wer sie sah, würde sie für eine reiche Französin halten, die hier oben, gegenüber der Ile Saint-Louis, in Luxus lebte. Der Dampfer glitt seitwärts, als wäre er steuerlos, aber dann nahm er wieder Fahrt auf und rauschte durch brodelndes braunes Wasser in Richtung Notre-Dame. Mrs. Redden beugte sich über das Eisengeländer, um an den sechs Stockwerken entlang hinunter auf die Straße zu blicken, wo weißgeschürzte Kellner, winzig wie kleine Bräutigamfiguren auf einer Hochzeitstorte, zwischen Tischen auf dem Bürgersteig hin und her eilten. Sie mußte an die Aussicht daheim von ihrem Wohnzimmer aus denken. Der Garten: mit Efeu bedeckte Backsteine, der Cave Hill, der Berg von Belfast, der hinter der Gartenmauer aufragte, seine Umrisse, die an das Profil eines schlafenden Riesen erinnerten, das Gesicht nach oben gewandt, dem grauen Himmel zugekehrt. Genau gegenüber von ihrem Haus befand sich die höchste Erhebung des Berges, der Gipfel, der Napoleons Nase genannt wurde. Daran mußte sie jetzt denken, während sie auf Napoleons Stadt hinunterblickte. Der Kaiser auf seinem weißen Roß Marengo, wie er nach dem Sieg von Austerlitz auf die Place des Invalides ritt: Hufeklappern auf Kopfsteinpflaster, seidene Standarten, geflochtene goldene Abzugsleinen, Pelztschakos, die Alte Garde. Napoleons Nase. Und das hier. Sie trat wieder ins Zimmer, schloß die Balkontür, ging in die Diele hinaus, um ihren Koffer zu holen. Aber da – ihr stand beinahe das Herz still – hörte sie jemanden in der Wohnung umhergehen.
{15}Einbrecher. Oder Schlimmeres? Seit der Bombe in der Abercorn Street schreckte sie bei jeder Kleinigkeit zusammen. Sie stand mucksmäuschenstill da, horchte, bis sie sah, oh, Gott sei Dank, wer es war. Ein Mädchen, das im Gastzimmer hin und her ging.
»Hab ich Sie erschreckt?« fragte das Mädchen, als es Mrs. Redden sah und den Ausdruck in Mrs. Reddens Gesicht bemerkte.
»Nein, nein.«
Das Mädchen, der Stimme nach eine Amerikanerin, trug Blue jeans und ein durchsichtiges Bauernhemd. Ein großer Rucksack mit Rahmengestell stand geöffnet mitten im Gastzimmer. »Ich hätte eigentlich schon vor einer Stunde fort sein sollen, aber ich bin am Telefon aufgehalten worden. Sie sind Pegs Freundin aus Belfast, stimmt’s?«
»Ja, stimmt.«
»Ich bin Debbie Rush.«
»Sheila Redden«, sagte Mrs. Redden, und es entstand eine Verlegenheitspause.
»Wie sieht es denn in Belfast so aus?« fragte das Mädchen.
»Oh, wie immer.«
»Muß schlimm sein, nicht? Ob die da je wieder Ordnung schaffen?«
Mrs. Redden lächelte. Sie hoffte, es war ein freundliches Lächeln. Yankees. Kevin hatte eine amerikanische Tante, die in Boston lebte und im letzten Sommer bei ihnen zu Besuch gewesen war: eine Nervensäge. Nun ja, das Mädchen hier arbeitete wahrscheinlich bei Peg.
»Ich nehme an, Sie müssen nur die Briten rausschmeißen«, sagte das Mädchen.
Mrs. Redden fand es überflüssig, darauf zu antworten. »Arbeiten Sie in Pegs Büro?«
{16}»Bei Radio Free Europe?« Das Mädchen mußte lachen. »Nein, nein. Ich bin eine Freundin von Tom Lowry. Tom ist ein Freund von Peg, und als es Ärger mit meinem Charterflug nach Haus in die Staaten gab, hat er mit ihr geredet, und sie hat mich hier pennen lassen, bis Sie kamen. Sie ist wirklich sehr nett.«
Mrs. Redden kam sich sofort schuldig vor. »Dann setze ich Sie sozusagen vor die Tür?«
»Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich gehe heute in ein Hotel, und morgen kriege ich hoffentlich einen Platz in einer Maschine.« Das Mädchen hob den Rucksack hoch und wuchtete ihn sich auf den Rücken. Ihre Brüste standen unter dem dünnen Hemd hervor. Mrs. Redden half ihr, den Rucksack zurechtzuschieben.
»Oh, danke«, sagte das Mädchen. »Gut, daß ich treppabwärts muß und nicht nach oben. Wie finden Sie diese Treppe?«
»Gut für die Figur«, sagte Mrs. Redden.
»Das stimmt.« Das Mädchen schob die Daumen unter die Traggurte, drehte sich um und marschierte wie ein Soldat in die Diele hinaus. Mrs. Redden lief, um ihr die Wohnungstür aufzumachen. »Also dann … war nett, Sie kennenzulernen«, befand das Mädchen.
»Es tut mir leid, daß ich Sie so rauswerfe.«
»Nein, nein, ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Auf Wiedersehen.«
Mrs. Redden hielt die Tür auf – sie wollte sie nicht schließen, ehe das Mädchen fort war, es hätte unfreundlich gewirkt, fand sie – und beobachtete, wie der blonde Schopf abwärts wippte und im Bogen herum, abwärts und im Bogen herum, bis das Treppenhaus leer war.
Vier Stunden später, als Mrs. Redden und Peg Conway {17}mit einem Essen in der Coupole ihr Wiedersehen feierten, blieben zwei Homosexuelle, die durch das Restaurant kamen, unvermittelt stehen, starrten Mrs. Redden an, flüsterten miteinander und machten dann eine formvollendete Verbeugung zu ihr hin.
»Du kennst sie doch nicht?« fragte Peg.
»Nein, natürlich nicht.«
»Sie müssen dich mit irgendwem verwechselt haben.«
»Oder sie haben gedacht, ich wäre ein Mann im Fummel.«
Peg lachte. »Du bist verrückt, warum sollten sie das denken?«
»Wegen meiner Größe. Weil ich so turmhoch aufrage auf dieser kleinen Bank.«
»Wann überwindest du endlich diesen Komplex wegen deiner Größe?«
»So etwas überwindet man nie«, sagte Mrs. Redden.
»Da wir gerade von Schwulen reden –« Peg Conway fing wieder an zu lachen – »was ist eigentlich aus Fairy Rice geworden?«
»War er nicht umwerfend?« Sie lachten beide und erinnerten sich an den Kommilitonen von der Queen’s University, der ständig einen Pullover, so lang wie ein kurzes Kleid, getragen hatte und bei Vorlesungen immer in der ersten Reihe saß und sich mit einem ledernen Nagelkissen die Fingernägel polierte.
»Seine alte Dame ist gestorben«, sagte Mrs. Redden. »Vor ein paar Jahren schon. Ich habe die Todesanzeige im Belfast Telegraph gelesen.«
»Weißt du noch, wie seine Mutter das ganze Studentenhaus unsicher gemacht hat, weil sie ihm unbedingt seinen Lunch in einem Picknickkorb bringen wollte?«
{18}Sie lachten.
»Ich habe gehört, er sei nach England gegangen«, sagte Mrs. Redden.
»Fairy? Wirklich?«
»Ich glaube, ja.«
»Sag mal«, sagte Peg, »habt ihr, du und Kevin, nie daran gedacht auszuwandern?«
»Oh, Kevin würde Belfast nie verlassen.«
»Warum nicht.«
»Es würde bedeuten, wieder ganz von vorn anzufangen, eine neue Praxis aufzubauen. Im übrigen verreist er am liebsten überhaupt nicht. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um ihn zu überreden, diesen Urlaub in Villefranche mit mir zu machen.«
»Ich erinnere mich aber doch, daß er sich früher immer gern amüsiert hat«, sagte Peg. »Die Pferderennen, weißt du noch?« Und während sie das sagte, sah sie ihn vor sich, Sheilas großen, stämmigen Mann, wie er mit einem Tribünenplatz-Abzeichen im Knopfloch mitten im Mitgliederabschnitt auf der Curragh-Rennbahn stand und den Feldstecher hob.
»O Gott, ja, das war immer ein Fest! Nach Dublin fahren, in Buswells Hotel übernachten, dann den ganzen Sonnabend bei den Rennen und ein großes Essen, ehe wir nach Hause fuhren. Aber jetzt hat er dafür keine Zeit mehr.«
»Man sollte sich die Zeit einfach nehmen.«
»Er hatte es wirklich nicht leicht«, sagte Mrs. Redden. »Ich meine, mit seiner Gemeinschaftspraxis. Und jetzt hat er auch noch einen zusätzlichen Job als chirurgischer Berater der britischen Armee. Sie holen ihn drei- oder viermal in der Woche nach Lisburn, in ihr Hauptquartier. Es ist {19}einfach zuviel für einen. Und es hat ihn nicht gerade umgänglicher gemacht, das kann ich dir sagen.«
Peg Conway hörte nicht mehr richtig zu: Sie blickte zur Tür. Sie hatte gehofft, Ivo würde aufkreuzen, aber jetzt war kaum noch damit zu rechnen. Sie sagte: »Apropos Villefranche, ich habe kürzlich ein umwerfend unanständiges Wochenende in Südfrankreich verbracht.«
Mrs. Redden wurde verlegen. »So?« sagte sie.
»Er heißt Ivo Radic. Ein Jugoslawe.«
»Jugoslawe«, sagte Mrs. Redden. Es gab also einen neuen Mann.
»Ein Emigrant. Er unterrichtet Englisch und Deutsch in einer vornehmen kleinen Privatschule im sechzehnten Arrondissement. Im Vergleich zu Carlo ist er jedenfalls ein Fortschritt.«
»Und was ist aus Carlo geworden?«
»Frag mich nicht! Seine Frau kann ihn von mir aus behalten. Ivo ist wenigstens geschieden.«
»Ivo Radic«, sagte Mrs. Redden, als probierte sie den Namen aus.
»Ich habe ihn durch einen komischen Zufall kennengelernt«, sagte Peg. »Hugh Greer – du erinnerst dich doch an Hugh Greer?«
»Natürlich«, sagte Mrs. Redden. Hugh Greer, ein Professor vom Trinity College. Pegs große alte Liebe.
»Also, Hugh hatte in Dublin einen amerikanischen Studenten, einen Jungen, der Tom Lowry heißt. Und als Tom im Sommer nach Paris fuhr, hat Hugh ihn gebeten, mich doch mal zu besuchen. Tom hat es getan, und dann lud er mich auf einen Drink in seine Wohnung ein. Und sein Mitbewohner war Ivo. Also habe ich auf Umwegen Ivo Radic durch Hugh Greer kennengelernt.«
{20}»Du stehst also immer noch mit Hugh in Verbindung?«
»Ja. Der arme alte Hugh. Er hat Krebs – wußtest du das?«
»O Gott.«
»Lunge.«
»Wie alt ist er?«
»Ungefähr fünfzig. Sag mal, hättest du Lust, Ivo kennenzulernen?«
Mrs. Redden überlegte – was sollte sie sagen? »Ja, natürlich«, sagte sie.
»Gut. Paß auf. Wir zahlen jetzt und gehen ins Atrium, das ist ein Café. Gleich um die Ecke dort ist die Wohnung von Ivo und Tom. Ich rufe eben mal an und sehe, ob Ivo zu uns ins Atrium kommen kann«, sagte Peg. Sie stand sofort entschlossen auf und machte sich auf den Weg zum cabinet de toilette, wo die Telefone waren. Mrs. Redden sah ihr nach und blickte dann auf ihre schüchterne, verstohlene Art zu den Leuten in der Nische nebenan hinüber, einem aristokratisch aussehenden älteren Franzosen und seinem jungen Sohn, die beide Bélon-Austern aßen und den Saft aus den Schalen schlürften. Sie erinnerte sich an ihren ersten Besuch in der Coupole. Das war in dem Sommer gewesen, als sie den Sprachkurs an der Alliance Française gemacht hatte. Ihr Onkel Dan war unerwartet nach Paris gekommen und hatte sie hier zum Mittagessen eingeladen, zusammen mit einem jungen Mann, mit dem er verabredet war, dem Pariser Korrespondenten der Irish Times. Nach dem Essen waren sie, alle drei, zu einem Gartenfest nach Fontainebleau gefahren. Die Gastgeberin war irgendeine schwedische Gräfin, mit der Onkel Dan befreundet war. Onkel Dan kannte alle Leute. Krebs, er ist an Krebs gestorben. Jetzt hat es Hugh Greer erwischt. Als Onkel Dan {21}beerdigt wurde, bin ich allein mit dem Zug nach Dublin gefahren. Kevin mußte operieren. Jeder, der etwas war, nahm an der Beerdigung teil, der Kardinal in seinem roten Gewand saß während der Messe auf dem Bischofsstuhl neben dem Altar, und auf dem Friedhof Glasnevin sah ich de Valéra: Er nahm seinen Hut ab und drückte ihn an die Brust, während er dort stand und der Priester die Gebete für den Toten sprach. Lemass, der Premierminister, stand neben ihm, und auch alle Minister waren da, und das ganze diplomatische Korps, alle. Als die Hornisten der irischen Armee nach den Gebeten den Zapfenstreich spielten, saß ich mit Tante Meg in einem großen, gemieteten Daimler. Ich weinte, aber Tante Meg weinte nicht, sie saß nur da und beobachtete alles, ihren Stock fest aufgestützt zwischen ihren Knien, als wäre er das einzige, was sie aufrecht hielt, und in dem Augenblick, als die Hörner gesenkt wurden, sagte sie: »Die Obsttorten, ich habe die Obsttorten vergessen. Ich habe sieben bei Bewley bestellt. Sag Mrs. O’Keefe, sie soll fünf davon zu dem Sherry und den Sandwiches stellen. Sheila, hörst du mir auch zu?«
Mrs. Redden blickte wieder hinüber zu dem älteren Franzosen und seinem Sohn, die ihre Austern inzwischen gegessen hatten und Loire-Wein tranken und die Austernschalen mit dünnen butterbestrichenen Scheibchen Graubrot austupften. Sie drehte sich um und sah Peg durch den großen Raum zurückkommen. Sie macht schon von weitem ein Siegeszeichen mit dem Daumen – der Jugoslawe mußte ja gesagt haben. Also werden wir den Abend in diesem Café, dem Atrium, beschließen, zu dritt. Mrs. Redden lächelte Peg zu, aber sie mußte an Onkel Dans Grab denken, wie es ausgesehen hatte, als sie letztesmal dort gewesen war, allein, zwei Jahre nach seiner {22}Beerdigung, an einem stürmischen Tag mit Blitz und Donner: kein Kreuz auf dem Grab, kein Hinweis, wer er gewesen war, nur eine Platte aus grauem Connemara-Marmor, flach auf dem Grab, wie eine Tür, die in die Erde führte. Sein Name: Daniel Deane. 1899–1966. Sie kaufte in einem Blumenladen am Friedhof ein paar Nelken. Onkel Dan hatte gern eine Nelke im Knopfloch getragen.
Der Friedhofswärter gab ihr eine kleine blaue Glasvase. Rote Nelken in einer blauen Glasvase stellte sie auf sein Grab.
Im Atrium wählte Peg einen Tisch mit einem guten Blick auf den Boulevard Saint-Germain. Mrs. Redden wurde wieder daran erinnert, wie Franzosen sich an einen Tisch setzten – nicht so, daß sie ihren Tischgenossen ins Gesicht blickten, sondern ein wenig seitwärts gewandt, um die Passanten beobachten zu können. Der Jugoslawe war noch nicht erschienen.
»Ich finde es herrlich, hier zu sitzen und sich die Leute anzusehen«, sagte Mrs. Redden und starrte gebannt hinaus auf die Parade draußen auf dem Bürgersteig.
»Die meisten von diesen Leuten täten besser daran, zu Haus zu büffeln, statt hier in ihren Kostümen zu flanieren«, sagte Peg. »Nächste Woche sind die Semesterschlußprüfungen an der Sorbonne. Was für ein Glück, daß ich keine französische Mutter bin!«
Aber Mrs. Redden dachte, daß sie gern eine französische Mutter wäre. Hier konnten die Kinder gehen, wohin sie wollten, ohne daß man Angst vor Bomben haben mußte, ohne daß sie von einer Armeepatrouille angehalten oder versehentlich von der Polizei mitgenommen oder von der Kugel eines Heckenschützen getroffen wurden. {23}Wenn Danny einen Klassenkameraden besuchte und dort von der Dunkelheit überrascht wurde, mußte er meist die Nacht dort verbringen.
Der Kellner kam.
»Hör zu«, sagte Peg. »Wenn wir einen Cognac trinken, ist es am besten, wir bestellen ihn gleich und zahlen, ehe Ivo kommt. Sonst besteht er darauf, uns einzuladen, der arme Kerl.«
»Gut, aber nur, wenn du mich zahlen läßt«, sagte Mrs. Redden. »Deux cognacs et deux cafés, s’il vous plaît.«
»Bien, Madame«, sagte der Kellner.
Vielleicht war es der Cognac, vielleicht aber auch die Aussicht, daß Ivo bald dazukommen würde, jedenfalls wurde Peg jetzt sichtlich munterer. »So, und morgen abend bist du also in Villefranche in demselben Hotel, in dem ihr auf eurer Hochzeitsreise gewesen seid? Das bedeutet immerhin etwas. Daß es dir beim erstenmal gefallen hat.«
Diese Bemerkung verdroß Mrs. Redden, auch wenn sie es sich nicht anmerken ließ. Mit ihren fast vierzig Jahren hätte Peg eigentlich über ihre Schulmädchenmanie, ständig über Sex zu reden, hinaus sein sollen, dachte sie. Aber mitnichten.
»Du wirst ja rot«, sagte Peg.
»Oh, hör auf.«
»Wieso, Sheila? Ich beneide dich. Ich glaube, du gehörst zu den wenigen Leuten aus meiner Bekanntschaft, die immer noch glücklich verheiratet sind. Und ganz bestimmt bist du die einzige, die ein zweites Mal in die Flitterwochen fährt – wie viele Jahre danach?«
»Sechzehn.«
»Mein Gott, ist das wirklich schon so lange her?«
{24}»Danny ist fünfzehn. Wir haben 1958 geheiratet.«
»Dann bist du … achtunddreißig. Das sieht man dir aber nicht an.«
»Bis November bin ich noch siebenunddreißig«, sagte Mrs. Redden lachend.
»Ivo ist vier Jahre jünger als ich. Ich nehme an, das klingt ziemlich dekadent.«
»Ach, Unsinn«, sagte Mrs. Redden, dachte jedoch, ich könnte es nicht, aber ich bin ja auch nicht Peg, sie hat immer all das gemacht, wozu ich nie genug Mut hatte – sie ist nach ihrem Examen nach London gegangen und hat weiterstudiert, ist dann bei der irischen UN-Delegation in New York gewesen, und jetzt lebt sie in Paris und verdient eine Menge Geld bei den Amerikanern. Sie lebt wie ein Mann, frei, hat Affären, reist, lebt immer in großen Städten, während ich, seht mich nur an, all die Jahre zu Haus gehockt habe, und mein Studium – reine Verschwendung. Ich glaube, ich könnte nicht einmal mehr mich selbst ertragen. »Weißt du«, sagte sie zu Peg, »arbeiten und reisen erhält jung. Aber wenn du zu Hause sitzt und nichts tust, kommst du dir vor wie eine Frau in mittleren Jahren. Ich habe gerade neulich darüber nachgedacht. Es ist, als ob die Ferien das einzige in meinem Leben sind, worauf ich mich noch freue. Das ist doch furchtbar, irgend etwas ist da doch nicht in Ordnung.«
»Wahrscheinlich«, sagte Peg, aber Mrs. Redden merkte, daß sie gar nicht richtig zuhörte. Jemand war ins Café gekommen, und jetzt gab Peg ihm ein Zeichen. Mrs. Redden starrte den neuen Gast an. Vier Jahre jünger als sie, wem wollte Peg eigentlich etwas vormachen? Zehn Jahre kamen der Sache schon näher. Der Junge war sehr groß, hatte lange dunkle Haare und ein blasses, hageres Gesicht. {25}Er trug einen braunen Pullover, eine braune Cordhose und ausgetretene braune Wildlederstiefel von der Art, wie Mrs. Reddens eigener Sohn sie sich letztes Jahr gekauft hatte. Er lächelte, als er auf sie zukam, warf mit einer Kopfbewegung die Haare, die ihm in die Stirn hingen, zurück, eine Geste, die früher nur Mädchen gemacht hatten.
»Hallo, Tom«, sagte Peg.
Es war also nicht Pegs Freund.
»Sheila, das ist Tom Lowry. Sheila Redden.«
»Hallo«, sagte er und wandte sich dann an Peg. »Ich bringe leider schlechte Nachrichten. Ivo hat sich wieder den Rücken ausgerenkt.«
»Oh, nein!«
Lässig setzte er sich rittlings auf einen Stuhl und legte die Arme auf die Lehne. Er starrte Mrs. Redden an. Dann sagte er zu Peg: »Er war gerade auf dem Weg zu euch, aber kaum war er zur Tür hinaus, hörte ich ihn schreien und fand ihn völlig fertig unten im Hof.«
»Bestimmt gibt er mir die Schuld«, sagte Peg. »Du wirst es erleben.«
»Nein, nein«, sagte der Junge, doch während er sprach, sah er nicht mehr zu Peg, er starrte wieder Mrs. Redden an, so daß sie überlegte, ob irgend etwas an ihr nicht in Ordnung sei. Sie blickte auf ihren Rock hinunter, aber nein, das war es nicht. Es ist mein Gesicht, er starrt mein Gesicht an.
»Also, was machen wir?« fragte Peg.
»Warum kommt ihr nicht zu uns? Ivo würde euch gern sehen, und ich könnte euch einen Drink machen.«
»Ich weiß nicht«, meinte Peg. »Also gut, aber nur auf einen Sprung. Bist du einverstanden, Sheila?«
»Ja, natürlich.« Was sollte sie sonst sagen? Und wie {26}nicht anders zu erwarten: In dem Augenblick, als sie zustimmte, war Peg auch schon wieder aufgesprungen, ohne die Cognacs zu beachten, die sie noch nicht ausgetrunken hatten. »Warte«, sagte Mrs. Redden. »Ich muß noch zahlen.«
»Lassen Sie mich das machen«, sagte Tom Lowry.
»Nein, nein.« Und so bezahlte Mrs. Redden nach einigem Hin und Her, und dann gingen sie eine dunkle Nebenstraße hinter dem Marché Saint-Germain hinunter, und Peg lief voraus, als wäre der Teufel hinter ihr her, und ließ sie allein mit dem Fremden. Das erste, was sie dachte, war, daß er größer war als sie, wie angenehm, aber trotzdem duckte sie sich aus Gewohnheit ein wenig, während sie neben ihm ging. Er schien mehr der stille Typ zu sein. Der stille Amerikaner, von Graham Greene. Aber dann fiel ihr ein, daß der stille Amerikaner in dem Buch ein unheimlicher, finsterer Bursche war.
»Sie sind aus Nordirland?« fragte er.
»Ja.«
»Ich glaubte doch einen Hauch von Ulster zu erkennen! Machen Sie Ferien?«
Andere Yankees sagten »Urlaub«. Er war anders …»Ja.«
»Sie sind allein hier?«
Sie warf ihm unter dem Licht einer Straßenlaterne einen Blick zu.
»Entschuldigung«, sagte er. »Ich fragte nur, weil Peg mir erzählt hat, Sie kämen mit Ihrem Mann.«
»Oh. Er kommt morgen nach, wir treffen uns in Villefranche.«
»Dann sind Sie nur diesen einen Abend in Paris?«
Sie nickte, und er sagte nichts mehr, bis sie zu dem {27}Mietshaus kamen, in dem er wohnte. Peg wartete schon ungeduldig vor der verschlossenen Haustür. Als er den Schlüssel aus der Tasche zog, um aufzuschließen, sah Mrs. Redden, daß er sie wieder anblickte – so ähnlich, wie sie Leute betrachtete, wenn sie neugierig war und nicht wollte, daß man es merkte.
»Moment, ich mache Licht«, sagte er, als er sie in einen stockdunklen Innenhof führte. Er tastete herum, bis eine Lampe anging, eine trübe Funzel, die gerade so lange brannte, bis sie über den Hof zu der Wohnung im Parterre geeilt waren, in der er wohnte. Als er den Schlüssel in die Wohnungstür steckte, ging das Licht wieder aus. Er schloß im Dunkeln auf, ging ihnen voran und ließ sie herein, in eine hell erleuchtete Diele.
Sehr klein, war Mrs. Reddens erster Eindruck von der Wohnung. Rechts eine winzige saubere Küche, dann ein kleines Bad, im Hintergrund ein kleines Schlafzimmer. Über der Lehne eines Stuhls in der Diele hing ein dunkles Anzugjackett, aus dessen Brusttasche weiße Taschentuchecken herausragten. Sie gingen in das kleine Wohnzimmer, wo ein sehr gut aussehender, korrekt mit dunkler Anzughose, weißem Hemd und roter Wollkrawatte bekleideter Herr rücklings auf dem Fußboden lag. Wie ein zur Trauerfeier aufgebahrter Toter, dachte Mrs. Redden.
»Guten Abend.« Der Mann auf dem Fußboden hatte eine tiefe fremdartige Stimme. »Entschuldigt bitte, daß ich euch so empfange.«
»Oh, Ivo, Liebes«, sagte Peg und kniete sofort neben ihm nieder und fuhr mit den Fingern durch sein ergrauendes Haar. Das ist kein Mann, der sich gern die Haare kraulen läßt, dachte Mrs. Redden, als der Kranke auf dem Fußboden den Kopf von Peg abwandte.
{28}»Das ist meine Freundin Sheila Redden. Ivo Radic.«
Der gutaussehende Mann lächelte sie an und sagte, er freue sich, sie kennenzulernen. Tom Lowry kam mit einer Flasche und vier Schnapsgläsern ins Zimmer. »Ah«, sagte Ivo. »Sliwowitz. Dürfen wir den Damen einen digestif anbieten?«
»Liebling«, sagte Peg, »zuerst müssen wir dich hochheben und auf dein Bett legen.«
»Ich ziehe den Fußboden vor. Das gehört zur Therapie.«
»Ist es nicht doch vielleicht bequemer, wenn du aufrecht sitzt?«
»Wenn ich nicht flach liege, kann ich morgen nicht unterrichten. Und wenn ich nicht zum Unterricht erscheine, wird le docteur Laporte mir am Monatsende wieder etwas von meinem Gehalt abziehen.«
»Aber du hast ein Brett unter der Matratze. Wir legen dich auf dein Bett und setzen uns alle zu dir ins Schlafzimmer.«
Der gutaussehende Mann lachte, aber es klang nicht sehr amüsiert. »Ihre Freundin«, sagte er zu Mrs. Redden, »möchte mein Leben in die Hand nehmen.«
»Ivo, bitte«, sagte Peg. »Leg dich wenigstens auf das Sofa.«
»Das Sofa ist zu weich«, sagte Ivo. Er lächelte Mrs. Redden immer noch an. »Hatten Sie eine angenehme Reise von London, Madame?«
»Ich bin von Irland herübergekommen, mit dem Flugzeug.«
»Ah, Irland.«
Tom Lowry verteilte die Schnapsgläser. Peg hatte sich aus ihrer knienden Haltung erhoben und starrte den {29}Mann auf dem Fußboden noch immer so an, als wäre sonst niemand anders im Zimmer. »Möchtest du mir irgend etwas sagen, Liebling?« sagte sie. »Bist du vielleicht schlecht gelaunt?«
»Nein, mein Liebes, ich bin sehr gut gelaunt.«
»Gut, dann steh bitte auf.«
Tom Lowry schob Mrs. Redden einen Sessel hin und sah sie mit einem Lächeln an, als wollte er sie bitten, die kleine Auseinandersetzung nicht zu beachten.
»Sheila ist nur diesen einen Abend in Paris«, fuhr Peg fort. »Es kann ihr nicht viel Spaß machen, hier zu sitzen, während du so auf dem Fußboden liegst.«
»Oh, mach dir meinetwegen keine Sorgen«, sagte Mrs. Redden hastig und sah wieder zu dem Jugoslawen hinüber. Er hatte dunkle Augen; er sah wirklich gut aus, entschied sie, aber er war einer von den Männern, vor denen sie Angst hatte, einer von denen, die so aussahen, als könnten sie sehr grausam zu einem sein. Er wandte sich ihr jetzt wieder zu, lächelte sie an, ignorierte Peg und hob sein Schnapsglas zu einem Toast. »Nasdrownje«, sagte er zu Mrs. Redden. »Willkommen in Paris.«
Alle beobachteten, wie er das Unmögliche versuchte: das Glas an die Lippen zu bringen und zu leeren, ohne den Kopf vom Teppich zu heben. Im letzten Augenblick rann ihm ein bißchen von dem Schnaps am Mundwinkel herunter. Peg, die sich zurückgezogen hatte und niedergeschlagen an dem kleinen Schreibtisch saß, stand sofort auf, öffnete ihre Handtasche, holte ein Taschentuch heraus, kniete abermals neben ihm nieder und tupfte ihm das Kinn ab.
»Bitte!« sagte er und wandte den Kopf ab. Aber sie bestand darauf, ihr Werk zu vollenden.
{30}»Wie lange haben Sie diese Wohnung schon?« fragte Mrs. Redden Tom Lowry.
»Oh, es ist eigentlich nur Ivos Wohnung. Aber er läßt mich hier auf dem Sofa schlafen.«
»Also, ich muß schon sagen, Sie sind beide sehr ordentlich.«
»Ivo, steh auf!« sagte Peg plötzlich.
Ivo lächelte, aber er rührte sich nicht.
»Na schön. Wenn du Gäste nicht so empfangen kannst, wie es sich gehört, gehen Sheila und ich besser nach Haus.«
Mrs. Redden blickte zu Ivo hinüber und sah, wie ihm die Röte ins Gesicht schoß. Peg wandte sich ihr zu. »Bist du soweit, Sheila?«
Mrs. Redden stand verlegen da.
»Sie fliegen morgen an die Riviera, Madame?« fragte Ivo.
»Ja. Nach Nizza.«
»Ah, das Land der Sonne. Von dieser Stadt kann man das leider nicht sagen. Grau, jeden Tag grau. Kein Wunder, daß die Menschen hier so unausgeglichen sind.«
»Ich bin nicht unausgeglichen«, sagte Peg. »Aber ich gehe jetzt. Gute Nacht, Tom.«
»Vielen Dank für den Sliwowitz«, sagte Mrs. Redden zu beiden Männern.
»Keine Ursache«, sagte der Mann auf dem Fußboden und wandte sich dann mit Basiliskenblick Peg zu. »Ich bitte um Verzeihung. Du bist nicht unausgeglichen, du bist gut gelaunt. Es gefällt dir nur, mir und vielleicht auch der Dame den Abend zu verderben.«
»Gute Nacht«, sagte Peg, drehte sich um und ging aus dem Zimmer. Mrs. Redden lächelte den beiden Männern unsicher zu und wandte sich zum Gehen.
{31}»Ich bringe Sie hinaus«, sagte Tom Lowry. »Sie finden allein nicht die Lampe im Hof.«
»Gute Nacht, Madame«, sagte Ivo. »Genießen Sie die Sonne.«
Im Licht der Lampe wirkte der Hof wie ein großes Aquarium. Peg, die es eilig hatte, das Haus zu verlassen, hatte ihn schon halb durchquert. Sie holten sie erst an der verschlossenen Haustür wieder ein. »Hör mal«, sagte Tom. »Warum gehst du nicht zurück und sprichst in aller Ruhe mit ihm? Ich bringe inzwischen Sheila nach Haus.«
»Verdammt, nein! Es ist Sheilas einziger Abend hier, und dieser egoistische Schuft muß unbedingt eine Show abziehen!«
»Peg, wenn ihr euch jetzt nicht wieder vertragt, dauert es wochenlang. Bitte geh zurück.«
Das Licht im Hof erlosch. Tom Lowry verschwand, um den Schalter zu suchen. Als die Lampe wieder anging, sah Mrs. Redden, daß Peg schwankte, und so sagte sie: »Hör zu, tu’s. Ich geh runter zum Atrium und warte dort auf dich.«
»Macht es dir auch wirklich nichts aus? Oh, er ist manchmal schrecklich, aber er meint es nicht so. Der verdammte Kerl kann nichts dafür. Es ist irgendso ein jugoslawisches Männlichkeitsgetue.«
»Natürlich macht es mir nichts aus. Los, geh.«
»Ich begleite Sheila«, sagte Tom Lowry. »Dann seid ihr ungestört. Bis nachher, im Atrium.«
Peg lächelte. »Ihr seid beide großartig.«
So kam es, daß Mrs. Redden mit einem Jungen, den sie gerade erst kennengelernt hatte, eine Pariser Straße hinunterging, und nach wenigen Minuten fingen beide an zu lachen.
{32}»Ivo, steh auf!« rief Mrs. Redden.
»Das Land der Sonne!« sagte er. Und sie lachten. Sie wandte sich ihm zu, sah, wie er seine langen dunklen Haare zurückwarf, sah seine glänzenden Augen, seinen schnellen Gang, als seien er und sie unterwegs zu einem aufregenden Rendezvous. Und plötzlich war sie wieder im Paris ihrer Studentenzeit, als wären die dazwischen liegenden Jahre nie gewesen, die Jahre, die sie damit zugebracht hatte, zu kochen und Schulkleidung für Danny zu kaufen, nett zu Kevins Mutter zu sein und andere Ärzte mit ihren Frauen zu Abendgesellschaften einzuladen – eine Wäscheliste von kleinen Ereignissen, die ihr Leben ausgemacht hatten, seit sie mit Kevin verheiratet war.
»Wo leben Sie in Amerika?« fragte sie ihn.
»In New York. Greenwich Village.«
»Das ist das Künstlerviertel, nicht wahr?«
»Ja. Aber ich bin dort geboren. Mein Vater arbeitet am Saint Vincent’s Hospital. Das ist das große Krankenhaus im Village.«
»Er ist also Arzt?«
»Ja.«
»Mein Bruder ist auch Arzt«, sagte sie. Ihren Mann erwähnte sie nicht.
Im Atrium führte er sie in den hinteren Teil des Cafés, zu den Tischen, die von den Stammgästen bevorzugt wurden. »Hören Sie«, sagte er, »es ist Ihr erster Tag in Paris. Darf ich Sie zu Champagner einladen?«
»Champagner? Das ist viel zu teuer.«
»Nein, erlauben Sie es mir«, sagte er. »Ich möchte es gern. Bitte!«
»Laden Sie mich zu einem Pernod ein.«
»Wirklich?«
{33}»Ja, bitte.«
Er winkte dem Kellner. »Deux Pernod.«
»Je suis désolé«, sagte der Kellner. »Il n’y a pas de Pernod. Je n’ai que du Ricard.«
»Ricard, ça va«, sagte sie. »Au fait, je le préfère.«
»Deux Ricard, alors«, sagte er zu dem Kellner. Und sagte dann zu ihr: »Ich weiß nicht, warum ich hier bestelle. Ihr Französisch ist wesentlich besser als meins.«
»Ich hab’s an der Uni gelernt.«
»Queen’s University?«
»Ja. Und Sie waren am Trinity College, nicht wahr? Bei Hugh Greer.«
»Ja, Sie kennen ihn?«
»Ich kannte ihn, aber das ist lange her.« Sie sah Hugh vor sich, während sie das sagte, untersetzt, stotternd, mit Hosen, die immer zu kurz zu sein schienen. »Was haben Sie bei Hugh gemacht? Anglo-irische Literatur? Seine Joyce-Yeats-Show?«
»Genau.«
»Und was haben Sie jetzt vor? Wollen Sie Lehrer werden?«
»Ich weiß nicht. Ich werde ein Jahr Pause machen, um darüber nachzudenken.«
»Ein Jahr Pause? Da müssen Sie ja ein reicher Mann sein.«
»Nein, ich hab einen Job. Ein Freund von mir ist Geschäftsführer in einem kleinen Ferienhotel in Vermont und möchte nächstes Jahr nach Europa. Ich habe oft im Sommer bei ihm gearbeitet, und nun werde ich das Hotel für ihn führen, solange er fort ist. Es ist ein herrliches Fleckchen. Skilaufen im Winter, ein See für den Sommer.«
»Klingt sehr gut.«
{34}»Warum kommen Sie nicht rüber und besuchen mich? Als geschäftsführender Hoteldirektor kann ich Ihnen Rabatt geben.«
Sie lachte. Der Kellner brachte den Ricard und goß Wasser in ihre Gläser, das die gelbe Flüssigkeit hell und kreidig machte. Der Junge, dieser Fremde, hob sein Glas und sah ihr in die Augen.
»Sláinte«, sagte er. Es war der irische Trinkspruch.
»Sláinte«, sagte sie. Und als sie anstießen, berührte seine Hand die ihre, und sie wußte – endlich –, wie es für den anderen sein mußte – für die Männer, die im Laufe der Jahre, wie Kevin zu sagen pflegte, in sie verknallt gewesen waren. Nun kannte sie das Gefühl. Oft war die Verknalltheit nur ein Witz gewesen, wie bei Pat Lawlor unten in Mullen’s Garage, der jedesmal, wenn sie zum Tanken vorfuhr, einen Kamm aus seinem Overall holte, um sich die Haare über seine kahle Stelle zu kämmen. Oder wie bei dem jungen Schlachter in Kennedy & McCourt’s Schlachterei, der jedesmal die anderen Kundinnen drängte, sich zu entscheiden, damit er zu ihr kommen und sie bedienen konnte. Aber manchmal war es auch weniger komisch gewesen. Sie war immer schüchtern, wenn sie sich mit einem fremden Mann unterhielt, besonders wenn es ein gescheiter Mann war. Dann gab sie sich Mühe, nett zu sein, und die Männer reagierten, und manchmal trat dann so ein Ausdruck in ihre Augen, und sie fingen an, mit ihr zu flirten. Sie hatte das immer ziemlich harmlos gefunden, bis Kevin sie vor zwei Jahren plötzlich beschuldigt hatte, sie mache »anderen Männern schöne Augen, ohne es selber zu merken«. – »Das ist eine Gemeinheit, so etwas zu sagen«, hatte sie geantwortet. »Und selbst wenn es wahr wäre, was ist denn schon Schlimmes an einem harmlosen {35}