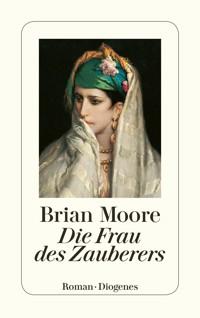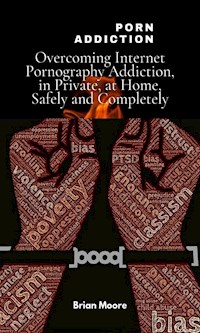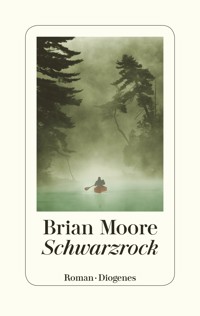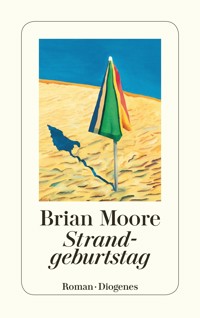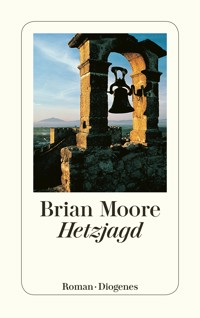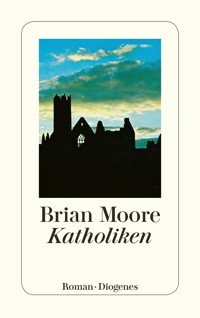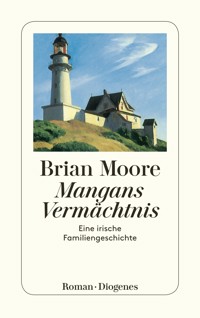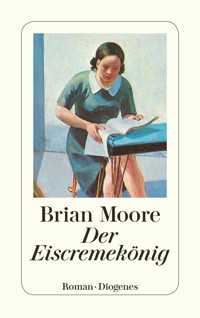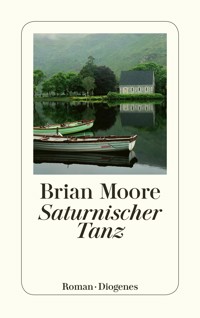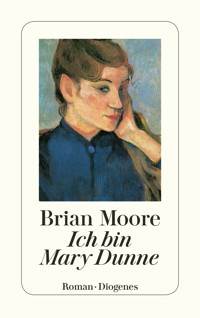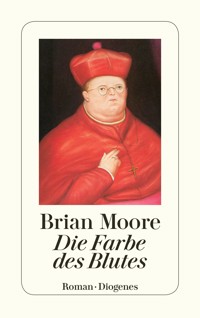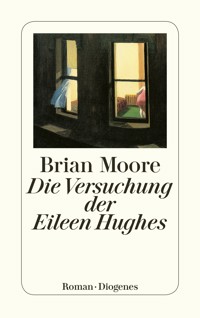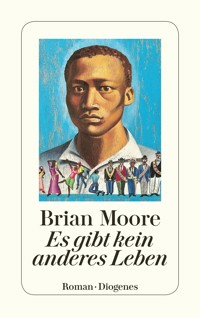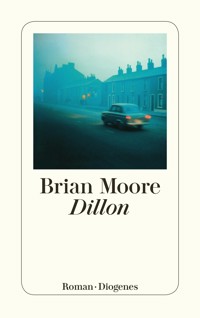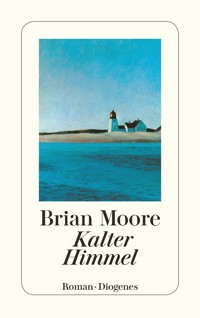
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der amerikanische Arzt Dr. A. Davenport ist mit seiner Frau Marie auf Urlaubsreise. Bei einem Bad vor der Küste wird er von einem Motorboot erfaßt. Dr. Davenport erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen, sein Körper wird in die Leichenhalle gebracht. Am nächsten Morgen ist die Leiche verschwunden. Marie Davenport, die untreue Gattin, glaubt, daß ihr Mann noch lebt, und will ihn wiederfinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Brian Moore
Kalter Himmel
Roman
Aus dem Englischen von Otto Bayer
Diogenes
{4}Für Jean, und für Michael
{5}Plötzlich sah ich den kalten Himmel,
Witterung der Krähen,
Wie wenn Eis erbrennen würde
zu immer eisigerem Eis (…)
William Butler Yeats: Der kalte Himmel (nach Erich Kahler)
{7}I
1
Die Holzbank des kleinen Tretboots war nach hinten geneigt, so daß Marie in den Himmel blickte. Kein Wölkchen. Über ihr zog in dieser Unermeßlichkeit eine Möwe ihre schnörkelige Bahn. Marie und Alex traten die Pedale im Takt, die Drehpaddel tauchten klatschend in die Wellen und trieben das Boot durch die geschlossenen Reihen der Badenden hindurch vom Strand weg und ins tiefere, abgeschiedenere Wasser der Baie des Anges. Marie ließ es jetzt etwas ruhiger angehen, aber Alex strampelte verbissen weiter und lenkte das Pédalo geradewegs gen Mittelmeer.
»Wir sollten nicht so weit hinausfahren«, sagte sie.
»Ich will weg von den Leuten. Ich möchte schwimmen.«
Es war so typisch für ihn, daß er immer seine eigenen Vorstellungen hatte, stets Muße in Betriebsamkeit verwandeln mußte, sogar an diesen paar Urlaubstagen. Sie verzeichnete jetzt jeden seiner Fehler. Es war, als hätte sie mit dem Entschluß, ihn zu verlassen, ihm allen Kredit entzogen. Sie blickte zurück zu der langen Hotelreihe an der Promenade des Anglais. Heute war der Tag, an dem sie es ihm zu sagen gehofft hatte. Sie hatte beim Frühstück damit herausrücken und sofort abreisen wollen, zuerst nach New York, dann nach Los Angeles, zu Daniel. Doch beim Frühstück hatte sie aller Mut verlassen. Und da nun der halbe Tag schon um war, konnte sie es gleich auf morgen verschieben.
{8}Weit vor der Küste kamen die Schaufeln zur Ruhe. Das Pédalo schaukelte auf seinen Zwillingsschwimmern, als Alex sich von seinem Sitz erhob. Er reichte ihr seine Sonnenbrille. »Hier müßte es gehen«, sagte er, und schon hechtete er in das tiefblaue Wasser, und das Boot schaukelte noch mehr. Sie sah ihn wieder auftauchen. »Fahr mir nach!« rief er. Ein guter Schwimmer war er nicht, er kraulte mit viel Kraft, aber ohne Stil. Marie trat wieder in die Pedale, die Hand am Ruder, und blieb mit dem kleinen Boot immer dicht hinter ihm. Wenn sie ihm so zusah, wußte sie, daß er dieses Tempo nicht lange durchhalten würde. Sie sah seine wild fuchtelnden Arme und stellte sich einen Augenblick lang vor, daß diese Arme sie schlugen. Er hatte sie noch nie geschlagen. Schlagen war nicht seine Art. Er konnte gekränkt sein, kalt, auch nachtragend. Aber gewalttätig war er nicht.
Sie hörte ein Motorboot, dessen Brummen immer lauter wurde. Sie drehte sich um, sah aber hinter sich kein Boot. Als sie jedoch nach rechts blickte, wo Alex schwamm, sah sie einen großen Außenborder sehr schnell in ihre Richtung kommen. Die werden uns doch sehen! dachte sie erschrocken, und dann war es, als säße sie im Kino und sähe das Ganze in einem Film, als Unbeteiligte; sie sah einen Mann in dem Motorboot, einen jungen Mann mit grünem Hemd; doch der Mann stand nicht am Ruder, er stand mit dem Rücken zu ihr in der Bootsmitte, und soeben bückte er sich und hob ein Kind auf, das dort hingefallen war. »He!« rief sie. »He!« – denn er mußte sich ja umdrehen, das Boot kam doch direkt auf Alex zu, auf sie zu. Aber der Mann im Boot hörte nichts. Er ging mit dem Kind auf die andere Seite des Boots, das nur noch ein paar Meter weit weg war. »Alex!« rief sie. »Alex, paß auf!« Doch Alex kraulte weiter, und jetzt {9}prallte das Boot, dessen Bug wie ein Messer das Wasser zerteilte, mit einem schaurig-dumpfen Ton gegen Alex, fuhr über ihn hinweg und krachte in die Schwimmkörper des kleinen Tretboots, das kenterte, und unversehens befand sie sich selbst im Wasser, ging unter, kam wieder hoch. Sie sah sich nach dem Motorboot um, das weiterbrauste, das demolierte Tretboot wie ein Bündel Reisig auf den Bug gespießt. Sie hörte den Motor ersterben und wieder aufheulen, sah das Boot einen Halbkreis schlagen und zurückkommen. Alex? Sie blickte um sich und sah seinen Körper unweit an der Wasseroberfläche treiben. Im Bruststil, dem einzigen, den sie beherrschte, schwamm sie hin. Er trieb bäuchlings im Wasser, Arme und Beine abgestreckt. Sie bekam sein Handgelenk zu fassen und zog ihn zu sich. Das Motorboot kam längsseits, der Mann im grünen Hemd streckte die Hand nach ihr aus, aber sie rief: »Nein, nein«, und schob ihm Alex entgegen. Der Mann packte Alex an den Haaren und zog, sie schob von unten nach, doch zweimal glitt Alex ins Wasser zurück, ehe der Mann ihn mit einem gewaltsamen Ruck halb über die Bordwand riß wie einen Sack, ein neuer Ruck, und Alex verschwand im Boot. » Un instant, Madame, un instant«, rief der Mann und kam mit einer kleinen Eisenleiter wieder, hängte sie in die Bordwand ein. Sie kletterte ins Boot, während der Mann nach vorn ging, um mit den Füßen das demolierte Pédalo vom Bug zu lösen. Im Bootsheck saß ein kleines Kind und starrte Alex an, der bäuchlings auf den Planken lag. Sie ging hin und sah aus einer Platzwunde an Alex’ Kopf Blut laufen und in seinen Haaren versickern. Er atmete noch, war aber bewußtlos. Sie umfaßte ihn und zog ihn an sich, wobei sein Blut ihr über die Brust rann. Sie sah die nackten Beine des Bootsbesitzers an ihr vorbei nach hinten gehen, wo er den {10}Motor wieder anwarf. Das Kind wollte zu brüllen anfangen, aber der Mann bückte sich und gab ihm einen zornigen Klaps, damit es still war. Dann drehte er sich mit angstverzerrtem Gesicht zu ihr um. »Nous y serons dans un instant«, rief er und gab Vollgas. Sie hielt Alex fest, dessen Blut von ihrem Unterarm auf die Bootsplanken tropfte, während sie dem Strand entgegenrasten.
Gleich würden sie da sein. Sie hörte den Motor langsamer drehen. Der Bootsbesitzer rief und gestikulierte. Sie fuhren an Badenden vorbei, deren Gesichter zu ihnen heraufstarrten. Der Bootskiel glitt knirschend auf den kiesigen Strand, und überall packten Leute an und zogen das Boot an Land. Alex lag schlaff in ihren Armen. Zwei junge Männer in roten Badehosen sprangen ins Boot. »Attendez, Mademoiselle«, sagte der eine, während sie ihr Alex aus dem Arm nahmen und ihn auf eine Plane legten, die sie auf dem steinigen Strand ausgebreitet hatten. Sie beugten sich über ihn, einer versuchte Mund-zu-Mund-Beatmung, Menschen drängten sich heran, und der Bootsbesitzer redete auf sie ein, aber sie verstand sein Französisch nicht mehr, sie konnte sich nicht konzentrieren. Taumelnd ging sie über den steinigen Strand, drängte sich durch den Kreis der Schaulustigen und kniete neben Alex nieder. Sie hatten irgendeinen Apparat neben ihn gelegt, und soeben kamen zwei weitere junge Männer in roten Badehosen mit einer Tragbahre. Sie klebten irgendwelche Kabel an Alex’ Handgelenke. Marie hörte auf französisch fragen, was denn passiert sei; der Bootsbesitzer im grünen Hemd, der sein Söhnchen auf dem Arm hatte, antwortete auf französisch, das Kind sei schuld, es sei auf dem Deck herumgelaufen und hingefallen, und er habe es aufheben wollen, er wisse gar nichts, er habe nichts gesehen, und dann hörte Marie nichts {11}mehr, denn seine Worte gingen im Sirenengeheul eines französischen Rettungswagens unter, das immer lauter wurde, dann auf der Promenade über dem Strand verstummte. Der Tretbootverleiher kam und fragte nach ihrem Spindschlüssel, er wolle ihre Sachen holen. Sie hatte den Schlüssel am Handgelenk. Alex hatte seine Sachen im selben Spind. Der Rettungsschwimmer, der die Mund-zu-Mund-Beatmung machte, hielt jetzt inne, sah zu ihr auf und nickte beruhigend. »Ça va«, sagte er. »Ça va, Mademoiselle.«
»Nicht schlimm?« fragte sie.
»Ah, Sie sprechen Englisch«, sagte der junge Mann. »Nein, nicht weiter schlimm. Sein Atem ist stabil.«
Er war nicht ertrunken, er war nur bewußtlos von dem Schlag. Sie erinnerte sich an diesen schaurigen Ton, als das Boot ihn rammte. Dann sah sie über dem Kreis der Gesichter, die auf sie herunterstarrten, den runden Ausschnitt eines kaltblauen Himmels und fühlte wieder diese Angst, als zeigten vom Himmelsrund Geschütze auf sie, bereit, sie zu erschießen. In den Gesichterkreis kam jetzt Bewegung, man verdrehte die Köpfe nach den beiden Sanitätern in weißen Kitteln, die zum Strand herunterkamen, begleitet von einem französischen Polizisten, der als erstes die Schaulustigen fortschickte. Sie richtete sich auf, als man Alex auf eine große Tragbahre legte, ein Gestell mit Stahlschienen und Kissen und einer Decke, mit der sie ihn zudeckten. Sie bewegten ihn sehr behutsam. Der Tretbootverleiher kam zurück und brachte ihre Strandtasche, ihr Strandkleid sowie Alex’ Hemd, Hose, Sandalen und Brieftasche. Sie stopfte alles in die Strandtasche. Der Motorbootbesitzer kam mit dem kleinen Jungen an der Hand und setzte zu einer langen, umständlichen Entschuldigung an, aber sie {12}schnitt ihm mit einem Kopfnicken das Wort ab und folgte den Sanitätern, die Alex auf der Bahre trugen. Der Polizist schloß sich ihr an und befragte sie nach dem Unfall, notierte die Anschrift ihres Hotels. Sie betrachtete Alex’ Kopf. Warum hatte man die Wunde nicht verbunden? Die Sanitäter trugen die Bahre über eine Böschung vom Strand zur Promenade des Anglais hinauf, wo sich inzwischen eine noch größere Menschenmenge versammelt hatte. Leute drängten sich um sie. Marie sah die Sanitäter die Bahre in einen weißen Rettungswagen schieben. »Steigen Sie bitte ein, Mademoiselle«, sagte der eine Sanitäter, der Englisch sprach, nahm ihr zugleich die Strandtasche ab und legte sie in den Wagen, um ihr dann beim Einsteigen zu helfen. Sie setzte sich Alex gegenüber auf eine Bahre, während der Sanitäter die Tür zuschob. Das Blaulicht begann zu blitzen, die Sirene heulte los, und der Rettungswagen schwenkte verwegen in den Gegenverkehr. Marie mußte sich an den Stahlschienen ihrer Bahre festhalten, als der Wagen eine waghalsige Kurve drehte und mit Vollgas losbrauste, aufwärts durch die Straßen von Nizza. Alex war an seiner Bahre festgeschnallt. Sie betrachtete sein Gesicht. Er hatte die Augen geschlossen. Der Sanitäter beugte sich über ihn, sah ihn an und lächelte ihr beruhigend zu, doch er beruhigte sie nicht. Der Rettungswagen raste über einen großen Platz, der ringsum von Straßencafés gesäumt war. Sie erkannte den Platz, an dem sie gestern noch mit Alex Kaffee getrunken hatte. Die Sirene machte jede Unterhaltung unmöglich, und der Fahrer steuerte so hektisch durch die Lücken im langsam fließenden Verkehr, daß der Wagen dauernd hin und her schwankte. Marie klammerte sich mühsam fest. Sie sah eine Kirchturmuhr. Es war zwanzig nach vier.
Einer der Sanitäter fühlte Alex’ Puls, während der andere {13}nach vorn kletterte und mit zwei Handtüchern und einem Fläschchen wiederkam. In dem Fläschchen war eine rosa Flüssigkeit, mit der er das eine Handtuch tränkte, bevor er es ihr reichte. Sie begann sich gehorsam das Blut von Schultern und Armen zu wischen, was nicht leicht war, denn sie mußte sich ständig mit der einen Hand an der Schiene festhalten. Erst jetzt dachte sie: Ich kann doch nicht im Bikini ins Krankenhaus. Mein Strandkleid ist in der Tasche, die Sandalen auch. Der Sanitäter gab ihr ein zweites Handtuch zum Abtrocknen. Er trug ein dünnes Goldkettchen um den Hals, an dem ein Kreuz vor seiner schwarz behaarten Brust baumelte. Ihr Blick blieb an dem Kreuz hängen. Das in Carmel ist genau ein Jahr her. Auf den Tag genau. Der Rettungswagen, der gerade ein schmales Sträßchen hinaufjagte, wurde jetzt vom anderen Verkehr behindert und protestierte mit heulender Sirene, während der Fahrer das Lenkrad hin und her riß und wieder losbrauste. An einer Straßenlaterne sah sie ein Schild mit einem Pfeil nach rechts: HÔPITAL. Sie bogen rechts ab. Die Sirene verstummte, als sie in einen Hof rollten und in der Nähe mehrerer Türen zum Stehen kamen. Der Wagen fuhr rückwärts an die Türen heran, die Sanitäter sprangen ab, halfen ihr hinunter und zogen die Bahre heraus. Marie kramte in ihrer Strandtasche, fand das gelbe Kleid und streifte es sich über den nassen Bikini. Sie fand die Sandalen und schlüpfte hinein, gerade als die Sanitäter die Bahre auf ein Fahrgestell hoben und in die Aufnahme rollten. Sie folgte ihnen über einen Korridor, vorbei an anderen Patienten, die Alex neugierig ansahen. Einer der Sanitäter gab ihr ein Zeichen, sie solle warten. Die Bahre wurde in einen kleinen Raum geschoben, wo sich sofort ein Arzt und eine Krankenschwester Alex vornahmen. Marie sah nicht, was sie mit ihm machten, denn die {14}Tür ging zu, aber schon ein paar Minuten später wurde die Bahre wieder herausgeschoben. Der Sanitäter bedeutete ihr mitzukommen, und sie fuhren in einem Aufzug nach oben. Sie stand am Kopfende der Bahre und sah in Alex’ Gesicht. Ob er beim Zusammenprall mit dem Boot einen Schädelbruch erlitten hatte?
Die Tür des Aufzugs glitt auf. Sie rollten die Bahre auf eine Doppeltür zu, über der ein rotes Lämpchen brannte. Wieder mußte Marie warten. Die Bahre rollte durch die Tür, die Tür ging zu. Sie drehte sich um und sah eine Frau im weißen Kittel auf sie zukommen. Die Frau hatte einen Schreibblock in der Hand. »Voulez-vous m’accompagner à la chambre de réception?« forderte sie Marie auf.
»Sprechen Sie Englisch?« fragte Marie. Sie glaubte das jetzt nicht mit ihrem Französisch regeln zu können.
»Ein wenig, ja. Ist das Ihr Mann?«
»Ja.«
»Hier ist die Intensivstation. Der Arzt wird bald mit Ihnen sprechen. Sind Sie versichert, oder haben Sie eine Kreditkarte?«
»Ja«, sagte sie, »American Express.« Alex war über Blue Shield versichert, aber das wollte sie jetzt nicht lang und breit erklären. Sie nahm ihre Kreditkarte aus dem Portemonnaie in ihrer Strandtasche und gab sie der Frau, die sie in einen Kartenleser schob und sie ihr dann zurückgab. Daß Krankenhäuser Kreditkarten nahmen, mutete sie seltsam an. Die Schwester vom Empfang führte sie jetzt in eine Art Wartezimmer mit Sofas und einem Tischchen, auf dem ein paar französische Illustrierte lagen. Sie nahmen auf einem der Sofas Platz, und die Frau begann ihr Fragen zu stellen und trug ihre Antworten in ein Formular ein: Alex’ Namen, Anschrift und Beruf, dann den Namen und die Adresse {15}ihres Hotels in Nizza. Daraufhin bat die Frau sie zu warten. Minuten später kam eine Krankenschwester, eine ältere Frau mit weißer Haube. »Ich spreche Englisch«, sagte sie mit starkem französischem Akzent. Auch sie hatte einen Formularblock bei sich. Sie wollte Alex’ vollen Namen wissen, und ob er einmal eine schwere Krankheit gehabt habe, ob er zur Zeit Medikamente nehme? Dann erkundigte sie sich nach dem Unfall. Sie stellte ihre Fragen auf englisch, aber Marie sah, daß sie die Antworten auf französisch niederschrieb. Nachdem das Formular ausgefüllt war, sagte die Schwester: »Es wird nicht lange dauern. Sobald ich etwas höre, sage ich Ihnen Bescheid.«
Im Wartezimmer saßen noch drei Leute und blätterten in den Illustrierten herum, als erwarteten sie, darin eine geheime Botschaft zu finden. Das Wartezimmer hatte ein Fenster auf einen Hof mit zwei verstaubten Palmen und einer Bank. Auf der Bank saß ein alter Mann. Er trug einen Morgenmantel aus grauem Flanell, darunter einen gestreiften Schlafanzug und Pantoffeln, und Marie sah, daß er weinte. Ob ihm soeben etwas Schreckliches über seinen Gesundheitszustand mitgeteilt worden war? Marie fühlte sich elend. Sie hatte Angst, sich übergeben zu müssen. Sie ging aus dem Zimmer und fragte nach den Toiletten, und die Schwester an der Anmeldung erklärte ihr den Weg. In der Toilette ging sie zum Spiegel und sah, daß ihre Haare ganz naß und wirr waren und der nasse Bikini durch ihr Strandkleid zu sehen war. Sie blieb vor dem Spiegel stehen. Sie mußte sich nicht übergeben. Ist das die Strafe? fragte ihr Spiegelbild. Erschrocken wandte sie sich ab, als hätte jemand die Frage laut gestellt. Sie ging wieder zur Anmeldung. Als die diensthabende Schwester sie kommen sah, winkte sie Marie zu sich und begleitete sie zur {16}Intensivstation. Einen Gang entlang lagen lauter kleine Zimmer, Zimmer mit Herzmonitoren über den Krankenbetten. Die Schwester sagte, sie solle warten, und ging in eines der Zimmerchen, dessen Tür sie hinter sich schloß. Kurz darauf kam ein junger Arzt aus diesem Zimmer und nahm sich das Stethoskop aus den Ohren. Er trug einen langen weißen Kittel mit ausgefransten Ärmeln. Er fragte sie etwas auf französisch, und als sie nicht gleich antwortete, wiederholte er die Frage auf englisch: »Er ist von einem Motorboot gerammt worden, ja? Dieses Boot – haben Sie den Unfall gesehen?«
»Ja.«
»Ist er danach einmal wieder zu Bewußtsein gekommen?«
»Nein«, sagte sie, »ich glaube nicht.«
»Er hat weder die Augen geöffnet noch gesprochen?«
»Nein.«
»Und wann war der Unfall? Um wieviel Uhr?«
»Etwa um vier, glaube ich. Ja, etwa um vier.«
»Danke. Würden Sie jetzt bitte wieder zur Anmeldung gehen?«
»Aber wie geht es ihm, Doktor?« fragte sie. »Darf ich ihn nicht sehen?«
»Bedaure, er liegt noch im Koma. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung. Zur Zeit warten wir auf die Röntgenbilder.«
»Hat er sonst noch etwas? Knochen gebrochen, irgend etwas in der Art?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, nein.« Er nickte ihr zu und ging wieder in das Zimmer. Jetzt hörte sie hinter sich Stimmen. Aus einem der gegenüberliegenden Zimmer kamen drei Ärzte und eine Krankenschwester. Der {17}Oberarzt fiel ihr sofort auf, denn er sah aus wie Einstein. Er hatte ein ulkiges Gesicht mit einem struppigen grauen Schnurrbart, und das struppige graue Haar darüber stand ihm wie ein Strahlenkranz um den Kopf. Er lächelte ihr zu, dann fragte er die Schwester in seinem Gefolge: »La prochaine, c’est quoi?«
»Un accident à la plage«, antwortete die Schwester. Marie sah die Gruppe in eines der Zimmer gehen. Ein Unfall am Strand. Dann ist das Alex’ Zimmer? Sie wollte gerade hingehen und sich vergewissern, als die Schwester von der Anmeldung sie wieder abholen kam. Sie folgte der Schwester, ging ins Wartezimmer und setzte sich so, daß sie auf den Hof sah. Der alte Mann, der vorhin geweint hatte, war noch da, aber er spielte jetzt Dame mit einer jungen Mitpatientin. Während Marie ihnen zusah, grinste der Alte auf einmal triumphierend, übersprang zwei gegnerische Steine und nahm sie vom Brett. Plötzlich fühlte Marie sich von Panik ergriffen. Sie war allein in einem fremden Land. Sie hatte ihr Französisch in einer Schule in Montreal gelernt. Über Frankreich wußte sie nichts. Wenn die Ärzte nun operieren wollten? Sie dachte an Reeves Bulmer, der Anfang der Woche zusammen mit Alex in Marseille auf dem Podium gesessen hatte. Reeves war Neuropathologe; er würde Alex’ Zustand am besten beurteilen können, wenn sie ihn fände. Aber sie wußte nur, daß Reeves und Betty im Anschluß an die Konferenz nach Paris weitergefahren waren. Wo sie in Paris wohnten, wußte sie nicht. Sie würde aufs amerikanische Konsulat oder in die Botschaft gehen und um Hilfe bitten müssen. Es gab hier bestimmt ein Konsulat. Und wenn Alex nun einen Gehirnschaden hatte? Manchmal können sie dann nicht sprechen und liegen eine Ewigkeit im Krankenhaus. Sie mußte an den Presseattaché des {18}Präsidenten denken, den die Kugel eines Attentäters in den Kopf getroffen hatte. Der Mann hatte monatelang in Lebensgefahr geschwebt.
Am besten wäre es, Daniel anzurufen. Aber sie wußte nicht, wo Daniel war. Sie wußte nur, daß er irgendwo in Marin County mit Elaine Urlaub machte. Und gab es überhaupt jemanden, der ihr helfen konnte, wenn dieses Unglück kein Zufall war? Sie sah auf den Hof hinaus, wo der alte Mann und das Mädchen in ihren Morgenmänteln soeben die Steine zu einem neuen Spiel aufstellten. Sie erinnerte sich an diesen Augenblick heute am Strand von Nizza, als Alex und der Bootsverleiher das Pédalo im seichten Wasser festgehalten hatten, um sie einsteigen zu lassen; es war der Augenblick gewesen, in dem ihr wie beim Läuten einer Totenglocke plötzlich eingefallen war, daß sich das Ereignis von Carmel heute zum erstenmal jährte.
2
Nach zwei Stunden hatte sie von den Ärzten noch immer nichts gehört. Die Schwester an der Anmeldung war von einer Kollegin abgelöst worden, die ihr nur sagte, daß Alex noch immer im Koma liege und »il n’y a pas de bulletin pour le moment.« Sie riet Marie, etwas essen zu gehen, aber Marie blieb im Wartezimmer sitzen und blickte weiter auf den Hof hinaus, bis es dunkel wurde und sie von den Palmen nur noch die Silhouetten vor dem Himmel sah. Um neun Uhr kamen ein paar Ärzte aus der Intensivstation und verabschiedeten sich mit Handschlag voneinander. Einer war der Oberarzt, den sie schon einmal gesehen hatte, dieser {19}ältere, der aussah wie Einstein. Sie sah ihn zur Anmeldung gehen und mit der Schwester sprechen, dann ging er zur Station zurück. Die Schwester kam ins Wartezimmer und faßte Marie ins Auge. Es war ein Blick wie eine Urteilsverkündung. »Le Docteur Boulanger vous attend dans son bureau«, sagte sie und führte Marie in die Intensivstation. Unmittelbar hinter der Doppeltür befand sich rechts ein kleines Büro, das Marie beim ersten Mal nicht gesehen hatte. An einem Schreibtisch, umgeben von Aktenschränken und Regalen mit Blutproben, stand Dr. Boulanger in seinem langen weißen Kittel, das graue Einsteinhaar wie eine Aureole angeleuchtet von der Lampe hinter ihm. Er kam auf sie zu und gab ihr die Hand. »Guten Abend«, sagte er. »Ich spreche Englisch. Nicht besonders gut, aber ich hoffe, es reicht.«
Marie nickte. Ihr war schlecht vor Angst. Der Arzt hatte große, traurig schimmernde Augen. »Es tut mir leid«, sagte er. »Aber ich habe eine schlechte Nachricht.«
»Oh«, sagte sie nur. Nun wußte sie es also. Kein Gehirnschaden. Er war tot.
»Wir konnten leider nicht mehr viel tun. Er hat einen Schädelbruch erlitten, keine ausgedehnte Fraktur, aber offenbar war der Schlag gegen den Kopf sehr stark und hat eine schwere Gehirnerschütterung hervorgerufen. Er war Arzt, nicht wahr?«
»Ja, Pathologe«, sagte Marie.
»Mein aufrichtiges Beileid.«
Sie senkte den Kopf. Sie schloß die Augen, als wollte sie aussperren, was hier geschah.
»Waren Sie hier auf Urlaub?« fragte der Arzt.
»Wir waren in Marseille auf einer Fachkonferenz. Danach sind wir hierhergekommen.«
{20}»Ach ja, stimmt. Das war diese internationale Konferenz über Atherosklerose. Sie sind Amerikanerin?«
»Ja.«
»Haben Sie hier Freunde, jemanden, der Ihnen behilflich sein kann?«
»Nein. Ich bin zum erstenmal in Frankreich.«
»Nun, dann werden wir morgen früh das amerikanische Konsulat verständigen. Dort wird man Ihnen bei den Formalitäten helfen. Ach so, bevor ich es vergesse. Es tut mir sehr leid, aber wir sind in solchen Fällen zur Obduktion verpflichtet. Dazu müssen Sie uns einige Formulare unterschreiben. Ihr Einverständnis erklären.« Er ließ sie am Schreibtisch Platz nehmen und reichte ihr ein Formular nebst Kugelschreiber. »Wir werden die Obduktion gleich morgen früh vornehmen, um Sie nicht länger als nötig hier festzuhalten. Wollen Sie die Leiche nach Amerika überführen?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Wir werden jedenfalls alles tun, um die Dinge nicht zu komplizieren.« Er faßte sie am Arm, als wollte er sie vor etwas warnen. »Möchten Sie den Toten sehen? Ich glaube, er wird gerade verlegt.«
Sie folgte ihm auf den Gang. Sie ging mit ihm zu Alex’ Zimmer. An der Tür hielt er an. »Moment«, sagte er. Sie sah in dem Zimmer zwei Schwestern bei der Arbeit. Dr. Boulanger ging hinein und flüsterte etwas, worauf die Schwestern herauskamen und ihr zunickten. Die eine brachte verschmutzte Laken und ein Kissen mit heraus. »Madame?« sagte Dr. Boulanger an der Tür und winkte sie herein.
Als sie eintrat, war das Bett leer. Über dem Bett befand sich ein Herzmonitor. Zwei Infusionsständer mit Flaschen voll Blutplasma und Salzlösung waren an die Wand {21}gerückt. Das Zimmer wirkte so ausgeräumt, als wartete es schon auf den nächsten Patienten. Dann sah sie die Rollbahre neben der Tür. Sie hatte keine Matratze und war mit einem weißen Plastiktuch abgedeckt. Dr. Boulanger ging hin und schlug das Kopfende des Tuchs zurück. Währenddessen sah Marie zum anderen Ende der Bahre, wo ein Fuß herausragte. An der großen Zehe hing ein Plastikschildchen mit den Patientendaten. Sie trat an die Bahre. Alex’ Gesicht war sehr weiß, als wäre alles Blut aus ihm gewichen. Seine Augen waren geschlossen, und man hatte ihm eine Mullbinde um das Kinn gewickelt, damit der Mund zu blieb. An einer Stelle über dem linken Ohr hatte man ihm die Haare abrasiert, um eine gräßliche Wunde freizulegen, gefärbt mit einem gelben Antiseptikum, aber auch noch blutig. Die Haut klaffte auseinander wie zwei geöffnete Lippen. Der Arzt hielt das Tuch aufgeschlagen und sah sie mit traurigen, kummergewohnten Augen fragend an, und als sie nickte, deckte er Alex’ Gesicht wieder zu. Sie wollte Alex nicht allein hier zurücklassen. Sie hatte das Gefühl, ihn preiszugeben. Der Arzt nahm sie beim Arm und führte sie hinaus. Man werde ihr ein Taxi zu ihrem Hotel besorgen, sagte er. Er sprach mit der Nachtschwester an der Anmeldung über das Taxi. Dann sagte er zu Marie, sie könne den Leichnam morgen abholen lassen, man werde das amerikanische Konsulat verständigen, das sich mit ihr in Verbindung setzen werde. Er sprach ihr noch einmal sein Beileid aus, gab ihr die Hand, sagte gute Nacht, drehte sich um und ging zurück durch die Doppeltür unter der roten Lampe. Die Türen schlossen sich hinter ihm, die Türen, die zu jenem Zimmer führten, in dem Alex lag, allein.
Die Schwester an der Anmeldung sagte ihr, das Taxi sei unterwegs. Sie nahm wieder im Wartezimmer Platz, wo sie {22}schon so viele Stunden gesessen hatte. Sie dachte an Alex’ Mutter, die verständigt werden mußte, und nahm sich vor, sie vom Hotel aus sofort anzurufen. Aber während sie im Taxi die engen Straßen hinunterfuhr, vorbei an den nächtlich erhellten Kneipen, den Stoßstange an Stoßstange geparkten Autos, überlegte sie, daß sie Alex’ Mutter bei dem Anruf heute abend wohl fragen mußte, ob sie die Leiche hier einäschern lassen oder nach Hause überführen solle. Schrecklich, so etwas fragen zu müssen. Marie erinnerte sich nicht, ob Alex je von einem Familiengrab gesprochen hatte. Wenn ja, war es in Boston? Sie stellte fest, wie wenig sie über sein Leben wußte. Wenn er über seine Vergangenheit gesprochen hatte, dann höchstens von den Orten, an denen er studiert und gearbeitet hatte, um zu werden, was er war. Sein Vater war Anwalt gewesen und hatte in Boston praktiziert, das wußte sie, und seine Mutter hatte nicht wieder geheiratet und besaß etwas eigenes Vermögen. Sie wußte, daß Alex’ Schwester Barbara in Washington wohnte. Sie hatte Barbara nur einmal gesehen, als diese mit ihren beiden Töchterchen nach Hawaii in Urlaub gefahren und dabei durch Los Angeles gekommen war. Marie kannte Alex’ Mutter nicht besonders gut, hatte aber den Eindruck, daß Mrs. Davenport gegen sie eingenommen war. Sie wußte, daß Alex keine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter gehabt hatte. Sie fragte sich, wie sehr seine Mutter wohl um ihn trauern würde? Wer würde denn wirklich um Alex trauern? Ich, sagte sie bei sich, ich werde um dich trauern. Obwohl ich mich gegen dich gewandt habe, werde ich um dich trauern. Während sie dies bei sich dachte, hielt das Taxi vor dem Miramar, einem kleinen Hotel an einer Parallelstraße zur Strandpromenade. Ihr Zimmer lag im obersten Stock. Es hatte einen Balkon, und wenn man sich auf dem {23}Balkon in die äußerste Ecke stellte, konnte man einen Zipfel Meer sehen. Sie bezahlte das Taxi und ging in die Hotelhalle. Als sie ihren Schlüssel von der Rezeption holte, lag dort eine Nachricht für sie. Es war ein Blatt liniertes Papier in einem Umschlag, auf dem ihr Name stand. Die Nachricht war von einem Edouard Duvalier, und erst nachdem sie ein paar Sätze gelesen hatte, begriff sie, daß es der Motorbootbesitzer war, der noch nicht wußte, daß Alex tot war. Monsieur Duvalier schrieb, er wolle Alex morgen im Krankenhaus besuchen, wenn es ihr recht sei. Sie zerknüllte den Zettel, nahm ihren Schlüssel und ging nach oben. Sie fand, daß sie Alex’ Mutter doch anrufen müsse. Sie würde nichts von einer Einäscherung erwähnen und nur fragen, ob seine Mutter ihn in Boston beisetzen lassen wolle. Sonst werde sie das hier in die Wege leiten.
Sie setzte sich aufs Bett, öffnete die Strandtasche und fand Alex’ Brieftasche. Er hatte darin ein kleines Notizbuch mit Adressen und Telefonnummern. Sie blätterte es durch: Ärzte, Krankenhäuser, Labors. Unter »M« fand sie schließlich: Mutter/Boston nebst Telefonnummer. Sie rief die Telefonzentrale an, die versprach, sofort zurückzurufen. Während Marie wartete, leerte sie die Strandtasche und räumte Alex’ Hemd, Sandalen und Hose in einen Schrank. Seine Brieftasche legte sie in die Schreibtischschublade. Jetzt klingelte das Telefon. In Boston meldete sich eine Frauenstimme, aber es war nicht seine Mutter. Die Stimme sagte, daß Mrs. Davenport nicht zu Hause sei.
»Ich rufe aus Frankreich an. Können Sie mir sagen, wo ich sie erreiche?«
»Sie macht eine Kreuzfahrt. Sie ist auf Jamaika oder den Bermudas, wo genau, weiß ich nicht.«
»Wann kommt sie zurück?«
{24}»Das weiß ich nicht. In ein paar Tagen, nehme ich an. Aber ich weiß es nicht. Ich bin nur die Putzfrau.«
»Aha. Danke.« Marie legte auf. »Ich kann die Putzfrau nicht beauftragen, Alex’ Mutter zu sagen, daß Alex tödlich verunglückt ist.«
Sie suchte in dem Notizbuch nach der Nummer seiner Schwester, fand aber keine. Sie versuchte sich an den Namen der Zeitung zu erinnern, bei der Barbaras Mann arbeitete, aber er fiel ihr nicht ein. In ihrer New Yorker Wohnung stand das in ihrem Adreßbuch. Sie dachte an ihren Vater, der allein in seinem Haus in Brentwood lebte. Wie spät war es jetzt an der amerikanischen Westküste? Früher Nachmittag? Wenn sie ihn anrief, würde er sich vielleicht anerbieten herzukommen, aber was würde das nützen? Das eine Mal, als sie ihn gebraucht hätte, damals, als ihre Mutter starb, hatte er sie im Stich gelassen. Marie war zwölf gewesen. Ihre Mutter, nur eine Taufscheinkatholikin, hatte Marie im Jahr davor, als sie von New York nach Montreal gezogen waren, als Tagesschülerin in einer Klosterschule angemeldet. In New York war Marie auf eine staatliche Schule gegangen. Sie wußte so gut wie nichts vom katholischen Glauben und bekam prompt Ärger mit den Nonnen. Sie wurde wegen Despektierlichkeit bestraft, weil sie in der Kapelle redete und ungezogene Bemerkungen über Heilige und das Sakrament der Buße machte. Sie bekam einen öffentlichen Tadel von der Direktorin, weil sie sich um die Abendandacht gedrückt hatte, und als Marie einmal den Nonnen trotzig ins Gesicht sagte, sie gehe nie in die Sonntagsmesse, wurde ihre Mutter einbestellt. Ihr Vater war nicht einmal Taufscheinkatholik, und nachdem ihre Mutter tot war, bat Marie ihn, sie auf eine andere Schule zu schicken. Aber ihr Vater erfüllte ihr diese Bitte nicht. Statt {25}dessen hörte er auf die Nonnen, die ihm empfahlen, sie jetzt ins Internat zu geben, da sie ohne die mütterliche Anleitung einer festen Hand bedürfe. So sehr Marie weinte und flehte, ihr Vater ließ sich nicht erweichen. Es war praktisch für ihn, sie ins Internat zu geben, das war ihr damals klar geworden. Sie hatte es ihm seinerzeit nicht verziehen. Ja, sie verzieh es ihm noch heute nicht.
Der einzige Mensch, auf dessen Hilfe sie vertrauen konnte, war Daniel. Sie sah sein Gesicht vor sich, sein schiefes Grinsen, die hohe Stirn, die freundlichen, klugen braunen Augen. Wenn er doch jetzt hier hereinkommen könnte, klein, zerknittert, lächelnd. Aber sie konnte Daniel nicht erreichen. Daniel war mit seiner Frau und seiner halbwüchsigen Stieftochter irgendwo in Marin County auf Urlaub. Wo genau, wußte sie nicht.
Sie ging ins Bad. Endlich zog sie das Strandkleid und den Bikini aus. Sie legte sich den Regenmantel um, den sie auf Reisen immer als Morgenmantel benutzte. Sie dachte an die kommende Nacht. Sie ging zu Alex’ Tasche und fand den kleinen Beutel, in dem er ihre Medikamente aufbewahrte. Sie nahm die letzten zwei Dalmankapseln. Alex war ein entschiedener Gegner von Schlaftabletten, weshalb sie selten welche nahm, sogar in diesem Jahr, als bei ihr die Migräneanfälle und die Alpträume wegen Carmel anfingen, diese Alpträume, von denen sie niemandem erzählte. Ob sie die Alpträume und Migräneanfälle von jetzt an auch noch haben würde? – Er ist tot. Ich habe meine Strafe.
Nachdem sie die Kapseln genommen hatte, öffnete sie die Tür zu dem schmalen Balkon und ging hinaus. Vom Balkon konnte man auf einen ovalen, von Unterwasserlampen beleuchteten Swimmingpool hinuntersehen. {26}Soeben fegte ein heißer Windstoß über den Swimmingpool und erzeugte Tausende winziger Wellen auf der glatten Oberfläche. Am Beckenrand huschte etwas im Schatten hin und her. Eine Ratte. Die Ratte kam jetzt ins Licht und spähte ins Wasser hinunter, als hätte sie noch nie einen Swimmingpool gesehen. Jemand lachte in einem der Hotelzimmer gegenüber, und die Ratte huschte zurück in den Schatten. Marie vernahm eine neue Lachsalve und mußte an Alex denken, wie er bäuchlings im Wasser trieb. Sie ging wieder ins Zimmer, ließ die Balkontür aber offen. Im Zimmer war es heiß und stickig. Sie zog den Regenmantel aus, legte sich nackt ins Bett und zog ein Laken über sich. Unten auf dem Hof zirpten Zikaden. Sie wandte im Liegen den Kopf und sah in den Nachthimmel, den die Lichter am Strand orangerot färbten. – Ist das die Strafe für meine Unterlassung? Haben sie ihn deswegen getötet?
Rache oder Zufall? Erneut rasselten ihre Gedanken wie an einer Brunnenkette hinunter in das tiefe Loch dieser unentrinnbaren Frage.
3
Der Frühstückskellner stemmte sein Hinterteil gegen die Schwingtür und kam rückwärts mit drei Tabletts cafés complets aus der Küche in den Frühstücksraum. Er drehte sich um, ging zu Tisch sechs, an dem ein belgisches Ehepaar mit Tochter saß, und stellte ihnen je ein Tablett mit heißer Milch, heißem Kaffee, Butterkügelchen, Konfitüre, Croissants und Brötchen auf den Platz. »Bon appétit«, sagte er, dann sah er sich um, ob inzwischen weitere Gäste gekommen waren. Zimmer 24 war da, nicht der junge Herr, nur die {27}junge Dame. Er ging hin, wobei ihm einfiel, daß sie gestern mit ihm französisch gesprochen hatte, obwohl sie Amerikanerin war.
»Bonjour, Madame. Vous aves bien dormi?«
Ja, sagte Marie, sie habe gut geschlafen.
»Et Monsieur? Il arrive, Monsieur? Je vous apporte deux cafés complets?«
Nein, sagte sie, nur einmal Frühstück. Monsieur werde heute nicht kommen.
»Bien, Madame. Alors, un café complet«, sagte er und lächelte sie noch einmal an, bevor er in die Küche zurückging. Marie sah ihm nach. Das beigefarbene Jackett, offenbar eine Nummer zu groß für ihn, hing ihm lose um die Hüften. Gestern hatte sie, während sie hier auf Alex wartete, mit ihm geplaudert. Er hatte ihr gesagt, er heiße Ahmed und sei Türke, er habe eine Familie und lebe mit ihr schon zwei Jahre in Frankreich. Während sie ihm jetzt nachsah, dachte sie: Er hat eine Frau. Ich bin Witwe. Das altbackene Wort flößte ihr Angst ein. Selbst jetzt noch schien es ihr möglich, daß Alex einfach hier hereinkam, so wie er immer von seinen Reisen nach Hause kam und ohne Umarmung oder Begrüßungskuß als erstes fragte: »Na, hat’s was Wichtiges gegeben, solange ich fort war?«
Sie sah auf die Uhr. Das amerikanische Konsulat machte gewiß nicht vor halb zehn auf. Sie würde nach dem Frühstück mit einem Taxi hinfahren und mit dem zuständigen Beamten sprechen. Sie hatte beschlossen, den Leichnam in Nizza einäschern und beisetzen zu lassen, wenn sie heute weder Alex’ Mutter noch seine Schwester erreichte. Kein Trauergottesdienst. Alex hatte für so etwas nichts übrig gehabt. Er hatte keine religiösen Empfindungen, sowenig wie sie. Einen Grabstein würde er auch nicht wollen. Eine {28}Todesanzeige in der New York Times, natürlich, aber das hatte Zeit.
Ahmed kam. Er baute geschickt alle die Sachen vor ihr auf, die sie gar nicht essen wollte: Croissants, Konfitüre, Butterkügelchen. »Café noir ou café crème, Madame?« fragte er, in jeder Hand ein dampfendes Kännchen, das eine mit Kaffee, das andere mit heißer Milch.
»Schwarz«, sagte sie, und während er den Kaffee einschenkte, fragte er wieder: »Monsieur descend plus tard?«
Nein, sagte sie, Monsieur komme auch nicht später. Sie hatte das Gefühl, daß ihr bei diesen Worten die Stimme brach, doch Ahmed schien nichts zu merken. Er wünschte ihr »bonne journée« und ging lächelnd fort.
Sie trank einen Schluck heißen Kaffee. In dem Moment kam jemand von der Rezeption ins Frühstückszimmer, sah sich um und kam dann auf sie zu. »Mrs. Davenport?«
»Ja.«
»Ein Anruf vom Krankenhaus St. Croix. Da möchte jemand Sie sprechen.«
Marie stand auf und folgte dem Angestellten. Der Mann führte sie zu einer Telefonzelle neben der Rezeption. Sie nahm den Hörer ab. »Ja bitte?«
»Mrs. Davenport?« fragte jemand mit französischem Akzent.
»Ja.«
»Guten Morgen. Dr. Boulanger läßt Ihnen ausrichten, daß wir mit dem amerikanischen Konsulat gesprochen haben. Jemand von dort wird Sie im Hotel abholen und mit Ihnen hierherkommen. Dr. Faure, unser medizinischer Direktor, möchte Sie sprechen. Bitte warten Sie in Ihrem Hotel.«
»Gut«, sagte sie. »Danke.«
{29}Kaum hatte Marie aufgelegt, dachte sie, daß sie hätte fragen sollen, wann diese Person vom Konsulat denn kommen werde. Da sie aber nicht gefragt hatte, mußte sie sich nun wohl zum Aufbruch bereithalten. Sie ging auf ihr Zimmer. Auf dem Stockwerk waren die Zimmermädchen schon am Werk, aber ihr Zimmer war noch nicht gemacht. Sie nahm ihre Umhängetasche, ging wieder in die Halle hinunter und setzte sich in die Nähe der Tür. Wenige Minuten später hörte sie einen kräftig gebauten jungen Mann, der gar nichts anderes als Amerikaner sein konnte, an der Rezeption ihren Namen sagen. Er trug einen Anzug von der Stange, ein weißes Hemd mit rot-blau gestreifter Krawatte und sehr praktische, derbe schwarze Schuhe. Marie stand auf und ging hinüber. Als er sich zur Begrüßung umdrehte, sah sie, daß er eine frische Farbe und ein angenehmes Lächeln im Gesicht hatte. »Mrs. Davenport?« Er gab ihr die Hand. »Tom Farrelly, ich komme vom Konsulat. Mein Wagen steht draußen.« Und als sie zusammen hinausgingen, sagte er: »Mein aufrichtiges Beileid.«
Sie nickte. »Danke«, sagte sie und dachte: Es gibt keine Entgegnung, wenn jemand sein Beileid äußert; die Sprache hat dafür keine Worte.
Sein Auto war ein hellroter kleiner Ford. Auf der Fahrt durch die steil ansteigenden Straßen zum Krankenhaus bat er sie, ihm genau zu erklären, was am Strand passiert war. Nachdem sie es ihm erzählt hatte, fragte er: »Hat die französische Polizei diesen Motorbootbesitzer vernommen? Und hat sie Ihnen Fragen gestellt?«
»Nein, nur nach meiner Adresse. Der Motorbootbesitzer war auch dabei. Ich nehme an, daß sie mit ihm gesprochen haben, aber sicher weiß ich es nicht.« Sie dachte, daß es ihm wohl um den Bericht ging, den er gewiß schreiben {30}mußte. Wenn ein Amerikaner im Ausland starb, mußte bestimmt etwas von Amts wegen unternommen werden. Sie sagte: »Im Krankenhaus hat man mir gesagt, daß sie gleich heute früh eine Obduktion machen wollten. Haben Sie eine Vorstellung, wann sie die Leiche freigeben werden?«
Er schien zu zögern, bevor er antwortete: »Nein, leider nicht.«
»Normalerweise, meine ich. Was wäre normal?«
»Hm, vielleicht morgen.« Er schien sich da nicht sicher zu sein. »Ihr Mann war Arzt, nicht wahr? Pathologe.«
»Ja«, sagte sie. Er fragte, ob sie hier Urlaub gemacht hätten, und sie erzählte ihm von der Konferenz in Marseille, auf der ihr Mann ein Referat gehalten hatte.
»Ist das Ihr erster Frankreichbesuch?«
»Ja.«
»Und für Ihren Mann, war es auch seine erste Reise?«
»Nein, er war schon einmal zu einer Konferenz in Lyon.«
»Wann?«
»Vor vier, fünf Jahren, glaube ich. Wir waren damals noch nicht verheiratet.«
»Sprach er Französisch?«
»Ein wenig.«
»Sprechen Sie Französisch?«
»Einigermaßen. Ich habe es im Internat gelernt, in Montreal.«
»Aber Sie sind Amerikanerin?«
»Ja, und mein Mann ist auch Amerikaner.«
Er wandte den Kopf und sah sie an.
»Verzeihung«, sagte sie. »Man gewöhnt sich so schwer daran.«
{31}»Natürlich.« Sie sah aber, daß er sie ganz merkwürdig betrachtete, diesmal im Rückspiegel. Um das Thema zu wechseln, fragte sie ihn, wie lange er schon in Nizza sei, und als er es ihr gerade sagen wollte, kamen sie beim Krankenhaus an. Er fuhr zum Haupttor hinein, stellte den Wagen auf einen für Ärzte reservierten Parkplatz und führte sie mit einer Selbstverständlichkeit, als kenne er sich hier aus, nach drinnen. Sie betraten einen Büroflügel, und er ließ sie in einem Wartezimmer Platz nehmen, während er Bescheid sagen ging, daß sie da waren. Dann kam er zurück und setzte sich zu ihr. Er sagte ihr, daß sie mit drei Ärzten sprechen würden: Dr. Boulanger, der Alex behandelt habe, dem Chefarzt der Pathologie, und Dr. Faure, dem medizinischen Direktor des Krankenhauses.
»Sind sie mit der Obduktion demnach schon fertig?«
»Nein.« Er sah sie an. »Ich denke, das sollte Ihnen lieber Dr. Faure erklären. Reicht Ihr Französisch, um dem Gespräch zu folgen, oder soll ich dolmetschen?«
»Danke, es wird schon gehen. Wenn ich etwas nicht verstehe, können Sie immer noch einspringen.«
»Gut. Ich weiß jedenfalls, daß Dr. Boulanger Englisch spricht, Dr. Faure auch ein bißchen, glaube ich. Es wird schon klappen.«
Eine Sekretärin hatte das Wartezimmer betreten und kam auf sie zu. »Gehen wir«, sagte Tom Farrelly und stand auf. Sie folgten der Sekretärin durch ein Labyrinth von Korridoren zu einem Büro, das dem Schild an der Milchglastür zufolge dem medizinischen Direktor gehörte. Beim Eintreten sah sie als erstes Dr. Boulanger. Es waren aber noch zwei Ärzte da, nämlich der Chefarzt der Pathologie, ein hochgewachsener Mann mit Glatze, der wie Dr. Boulanger einen weißen Kittel trug, und hinter einem {32}imposanten Schreibtisch Dr. Faure, ein gestrenger alter Herr im braunen Zweireiher, das Abzeichen der Ehrenlegion am Revers. Marie hatte den Eindruck, daß sie und Tom Farrelly mit ihrem Eintreten ein Streitgespräch zwischen den Ärzten unterbrachen. Sie wurde vorgestellt und bekam einen Platz angeboten. Dann sah Dr. Faure über seine Lesebrille hinweg zu Farrelly und fragte auf französisch: »Haben Sie der Dame schon gesagt, was passiert ist?«
»Nein«, sagte Tom. »Ich wollte das lieber Sie erklären lassen.«
»François?« Dr. Faure sah Dr. Boulanger an, der seinen struppigen Einsteinschnurrbart befühlte und schließlich zu Marie sagte: »Ich muß Ihnen mitteilen, Madame, daß die Leiche Ihres Mannes verschwunden ist.«
»Wie bitte?« Sie war so verwirrt, daß sie glaubte, sie habe sich vielleicht verhört, ihn falsch verstanden. Aber das Wort war nicht zu verwechseln, weder auf englisch noch auf französisch.
»Lassen Sie mich erklären«, sagte Dr. Boulanger. »Wir hatten die Obduktion für heute früh acht Uhr angesetzt. Als der diensthabende Arzt einen Gehilfen nach der Leiche schickte, lag in der Leichenhalle nur noch das Namensschildchen neben der Bahre auf dem Boden. Wir haben für diesen Vorgang keine Erklärung. Wir haben sofort eine Suchaktion eingeleitet, ob man die Leiche infolge eines äußerst unwahrscheinlichen Zufalls verwechselt hat. Nun war aber im Laufe der Nacht weder eine Leiche in die Halle gebracht noch herausgeholt worden. Und die Leiche Ihres Mannes war die erste, nach der heute morgen verlangt wurde. Wie gesagt, wir haben dafür offen gestanden keine Erklärung. Könnten Sie uns vielleicht irgend etwas dazu sagen? Ich meine, wüßten Sie einen Grund, warum jemand {33}auf die Idee kommen könnte, die Leiche Ihres Mannes zu stehlen?«
»Natürlich nicht.«
»Er hatte keine Feinde?« fragte der mit der Glatze.
»Nein«, sagte sie. »Es war ja ein Unfall. Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wir kennen hier niemanden und waren auch noch nie in Frankreich. Wieso sollte da jemand die Leiche stehlen wollen? Das hätte doch keinen Sinn.«
»Ganz recht«, sagte Tom Farrelly.
»Eben«, sagte der mit der Glatze. »Das hätte keinen Sinn. Es ist zwar in ganz seltenen Fällen schon vorgekommen, daß eine Leiche nicht da war, wo sie hingehörte, aber das hat sich immer spätestens nach einer Stunde aufgeklärt.«
»Es könnte also doch sein, daß sie irgendwo am falschen Platz liegt?« meinte Tom Farrelly.
»Ich kann Ihnen versichern«, sagte der Arzt, »daß die Leiche sich nicht im Krankenhaus befindet. Sie liegt nirgendwo am falschen Platz. Jemand hat sie fortgeholt.«
Dr. Faure, der medizinische Direktor, räusperte sich und sah Marie an. »Dr. Pannaud hat recht«, sagte er. »Es tut mir leid, aber wir haben keine Erklärung. Die Leichenhalle war verschlossen. Sie ist immer verschlossen. Den Schlüssel bekommen nur Pflegekräfte und Ärzte ausgehändigt, die der Verwaltung bekannt sind. Von innen läßt die Tür sich natürlich öffnen. Wenn ein Außenstehender die Absicht hätte, eine Leiche zu stehlen, müßte er sich in der Leichenhalle versteckt halten. Es ist völlig absurd.«
Marie hatte einen ganz trockenen Hals, als sie jetzt sprach. »Aber wenn nun ein Fehler passiert wäre?« fragte sie Dr. Boulanger. »Wenn mein Mann gar nicht tot war?«
»Das ist überhaupt keine Frage«, sagte der mit der {34}Glatze. »Aber nehmen wir ruhig einmal an, es hätte eine Fehldiagnose gegeben – wieso wäre Ihr Mann dann nicht heraufgekommen, um uns darauf anzusprechen? Schließlich war er doch selbst Pathologe.«
Dr. Boulanger schien diese Zwischenfrage nur als ärgerlich zu empfinden. »Hören Sie, Madame«, sagte er zu Marie. »Ihr Mann war tot. Ich habe ihn selbst untersucht. Keinerlei Lebenszeichen mehr. Ich habe alle Tests auf Hirntod gemacht.«
»Aber manchmal – ich meine, es kommt doch vor, daß jemand für tot gehalten wird, der dann doch nicht tot ist. Das kommt doch vor«, sagte Tom Farrelly.
»Er war tot«, sagte Dr. Boulanger. Er sah zuerst Tom an, dann Marie. »Ich weiß es, Madame. Nicht nur weil ich Arzt bin. Wer schon so viele Tote gesehen hat wie ich, der weiß es einfach. Stimmt das nicht, Dr. Pannaud?«
Der Kahlköpfige nickte. »Dr. Davenport ist gestern abend kurz nach sieben Uhr gestorben«, sagte er. »Ich habe mir alle Unterlagen angesehen und bin ganz derselben Meinung. Von einem Irrtum kann keine Rede sein.«
»Die logische Schlußfolgerung«, sagte Dr. Faure, »ist demnach, daß jemand die Leiche aus der Halle geholt und auf irgendeine Weise aus dem Krankenhaus geschafft hat. In diesem Fall müssen wir die Polizei einschalten. Das heißt, falls Mrs. Davenport nicht doch noch eine Erklärung anzubieten hat. Und die haben Sie doch nicht, Mrs. Davenport?«
»Nein«, sagte sie und hatte dabei das Gefühl, gar nicht mehr wach zu sein, sich mitten in einem Traum zu befinden, der so widersinnig war, daß sie wußte, es konnte nicht wahr sein, und sie würde jeden Moment daraus erwachen. Sie sah Dr. Faure sich erheben und Tom Farrelly etwas zuflüstern. {35}Dann sprachen die drei Ärzte ihr nacheinander ihr Beileid aus. Sie hörte sie weiter über dieses Rätsel reden, diese Unerklärlichkeit. Auch sie sagte etwas, konnte sich aber hinterher an keines ihrer Worte mehr erinnern. Farrelly nahm sie beim Arm, und sie gingen durch die vielen Korridore zurück zum Haupteingang und hinaus zu dem in der warmen Mittelmeersonne geparkten Wagen. »Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll«, sagte Farrelly beim Einsteigen. »Ich bringe Sie jetzt zum Hotel. Wahrscheinlich wird die Polizei jemanden vorbeischicken, der Ihre Aussage zu Protokoll nimmt, irgendwann heute, denke ich. Und ich bleibe natürlich mit Ihnen in Verbindung. Sie haben ja vermutlich keine Pläne. Nein, wie sollten Sie? Kennen Sie hier jemanden, der hierherkommen und Ihnen ein bißchen zur Seite stehen könnte?«
»Nein«, sagte sie. Dann schwieg sie, während sie durch die Straßen von Nizza zurückfuhren. Ihr ganzes Inneres, das sich so gegen den Gedanken an Alex’ Tod gesträubt hatte, rang jetzt mit der widersinnigen Hoffnung, er könne irgendwie doch noch am Leben sein. »Wenn die sich nun aber doch geirrt haben?« fragte sie plötzlich, als Farrelly den Wagen vor dem Hotel Miramar anhielt. »Es gibt solche Irrtümer. Ich meine, das haben Sie ja selbst gesagt. Von so etwas liest man ja auch manchmal in den Zeitungen, meine ich.«
»Und wo ist er dann?« fragte Farrelly. »Er hatte nichts an. Er kann nicht ohne Kleider da hinausgegangen sein. Das ist nicht plausibel. Ich nehme an, in diesem Krankenhaus ist ein Fehler passiert, und sie werden die Leiche irgendwo auf einer Station wiederfinden. Das ist die einzig mögliche Erklärung.«
Er stieg aus dem Wagen und begleitete sie zum {36}Hoteleingang. »Hören Sie«, sagte er, »wenn Sie aus irgendeinem Grund Hilfe brauchen, rufen Sie mich einfach unter dieser Nummer an. Ich komme dann, oder falls ich nicht da bin, kommt jemand anders vom Konsulat.« Er gab ihr seine Karte. »Sie sehen müde aus«, sagte er. »Vielleicht sollten Sie versuchen, sich ein wenig hinzulegen.«
Sie nahm seine Karte und versuchte zu lächeln. Pure Angewohnheit, dieses Lächeln. Menschen lächelten unter den unmöglichsten Umständen. »Danke«, sagte sie. »Danke für Ihre Hilfe.«
Sie sah ihm nach, wie er in seinem kleinen roten Ford davonfuhr. Sie ging in die Hotelhalle, wo es von Touristen wimmelte, die auf einen Ausflugsbus warteten. Es waren Amerikaner. Ihr vertrauter Akzent gab ihr das Gefühl, zu Hause zu sein, nicht hier in Frankreich, und dieses Gefühl verstärkte sich noch, als sie beim Warten auf den Aufzug durch die Glastür auf den Innenhof des Hotels sah, wo der Swimmingpool war. Die Bougainvilleen auf dem Hof sahen aus wie die am Swimmingpool ihres Vaters in Brentwood. Plötzlich dachte sie erschrocken: Carmel. Konnte das sein? Sie merkte, daß sie zitterte, als sie in den Aufzug stieg. Seit Carmel ist alles möglich.
Als sie in ihr Zimmer trat, sah sie, daß es während ihrer Abwesenheit aufgeräumt worden war. Sie sah auch, daß die Balkontür offen stand, und das überraschte sie. Man konnte von den Balkonen aus über eine Außentreppe zum Swimmingpool hinuntergehen. Deshalb hing an der Tür ein Schildchen mit der Mahnung, man möge die Balkontüren »wegen Gefahr von Dieben«, wie es etwas unbeholfen hieß, immer geschlossen lassen. Sie hatte sie doch wohl nicht offen gelassen? Und warum hatte das Zimmermädchen sie nicht zugemacht? Marie dachte sofort an Einbruch. Als sie {37}noch am UCLA studierte, hatte sie mit einer Kommilitonin ein Appartement außerhalb des Campus bewohnt, und dort war einmal eingebrochen worden, das ganze Appartement leergeräumt und verwüstet. Jetzt rannte sie in panischem Schrecken zu der Schublade, in der sich ihre Pässe, Reiseschecks, Geld und Flugtickets befanden. Sie zog die Schublade auf und war im ersten Moment erleichtert. Die große Reisemappe war noch da. Dann fiel ihr jedoch Alex’ Brieftasche ein. Ich habe sie gestern abend hier hineingetan. Daran erinnere ich mich genau. Sie wühlte in der Schublade, fand die Brieftasche aber nicht darin und öffnete die Reisemappe. Sie fand ihren Paß, ein Flugticket und ein paar Reiseschecks. Aber es hätten zwei Heftchen Reiseschecks da sein müssen, eines mit Alex’ Unterschrift, eines mit ihrer. Ihres war da. Seines nicht.
Nun bleib bitte ganz ruhig, befahl sie sich. Überzeuge dich erst genau davon. Sie blieb noch einen Moment stehen und versuchte, ihre zitternden Glieder unter Kontrolle zu bekommen. Dann durchsuchte sie sorgfältig die Reisemappe, ein Fach nach dem anderen. Ihr Rückflugticket nach New York war da. Alex’ Ticket fehlte. Außer seinen Reiseschecks fehlten etwa fünfhundert Dollar in bar. Nachdem dies feststand, ging sie zum Kleiderschrank und sah hinein. Sie hatten vier Koffer auf diese Reise mitgenommen. Seine Aktentasche und ein Koffer waren weg. Sie sah, daß nur einige von seinen Kleidungsstücken fehlten. Seine Anzüge, zwei Freizeithosen, Pullover, Hemden und Socken befanden sich noch im Schrank und in den Schubladen. Sie sah Tom Farrellys Gesicht wieder vor sich. Und wo ist er dann? Er hatte nichts an. Er kann nicht ohne Kleider da hinausgegangen sein. Er hatte keine Kleider dort. Er hatte nur eine {38}Badehose angehabt. Er konnte doch nicht in der Badehose zum Hotel gelaufen sein, oder?