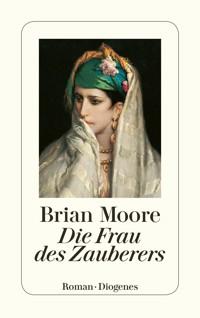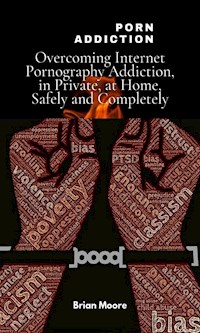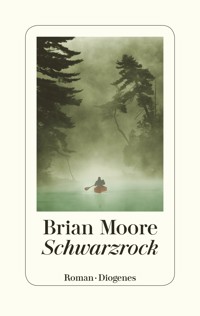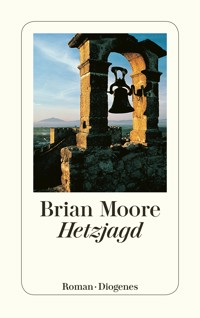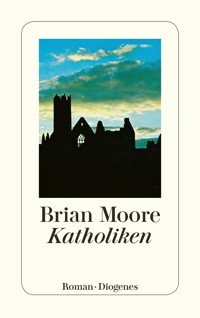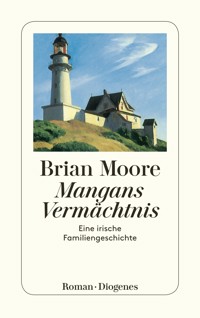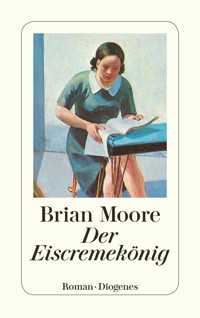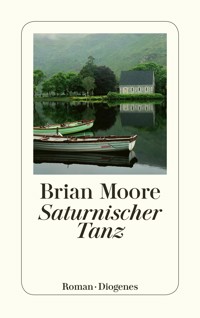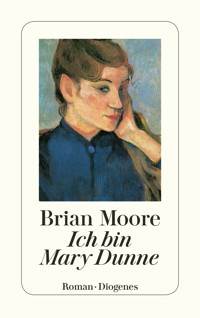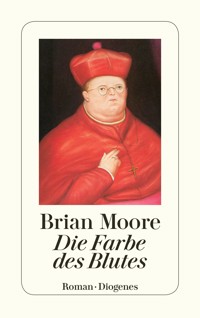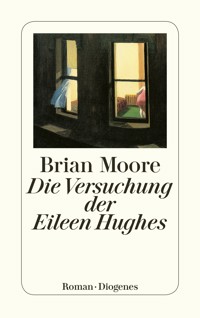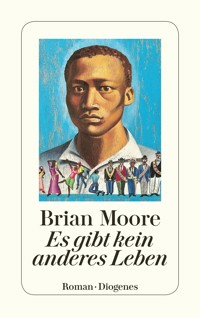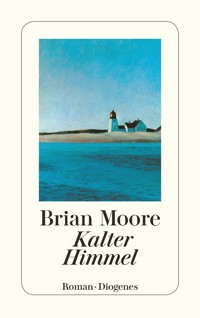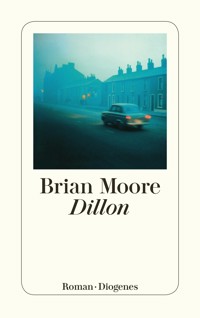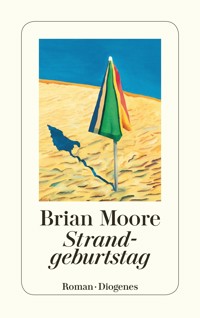
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fergus Fadden, ein in die Staaten ausgewanderter Nordire und Schriftsteller, braucht dringend Geld. Da kommt ihm das Angebot gerade recht, in ein kalifornisches Strandhaus zu ziehen, um dort das Drehbuch zu seinem Roman zu überarbeiten. Doch plötzlich sitzt sein lang verstorbener Vater auf dem Sofa, und nach und nach füllt sich das Haus mit irischen Gespenstern. Doch warum bedrängen sie ihn?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Brian Moore
Strandgeburtstag
Roman
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Diogenes
{4}Für Jean, abermals
{5}Wie Dänen in Dänemark
fühlten wir uns den ganzen Tag
und kannten einander genau,
rüstige Landsmänner, denen das
Ausländische ein anderer Tag
der Woche und seltsamer noch als
ein Sonntag war …
Wallace Stevens:
The Auroras of Autumn
{7}Als seine Freundin ging, weinte Fergus. Er hatte sie nicht brüskieren, nur allgemein über ihre Situation sprechen wollen, aber sie stand auf und lief ins Bad, wo ihre Kleider lagen. Als sie wieder herauskam, trug sie einen Pullover über einem sehr kurzen Rock und hatte sich eine Schulmädchenschleife ins lange rote Haar gebunden. Er wußte, daß er zu alt für sie war. Sie wich seinem Blick aus.
»Dani?« rief er, aber sie stellte sich taub und verließ das Schlafzimmer. Er hörte sie über den geziegelten Flur laufen, die Haustür öffnen und hinter sich zuschlagen. Er spielte mit dem Gedanken, aufzustehen und sich zu entschuldigen. Aber da hörte er schon den Motor des Volkswagens, während sie Gas gab, in die Auffahrt bog und zum Pacific Coast Highway fuhr. Als es wieder still war, stieg er aus dem Bett und trat ins Wohnzimmer. Er öffnete die Glastür und ging hinaus auf die meerwärts gelegene Terrasse. Er stand da, starrte auf den menschenleeren Strand und auf die sich brechenden Wellen. Und er weinte.
Nach einer Weile wandte er sich vom Meer ab, ging wieder ins Wohnzimmer und setzte sich in einen orangefarbenen Sessel. Vor ihm stand ein großes gelbes Sofa, ein Panoramafenster gab den Blick auf die hohen, kahlen Berge hinter dem Haus frei. Die fröhlichen mexikanischen Farben des Zimmers wirkten blaß im Morgenlicht. Hinter ihm donnerten die Wellen an den Strand wie eine im Windzug schlagende Tür.
{8}Im Eisenholzbaum hinter dem Panoramafenster begann irgendwo ein Vogel zu singen. Fergus zog ein Kleenex aus der Tasche seines Schlafanzugs, trocknete sich die Augen und schneuzte sich die Nase. Als er damit fertig war, sah er sich im Zimmer um. Sein Vater saß auf dem gelben Sofa.
Sein Vater war genauso angezogen, wie Fergus ihn in Erinnerung hatte. Er trug einen schokoladenbraunen Anzug aus schwerem Tweed. Sein Seidenschlips mit den grünroten Streifen der St.-Michan’s-Altherrenvereinigung war zu einem großen Knoten geschlungen und hing lässig im Ausschnitt seines weißen, gestärkten Hemdkragens. Der randlose Kneifer saß fest auf seinem Nasenrücken, an der Klappe über dem rechten Auge hing ein schwarzes Seidenband, das sich über sein Ohr schwang und locker um seinen Hals wand. Seine Schuhe waren braun.
Fergus hatte Angst. Er senkte den Blick, wie ein Kind zu Boden schaut, wenn es verwirrt ist. Dann sah er unbehaglich wieder zum gelben Sofa. Sein Vater war immer noch da.
»Herrgott noch mal!« sagte Fergus.
Bei der Erwähnung des heiligen Namens schlug Fergus’ Vater das Kreuzzeichen, berührte zuerst seine Stirn, dann die Brust, die linke und schließlich die rechte Schulter, so wie er es sein Leben lang getan hatte, zu Fergus’ großer Verlegenheit sogar in aller Öffentlichkeit auf der Straße oder im Bus, wenn er zufällig an einer katholischen Kirche vorbeikam. Nachdem er sich bekreuzigt hatte, stieß Fergus’ Vater einen tiefen Seufzer aus, und sein Atem ließ die buschigen Haarspitzen seines mächtigen, nikotingefleckten Schnäuzers erzittern. Der Vater warf Fergus einen bekümmerten Blick zu. Dieser Blick war Fergus noch nach {9}einundzwanzig Jahren in Erinnerung, und als er ihn jetzt wieder sah, wich er ihm aus, erhob sich und ging ins Gästebad, das gleich neben dem Wohnzimmer lag. Er zog die Tür zu und schloß sich ein, trat ans Waschbecken und betrachtete sein Gesicht im Spiegel. Seine Augen wirkten normal: Selbst von seinen Tränen war keine Spur mehr zu sehen. Jedenfalls deutete in seinem Gesicht nichts darauf hin, daß er gerade halluziniert oder so etwas wie eine außersinnliche Wahrnehmung gehabt hatte. Und doch habe ich ihn gesehen, sagte Fergus seinem Spiegelbild. Ich habe ihn so deutlich gesehen, als wäre er noch am Leben; seine rote Haut, seinen Atem, einfach alles. Es war wie eines dieser Wunder, an die er geglaubt hat, Lourdes etwa oder die Jungfrau Maria, die Thérèse von Lisieux erschienen ist. Jetzt weiß ich, wieso die Leute nach einer Halluzination glauben, Gott oder irgendeinen Heiligen tatsächlich gesehen zu haben. Einfach unfaßbar. Ich muß Dani anrufen und ihr davon erzählen. Vergiß den Krach. Sobald sie in ihrem Büro ist, rufe ich sie an.
Doch dann fiel ihm ein, daß sein Vater gleich neben dem Telefon gesessen hatte. Besorgt entriegelte er die Badezimmertür und sah ins Wohnzimmer. Auf dem gelben Sofa war niemand. Die Vision war verschwunden.
Im selben Augenblick empfand Fergus fast so etwas wie ein Gefühl von Trauer. Typisch sein Vater, taucht auf und verschwindet wieder, ohne ihm Gelegenheit zu geben, ein Wort mit ihm zu wechseln. Das war so seine Art, selbst noch bei seinem Abgang, als er unten im Schlafzimmer in der Hampden Street in Belfast eines Abends aus heiterem Himmel starb. Das Herz seines Vaters hatte genau in dem Augenblick zu schlagen aufgehört, in dem Fergus nichtsahnend einen Stock höher in seinem Bett zu onanieren {10}begonnen hatte. Als seine Mutter Fergus rief, er möge herunterkommen, war Fergus gerade gekommen (in seine Schlafanzugshose) und mußte seine Rettungsaktion verschieben, bis er sich eine saubere Hose angezogen hatte. Herrgott noch mal!
Fergus sprach »Herrgott noch mal« nicht laut aus, merkte zu seiner Überraschung aber, daß er aus Ehrfurcht vor dem heiligen Namen kurz den Kopf senkte. Gestern hätte er hundertmal »Herrgott noch mal« sagen oder denken können, und es wäre nur ein bedeutungsloser Ausruf gewesen. Doch jetzt war ihm bewußt, daß er den heiligen Namen gedankenlos ausgesprochen hatte. Und das war früher einmal eine Todsünde gewesen (oder war es eine läßliche Sünde?).
Er nahm es philosophisch (was vergangen ist, ist vergangen) und drehte sich zur Glastür um, hinter der, wie immer, das Meer lag, dessen Wellen sich schon weit vor dem Ufer brachen. Thalassa, Thalassa, das laut tönende Meer, unsere große Mutter, Thalassa. Fergus konnte zwar kein Griechisch, aber er sagte diese Worte gern vor sich hin: Er hatte eine Schwäche für klangvolle Silben. Jetzt sagte er laut: »Thalassa! Thalassa!«, und im selben Moment sah er seinen Vater wieder. Er saß in einer der beiden Korbschaukeln, die an Ketten von den Terrassenbalken herabhingen. Wie ein altes Kind in einer Gartenschaukel schwang sein Vater in dem Korbsessel langsam hin und her. Er schaute Fergus nicht an. Er blickte aufs Meer und hockte zusammengesunken in der Hängeschaukel; seine Füße schwebten über dem Boden.
Fergus schob die Glastür auf und trat hinaus auf die Terrasse. Sein Vater hatte ihn noch nicht entdeckt. Er sah würdevoll aus, trotz der unvorteilhaften, altmodischen {11}Kleider; das Licht spiegelte sich in seiner Brille, sooft er in die Sonne pendelte und die Korbschaukel sich in einem weiten Halbkreis drehte; irgendwie machte es Fergus wütend, daß sein Vater sich diesen lächerlichen Platz ausgesucht hatte. Die Terrasse war zwanzig Meter lang, und es standen andere, passendere Sitzgelegenheiten herum. Doch als er seinen Vater in dem blöden Sitz schaukeln sah und auf die braunen Schuhe seines Vaters blickte, die einige Zentimeter über dem roten Ziegelboden baumelten, ermahnte sich Fergus zur Ruhe. Diesmal wollte er seinen Vater nicht wieder verschwinden lassen.
»Daddy?«
Sein Vater warf ihm einen gleichgültigen Blick zu und schaute dann wieder aufs Meer. Aus seiner Kindheit erinnerte sich Fergus an diesen Blick. Erwachsene konnten dich hören, schenkten dir aber keine Beachtung. Sie hatten das nicht nötig.
»Daddy? Ich bin’s, Fergus.«
Diesmal sah er Fergus nicht einmal an; der Korbstuhl drehte sich wie eine Wetterfahne, beschrieb einen Halbkreis und pendelte, sobald die Kette sich aufdrehte, in umgekehrter Richtung zurück. Sein Vater holte aus seiner Westentasche eine vertraute gelbe Pappschachtel: zwanzig Wills’-Gold-Flake-Zigaretten, steckte sich eine Gold-Flake exakt mitten zwischen die Lippen, ließ sie dort hängen und zündete sie mit einem silbernen, kugelförmigen Feuerzeug an. Vor vielen Jahren hatte sein Vater eine Kugel entfernt, die das Herz eines Kindes nur knapp verfehlt hatte. Die Eltern hatten sich die Kugel als Souvenir erbeten und seinem Vater einen Monat später ein silbernes Feuerzeug, die vergrößerte Kopie der Kugel, geschenkt. Für Dr. James Fadden aus Dankbarkeit von Tim Byrnes {12}Eltern stand darauf eingraviert. Während Dr. Fadden jetzt in der Korbschaukel Halbkreise beschrieb, schob er das Feuerzeug wieder in die Westentasche zurück, nahm einen tiefen Zug und sog an der Zigarette, bis das Ende rot wie glühende Kohle aufglomm. Der Rauch löste einen Hustenanfall aus, aber Dr. Fadden nahm die Zigarette nicht aus dem Mund. Ein schmaler Aschestreifen fiel auf die Weste. Dr. Fadden ignorierte die Asche.
Kaum war der Husten seines Vaters verklungen, hüstelte jemand unterwürfig, als ob er der gereizten Kehle Dr. Faddens zustimmen wollte. Fergus, der sich nach diesem Laut umdrehte, sah seine Mutter am anderen Ende der Terrasse auf den zum Strand führenden Stufen sitzen. Sie untersuchte die kleine, gummiartige und bananenförmige Kriechpflanze, Eiskraut genannt, die den zum Sand hin abfallenden Hang bedeckte. Der Anblick der Pflanze schien sie zu überraschen. Seine Mutter trug ein geblümtes Kleid, eines von denen, die sie so oft bei der Hausarbeit angehabt hatte, und als sie merkte, daß Fergus sie ansah, legte sich die Haut um ihre Augenwinkel in Falten, und sie lächelte ihrem Sohn beschwichtigend zu. Es war ein Lächeln, das ihm aus ihren letzten Jahren nur allzu vertraut war, aus jener Zeit, als sie finanziell von ihm abhängig gewesen war, die Rollen vertauschen und sein Kind werden wollte. Von ihrem Blick überrascht und beschämt über seine Erinnerungen, wandte er sich ab, eilte zurück ins Wohnzimmer, zog die Glastür zu und schloß hinter sich ab, um seine Mutter auszusperren. Er ging zum gelben Sofa, griff nach dem Telefonhörer und lauschte einen Moment beruhigt auf den vertrauten Freiton. Er wußte nicht, warum er den Hörer in die Hand genommen hatte. Es wäre sinnlos, um Hilfe zu rufen. Vermittlung, holen Sie {13}die Polizei. Ich habe Geister in meinem Haus. Sie würden Männer mit einer Zwangsjacke schicken, falls sie überhaupt jemanden schicken würden. Während er noch den Hörer an sein Ohr hielt, kam es ihm plötzlich so vor, als wäre seine Mutter ihm gefolgt, und schuldbewußt knallte er den Hörer zurück auf die Gabel. Doch außer ihm war niemand im Zimmer. Draußen, auf der Terrasse, sah er die jetzt wieder leere Korbschaukel langsam an der Kette schwingen. Er ging zur Tür, schaute über die Terrasse und ließ seinen Blick über den Weg zum Strand, den eiskrautbewachsenen Hang und die Bougainvilleabüsche wandern, hinter denen sich eine verfallene Spielhütte verbarg. Es war niemand zu sehen.
Er kehrte der Aussicht auf das Meer den Rücken und setzte sich in den orangefarbenen Sessel, eben jenen Sessel, in dem er auch gesessen hatte, als die Visionen auftauchten. Er spielte wieder mit dem Gedanken, Dani anzurufen, fragte sich dann aber, ob nicht selbst Dani bezweifeln würde, daß er zwar Erscheinungen gehabt hatte, aber immer noch bei klarem Verstand war.
Natürlich könnte es auch sein, daß er nicht mehr bei klarem Verstand war. Er schloß diese Möglichkeit nicht aus.
Ein Auto: Er hörte, wie es vom Highway abbog und am oberen Ende der Auffahrt hielt. Es war nicht ihr Volkswagen. Er stand auf, bückte sich, um nicht durch das Fenster gesehen werden zu können, huschte über den geziegelten Flur ins Schlafzimmer, zog den Schlafanzug aus und streifte sich Hemd und Hose über. Mit den Füßen fuhr er in ein Paar Pantoffeln, schlich sich verstohlen in sein Arbeitszimmer, spannte ein Blatt Papier in die tragbare elektrische Schreibmaschine und tat, als würde er arbeiten. Er fragte sich, ob jemand geschickt worden war, {14}um ihn zu überprüfen: ein Privatdetektiv etwa? Doch noch während er sich diese Frage stellte, wußte er, daß er sich irrte; sie verschwendeten keinerlei Gedanken an ihn. Redshields hatte seit drei Wochen nicht angerufen. Und Boweri war fertig mit ihm.
Es schellte. Ding-dong! Kein Mensch kam je zu diesem Haus, der Postbote, der Mann von der Reinigung und die Leute vom United-Parcels-Service ausgenommen. Und für die war es viel zu früh. Ein Eilbrief? Er ging aus dem Arbeitszimmer in den Flur und öffnete die Haustür.
Zwei Männer standen draußen. Sie trugen dunkle Anzüge. An ihrem Auto war keine Reklame zu sehen. »Guten Morgen«, sagte der Ältere. »Ich bin Mr. Prentiss, und das ist Mr. Hoxley. Wie geht es Ihnen?«
»Gut«, sagte Fergus.
»Wir haben uns gefragt, ob wir vielleicht hereinkommen und Sie einen Augenblick besuchen dürften?«
»Worum geht’s?«
»Mr. Hoxley dachte, er könnte Ihnen vielleicht etwas über unsere Broschüren erzählen, falls Sie Interesse haben.«
»Wir sind Mitglieder der Church of the Brethren of God«, sagte Mr. Hoxley. Beide Männer lächelten, kaum daß sie damit herausgerückt waren.
»Tut mir leid, ich habe kein Interesse«, sagte Fergus.
»Nun, wenn wir nicht hereinkommen und Sie besuchen dürfen, so würden Sie es vielleicht vorziehen, wenn wir Ihnen einige Broschüren daließen, damit Sie sich nach eigenem Gutdünken damit vertraut machen können?«
»Nein, wirklich, ich glaube nicht, vielen Dank. Ich stecke mitten in der Arbeit, danke. Ich bin im Augenblick sehr beschäftigt.«
{15}»Sind Sie ganz sicher, Sir?« fragte Mr. Prentiss.
»Ja, tut mir leid. Ganz sicher.«
»Nun, in dem Fall bedauern wir, daß wir Sie gestört haben, Sir.«
»Ist schon in Ordnung.«
»Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag, Sir«, sagte Mr. Prentiss.
»Ja, noch einen guten Tag, Sir«, sagte Mr. Hoxley.
»Auf Wiedersehen«, sagte Fergus. Er schloß die Tür und stellte sich vor, wie sie die Auffahrt hinuntergingen, ohne ein Wort zu reden, demutsvoll in ihren dunkeln Anzügen und den schwarzen derben Straßenschuhen. Es gehörte zu ihrer Besuchsstrategie, sich jedem Haus zu Fuß zu nähern, die gesamte Strecke der langen Auffahrt zu Fuß zu gehen und abgewiesen zu werden, um nun in der heißen Sonne zurückzugehen, auf daß Gott sie liebe; aber vermutlich, dachte Fergus, liebte Gott sie auch. Was hätten sie wohl gesagt, wenn er sie hereingebeten und ihnen erzählt hätte, daß ihm wenige Minuten zuvor eine vollkommen klare Vision seiner toten Eltern gewährt worden war? Wahrscheinlich waren sie die idealen Gesprächspartner, um über derlei Manifestationen zu reden, und einen verrückten Augenblick lang spielte Fergus mit dem Gedanken, die Haustür zu öffnen, ihnen nachzurufen, damit sie sich umdrehten und zurückkamen, die demütigen Betbrüder, die im Weinberg der Seelen der Menschen arbeiteten, bereit, sich auch um seine Seele zu kümmern und ihm warnend mitzuteilen, daß das Himmelreich nahe sei.
Doch als er zurück ins Arbeitszimmer ging und zur Auffahrt hinübersah, waren sie fort. Er stellte die elektrische Schreibmaschine aus. Neben der Schreibmaschine sah er die Blätter liegen, die er für den Fall, daß Redshields {16}vorbeikommen sollte, ordentlich in einer Mappe abgeheftet hatte. Aber Redshields dachte natürlich nicht daran herzukommen. Warum auch? Er und Boweri hatten ihn längst vergessen. Sie kümmerten sich um ihre eigenen Geschäfte. Es war an ihnen, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, und sie hatten keinen Finger gerührt. Wahrscheinlich gab es längst einen anderen, der in eben diesem Augenblick an dem Skript arbeitete. Ganz bestimmt.
Also gut. Er würde zurück an die Ostküste fahren. Er würde von hier verschwinden und nicht zurückkommen, niemals, es sei denn, er könnte zu seinen und nicht zu ihren Bedingungen kommen. Aber wie? Er hatte kein Geld mehr: Seine Frau hatte ihn ausgenommen; da waren die Scheidungskosten, dann die Rechnungen seiner Frau, die Abfindung, die Unterhaltszahlungen, das Geld fürs Kind. Außerdem würde Boweri bestimmt einen Prozeß gegen ihn anstrengen, wenn er jetzt gehen sollte. Im vergangenen Jahr war ihm sein Leben fremd geworden wie die Geschichte eines anderen Menschen, eine komische Tragödie oder eine tragische Farce, die er hinter sich lassen wollte, um ein neues Leben anzufangen. Mit Dani. Doch gerade seine Hoffnung auf ein neues Leben war der Grund für ihren Krach heute morgen gewesen. Aus einem verworrenen Durcheinander bedrohlicher Träume war er aufgewacht, neben ihm auf dem Kissen Danis seidenweiches, rotes Haar, ein wohltuender Anblick. Erregt hatte er sie geküßt und gestreichelt, und sie hatten den Tag damit begonnen, sich zu lieben. Danach hatte er glücklich und zukunftsfroh davon geredet, sie mit ins Ausland zu nehmen, um ihr all die Orte zu zeigen, die sie noch nie gesehen hatte: London, Rom, Stockholm, Dublin und – natürlich – Paris.
{17}»Schaffen wir das in zwei Wochen Urlaub?« hatte Dani ihn unterbrochen.
»Bis dahin ist meine Scheidung durch«, sagte er. »Dann kannst du deinen Job aufgeben.«
»Bitte!«
»Bitte was?«
»Du hast mir versprochen, nicht mehr davon anzufangen.«
»Wovon?«
»Von Heirat«, sagte sie. »Daß wir heiraten. Du hast versprochen, nicht mehr davon zu reden.«
»Ach, komm schon. Warum nicht?«
»Weil.«
»Weil was?«
»Bitte«, sagte sie, während ihre Verstimmung in Ärger überging. »Halt einfach den Mund, okay?«
»Ach, komm schon, was ist los? Irgendein Aberglaube? Mit der Scheidung wird es schon klappen, keine Angst.«
»Ich habe keine Angst, Fergus, das habe ich dir doch gesagt. Ich bin glücklich, so wie es ist.«
Er hatte an Boweri denken müssen. Frauen wollen geheiratet werden, hatte Boweri gesagt. Alle Frauen, hatte Boweri gesagt.
»Sieh doch, Frauen wollen geheiratet werden«, sagte er zu Dani. Fast kam es ihm vor, als hätte Boweri ihm die Worte in den Mund gelegt.
»Scheiße!«
»Was soll das heißen? Scheiße?«
»Was soll ich mit Scheiße schon meinen?« hatte Dani gefragt. »Ich meine Scheiße, Scheiße, Scheiße!«
»Immer langsam, Liebling, kein Grund, verrückt zu {18}spielen. Schließlich wollte ich mit dir nur über unsere Situation reden, sonst nichts.«
Im selben Augenblick war sie aufgestanden und nackt ins Bad geeilt. Als sie wieder herauskam, mußte er an Ben Jonson denken:
Noch angezogen, noch so adrett
Als gingest du auf ein Fest.
Die junge Miss Kalifornien im Minirock, eine Schulmädchenschleife im hüftlangen roten Haar. Sie war schön. Er wußte, daß er zu alt für sie war. Wie redete man mit so einem Menschen? Er versuchte, sie anzulächeln. Sie ignorierte sein Lächeln.
Er hätte sich entschuldigen sollen: Jetzt würde er den ganzen Tag Angst haben, denn sie im Büro anzurufen hatte keinen Sinn. »Ist dies ein persönliches Gespräch?« Nein, ist es nicht. »Worum geht es dann bitte?« Ach, scheiß drauf, es war nicht seine Schuld, man konnte doch nicht immer das Richtige sagen. Wäre der eine Satz nicht falsch gewesen, hätte es keinen Krach gegeben; nur ein Satz, den er nicht hätte sagen sollen. Aber geht es in jedem Krach nicht um diesen einen Satz, den man nicht hätte sagen sollen? Es war so leicht, etwas falsch zu machen mit einem Menschen aus einem anderen Land, aus einer anderen Generation, mit jemandem aus Kalifornien, Himmel noch mal.
Also war Dani wütend aus dem Haus gegangen und die dreißig Meilen nach Los Angeles zu ihrer Arbeit gefahren, ohne vorher auch nur eine Tasse Kaffee getrunken zu haben. Unterdessen hatte er geweint und Visionen gehabt. Er ging in die Küche und schüttete Bohnen in die {19}Kaffeemaschine. Ich werde noch einmal ganz von vorn anfangen, sagte er sich, als wenn nichts Ungewöhnliches geschehen wäre. Ich werde mir einen Kaffee machen und zu arbeiten beginnen. Doch als Fergus den Kaffee mahlte, spürte er, wie ihm wieder die Tränen kamen. Warum weine ich? fragte er sich. Weil die Tränen meinen Kummer lindern?
Ich habe Angst, daß ich sie verliere. Deshalb weine ich.
»Dani? Diese kleine Nutte?«
Während er in der Küche stand, auf die Kaffeebohnen starrte, die lärmend in der Kaffeemaschine herumhüpften, erinnerte sich Fergus daran, wie Boweri ihm diese Frage gestellt hatte, als sie in seiner Villa in Bel-Air saßen, in einem Zimmer, das Boweri seine ›Ideenklause‹ nannte. Boweri, von massiger Gestalt, lächelte und schloß die eiförmigen Augen, während er sein breites, fast orientalisches Gesicht dem durch ein offenes Fenster fallenden Sonnenlicht zuwandte; sein Lächeln entblößte schneeweiße Zahnkronen. Als Boweris Lächeln in ein vergnügtes Glucksen überging, bebte seine Brust unter dem gelben Freizeithemd, und seine linke Hand strich in vertrauter Geste liebevoll über die große weiche Wölbung seiner Genitalien.
»So klein ist sie nicht«, antwortete Fergus. »Sie ist, ehrlich gesagt, sogar ziemlich groß.«
Und sofort kam er sich ein wenig dämlich vor, denn vermutlich hatte Boweri nicht ihre Körpergröße, sondern ihre Stellung in der Gesellschaft gemeint. Ein Filmstar wie Elizabeth Taylor war für Boweri eine ›große‹ Frau. Doch wie so oft schien Boweri nicht gehört zu haben, was Fergus gesagt hatte. Immer noch glucksend, wich er nun mit geschlossenen Augen dem Sonnenlicht aus und schüttelte {20}den Kopf, als wäre Fergus sein geliebter, aber etwas trottliger Sohn.
»Fannn-tastisch«, sagte Boweri. »Einfach fannn-tastisch. Also, ich finde das wirklich großartig. Wissen Sie, ich freue mich für Sie. Bringen Sie die Kleine doch irgendwann einmal mit. Wir könnten zum Rennen gehen.«
Doch natürlich hatte Fergus Dani nicht mitgebracht. Redshields hatte er sie auch nicht vorgestellt. Als er vor Redshields einmal unvorsichtigerweise erwähnte, daß er mit einer Frau zusammenlebe, hatte Redshields sofort gefragt, wie alt sie sei. Als Fergus antwortete, sie sei zweiundzwanzig, meinte Redshields: »Hart an der Grenze, übertreiben Sie’s nicht. Glauben Sie mir, wenn ich es vermeiden kann, vögle ich mit keiner, die älter als zwanzig ist. Muß man heutzutage auch nicht mehr. Diese jungen Dinger lassen sich alle flachlegen, die denken sich nichts dabei. Sie sollten mal den Arsch einer Achtzehnjährigen probieren, das kann ich Ihnen nur raten.«
Dabei ist Redshields das Vieh, das von meinen Texten behauptet hat, ihnen fehle ›die nötige Wärme‹, und der mir riet, einmal ›eine ehrliche Liebesgeschichte über eine ganz normale menschliche Beziehung‹ zu schreiben, dachte Fergus. Ist es da ein Wunder, daß ich gleich morgens in der Frühe Visionen habe?
»Schlechte Gesellschaft.«
Die Stimme klang so laut, als wollte ihr Besitzer das Knirschen der Kaffeemaschine übertönen. Fergus stellte die Kaffeemaschine ab. Father Kinneally hielt die Kühlschranktür auf und schaute hinein, als ob er etwas zu essen suchte. Fergus betrachtete Father Kinneallys Hinterkopf und erinnerte sich wieder an den kahlen Glorienschein, um den sich vergebens das schwarze Haar lockte, das {21}gleiche Haar, das so unbezähmbar auf seinen Wangen sproß und sich selbst unter den Gläsern seiner dünnen Nickelbrille in seltsamen kleinen Büscheln blicken ließ. Father Kinneally beugte sich beim Sprechen vor, untersuchte die hinteren Winkel des Kühlschranks und machte dabei eine für ihn typische Bewegung: Er preßte mit der Zunge von innen gegen die Unterlippe, so daß sie sich zu einem häßlichen Affengesicht vorwölbte. »O Heilige Mutter Jesu«, sagte Father Kinneally in jenem eigenartigen Wimmerton, der anzeigte, daß er zu beten begonnen hatte. »Lege bei deinem göttlichen Sohn Fürbitte ein und flehe ihn an, diesem Jungen Mut zu gewähren, auf daß er sich übler Gesellschaft erwehre, seiner Schwäche Herr werde und sich ein für allemal von dem abkehre, was seine unsterbliche Seele gefährdet. Amen.«
»Irre«, sagte Fergus und verfiel in die Redeweise seiner Schultage. »Der kahle Kinneally. Father Maurice Kinneally wollte ich sagen, Magister und Doktor der Theologie.«
Father Kinneally nickte, als bestätige er seine Titel, langte in den Kühlschrank und nahm sich eine Weintraube. Er hielt die Traube zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete sie aufmerksam. Fergus blickte auf die klobigen schwarzen Stiefel des Fathers und auf sein Kinn, das zweimal am Tag eine Rasur brauchte, aber unrasiert war, und begriff mit einem Schlag, daß er jetzt ebenso alt war wie Father Kinneally damals, als der ihn, Fergus, in Englisch am St. Michan’s College unterrichtet hatte. Ihm fiel auch wieder ein, daß Father Kinneally auf seine alten Tage pensioniert und als Gemeindepriester in ein Dorf der Grafschaft Down geschickt worden war, konnte sich den Father aber einfach nicht als {22}Gemeindepfarrer vorstellen, der sich etwa die Beichte einer verheirateten Frau anhörte, er, der schon puterrot anlief, wenn ihm beim Sportfest eine Mutter seiner Schüler eine Frage stellte. Doch in der Klasse und auf der Kanzel war Father Kinneally ein Spezialist, wenn es um die Ränke der Frauen ging, ein Offizier der militanten Kirche, stets bereit, die Seele der Jungen in seiner Obhut gegen den Teufel und all seine weiblichen Heerscharen zu verteidigen.
»Wissen Sie, Father«, sagte Fergus, »es gibt da etwas, das ich Sie schon immer fragen wollte. Stimmt es wirklich, daß Sie einmal in die Praxis des Schulzahnarztes gestürmt sind und alle Anzeigen für Korsetts und BHs aus den Zeitschriften auf dem Tisch im Wartezimmer herausgeschnitten haben?«
Father Kinneally, der noch immer die Weintraube betrachtete, senkte den Kopf, eine Bewegung, die ebensogut Zustimmung wie Ablehnung bedeuten mochte. »Hat der Zahnarzt, Mr. – ähm – Mr. Findlater, hat der dir davon erzählt?«
»Stimmt, Conor Findlater. Er hat eine enge Freundin meiner Mutter geheiratet und mir später davon erzählt, lange nachdem ich die Schule verlassen hatte.«
Father Kinneally steckte sich die Traube in den Mund, schob sie mit der Zunge in seine rechte Wange, die sich ein wenig vorwölbte, und biß dann entschlossen zu. »Kleine Jungs haben sich diese anzüglichen Bilder angeschaut«, sagte Father Kinneally. »Also hielt ich es für einen weisen Entschluß. Vergiß nicht, eine Gelegenheit zur Sünde ist eine Gelegenheit zur Sünde, auch wenn sie unbeabsichtigt herbeigeführt wird.«
»Also stimmt es doch.« Fergus merkte, daß sich sein Gesicht zu einem Lächeln verzog, aber Father Kinneallys {23}Augen, die selbstgerecht durch seine Nickelbrille blickten, sahen ihn warnend an.
»Lach du ruhig, Fergus Fadden, nur zu, lach ruhig. Aber ich glaube, wir haben gerade über ein weitaus ernsteres Thema gesprochen. Ich glaube, wir sprachen über deinen Arbeitskollegen Mr. Redshields. Wir redeten über sein Verhalten – oder sagen wir lieber über sein unziemliches Verhalten. Ein Vergehen nicht allein gegen die Gebote Gottes, sondern auch gegen die Gesetze, wie sie von Menschen in allen ehrbaren Gemeinschaften auf dieser Welt festgelegt wurden. Würdest du diesen Redshields deiner Nichte vorstellen?«
»Meiner Nichte?«
»Ja, deiner Nichte, der Tochter deiner Schwester in Dundalk, der kleinen Peggy. Sie ist jetzt siebzehn. Und? Würdest du?«
»Nein«, sagte Fergus. »Eins zu null für Sie.«
»Es ist wirklich nicht an dir, den ersten Stein zu werfen«, sagte Father Kinneally. »Ich denke da an das junge Mädchen, das vor kaum einer Stunde dieses Haus verlassen hat, jenes Mädchen, neben dem du heute morgen aufgewacht bist, wie die Natur dich geschaffen hat, dein nacktes Fleisch an ihrem nackten Fleisch, das junge Mädchen, mit dem du deinen Tag begonnen hast, ohne an den Gott über dir oder an die Verdammung zu denken, die deiner harrt. In voller Absicht hast du an diesem Mädchen mit Blicken, Berührungen und Gedanken eine Todsünde begangen, hast ein von Gott geschaffenes Gefäß durch unanständige, lüsterne, unmoralische, fleischliche Taten beschmutzt, die zu schrecklich sind, sie zu erwähnen. Mein Herr, ich will dir sagen, was du bist, du bist ein Sündenpfuhl. Würden wir dich mit einem Messer aufschlitzen, {24}würde der Gestank deiner faulenden Seele von hier bis Cork die Luft verpesten!«
»Was verstehen Sie denn schon davon?« sagte Fergus. »Sie waren doch Ihr Leben lang mit keiner Frau zusammen.«
»Man muß nicht sündigen, um zu wissen, was eine Sünde ist!«
»Gott stehe Ihnen bei«, sagte Fergus. »Wissen Sie was? Sie waren ein verklemmter Schwuler, das waren Sie. Als Erwachsener ist mir das jetzt vollkommen klar. Wenn man sich vorstellt, daß euresgleichen kleine Jungen über Sex aufgeklärt haben. Und da reden Sie von schlechter Gesellschaft!«
»Gott vergebe dir«, sagte Father Kinneally. Er nahm seine Brille ab, zog ein leicht fleckiges, weißes Taschentuch aus dem Ärmel seiner Soutane und putzte sich mit einigem Nachdruck die Nase.
»Ich habe immer geglaubt«, sagte Father Kinneally, »daß du, Fergus, unter all den Jungen, die ich im Laufe der Jahre unterrichtet habe, eine echte Begabung, ein wahres Talent für das Schreiben von Essays besessen hast. In der Abschlußprüfung hast du die außerordentlich hohen Hoffnungen, die ich in dich gesetzt habe, leider nicht erfüllt, dennoch, Fergus, gab ich mir besondere Mühe, dich zu fördern, und ich glaube in aller Bescheidenheit behaupten zu können, wenn du heute einigen Erfolg auf dem Gebiete der Literatur hast, dann ist das, in gewissem Maße, auch mein Verdienst. Oder etwa nicht?«
»Ja, Father. Sie haben recht. Tut mir leid. Aber wissen Sie, ich meine, das Problem ist doch, daß Sie nur eine Halluzination sind, ich bilde Sie mir ein; trotzdem ist es erstaunlich, nicht wahr, daß wir hier stehen und {25}miteinander reden können, als wären Sie wirklich in diesem Zimmer. Mir kommt es fast vor, als könnte ich meine Hand ausstrecken und Sie berühren.«
»Faß mich nicht an!« sagte Father Kinneally äußerst verärgert. »Faß mich nicht an!« Er stieß die Kühlschranktür auf, so daß sie Fergus den Blick auf Father Kinneally versperrte. Fergus griff nach der Tür, und als er sie wieder schloß, war Father Kinneally verschwunden. Statt dessen stand Fergus’ Mutter dort, wo gerade noch der Priester gewesen war, doch war sie nicht mehr so angezogen, wie er sie zuvor gesehen hatte, und auch nicht so, wie Fergus sich an sie erinnerte, sondern sie glich jener jungen Frau, die er nur aus den Familienalben kannte. Sie trug ein schwarzes Kleid und einen schwarzen Glockenhut. Um ihren Hals hing eine lange, geknüpfte Kette aus falschen Perlen. In der linken Hand hielt sie ihr Gebetbuch, als wäre sie gerade aus der Kirche gekommen, und sie trug ein Ansteckbukett aus weißen Nelken, was vermuten ließ, daß sie von einer Hochzeit oder einer Taufe kam. Ihrem vorgewölbten Bauch nach zu urteilen (Fergus hatte sie in ihrem Leben nie so dick gesehen), mußte sie schwanger sein. »Ich bin entsetzt«, sagte seine Mutter. »So mit einem Priester zu reden. Ich hätte nicht übel Lust, dir die Hose runterzuziehen und deinen vier Buchstaben eine kräftige Abreibung zu verpassen.«
»Du hast kastanienbraunes Haar gehabt«, sagte Fergus. »Das hatte ich vergessen. Ich frage mich bloß, warum ich mich jetzt daran erinnere? Bist du schwanger, Mama?«
»Ich muß schon sagen, dein Vater war in dem ersten Jahr nach unserer Heirat wirklich wunderbar zu mir«, sagte seine Mutter. Sie lächelte und schaute, ihren Erinnerungen nachhängend, an Fergus vorbei zum Küchenherd. {26}»Ja, wir sind oft ausgegangen, Tanz, Partys und Theater; ach, wir waren bestimmt vier-, fünfmal die Woche unterwegs. Aber nach dem ersten Jahr haben meine Probleme angefangen. Mit jedem von euch vieren. Ich war ständig in anderen Umständen. Und dann die Fehlgeburten. Von denen hatte ich auch ein paar.«
»Die Geschichte war gegen dich«, sagte Fergus. »Stell dir vor, du würdest erst in – sagen wir – in zwanzig Jahren geboren werden, wenn auch für Katholiken die Geburtenkontrolle erlaubt ist.«
Seine Mutter schaute ihn an und wandte sich dann von ihm ab, wie sie es vor drohenden Krisen so oft getan hatte, und rief: »James? James. Kommst du bitte mal?«
Fergus’ Vater, im braunen Tweedanzug, eine Zigarette im Mundwinkel, trat gelangweilt in die Küche. »Ja, Liebes, was gibt’s?«
»James, ich möchte, daß du mit diesem Jungen ein ernstes Wort redest. Geburtenkontrolle ist eine Todsünde. Kein Katholik sollte davon reden, geschweige denn sagen, was Fergus mir gerade gesagt hat.«
»Was ist? Worum geht’s?« fragte Dr. Fadden.
»Hallo, Daddy«, sagte Fergus. Sein Vater betrachtete ihn mit einem seltsamen Blick. »Wir haben gerade von Geburtenkontrolle gesprochen«, sagte Fergus. »Wußtest du, daß die katholische Kirche heutzutage über die Frage der Geburtenkontrolle in zwei fast gleich große Lager gespalten ist?«
»Blödsinn.«
»Nein, das ist kein Blödsinn. Die Dinge haben sich geändert.«
»Unsinn«, sagte sein Vater. »Wieso auch? Das ist das Gesetz der Kirche, und Kirchengesetze ändern sich {27}nicht. Sie haben sich in zweitausend Jahren nicht geändert.«
»Jetzt ändern sie sich, Daddy.«
»Wer ist der Kerl überhaupt?« fragte Fergus’ Vater, an Fergus’ Mutter gewandt.
»Das ist Fergus, Lieber.«
»Wer?« Sein Vater setzte sich die Brille auf die Nase und starrte Fergus an. »Zu wenig Bewegung«, sagte sein Vater, als würde er ein Selbstgespräch führen. »Etwas Übergewicht, nichts Ernsthaftes. Leichtes Händezittern. Neurasthenischer Typ, kein Handwerker. Aber komische Kleider. Und diese entsetzlichen Schuhe. Guttaperchasohlen. Gummis haben wir die früher genannt.«
»Aber ich sage es dir doch, Liebling«, sagte Fergus’ Mutter. »Das ist unser Fergus.«
»Unser Fergus? Dieser Kerl? So alt?«
»Ich bin neununddreißig«, sagte Fergus. »Du bist seit einundzwanzig Jahren tot.«
»Das ist irgendein Ausländer«, sagte sein Vater zu seiner Mutter. »Ein Yankee, würde ich meinen.«
»Stimmt, er ist nach Amerika gegangen«, sagte Fergus’ Mutter. »Er ist nach deinem Tod ausgewandert, Liebling.«
»Nach Amerika?« Sein Vater schüttelte den Kopf. »Ach, das glaube ich nicht, doch keiner aus unserer Familie. Du weißt ja, was sie auf dem Land sagen – Nur die wirklich schlimme Sorte muß übers Wasser nach Amerika – hast du den Spruch noch nie gehört, Liebling? Unten in der Grafschaft Louth ist er weit verbreitet. Und es steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin, wenn es stimmt, was man so von den Amerikanern irischer Abstammung liest. Preisboxer und was weiß ich.«
»Was ist mit Präsident Kennedy?« fragte Fergus.
{28}»Wie bitte? Ich habe den Namen nicht verstanden.«
»Kennedy. John F. Kennedy.«
»Ist das Ihr Name?« fragte sein Vater.
»Nein, James, ich habe es dir doch schon erklärt. Das ist Fergus, unser zweiter Sohn.«
Sein Vater ließ den Kneifer von der Nase fallen, der am schwarzen Seidenbändchen herabstürzte und sich dann wie ein Jo-Jo um die eigene Achse drehte. »Hm«, sagte sein Vater. »Was wohl aus Jim geworden ist?«
»Jim hat eine Praxis in Belfast«, sagte Fergus’ Mutter.
»Tritt in meine Fußstapfen, wie?« sagte Dr. Fadden. »Chirurgie, möchte ich wetten.«
»Nein. Nur eine allgemeine Praxis«, sagte Fergus.
»Aber die läuft gut«, sagte Fergus’ Mutter.
»Ein praktischer Arzt?« sagte Dr. Fadden. »Warum hat er sich nicht spezialisiert?«
»Dazu fehlte ihm das Geld, James. Ich war ziemlich arm dran, als du von uns gegangen bist.«
»Blödsinn. Mich hat Geldmangel nie aufgehalten. Schließlich gibt es Stipendien. Bewirb dich, und du kannst deine Ausbildung finanzieren. Ich hab’s auch geschafft. Und zu meiner Zeit war das weit schwieriger als heute, das kann ich dir sagen. Aber meine Studiengebühren habe ich selbst bezahlt. Jeden verdammten Penny.«
»Ich weiß«, sagte Fergus. »Himmel noch mal, und ob ich das weiß!«
Sein Vater hustete, nahm die Zigarette aus dem Mund und suchte nach einem Aschenbecher. Fergus stellte ihm einen hin.
»Da wir gerade von Fergus reden«, sagte sein Vater. »Manchmal frage ich mich, was aus diesem Jungen noch werden soll.«
{29}»Falls es dich interessiert …«, begann Fergus.
»Unterbrich deinen Vater nicht immer!« warnte ihn Fergus’ Mutter.
»Ja, um den Jungen mach ich mir Sorgen«, sagte Fergus’ Vater. »An Verstand fehlt’s ihm nicht, er setzt ihn nur nicht vernünftig ein. Besteht der seine Abschlußprüfung nicht, das muß man sich mal vorstellen! Tz, tz, tz! Zu meiner Zeit mußte es mindestens eine Auszeichnung sein. Selbst wenn ich ein Lob bekam – und das war immerhin besser, als einfach nur zu bestehen –, hatte ich das Gefühl, ziemlich schlecht abgeschnitten zu haben.«
»Aber er hat sich gut gemacht, Liebling«, sagte Fergus’ Mutter.
»Natürlich habe ich mich gut gemacht«, sagte sein Vater.
»Du doch nicht, Liebling. Fergus. Er ist Journalist geworden und Schriftsteller. Er hat zwei Romane geschrieben. Man hält ziemlich viel von ihm.«
»Aha«, sagte Dr. Fadden. »Kannst du dich noch an die Brosche erinnern, die ich dir geschenkt habe? Die aus meiner Goldmedaille? Die Medaille habe ich damals in der Schule gewonnen, der erste Preis von ganz Irland für einen Schulaufsatz der Oberklassen.«
»Ja, Liebling. Aber wie ich schon gesagt habe, aus Fergus ist ein richtiger Schriftsteller geworden.«
»Hm«, sagte sein Vater. »Na ja. Kann er damit denn Geld verdienen?«
»Ihm scheint es gar nicht schlecht zu gehen.«
»Das bezweifle ich«, sagte sein Vater. »Ich kenne einige Schriftsteller. Nimm zum Beispiel John O’Hare, ein Mann, den man einen echten Literaten nennen könnte. Ich weiß noch, wie John gesagt hat, daß es sehr, sehr {30}schwierig sei, vom Schreiben zu leben. John hat an der Schule unterrichtet. Mußte er.«
»John O’Hare«, sagte Fergus. »Ein zehntklassiger Schundkrämer, der sentimentale Artikelchen für die Irish Mail schrieb. Das soll ein Schriftsteller sein?«
»Irgendwo muß ich noch zwei Bücher von John haben«, sagte Dr. Fadden. »Ulsters schöne alte Zeit zum Beispiel. An den Titel von dem anderen Buch kann ich mich nicht mehr erinnern. Sind beide mir gewidmet. Er war einer meiner Patienten.«
»Aber ich bin ein richtiger Schriftsteller, Daddy. Weißt du, mein Name steht im Who’s Who!«
»Da stehen auch die Namen von einer ganzen Reihe von Gaunern drin«, sagte sein Vater. »Wer schreibt denn das Who’s Who, na? Und was heißt das schon? Nichts als britische Hochnäsigkeit und Kungelei, wenn du mich fragst. Dabei gibt es weit mehr Namen guter Leute, die nicht drinstehen, als Namen guter Leute, die drinstehen. Stimmt’s?«
»Zugegeben«, sagte Fergus. »Aber trotzdem. Ich dachte, es würde dich freuen, daß ich Schriftsteller geworden bin. Ich weiß noch, wie du dich gefragt hast, ob ich überhaupt zu irgendwas tauge.«
Sein Vater wandte sich von ihm ab und blickte durch die Glastür auf das Meer. Wie in Zeitlupe rollten die weißen Wellen heran und brachen sich am Strand. »Ja«, sagte sein Vater. »Ja, ich habe mir Sorgen um dich gemacht.«
»Aber du hättest dir keine Sorgen zu machen brauchen«, sagte Fergus. »Der Observer – ich weiß noch, daß du immer auf den Observer geschworen hast. Nun, der Observer hat eine sehr gute Besprechung über mein letztes Buch gebracht.«
{31}»Der Observer, ja?« sagte sein Vater, kehrte der Glastür wieder den Rücken und lächelte Fergus’ Mutter an. »Hast du das gehört, Liebes?«
»Ja, Liebling, das ist doch sehr gut, nicht wahr?«
»Erstklassig«, sagte Dr. Fadden. »Unser Fergus, das ist aber eine Überraschung.«
»Ich will mich nicht loben, Daddy, aber … Nein, stimmt nicht, ich will mich loben. Vor allem, weil du in dem Glauben gestorben bist, daß ich ein Versager bin. Ich habe zwei Romane geschrieben. Der letzte wurde in sechs Ländern veröffentlicht. Und davor habe ich in New York für all die landesweiten Zeitschriften Artikel geschrieben. Auch für die englischen. Für die Wochenzeitungen, weißt du? Den New Statesman, den Spectator und so weiter.«
»Na, ich schätze, das hast du von meiner Familie«, sagte sein Vater. »In Englisch warst du immer schon gut, daran kann ich mich erinnern. Weißt du, ich habe selbst auch ein, zwei Sachen geschrieben, aber glaube nicht, ich mache mir über meine Stellung als Literat irgendwelche Illusionen. Ich weiß allerdings noch, daß mich die Herausgeber vom Michanian aus Anlaß der Hundertjahrfeier des St. Michan’s Colleges gebeten haben, etwas für ihre Zeitung zu schreiben. Ich habe damals eine Denkschrift für Alec Hickey verfaßt, einen unserer brillantesten Zöglinge und einen Freund meiner Kindheit. Und als Bischof Malone in den Ruhestand trat, habe ich seine Verdienste in der Irish Mail gewürdigt. Und im Practitioner