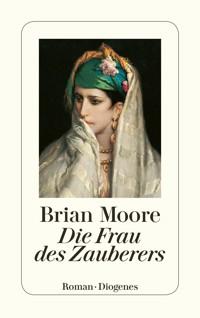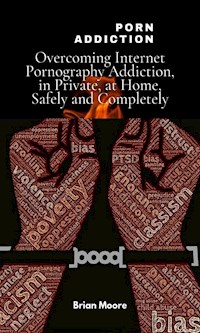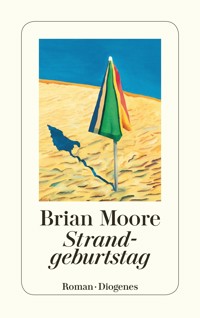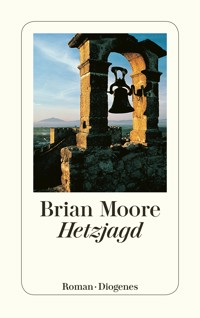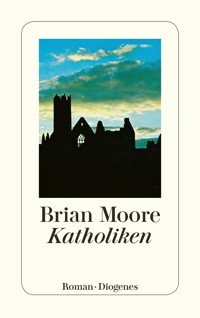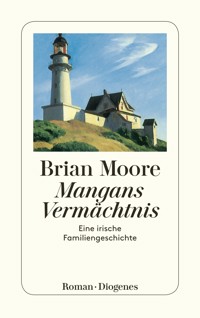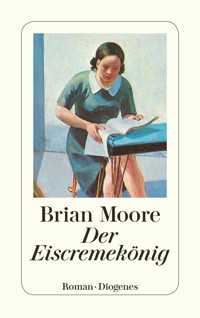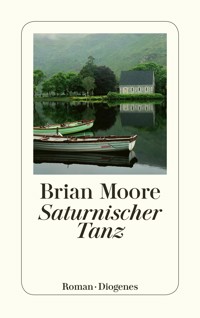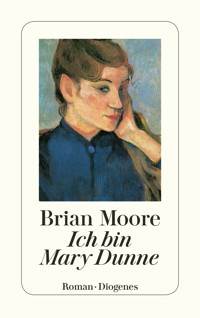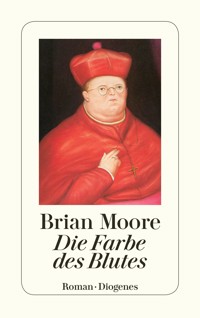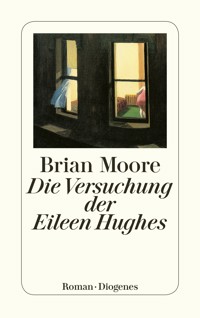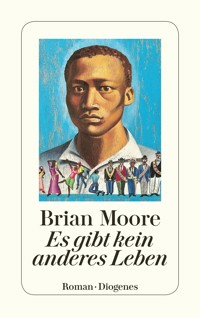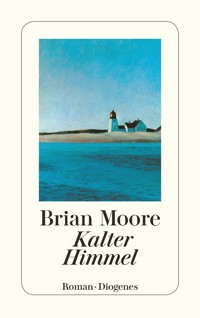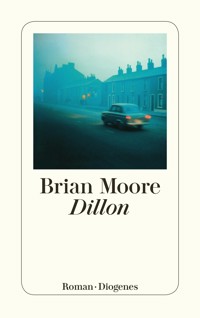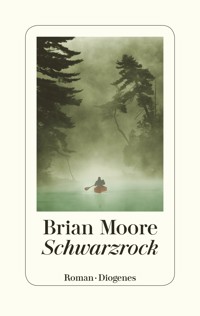
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Père Laforgue kommt als Jesuit in die Neue Welt, um unter Lebensgefahr »Wilde« zu missionieren. Doch je länger er das Leben der Indianer teilt, desto mehr begreift er sie. Die gemeinsame Fahrt den Sankt-Lorenz-Strom hinauf gen Norden, durch Feindesland, dem Winterlager entgegen, wird zur Bewährungsprobe. Mit genau recherchierten Details lässt Brian Moore das frühe 17. Jahrhundert plastisch werden. Ein atemlos spannender Abenteuerroman, basierend auf Augenzeugenberichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Brian Moore
Schwarzrock
Roman
Aus dem Englischen von Otto BayerMit einem Nachwort von Julian Barnes
Diogenes
Für Jean
Vorwort des Verfassers
Vor ein paar Jahren stieß ich in Graham Greenes Sämtlichen Essays auf seine Ausführungen über The Jesuits in North America in the Seventeenth Century, das gerühmte Werk des amerikanischen Historikers Francis Parkman (1823–1893). Greene zitiert den folgenden Absatz:
(Pater) Noël Chabanel kam später in die Mission, da er erst 1643 im Huronenland eintraf. Er verabscheute die Lebensweise der Indianer – den Rauch, das Ungeziefer, die eklige Nahrung, die Unmöglichkeit, sich zurückzuziehen. An ihren rauchenden Holzfeuern, umgeben von lärmenden Männern und Squaws mit ihren Hunden und den unablässig kreischenden Kindern konnte er sich nicht konzentrieren. Er hatte von Natur aus nicht die Gabe, ihre Sprache zu erlernen, und mühte sich fünf Jahre ohne nennenswerte Fortschritte mit ihr ab. Da flüsterte ihm der Teufel ins Ohr, er möge um Ablösung von dieser tristen, widerwärtigen Mühsal bitten und nach Frankreich zurückkehren, wo ihn eine ihm gemäße und nützliche Arbeit erwarte. Chabanel wollte davon nichts hören, und als die Versuchung ihn weiter plagte, tat er ein feierliches Gelübde, bis zu seinem Todestag in Kanada zu bleiben.
»Ein feierliches Gelübde.« Da spricht zu uns eine Stimme unmittelbar aus dem 17. Jahrhundert, die Stimme eines Gewissens, wie wir es heute wohl leider nicht mehr besitzen. Ich begann in Parkmans großem Werk zu lesen und entdeckte als seine Hauptquelle die Relations, jene langen Berichte der Jesuiten an ihre Oberen in Frankreich. Von Parkman wechselte ich über auf die Relations selbst, und in ihren bewegenden Schilderungen entdeckte ich eine unbekannte, ungeahnte Welt. Denn anders als die englischen, französischen und holländischen Händler kamen die Jesuiten nicht der Pelze und Eroberungen wegen nach Nordamerika, sondern um die Seelen derer zu retten, die sie »les sauvages« nannten – die Wilden.1
Um das zu vollbringen, mussten sie die an unflätigen Ausdrücken oft überreichen Sprachen der ›Wilden‹ lernen und ihre Religions- und Stammesbräuche studieren. Ihre Briefe, die einzigen wirklichen Berichte über die frühen Indianer Nordamerikas, machen uns mit einem Volk bekannt, das mit den »Rothäuten« aus Literatur und Folklore wenig Ähnlichkeit hat. Die Huronen, Irokesen und Algonkin waren schöne, tapfere und unvorstellbar grausame Menschen und in dieser frühen Phase noch in keiner Weise abhängig vom »Weißen Mann«, dem sie sich sogar körperlich und geistig überlegen dünkten. Sie waren kriegerisch, praktizierten rituellen Kannibalismus und unterwarfen aus religiösen Gründen ihre Feinde langen und untragbaren Martern. Dagegen war es ihnen als Eltern unerträglich, ihre ungebärdigen Kinder zu schlagen oder zurechtzuweisen. Sie waren lebensfroh und polygam und teilten mit Fremden sexuelle Freuden ebenso freigebig wie Essen und Herd. Sie verachteten die »Schwarzröcke«, weil sie Besitztümer horteten. Ebenso verachteten sie die Weißen wegen ihrer Dummheit, weil sie nicht erkannten, dass Erde und Flüsse und Tiere und alles Übrige von einem lebendigen Geist beseelt waren und Gesetzen gehorchten, die es zu achten galt.
Anhand der Werke von Anthropologen und Historikern, die vieles den frühen Jesuiten Unbekanntes über indianische Verhaltensweisen zusammengetragen haben, wurde mir doppelt bewusst, welch einzigartige und ergreifende Tragödie sich zugetragen haben muss, als der Indianerglaube an eine Welt der Nacht und die Macht der Träume mit der jesuitischen Verkündigung des Christentums und eines Paradieses nach dem Tod zusammenprallte. Dieser Roman will zeigen, wie der Glaube des jeweils einen bei dem anderen Angst, Feindseligkeit und Verzweiflung weckte, welche später zur Zerstörung und Aufgabe der Jesuitenmissionen führten und die Unterwerfung der Huronen durch die Irokesen, ihre Todfeinde, zur Folge hatten.
Während viele der in diesem Buch enthaltenen Informationen über Sitten, Glauben und Sprache der »Wilden« ebenso wie der Jesuiten aus den Relations stammen, bin ich darüber hinaus auch anderen Quellen verpflichtet: Ich danke James Hunter, dem Forschungskurator von Sainte Marie Among the Hurons, sowie Bill Byrick, Professor Bruce Trigger von der McGill University und Professor W.J. Eccles vom College of William and Mary für ihre Hilfe in allerlei Fragen.
Dank schulde ich auch dem Conseil des Arts du Canada, der mir die Möglichkeit verschaffte, Orte in Kanada aufzusuchen, an denen Zeugnisse der Geschichte und des Brauchtums der Irokesen, Algonkin und Huronen aufbewahrt werden, sowie die Örtlichkeiten früherer Irokesen- und Huronensiedlungen, vor allem das Städtchen Midland in Ontario, wo die Regierung Ontarios originalgetreue Langhäuser, ein Indianerdorf und die erste dort errichtete Jesuitenmission rekonstruieren ließ.
Erster Teil
1
Laforgue fühlte, wie er am ganzen Körper zitterte. Was kann sie so lange aufhalten? Hat der Kommandant abgelehnt? Warum hat er noch nicht nach mir geschickt? Ist das Gottes Strafe für die Lüge wegen meines Gehörs? Aber das war keine Lüge; meine Absicht war ehrenhaft. Oder ist das Sophisterei? Stecke ich so tief im Sumpf meines Ehrgeizes, dass ich Wahrheit nicht mehr von Falschheit unterscheiden kann?
Wohl schon zum hundertsten Mal machte der Posten, der vor der Kommandantur Wache schob, wieder kehrt und schritt die Mauer des Forts entlang. Laforgue hörte Stimmen. Er sah den steilen Pfad hinunter, der zu den Holzhäusern der Siedlung führte. Zwei Männer kamen herauf. Der eine, ein Offizier, hatte den Schlapphut tief in die Stirn gezogen, und seine Uniform war weiß von Staub. Als Laforgue das Gesicht des zweiten Mannes erkannte, erfasste ihn ein plötzliches Unbehagen. Vor einem Monat war dieser Mann, ein Pelzhändler namens Massé, aus der stinkigen Kneipe, in der die Händler zu trinken pflegten, herausgestürzt gekommen und hatte Laforgue obszöne Beleidigungen nachgerufen. Es ging dabei um ein Wildenmädchen, mit dem Massé schlief und das Laforgue seit kurzem im Glauben zu unterweisen versuchte.
Um weiteren Kränkungen jetzt aus dem Weg zu gehen, zog Laforgue sich tiefer in den Schatten der Mauer zurück. Dabei blickte er wieder zur Kommandantur hinauf. In einem Fensterrahmen sah er das Gesicht Champlains.
Der Kommandant, der am Fenster saß, sah einen breitkrempigen Priesterhut und Père Laforgues blasses, bärtiges Gesicht darunter. Er sah an der einsamen Gestalt des Klerikers vorbei zu dem hundert Meter tiefer gelegenen Gewimmel von Holzhäusern, der Siedlung Québec. Wie auf einem Gemälde wanderte sein Blick weiter zur Biegung des großen Flusses, wo vier französische Schiffe vor Anker lagen. In einer Woche würden sie nicht mehr da sein.
Hinter sich hörte er den Superior hüsteln, eine respektvolle und doch ungeduldige Ermahnung. »Ihr sagtet soeben, Monsieur le Commandant –?«
»Ich sagte, es ist spät im Jahr. Erklärt ihnen das.«
Père Bourque, der Jesuit, dolmetschte für die Wilden. Chomina, der ältere von ihnen, hatte sich den Kopf geschoren und nur einen schmalen Haarkamm in der Mitte übrig gelassen, der sich sträubte wie auf dem Rücken eines Igels. Sein Gesicht war wie eine Maske aus weißem Ton. Der Jüngere, ein Häuptling namens Neehatin, hatte sich zur Feier des Tages mit ockergelben Ringen um die Augen und einer leuchtend blauen Nase geschmückt. Beide beobachteten Champlain wie ein unberechenbares großes Tier. Als der Jesuit geendet hatte, ergriff der jüngere Wilde das Wort. Champlain wandte ihm das Gesicht zu wie ein Tauber, der von den Lippen zu lesen versuchte. In all den Jahren hatte er, der Gründer dieser Kolonie, die Sprache der Wilden nicht gelernt.
»Er fragt, ob Agnonha nicht mehr wünscht, dass sie die Franzosen mitnehmen«, übersetzte Père Bourque.
»Warum fragt er das?«
»Vermutlich fürchten sie, dass Ihr ihnen die geforderten sechs Musketen nicht gebt. Wie Ihr wisst, Exzellenz, haben sie uns nur deswegen ihre Hilfe angeboten.«
Champlain lächelte den Wilden an. »Sagt ihm, Agnonha ist dankbar für sein Hilfsangebot. Sagt ihm, dass Agnonha ausnahmsweise bereit sein könnte, ihm Musketen als Geschenke anzubieten. Aber sagt ihm auch, welche Sorge ich habe: Die Reise hätte zu ihrem Gelingen schon drei Wochen früher beginnen müssen.«
»Mit Verlaub«, sagte Père Bourque, »ich glaube, die Zeit reicht noch, um die Mission Ihonatiria zu erreichen. Wie Ihr wisst, habe ich die Reise selbst schon zweimal gemacht.«
Champlain betrachtete die schwarze Soutane des Paters und fühlte sich respektlos an den Rock eines Schuljungen erinnert. Die Reise, von der du sprichst, mon Père, habe ich gemacht und kartographiert, als du noch zur Schule gingst. Was weißt du über diese Zeit? Und was glaubst du, wozu die Wilden Musketen haben wollen? Nicht zum Jagen, sondern um ihre Feinde zu töten.
»Es geht nicht nur um den Wintereinbruch«, sagte er zu dem Jesuiten. »Da ist noch die andere, größere Gefahr. Über die haben wir noch nicht gesprochen.«
Der Jesuit neigte den Kopf. »Die Reise liegt, wie unser aller Leben, in Gottes Hand.«
»Aber wenn die Mission nicht mehr steht? Wenn Laforgue dort ankommt und die beiden Patres tot vorfindet?«
»Über diese Brücke werden wir gehen, wenn wir hinkommen.«
Champlain befingerte seinen ergrauenden Bart, eine Geste, mit der er seine Verärgerung ausdrückte. »Nicht wir«, sagte er. »Über diese Brücke muss Père Laforgue gehen. Ich kenne ihn nicht näher, aber er hat derlei Strapazen sicher noch nicht erlebt.«
»Möchtet Ihr ihn befragen, Exzellenz? Ich habe ihn mitgebracht. Er wartet draußen.«
»Was hätte ich davon? Ich sage, er hat keine Erfahrung auf dem großen Fluss.«
»Meines Erachtens«, sagte der Jesuit, »ist er der Aufgabe gewachsen. Er ist ordiniertes Mitglied der Gesellschaft Jesu, und der Orden hat seine Fähigkeiten sorgfältig geprüft.«
»Ihr redet von Prüfungen, die in Frankreich vorgenommen wurden. Ich rede von Gefahren und Entbehrungen, von denen die Gesellschaft Jesu sich nichts träumen ließ.«
»Mit Verlaub«, sagte Père Bourque, »es gibt wenige Gefahren, denen unsere Brüder in den verschiedensten Ländern der Erde noch nicht begegnet sind.«
Champlain sah zu den beiden Wilden hinüber, die auf dem Boden saßen, die Knie in Kopfhöhe. Bei ihnen galt es als ungezogen, sich im Stehen zu beraten, und während Champlain peinlich darauf geachtet hatte, dass er sitzen blieb, war der Jesuit unbedacht im Zimmer umhergegangen. »Der junge Mann, den Ihr mitschicken wollt, ist noch keine zwanzig, fast noch ein Kind«, sagte Champlain.
»Stimmt. Aber er ist ein außergewöhnlicher junger Mann.«
»Inwiefern außergewöhnlich, mon Père?«
»Er wurde als Arbeiter hierhergeschickt, aber mit den höchsten Empfehlungen. Er ist fromm und gewissenhaft. Sein Onkel, ein Priester, hat ihn Latein gelehrt, und er ist bei den Récollet-Patres in Rouen in die Schule gegangen.«
»Mit Latein kommt er auf dem großen Fluss nicht weit.«
»Das nicht. Aber er ist hochintelligent und anpassungsfähig. Als ich sein Sprachtalent entdeckte, habe ich ihn eine Zeit lang zu den Aalfischern der Algonkin geschickt. Nach einem Jahr beherrschte er die Sprachen der Algonkin und der Huronen.«
Champlain hörte ein plötzliches Krachen. Es kam von einer Holzschale, die auf den Boden geschlagen wurde. Die Wilden hatten zu spielen angefangen; bei dem Spiel schüttelten sie die Holzschale und betrachteten die Pflaumenkerne darin. Die Kerne waren auf der einen Seite schwarz, auf der andern weiß bemalt, und es kam darauf an, die in der Schale dominierende Farbe zu erraten. »Père Bourque, wir unterhalten uns schon zu lange in unserer Sprache«, sagte er. »Sie sind es leid geworden.«
»Richtig. Ich bitte um Entschuldigung.«
Wieder knallte die Schale auf den Boden. Champlain fühlte von neuem diese Taubheit in seinem Arm emporkriechen. Wird dies mein letzter Winter sein? Werde ich nie mehr Richelieus flammendrote Robe auf der Galerie des Palais de Justice auf mich zukommen sehen, vorbei an allen, die sein Ohr suchen? Ich verneige mich, um seinen Ring zu küssen; er lächelt mich an: ein Lächeln, das die Gedanken des Lächelnden nicht preisgibt. Wen wird er als Ersatz für mich hierher entsenden? Und was würde er zu diesem Ansinnen sagen: einen Priester und einen Jüngling in den fast sicheren Tod reisen zu lassen, um vielleicht einen kleinen Vorposten Frankreichs und des Glaubens zu retten? Bei der Landnahme sind Menschenleben die Währung.
Er hatte seine Antwort. Lächelnd sah er in die bemalten Gesichter.
»Sechs Musketen, nicht mehr. Sagt ihnen das.«
Der wartende Laforgue sah endlich den Superior und die Wilden aus der Kommandantur kommen.
Ja oder nein? Warum hat man nicht nach mir geschickt? Rasch ging er unterhalb der Mauer entlang und zügelte seinen Drang, in Laufschritt zu verfallen. Der Superior passierte die Wache und wollte sich an die Wilden wenden, doch sie, bei denen es nicht Sitte war, sich förmlich zu verabschieden, gingen einfach ihrer Wege. Sie benutzten nicht den Weg zur Siedlung hinunter, sondern schlugen den rauheren Pfad zu ihrem Lager ein.
Père Bourque sah sich um, als er Laforgues Schritte hörte. »Ah, da seid Ihr ja«, sagte er. »Kommt, wir müssen uns beeilen.«
Er ging ohne anzuhalten weiter. Laforgue, in der Gehorsamsregel geübt, stellte die Frage nicht, die ihn verzehrte, sondern nahm hinter ihm Schritt auf. Sie begegneten dem Offizier und Massé, die auf dem Weg nach oben waren und sich respektvoll vor dem Superior verneigten. Massé sah Laforgue nicht an. Schweigend gingen die beiden Patres weiter zu dem Steg, an dem ihr Kanu lag. Père Bourque wartete, während Laforgue die Leine losmachte, sich seine Holzschuhe um den Hals hängte, um den dünnen Bootsboden aus Birkenrinde nicht zu beschädigen, und vorsichtig in das Kanu stieg, das er dabei am Steg festhielt. Père Bourque zog ebenfalls seine Holzschuhe aus und stieg vorn ein, und Laforgue paddelte das Boot im Knien, wie er es von den Wilden gelernt hatte, vorsichtig auf den Fluss hinaus. Er lenkte es zu einem Nebenarm, der zur Mission der Jesuiten weiter flussabwärts führte. Jetzt nahm auch Père Bourque sein Paddel zur Hand. Gleichmäßig paddelten sie zum andern Ufer des Nebenarms, wo ein Rechteck hölzerner Palisaden die beiden Gebäude der Station umschloss. Laforgue wusste, dass der Superior sich ein Bild von seinen Fähigkeiten machen wollte, und richtete sich genau in dem Moment auf, als das flinke Kanu ans Ufer glitt, sprang auf den Anlegesteg, fing geschickt den Bug und holte ihn ein.
»Wo ist Daniel?«, fragte Père Bourque beim Aussteigen.
»Ich glaube, sie arbeiten alle am Vorratshaus.«
»Alle?« Der Superior wartete keine Antwort ab, sondern schlug den schmalen Pfad zur Station ein. Als sie durch das hohe Gras vor den Palisaden gingen, fiel eine Wolke von Mücken über sie her, und sie eilten geduckt und um sich schlagend halb im Laufschritt zum Eingangstor. »Geht Daniel suchen und bringt ihn zu mir«, sagte der Superior.
Sie trennten sich hinter dem Tor. Père Bourque trat in das eingeschossige Haupthaus; es war aus Brettern gebaut und mit Lehm beworfen, das Dach mit Gras gedeckt. Laforgue eilte zu dem zweiten Gebäude, das die Engländer vor ein paar Jahren halb niedergebrannt hatten und Arbeiter der Jesuitenmission zurzeit reparierten. Im Näherkommen hörte er Hämmern und Lachen; jemand rief etwas auf Bretonisch. Laforgue tauchte, immer noch auf der Flucht vor den Mückenschwärmen, unter dem als Tür dienenden Vorhang durch. Bei seinem Eintreten verstummte das Lachen und Hämmern, und die Männer im Gebälk und an den Werkbänken sahen schweigend zu ihm her.
»Was gibt es Neues, mon Père?«
Der Zimmermeister hatte die Frage gestellt, doch Laforgue sah zu Daniel Davost, der ein Brett in der Hand hielt und den Mund voller Nägel hatte.
»Noch nichts«, sagte Laforgue. »Aber Père Bourque möchte Daniel sprechen, sofort.«
»Dann fahrt Ihr«, sagte der Zimmermann, und die anderen tauschten Blicke. Sie alle missbilligten es, dass die Patres so einen jungen Burschen auf so eine gefährliche Reise schickten. Und als Daniel und Laforgue sich jetzt entfernten, gaben sie ihrem Unmut laut Ausdruck, aber auf Bretonisch, weil Laforgue das nicht verstand.
»Was sagen sie, Daniel?«
»Nichts, mon Père. Sie machen nur Scherze.«
Halb erstickend unter den Mückenschwärmen, rannten sie zum Haupthaus, das sie durch die Kapelle betraten, einen kleinen Raum mit nichts darin als einem Holzaltar, den zwei Tücher bedeckten; auf dem einen war der Heilige Geist in Gestalt einer Taube dargestellt, auf dem anderen die Jungfrau Maria. Durch die Kapelle kam man ins Refektorium, in dem die Patres auch arbeiteten. Hinter der Tür saßen zwölf Wilde, Männer und Frauen, im Halbkreis auf dem Boden. Sie rührten sich nicht, als Laforgue und Daniel eintraten, sondern starrten gebannt auf eine Uhr, die auf dem Tisch des Refektoriums stand. Ihre ungewaschenen Körper und fettigen Haare verbreiteten einen scharfen, üblen Gestank im Raum. Nebenan in der Küche arbeiteten die Patres Bonnet und Meynard und ein Laienbruder.
»Hier bringe ich Daniel, mon Père«, sagte Laforgue.
Der Superior, der am Refektoriumstisch saß und arbeitete, drehte sich um und wies auf die Uhr. Die Zeiger standen auf zwei Minuten vor vier. Laforgue nickte zum Zeichen, dass er verstanden hatte. Alle warteten und beobachteten schweigend die Uhr.
Anders als die Wilden, die den Kommandanten besucht hatten, waren diese hier nicht bemalt. Sie trugen ihre normale Sommerkleidung, die bei den Männern nur aus einem Lendenschurz bestand, während die Frauen sittsam genug in langen Kleidern aus Tierhäuten steckten. Alle starrten vor Schmutz, ihre Haare waren verfilzt und gespickt mit Essensresten, die Haut gegen Fliegen und Mücken eingefettet. Und dennoch wirkten sie mit ihren schlanken Körpern, die keinerlei Missbildungen aufwiesen, und den haarlosen Gesichtern schöner und wie zu einer höheren Spezies gehörig als die Priester der Mission.
Als die Zeiger sich jetzt auf vier Uhr zubewegten, stand einer der Wilden auf, ging einmal um die Uhr herum und dann in die Kapelle, um nachzusehen, ob sich dort jemand versteckt hielt. Zufrieden kam er zurück und nickte den andern zu. Die Patres in der Küche stellten ihre Arbeit ein und verstummten. Alle warteten in völliger Stille, in der nur das Ticken der Uhr zu hören war.
Dong! Dong! Dong! Dong!, schlug die Uhr. Beim vierten Schlag rief der Superior: »Halt!«
Das Schlagwerk verstummte; man vernahm wieder das gleichmäßige Ticken. Mit einem Aufschrei des Staunens und Entzückens begannen die Wilden aufeinander einzureden, als hätten sie soeben ein Wunder miterlebt. Der älteste von ihnen ergriff das Wort: »Seht ihr, ich habe es euch gesagt, ihr Hasenärsche. Der Häuptling lebt. Der Häuptling hat gesprochen. Ich habe es euch gesagt. Er hat gesprochen.«
Die Wilden grinsten und wechselten vergnügte Blicke. »Hundescheiße!«, rief eine alte Frau lachend. »Was hat er denn gesagt?«
Alle sahen den Superior an, der von dem Brief aufblickte, an dem er gerade schrieb. »Er hat gesagt, dass es Zeit zum Gehen ist«, antwortete Père Bourque in ihrer Sprache. »Er hat gesagt: ›Steht auf und geht nach Hause.‹«
Die schwatzende Abordnung der Wilden erhob sich unverzüglich. Schüchtern näherten sie sich der Uhr und beäugten sie von allen Seiten, aber anzurühren wagte sie keiner. Dann verließen sie, wie befohlen, einer nach dem andern das Refektorium durch die Kapelle und gingen zur Vordertür hinaus, die Père Bonnet ihnen zum Abschied aufhielt.
Daniel Davost hörte den Riegel einschnappen, als Père Bonnet die Tür schloss; wie eine Kerkertür. Er sah die Patres von ihren Arbeiten kommen und sich im Refektorium versammeln. ›Jetzt wird es bekanntgegeben.‹ Ihn schauderte, als hätte die Tür ein Verlies verschlossen, aus dem es kein Entrinnen gab. ›Was mache ich, wenn die Reise abgesagt wird? Die Algonkin werden sich am Fluss versammeln und im Morgengrauen aufbrechen. Sie ist bei ihnen; sie kniet in Chominas Kanu, den Kopf gesenkt, ein Paddel in der Hand. Sie schaut nicht zurück, denn in ihrem Leben gibt es keinen Abschied. Als ich gestern Nacht in unserm stickigen Zimmer lag, mit zwölf schnarchenden Arbeitern über mir und um mich herum, habe ich Jesus ins Gesicht gespien, ich, der ich einmal rein war, aber jetzt nicht zur Ehre Gottes auf diese Reise gehen will, sondern aus dem niedrigsten und sündigsten aller Gründe.‹
Er sah zum Superior, der immer noch an seinem Brief schrieb. Seine Angst steigerte sich zur Panik. ›Was tue ich, wenn die Reise abgesagt wird? Dann reiße ich aus.‹
Père Bourque schrieb und schrieb. Eilig füllte sein Federkiel Blatt um Blatt, denn sein Bericht sollte so vollständig wie möglich sein. Der Orden wollte es so. In den letzten paar Tagen hatte er jeden freien Augenblick daran gearbeitet, denn nächste Woche stachen die Schiffe in See. Der Pater Provinzial würde für eine weite Verbreitung dieses Berichts unter den Gläubigen und den Mächtigen sorgen, damit Gelder flossen und Freiwillige sich dem Werk der Seelenrettung verschrieben. In säuberlicher Handschrift führte Père Bourque gerade das Thema aus, dem seine größte Sorge galt.
Vor zwei Wochen kam ein von Père Brabant im Glauben getaufter Wilder aus dem Huronenland hierher. Ihongwaha, wie der Wilde mit Namen heißt, überbrachte uns einen Brief von Père Brabant, der die Wilden im Gebiet Ossossané betreut. Er enthielt eine Bitte an uns, so bald wie möglich Ersatz für Père Jérôme zu schicken, der im Norden des Landes, an einem Ort namens Ihonatiria, erkrankt ist. Wie Père Brabant auch schreibt, hat sich jetzt ein Fieber in dem ganzen Gebiet ausgebreitet, und die Zauberer der Huronen bezichtigen die ›Schwarzröcke‹ (unsere Patres), ihnen diese Krankheit gebracht zu haben. Père Brabant schreibt, dass ein als Christ getaufter Wilder aus Ihonatiria nach Ossossané gekommen sei und die Nachricht überbracht habe, die Häuptlinge hätten sich beraten und Père Jérôme mitteilen lassen, dass sie nichts dagegen hätten, wenn es ihren jungen Kriegern einfiele, ihm und Père Duval, seinem Gehilfen, eine Axt in den Schädel zu hauen. Père Brabant schreibt, da das Fieber auch sein eigenes Gebiet heimsuche, sei es ihm nicht möglich, selbst in den Norden zu reisen und sich Gewissheit über das Schicksal der Patres zu verschaffen. Er bittet uns, sofort einen Priester zu schicken, der im Falle, dass Père Jérômes Krankheit sich als tödlich erwiesen hat oder er und Père Duval zu Märtyrern wurden, die Mission Ihonatiria weiterführt. Die Nachricht hat uns aufgewühlt, und wir haben den Sieur de Champlain gebeten, uns zu helfen und eine Jägergruppe der Algonkin zu überreden, einen unserer Patres mit auf ihre jährliche Reise zu den Winterjagdgründen zu nehmen und ihm Paddler zur Verfügung zu stellen, die ihn bis über die Großen Schnellen begleiten, von wo ihm die Allumette weiterhelfen werden. Und so haben wir unter der gütigen Mithilfe des Sieur de Champlain beschlossen –
»Père Bourque?«
Der Superior sah auf. Das Refektorium war jetzt von den Priestern der Mission gefüllt, und auch der junge Daniel Davost war da. Der Superior löschte das Geschriebene mit etwas Sand ab, stand auf, wandte sich den Versammelten zu und machte das Kreuzzeichen. »Lasset uns beten«, sagte er, und als das lateinische Gebet beendet war, bekreuzigte er sich noch einmal. »Wir haben unseren Dank gesprochen, denn es hat Gott gefallen, unsere Bitte zu erhören.«
Sogleich ging erregtes Gemurmel durch den Raum. »Ja«, sagte Père Bourque. »Der Kommandant hat sich mit den geforderten Geschenken für die Wilden einverstanden erklärt, unter anderem sechs Musketen mit etwas Pulver und Blei. Er wird auch das übliche Abschiedsfest geben. Père Bonnet?«
»Ja, mon Père?«
»Wir werden unseren Beitrag zu diesem Fest leisten. Ihr werdet das mit dem Koch der Garnison besprechen. Und nun nehmt bitte Platz, alle.«
Gehorsam nahmen die Versammelten ihre Plätze um den Tisch des Refektoriums ein. »Wir müssen jetzt besprechen, was für Vorbereitungen zu treffen sind und was in den Kanus mitgenommen werden kann«, sagte der Superior. »Da Ihr von oberhalb der Großen Schnellen, wo die Algonkin Euch allein lassen werden, mit höchstens zwei Kanus weiterfahren könnt, müssen wir sorgsam auswählen. Ihr werdet Kleidung für die Mission mitnehmen und zusätzlich einen Kelch, eine Monstranz, vier Messbücher, zwei Garnituren Messgewänder, Schreibmaterial und einen großen Krug Messwein. Auch Tauschwaren werdet Ihr mitnehmen: Tabak, Ahlen, Perlen, Messer, Äxte. An Verpflegung werden wir ausreichend Maismehl für Sagamité vorbereiten, um die ganze Gruppe die zwanzig Tage zu ernähren, die Ihr bis oberhalb der Schnellen brauchen werdet. Nehmt auch Kleider und Mäntel für den kommenden Winter mit. Das alles, mit Ausnahme der Verpflegung, muss für den Fall, dass die Wilden Euch verlassen, zur Not auch in ein einziges Kanu passen. Schlimmstenfalls müsst Ihr in der Lage sein, ein Kanu mit Inhalt allein zu paddeln und zu tragen.«
»Und Schneeschuhe, mon Père?«, fragte Laforgue.
Es wurde gelacht. Alle hatten Laforgue tagtäglich im hohen Gras der Wiesen mit den seltsamen, aus Holz und Leder gefertigten Rahmenschneeschuhen an den Füßen üben sehen, mit denen die Wilden sich winters im Schnee fortbewegten. Er war herumgestakst wie ein Storch im Sumpf.
»Ja, nehmt sie mit«, sagte Père Bourque. »Und – ach ja, Daniel. Wenn wir hier fertig sind, möchte ich dich einen Augenblick sprechen.«
Die Besprechung ging weiter, aber Daniel hörte nicht mehr, was gesagt wurde. ›Ich möchte dich einen Moment sprechen.‹ Irgendjemand, vielleicht einer der Algonkin oben an den Reusen, muss scherzhaft etwas zu einem der Pelzhändler gesagt haben, und der hat es dann einem der Priester erzählt, der wiederum verpflichtet war, es sofort dem Superior zu melden, und jetzt will er mich zur Rede stellen. Und er wird wissen, dass ich gelogen habe, denn ich habe nicht gebeichtet, dass ich gesündigt und gesündigt habe und nicht aufhören kann. Welcher von den Patres war es? Père Laforgue? Nein, der hätte es sich anmerken lassen, als wir heute hierherkamen.
Der Superior beendete jetzt die Diskussion und winkte Daniel, ihm zu folgen. Der erhob sich voller Angst und folgte Père Bourque mit trockenem Mund vors Haus, von wo sie zu einem kleinen Lagerschuppen gingen, in dem die Patres manchmal die Beichte hörten. Dass die Unterredung gerade in diesem Schuppen stattfinden sollte, konnte nur bedeuten, dass er ertappt war. Sie traten ein. Der Superior schloss die Tür und gab Daniel ein Zeichen, auf dem einzigen Stuhl Platz zu nehmen, während er selbst sich auf einen umgedrehten Pflug setzte, der vor acht Jahren mit einem Schiff aus Frankreich gekommen, in diesem unwirtlichen Klima aber noch nie benutzt worden war. Der Superior zog seine Soutane über den Knöcheln hoch, die von Mückenstichen grässlich geschwollen waren.
»Sag mir, Daniel, warum du diese Reise machen möchtest.«
Die Frage stand in der Luft. Daniel zwang sich, den Superior anzusehen. Jemand hat es ihm gesagt. Er muss es wissen. »Warum fragt Ihr, mon Père?« Er hörte seine eigene Stimme beben, als er sprach.
»Weil ich entscheiden muss. Als ich heute mit dem Sieur de Champlain sprach, hat er mich vor der großen Gefahr gewarnt und an deine Jugend erinnert. Es stimmt, dass du noch sehr jung bist.«
»Ich fühle mich nicht jung«, sagte Daniel. Vor Erleichterung hätte er am liebsten aus vollem Hals gelacht. ›Er weiß nichts! Er weiß ja doch nichts!‹
Aber es war Père Bourque, der den Kopf zurückwarf und lachte, dass man seine kariösen Zähne sah. »Das zeigt, wie jung du noch bist. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Warum möchtest du diese Reise machen?«
Daniel zögerte und sagte dann wie ein Kind, das seinen Katechismus aufsagt: »Zur Ehre Gottes.«
›Mit dieser Lüge speie ich Jesus ins Gesicht!‹
»Aber du bist kein Jesuit.«
»Ich möchte Gott dienen. Deshalb habe ich darum gebeten, dass man mich nach Neufrankreich schickt.«
»Ja, natürlich, natürlich.« Der Superior bückte sich und kratzte seine zerstochenen Knöchel. »Gut, dann will ich dir etwas versprechen. Wenn du nach einem Jahr noch immer diesen Wunsch hast, werden wir unser Möglichstes tun, um dir zu helfen. Wir werden dich aus Ihonatiria zurückholen und nach Frankreich schicken, wo du für das Priesteramt studieren sollst. Würde dir das gefallen, Daniel?«
»Ja, mon Père.« Er weiß nichts. Er sieht mich schon in der schwarzen Soutane, hingebungsvoll, sein eigenes jüngeres Ich, vor dem Altar auf dem Angesicht liegen und die Priesterweihe empfangen, wie ich mich vor einem Jahr noch selbst gesehen habe, als ich in der Kirche der Heiligen Jungfrau von Honfleur kniete, die Arme ausgestreckt in Anbetung meines Heilands, und mein Gelübde tat, zwei Jahre lang Gott in einem fernen Land zu dienen.
»Leben deine Eltern noch?«, fragte Père Bourque.
»Nein, mon Père. Mein nächster Angehöriger ist mein Onkel, der Priester, von dem ich Euch erzählt habe.«
»Der dich Latein gelehrt hat. Wenn dir also etwas zustoßen sollte, was Gott bewahre, ist er es, an den ich schreiben muss?«
»Ja, mon Père.«
»Dann geh mit Gottes Segen«, sagte der Superior. »Ach ja, Daniel? Schicke mir Père Laforgue. Ich warte hier auf ihn.«
Die Trommeln der Wilden untermalten trunkene bretonische Lieder. Wolken von Mücken und winzigen Fliegen schwirrten umher und suchten Blut. Es war ein warmer Tag gewesen, aber nun brachte die abendliche Kühle vom Fluss her Linderung für den Kommandanten und die Häuptlinge der Wilden, die im Kreis am Flussufer saßen, Champlain aufrecht in einem Sessel, einen Umhang aus Biberpelz um die Schultern. Außerhalb dieses Kreises kauerten die Jesuiten der Mission dicht beieinander, als würden sie belagert: farblose Gestalten in langen schwarzen Soutanen, die breiten Hutkrempen seitlich hochgeschlagen. Ein Stückchen weiter flussabwärts hatte sich der größte Teil der Bevölkerung Neufrankreichs, gut hundert Kolonisten, Handwerker, Angestellte der Pelzhandelsgesellschaft und Soldaten, unter die übrigen Wilden vom Volk der Algonkin gemischt, die jetzt ihren Anteil vom Festmahl des Kommandanten verzehrten. Dies waren die jüngeren Männer mit ihren Frauen und Kindern, die sich um ein paar rauchende Feuer drängten, über denen in Kesseln eine übel riechende Masse aus Bärenfleisch, Fett, Fisch und Sagamité schwamm. Sie aßen gierig aus den Kesseln und wischten sich hin und wieder die fettigen Finger an ihren Haaren oder an den Hunden ab, die bellend um die Feuer sprangen und hofften, dass ein paar Brocken für sie abfielen.
Samuel de Champlain, der in der Mitte des Honoratiorenkreises saß, warf einen Blick zu seinem Dolmetscher, der ihm mit einem leichten Nicken bestätigte, dass die Zeit für seine Ansprache gekommen war. Er stand auf, verneigte sich vor den Häuptlingen, setzte sich wieder und nickte zu der Jesuitengruppe hinüber, wo Père Paul Laforgue augenblicklich aufstand und an die Seite des Kommandanten kam: ein schmächtiger, bleichgesichtiger Mann mit spärlichem Bartwuchs und intellektuellen Zügen, doch auch mit einer sonderbaren Entschlossenheit im Blick und um den schmalen Mund. Champlain wandte sich an die Häuptlinge und wies auf Père Bourque und die anderen Jesuiten. »Dies sind unsere hochwürdigen Väter«, sagte Champlain. »Wir lieben sie mehr als uns selbst. Das ganze Volk der Franzosen liebt sie. Nicht eurer Felle wegen sind sie zu euch gekommen. Sie haben Heimat und Freunde verlassen, um euch den Weg zum Himmel zu zeigen. Wenn ihr die Franzosen liebt, wie ihr sagt, dass ihr sie liebt, dann liebt und ehrt auch diese unsere hochwürdigen Väter. Und besonders lege ich, Agnonha, euch Père Laforgue ans Herz, der eine weite Reise ins Land der Huronen macht. Denen von euch, die ihn auf dieser Reise begleiten, sage ich, gebt gut auf ihn acht. Und nun vertraue ich diesen geliebten Père eurer Obhut an.«
Die Rede wurde Satz für Satz übersetzt und von den versammelten Wilden mit den üblichen Zustimmungsäußerungen unterbrochen. Die Kehllaute erinnerten Champlain an das schmerzliche Stöhnen von Tieren, doch er lächelte zufrieden, denn sie bedeuteten auch, dass die Reise genehmigt war.
Zwei Häuptlinge erhoben sich und setzten sich vor ihm in die Hocke. In der traditionellen Weise der Wilden wiederholte der erste, was Champlain gesagt hatte, und fasste dann zusammen, was man in dieser Angelegenheit schon früher besprochen hatte. Die Wilden, die keine Schrift kannten, verhandelten stets auf diese Weise und verblüfften die Franzosen immer wieder mit ihrem unglaublichen Gedächtnis. Der Häuptling erklärte sodann die unverbrüchliche Treue der Algonkin gegenüber den Franzosen im Allgemeinen und Champlain im Besonderen und erinnerte in seiner Rede an die Zeit vor mehr als fünfundzwanzig Jahren, als Champlain, den sie Agnonha oder »Mann aus Eisen« nannten, seine eherne Rüstung angelegt hatte und mit den Algonkin und Huronen ausgezogen war, um die Irokesen, ihre Erbfeinde, zu bekämpfen und zu töten.
Als die Rede beendet war, sprach Champlain noch ein paar Dankesworte und erhob sich, um das Ende der Unterredung anzuzeigen. Chomina und Neehatin, die Häuptlinge der Jägergruppe, die Laforgue begleiten sollte, standen ebenfalls auf, gingen zu dem Jesuiten und umarmten ihn zum Zeichen, dass er ihrer Obhut anvertraut war.
Zufrieden winkte Champlain seinen Offizieren und verließ die Versammlung. Als er unter dem Balkon des Handelspostens der Gesellschaft der Hundert Genossen Neufrankreichs vorbeikam, stand der Geschäftsführer, Martin Doumergue, auf und verneigte sich vor Seiner Exzellenz. Hinter ihm versteckte Pierre Tallévant, sein eben erst aus Frankreich eingetroffener Assistent, rasch eine halbleere Weinbrandflasche hinter seinem Rücken und verneigte sich ebenfalls, dann sahen beide dem Kommandanten und seinen Offizieren nach, wie sie den steilen Pfad zu Champlains Fort hinaufgingen.
»Warum zieht der Kommandant sich an wie ein Wilder?« fragte Tallévant, während er die Weinbrandflasche wieder hervorholte und seinem Vorgesetzten das Glas füllte.
Doumergue lachte. »Meint Ihr den Pelzumhang? Das ist ein Geschenk von den Häuptlingen. Aber symbolträchtig, wie?«
»Was meint Ihr damit?«
»Ich meine, ohne den Pelzhandel wären wir alle nicht hier in dieser Kolonie.«
»Kolonie?«, meinte Tallévant. »Wieso nennt man das eigentlich eine Kolonie? Seht Euch den Pöbel da draußen an. Wo sind die Kolonisten? Wo sind die Familien, die sich hier ansiedeln sollen? Die Engländer haben Kolonisten, die Holländer haben Kolonisten, und was haben wir? Pelzhändler und Priester.«
Doumergue trank und stellte sein Glas aufs Balkongeländer. »Könnt Ihr es uns verübeln?«, fragte er. »Ich meine, würdet Ihr eine Frau hierherbringen? Ich will Euch einmal etwas zeigen.«
Tallévant erhob sich auf unsicheren Beinen und trat ans Geländer.
»Seht, da drüben«, sagte Doumergue. »Seht Ihr den Wilden mit der Muskete auf dem Rücken?«
»Der gerade aus dem Kessel isst?«
»Ja. Wisst Ihr, wer das ist? Jean Mercier.«
»Wovon redet Ihr?«
»Ich sagte, das ist Mercier«, antwortete Doumergue. »Er war gerade mit einer Jägergruppe im Norden, um Pelze zu kaufen. Versteht Ihr? Er kleidet sich schon wie sie. Er isst sogar, was sie kochen.«
Tallévant starrte betreten zu der halbnackten Gestalt hinüber, die soeben in ein Stück halbgares Bärenfleisch biss, an dem noch die Haare hingen. Der Mann trug europäische Jägerstiefel, nicht die Schuhe aus weichem Leder, die ein echter Wilder tragen würde. Konnte das wirklich der Pelzhändler Mercier aus Rouen sein, dessen Abrechnungen Tallévant in den Akten der Gesellschaft in Caen gesehen hatte? Er wandte sich an Doumergue. »Was fehlt ihm? Ist er betrunken oder verrückt geworden?«
»Nein, nein, ihm gefällt dieses Leben.«
»Aber wie kann das angehen? Dieses stinkende Essen, die Fliegen, der Geruch, diese ganze Lebensweise!«
»Lebensweise?« Martin Doumergue lachte. »Die Wilden leben für ihr Vergnügen, für einen vollen Bauch. Sie leben zum Jagen und Fischen. Arbeit kennen die Algonkin nicht. Vor allem aber: Sie lassen ihn mit ihren jungen Mädchen vögeln. Das gefällt ihm. Er liebt die Jagd und freut sich, wegzukommen von dem Leben, das die Priester uns hier führen sehen möchten, mit Beten und Fasten und allem. Da oben ist er frei. Und er ist nicht der Einzige. Ich habe einundzwanzig Pelzhändler in meinen Büchern. Wenn sie hierbleiben, sind die meisten von ihnen in fünf Jahren genauso wie Mercier.«
»Ich glaub’s nicht«, sagte Tallévant.
»Und wenn wir Kolonisten hierherbringen«, sagte Doumergue, »wird es mit ihnen genauso gehen. Meint Ihr, ich würde eine Frau hierherholen und heiraten und mich hier niederlassen wollen? Wozu? Damit meine Söhne als Halbwilde aufwachsen und nackt in den Wäldern herumrennen und dann, wenn der Schnee kommt, Hungers sterben?«
Voll Unbehagen blickte Tallévant wieder zu der hochgewachsenen Gestalt des Pelzhändlers, den strähnigen, fettigen Haaren, den schmalen Hüften, den nackten Gesäßbacken unter dem Lendenschurz. Doumergue irrt sich; es muss Alkohol sein oder Irrsinn. Zurückzugehen von allem, was wir sind und wissen, auf diesen primitiven Stand? »Es will mir nicht einleuchten«, sagte er laut.
»Nein? Mir schon. Wir kolonisieren nicht die Wilden, sie kolonisieren uns. Selbst der Kommandant in diesem stinkenden Pelzumhang ist hier glücklicher, als er es in Frankreich je war.«
Tallévant füllte sein Glas nach und trank. Die Weinbranddünste stiegen ihm in den Kopf. »Also, ich nicht«, sagte er. »Wenn mein Vertrag ausläuft, kehre ich nach Hause zurück.«
Martin Doumergue sah ihn an. »So? Ich bin mir manchmal nicht sicher. Wird überhaupt einer von uns zurückkehren?«
Die beiden Wilden, die nach dem Fest des Kommandanten aufgestanden waren, um Paul Laforgue zu umarmen, führten ihn jetzt zum zeitweiligen Lager der Algonkin, und das Grinsen ihrer grellbunt bemalten Gesichter erinnerte ihn an die mittelalterlichen Festtagsmasken seiner normannischen Heimat. Als er das Lager betrat, umringten ihn die Wildenfrauen; die verheirateten unter ihnen waren vorzeitig gealtert und verschlissen von der Arbeit, die jungen Mädchen schändlich locker bekleidet und frech und unbekümmert wie die ungebärdigen Kinder, die feixend um ihn herumrannten und ihn zwickten und an ihm zupften, als hätte man ihnen ein Spielzeug mitgebracht. Laforgue, dem das dumpfe Sausen in seinem entzündeten Ohr das Hören erschwerte, verstand aus den Fragen der Wildenfrauen, dass sie wissen wollten, was er zu essen mit auf die Reise nehme, ob er Tabak habe und ihnen Weinbrand geben könne. Gesichter bedrängten ihn, weiß blitzende Zähne zwischen sonnenbrauner Haut, hübsche, fröhliche dunkle Augen, lange schwarze Haare: Diese Gesichter, diese Menschen werden außer Daniel meine einzige Gefährten sein, wenn wir Morgen flussaufwärts fahren.
Laforgue hatte noch nie in einem Wildenlager gelebt. Keiner der Patres, die zur Zeit in der Mission Québec tätig waren, außer Père Bourque, war auch schon so weit gereist, wie er nun reisen würde, hatte nachts im Freien oder in den Wigwams der Wilden geschlafen und nichts als ihre Nahrung zu essen bekommen. »Es ist eine Reise von der beschwerlichsten Art«, hatte der Superior ihn gewarnt. »Zugleich ist es aber auch die vorteilhafteste Art, so eine Reise zu machen. In einer Jägergruppe aus Männern, Frauen und Kindern hat man nämlich, falls unterwegs ein Kind oder Erwachsener krank wird, immer die Möglichkeit, durch eine Nottaufe eine Seele für Gott zu retten. Père Brabant und andere haben in den Relations geschrieben, dass sie noch auf jeder Reise ins Land der Huronen die große Ehre hatten, auf diese Weise mindestens eine Seele zu retten. Bedenkt, dass eine solche Gnade alle Gefahren und Widrigkeiten, die Ihr erleiden mögt, mehr als rechtfertigt.«
Eingedenk dieser Worte des Superiors zwang Laforgue sich jetzt zu einem Lächeln, während er die Neckereien der Wildenkinder über sich ergehen lassen musste: Das eine zog an den Perlen seines Rosenkranzes, als wollte es sie abreißen; ein anderes zupfte ihn am Bart und nannte ihn einen haarigen Hund, denn die Wilden trugen keine Bärte und rissen sich die eigene spärliche Gesichtsbehaarung aus, weil sie bei ihnen als hässlich galt. Ein kicherndes kleines Mädchen versuchte ihm dauernd zwischen die Knöpfe seiner Soutane zu greifen und seine Genitalien zu befühlen. Die Wilden beachteten das gar nicht, denn es kam für sie nicht in Frage, ihre Kinder zu strafen oder zu zügeln. Als der kleine Quälgeist nicht aufgab, hob Laforgue ihn schließlich hoch, stellte ihn ein Stückchen weiter wieder ab und versuchte sich aus dem Gedränge zu befreien. Doch die Wildenfrauen hielten ihn lachend fest, und wie er in diesem Augenblick sehnsüchtig an seine Zelle dachte, wo er sonst um diese Stunde allein im Gebet kniete, hatte er die Idee, Häuptling Ticktack zu beschwören. Er hob die Hände, als wollte er eine Rede halten, und rief: »Halt! Häuptling Ticktack sagt, ich muss jetzt nach Hause gehen. Der Häuptling sagt, es ist Zeit für mich, nach Hause zu gehen.«
»Wo ist denn der Häuptling?«, fragte eine alte Frau. »Hältst du ihn bei dir versteckt?«
»Nein, der Häuptling ist in unserem Haus. Aber er hat heute Morgen gesprochen. Entschuldigt mich, ich muss gehen.«
»Dong! Dong! Dong! Dong!«, ahmte die alte Frau, deren Gesicht ein einziges Spinnennetz winziger Fältchen war, den Schlag der Uhr so täuschend echt nach, dass es schon nicht mehr menschlich klang.
»Halt!«, rief ein anderer Wilder nach dem vierten Schlag, und alle brachen in großes Gelächter aus. Chomina, der Häuptling, der Laforgue ins Lager gebracht hatte, nahm ihn bei der Hand und bahnte ihm einen Weg durch die johlende Menge. »Geh nur, Nicanis«, sagte er zu Laforgue, dem die Algonkin diesen Namen gegeben hatten. »Geh zu Häuptling Ticktack, und sag ihm, dass wir dich morgen beim ersten Licht hier erwarten.«
»Dann bis morgen«, sagte Laforgue. Die Wilden waren still. Selbst die Kinder hörten auf herumzulaufen und sahen ihm schweigend nach, wie er ihre Feuer verließ und flussabwärts zu der Stelle ging, wo die Pelzhändler herumlagen und tranken. Im Näherkommen sah Laforgue im Schatten der Bäume Daniel stehen und auf ihn warten.
»Ich habe ein Kanu hier, mon Père. Ich bringe Euch zur Mission zurück.«
»Gut«, sagte Laforgue. Dann sah er den Jungen an. »Ist irgendetwas los?«
»Nein, mon Père.«
Aber es war etwas los, dessen war er sicher. Er hatte den Eindruck, dass Daniel Angst hatte, und im Weitergehen merkte er, wie der Junge sich oben auf der Uferböschung hielt, wie um die Stelle zwischen den Bäumen zu meiden, wo die Händler lagen. Das war zweifellos vernünftig, denn man wusste nie, in was für einer Stimmung die Pelzhändler waren, besonders an allgemeinen Feiertagen, wenn sie getrunken hatten. Und wie zur Bestätigung dieses Gedankens ertönten mit einem Mal Männerstimmen, gefolgt von einem plötzlichen Kreischen. Ein Wildenmädchen kam zwischen den Bäumen hervorgerannt, langbeinig und linkisch wie ein Füllen, das gleich hinfallen würde. Das Mädchen war groß und schlank und nach Wildenart festlich gekleidet, denn es trug nur eine Art Rock, der von der Taille bis zu den Knien