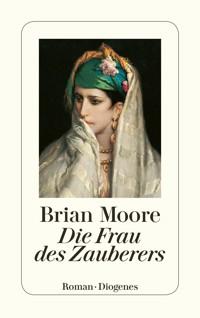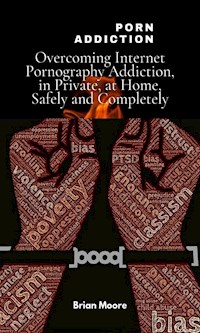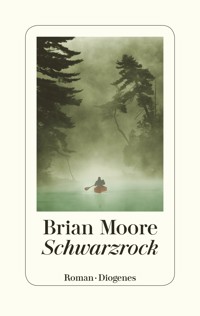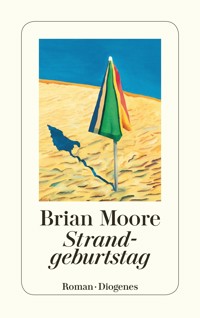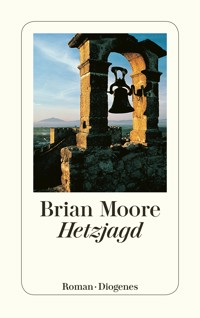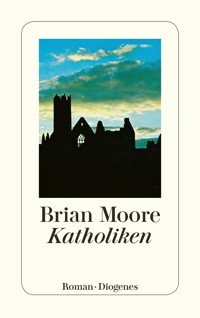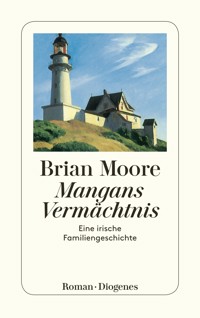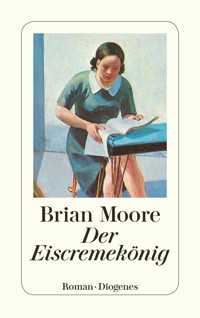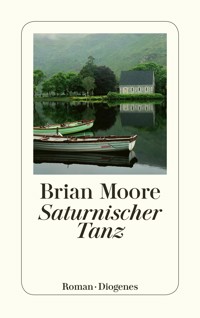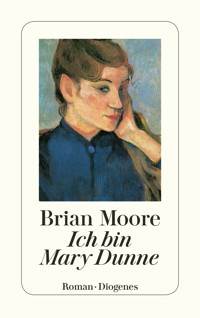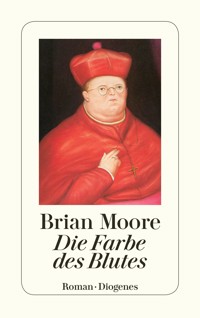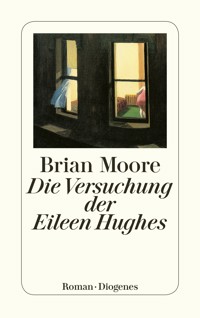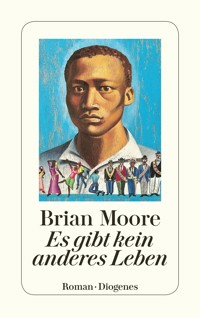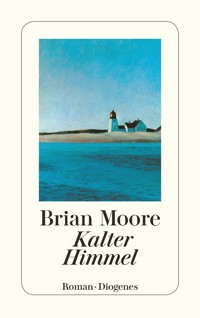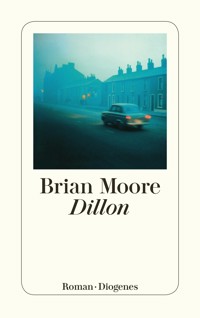7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ginger Coffey, mit Frau und Kind von Irland nach Kanada ausgewandert, läßt sich so schnell nicht unterkriegen. Seine großen Pläne als Vertreter für Whisky, Tweed und Strickwaren sind zwar gescheitert, doch sieht ihm das drohende Elend ja keiner an: In seiner Kleidung eines Dubliner Aristokraten macht er sich auf den Weg ins Arbeitsamt, und wer sagt schon, daß man Fragebogen immer richtig ausfüllen muß?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Brian Moore
Ginger Coffey sucht sein Glück
Roman
Aus dem Englischen von Gur Bland
Diogenes
{4}Für Jacqueline
{5}1
Fünfzehn Dollar, drei Cent. Abgezählt, und dann in die Hosentasche. Er nahm seinen Tirolerhut aus dem Schrank und überlegte dabei, ob die zwei Hirschhornknöpfe und der kleine Gamsbart im Hutband nicht doch etwas zu flott für diese Gelegenheit wären. Immerhin, sie konnten ihm auch Glück bringen. Und es war ein so schöner Morgen, klar, frisch und sauber. Vielleicht lag auch hierin ein gutes Vorzeichen. Vielleicht gewann er heute das Große Los.
James Francis (Ginger) Coffey wagte sich in die Küche. Seine Frau stand am Herd. Seine Tochter Paulie löffelte träge ihre Corn Flakes. Er wünschte guten Morgen, doch die einzige Antwort, die er erhielt, kam von Michel, dem kleinen Jungen der Hauswirtin. Der stand am Fenster und guckte hinaus.
»Was gibt’s denn da, Junge?« fragte Coffey und trat zu Michel. Gemeinsam beobachteten Mann und Junge einen Traktor der Montrealer Straßenreinigung, wie er sich über das Pflaster schleppte und den Schnee der letzten Nacht beiseite schob.
»Setz dich hin, Ginger, du bist genauso ’n Nichtsnutz wie der da«, sagte seine Frau, während sie sein Frühstück auf den Tisch stellte.
Er versuchte es noch einmal. »Guten Morgen, Veronica.«
»Seine Mutter war gerade da«, erklärte sie und deutete auf Michel. »Sie wollte wissen, wie lange wir die Wohnung {6}noch behalten. Ich sagte, du würdest mit ihr reden. Vergiß also nicht, bei ihr hereinzuschauen und zu kündigen, sowie du die Fahrkarten hast.«
»Jawohl, Schatz.« Verdammt! Konnte man nicht einen Bissen von seinem Frühstück herunterbringen, ehe sie mit ihrer Quengelei loslegte? Er wußte doch, daß mit Madame Beaulieu gesprochen werden mußte. Na schön!
Ein gekochtes Ei, eine Scheibe Toast und Tee. Es reichte nicht. Das Frühstück war seine Lieblingsmahlzeit; sie wußte das. Doch in der tränenseligen Armutsstimmung, die sie seit einigen Wochen mit sich herumtrug, würde sie ihm den Kopf abreißen, wenn er um ein zweites Ei bäte. Er versuchte es trotzdem.
»Würdest du mir noch ein Ei machen?« fragte er.
»Mach’s dir doch selber.«
Er wandte sich zu Paulie um. »Pet, setz mir doch bitte ein Ei auf.«
»Keine Zeit mehr, Daddy.«
Gut, gut. Wenn man die Wahl hatte, zu verhungern oder die Damen um die geringste Kleinigkeit zu bitten, konnte man gleich den Gürtel enger schnallen. Er aß Ei und Toast, trank eine zweite Tasse Tee und ging in den Flur, um seinen Mantel anzuziehen. Der war sein ganzer Stolz: Er war mit Schaffell gefüttert, dreißig Guineas hatte er bei Aquascutum gekostet.
Aber sie holte ihn ein, ehe er sich aus dem Staub machen konnte. »Vergiß ja nicht, mich anzurufen, sowie du die Karten hast«, sagte sie. »Und erkundige dich nach der Verbindung mit der Eisenbahnfähre von Southampton nach Dublin. Ich will Mutter nämlich die Zeiten mitteilen, ich schreibe ihr heute nachmittag.«
»Geht klar, Schatz.«
{7}»Was ich noch sagen wollte, Gerry Grosvenor kommt um fünf. Sieh zu, daß du nicht erst um sechs hereinschneist, hörst du?«
Was mußte sie auch Gerry Grosvenor ausdrücklich ins Haus bitten? Hätte man ihm nicht irgendwo in der Stadt auf Wiedersehen sagen können? Sie wußte doch ganz genau, daß er es nicht liebte, den Leuten Einblick in seine Wohnverhältnisse zu geben. Verdammt! Seine Augen glitten abschätzend über ihr derzeitiges Heim, wie es Gerry Grosvenors Augen tun würden. Der untere Teil eines Zweifamilienhauses an einer schäbigen Straße in Montreal, finster wie die Hölle, eine Bruchbude, vor fünfzig Jahren zusammengeklitscht und seitdem nach und nach aus allen Fugen gegangen. Die Türen schlossen nicht richtig, der Fußboden hatte sich verzogen und gewellt, die Wände wirkten geradezu aufgedunsen, so oft waren sie neu gestrichen und tapeziert worden. Und sie würden weiterhin anschwellen, denn es war eine Wohnung, die Leute auf dem Weg nach oben zu verschönern und Leute auf dem absteigenden Ast zu verkleiden versuchten. Und alles war vergebens. Die Hedschra der Mieter würde sich endlos fortsetzen.
Doch wozu sich ereifern, wozu reden? Sie hatte Gerry eingeladen: der Schaden ließ sich nicht mehr reparieren. »In Ordnung«, sagte er. »Und gib mir noch ’n Kuß. Ich muß los.«
Sie küßte ihn, wie sie ein Kind geküßt hätte. »Ich habe natürlich keine Ahnung, was ich Gerry anbieten soll«, erklärte sie. »Es ist nur Bier da, sonst nichts.«
»Sicher, sicher, macht nichts«, sagte er und küßte sie rasch, um ihr den Mund zu verschließen. »Also bis dann. Ich bin bestimmt vor fünf zurück.«
{8}Und weg war er.
Draußen in der eiskalten Luft stäubte Schnee, fein wie Salz, von den Kuppen der Schneewälle links und rechts neben der Fahrbahn, schwebte spiralenförmig höher und hinüber zu der Verkehrsinsel, wo ein Polizist seine weißbehandschuhte Pranke erhob und die Wagen stoppte, um Coffey über die Straße zu lassen. Coffey winkte ihm den gewohnten Gruß zu. Herrgott noch mal, die sahen in ihren schwarzen Pelzmützen wie Rußkis aus. Er konnte jetzt nur darüber lächeln. War es nicht komisch, daß er sich damals, ehe er hierherkam, Montreal als eine Art französische Stadt vorgestellt hatte? Französisch, von wegen! Es war eine Kreuzung zwischen Amerika und Rußland. Die Autos, der Supermarkt, der Reklamerummel, das war alles genauso, wie man es in den Hollywood-Filmen sah. Aber die Leute und der Schnee und die Kälte – diese Frau da zum Beispiel, mit ihrem Kopf, der in einer Babuschka fast verschwand, mit ihren Füßen, die in riesigen Kähnen einherstiefelten, und mit ihrem Kind, das sie auf einem Schlitten hinter sich herzog: war das nicht das reinste Sibirien?
»M’sieur.«
Den anderen Leuten an der Bushaltestelle fiel auf, daß der kleine Junge nicht warm genug angezogen war. Coffey merkte es nicht. »Na, Michel«, sagte er, »bringst du mich zum Bus?«
»Ich möcht’ ’n Bonbon.«
»Du bist wenigstens ehrlich«, sagte Coffey, legte dem Kind einen Arm um die Schultern und stapfte mit ihm zum Süßwarenladen an der Ecke. »Was für einen willst du denn haben?«
Der Kleine griff nach einem großen Plastikbeutel mit Drops. »Den hier, M’sieur?«
{9}»Du gehst aber ran«, sagte Coffey. »Genau das gleiche hab ich mir auch immer geholt, als ich so alt war wie du. Ist nicht mehr als recht und billig.« Er steckte ihm den Beutel in die Hand und fragte den Verkäufer nach dem Preis.
»Fünfzig Cent.«
Teufel auch, billig war das nun nicht gerade. Doch er konnte ja schließlich den Knirps nicht enttäuschen. So zahlte er, führte seinen Freund hinaus, wartete, bis der Polizist den Verkehr stoppte, dann schickte er Michel los. »Denk dran!« schärfte er ihm ein. »Das ist unser Geheimnis. Erzähl keinem Menschen, daß ich dir die Drops gekauft habe.«
»Okay. Merci, M’sieur.«
Coffey sah ihm nach, wie er davonrannte, dann begab er sich wieder zur Bushaltestelle, ans Ende der Schlange. Hoffentlich kam Veronica nicht hinter die Sache mit den Bonbons, sonst wäre wieder ein Vortrag darüber fällig, was es hieß, sein Geld an fremde Leute zu verschwenden. Aber, ach Gott, Coffey erinnerte sich sehr gut an seine eigene Kindheit, an die Seligkeiten eines Lutschbonbons oder eines Abziehbildes. Er lächelte bei dem Gedanken daran und stellte fest, daß ein Mädchen gleich neben ihm in der Schlange dieses Lächeln auf sich bezog. Sie lächelte zurück, und er warf ihr einen einladenden Blick zu. Denn noch war Leben in den alten Knochen. O ja, als der Herrgott das gute Aussehen verteilte, hatte Coffey bestimmt nicht am Ende der Schlange gestanden. Jetzt, in der Vollkraft seiner besten Jahre, sah er sich so: ein prächtiger, großer Bursche, von soldatischer Haltung, das rote Haar so dicht wie eh und je, und zu allem übrigen ein hübscher Schnurrbart. Und noch etwas kam hinzu: Coffey teilte die Ansicht, daß Kleider Leute machen, und er hatte aus sich {10}einen Dubliner Aristokraten gemacht. Seine sportliche Kleidung ließ ihn um Jahre jünger erscheinen, davon war er überzeugt, und er trug nur Anzüge aus bestem Stoff. Als er an jenem Morgen im Bus zur City fuhr, hätte kein Mensch in ganz Montreal gesagt: da geht ein Mann, der keine Arbeit hat. Nie im Leben! Nicht einmal, als er durch das Tor des Arbeitsamtes schritt und geradenwegs zur Berufsberatung für höhere Angestellte emporstieg.
»Füllen Sie’s dort drüben am Tisch aus, Mr. Coffey«, sagte der Angestellte. Netter junger Mann, keine Spur von Herablassung in seinem Ton, hilfsbereit und natürlich, als könnte dergleichen jedem passieren und alle Tage. Immerhin, als Coffey mit dem Stift in der Hand – Schreiben Sie in Blockbuchstaben oder Maschinenschrift – über der Liste saß, sah er sich wieder einmal den unheilvollen Tatsachen seines Lebenslaufs gegenüber. In Druckbuchstaben begann er:
Geboren:14. Mai 1917, Dublin, Irland.
Schulbildung: Plunkett School, Dublin. National University of Ireland, University College, Dublin.
Bestandene Examen, erworbene Titel und sonstige Qualifikationen: (Den B.A. hatte er nie geschafft; na wennschon:) Bachelor of Arts, 1940. (Nichts wie weiter!)
Frühere Anstellungen, mit genauen Daten, Namen und Anschriften der Arbeitgeber: (Verflucht! Da haben wir’s!) Wehrdienst 1940–45. Befördert zum Unteroffizier 1940. Zum Leutnant 1942. Dem Pressebüro zugeteilt, Hauptquartier des Stabes. Kylemore Distilleries, Dublin, 1946–48, zur besonderen Verfügung des Direktors. 1949–53, Assistent der Werbeabteilung, Coomb-Na-Baun Strickwaren, Cork, 1953–55, Sonderbeauftragter.
– Cootehill Distilleries, Dublin
{11}– Coomb-Na-Baun Strickwaren, Dublin
– Dromore Tweeds, Carrick-on-Shannon
jeweils August 1955 bis Dezember 1955, Sondervertretung für Kanada.
Augenblickliche Beschäftigung: Seine Beschäftigung war seit diesem Morgen, dem 2. Januar, null und nichtig, im Eimer, oder nicht? Also zog er einen Strich. Er überlas das Ganze, und strich sich dabei geistesabwesend mit dem Stift über den Schnurrbart. Dann unterzeichnete er mit einer großen, oft erprobten Unterschrift.
Das Holztäfelchen vor dem jungen Mann, der sich jetzt über Coffeys Bewerbung beugte, trug den Namen J. Donnelly. Und selbstverständlich bemerkte J. Donnelly, wie alle irischen Kanadier, Coffeys heimatlichen Akzent und förderte sofort eine Reihe von scherzhaften Anspielungen auf die alte Heimat zutage. Doch diese Witze taten nicht halb so weh, wie das, was folgte.
»Wie ich sehe, haben Sie Ihren B.A., Mr. Coffey. Kommt unter Umständen der Lehrberuf für Sie in Betracht? Es herrscht starker Lehrermangel hier in Kanada.«
»Heiliger Strohsack«, sagte Coffey und schenkte J. Donnelly ein ehrliches Grinsen. »Das ist doch schon so lange her, ich habe bestimmt schon alles vergessen, keinen Schimmer mehr.«
»Aha«, meinte J. Donnelly. »Ich verstehe noch nicht ganz, warum Sie sich um einen Posten bewerben, der mit Public Relations zusammenhängt. Abgesehen von Ihrem, hm, Heeresdienst, haben Sie doch nie so etwas gemacht.«
»Sehen Sie«, erklärte Coffey, »meine Arbeit hier als Vertreter dieser drei Firmen, die ich da aufgeführt habe, das war doch alles Werbung. Das kann man schon Public Relations nennen.«
{12}»Ja, ja. – Aber, ganz ehrlich, Mr. Coffey, ich fürchte, diese Praxis genügt kaum, um Sie für einen solchen Posten zu qualifizieren – einen gehobenen Posten.«
Stille. Coffey fummelte an dem Gamsbart seines Hutes herum. »Na gut, Mr. Donnelly, ich will Ihnen reinen Wein einschenken. Diese drei Firmen, die mich hierher geschickt haben, wollten mich gern zurückhaben, als sie den nordamerikanischen Markt fallenließen. Aber ich habe nein gesagt. Und der Grund, warum ich nein gesagt habe, ist der, daß ich Kanada für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten halte. Na ja, und deswegen, weil ich hierbleiben möchte, um jeden Preis, verstehen Sie, muß ich mich eben vielleicht damit abfinden, einen weniger guten Posten anzunehmen, als ich ihn zu Hause gewohnt war! Wie wär’s, wenn Sie mir ein Angebot machten, wie das Mädchen zum Seemann sagte?»
Doch J. Donnelly hatte dafür nur ein höfliches Lächeln.
»Oder – oder vielleicht, wenn in Public Relations nichts zu machen ist, haben Sie eine einfache Bürotätigkeit für mich?«
»Schreibarbeiten und dergleichen, Mr. Coffey?«
»Hm.«
»Dafür sind wir hier nicht zuständig, Sir. Hier vermitteln wir nur gehobene Angestellte. Einfache Angestellte einen Stock tiefer.«
»Oh!«
»Und zur Zeit dürfte es schwer sein, jemanden im untergeordneten Bürodienst unterzubringen. Aber wie Sie wollen. Soll ich Sie überweisen?«
»Ach nein, lassen Sie nur«, sagte Coffey. »In Public Relations haben Sie also nichts?«
J. Donnelly stand auf. »Wenn Sie einen Augenblick {13}warten wollen, ich sehe eben in unserer Kartei nach. Entschuldigen Sie mich.«
Er ging hinaus. Kurz darauf fing im Vorzimmer eine Schreibmaschine zu klappern an. Coffey zupfte an seinem grünen Hütchen und den Wildlederhandschuhen, bis J. Donnelly zurückkam. »Ich glaube, Sie haben Glück, Mr. Coffey«, sagte er. »Heute früh ist etwas hereingekommen, Hilfsredakteur der Firmenzeitung einer großen Nickelgesellschaft. Nicht genau das, was Sie suchen, aber Sie könnten’s ja mal probieren.«
Was sollte Coffey entgegnen? Er hatte kein besonderes Schreibtalent. Aber Not bricht Eisen, und seinerzeit hatte er im Heeresdienst hin und wieder eine Verlautbarung aufgesetzt. Er nahm den Zettel und bedankte sich.
»Ich werd’ noch dort anrufen und den Leuten sagen, daß Sie um elf Uhr an Deck sind«, erklärte J. Donnelly. »Schmieden Sie das Eisen, solange es heiß ist, ja? Und hier ist noch etwas anderes, falls es mit dem Job als Hilfsredakteur nichts wird.« Er überreichte ein zweites Stück Papier. »Na, und wenn beides schiefgeht«, meinte er, »kommen Sie wieder zu mir, und ich gebe Sie an die Abteilung für untere Angestellte weiter. Okay?«
Coffey steckte auch diesen Zettel in seine rohlederne Brieftasche und dankte dem Angestellten noch einmal.
»Viel Glück!« sagte Donnelly. »Das Glück der Iren, was, Mr. Coffey?«
»Haha«, machte Coffey, während er sich den kleinen Tiroler aufstülpte. Das Glück der Kanadier könnte er jetzt besser brauchen, dachte er. Immerhin, es war ein Anfang. Kopf hoch! Er zog ab, in den kühlen Morgen hinein, und holte den ersten Zettel hervor, um sich die Adresse einzuprägen. Es war auf dem Beaver Hall Hill. {14}Schon hob er den Arm, um einem Taxi zu winken, ließ ihn aber gleich wieder sinken, als er sich an die vierzehn Dollar in seiner Tasche erinnerte. Wenn er sich beeilte, konnte er es zu Fuß schaffen.
Auf Schusters Rappen, wie seine Mutter zu sagen pflegte. Ach, was hat’s für einen Sinn, Ginger Geld für die Tram zu geben, sagte sie immer, er benutzt es doch nicht dafür. Gibt er nicht jeden Penny für irgendeinen Unsinn aus, kaum hast du ihn in seine Tasche gesteckt? Und das stimmte, leider, damals genauso wie heute. An ihm blieb kein Geld kleben. Er dachte daran, wie er als kleiner Junge zur Schule gerast war, weil er sein Fahrgeld in irgendeinem Laden auf der Theke gelassen hatte, und dann rannte er und wirbelte seine Schulmappe um seinen Kopf herum durch die Luft, oder er blieb beim Stephen’s Green Park stehen, zog sein Lineal heraus und ließ es – ticketi, tack, tack – am Gitter entlangklappern. Und dabei träumte er vom Erwachsensein, malte sich ein Leben ohne Schule und Katechismus aus, ohne Examen und Befehle und Anordnungen, ein freies Dasein, in dem man in die Welt hinaus auf Abenteuer ausziehen konnte. Daran erinnerte er sich jetzt, während er auf Schusters Rappen, im beginnenden Schneefall (einem schmelzenden Frost, der die grauen Backsteinfronten der Bürohäuser mit Leichenfarbe überzog) die Notre Dame Street entlangeilte, wie er damals zur Schule gehastet war. Und hier gab’s nun keine Schule. Die lag dreißig Jahre zurück und dreitausend Meilen entfernt, jenseits eines halben eisigen Kontinents und des ganzen Atlantischen Ozeans. Sogar die Tageszeit war eine ganz andere als zu Hause. Hier herrschte noch früher Vormittag, und dort, in Dublin, machten die Pubs nach dem Lunch gerade wieder zu. Er bekam Heimweh, wenn er nur {15}an diese Pubs dachte, also durfte er nicht daran denken. Nein! War dies nicht die Chance, auf die er immer gewartet hatte? War er nicht endlich, zu guter Letzt, ein richtiger Abenteurer, ein Mann, der alles auf eine Karte gesetzt hatte, die Landkarte Kanadas, die nun, richtig ausgespielt, Ruhm und Glück bringen mußte? Also denn, vorwärts!
Auf Schusters Rappen überquerte er den Place d’Armes, kam am Denkmal von Maisonneuve vorbei, der ebenfalls ein Abenteurer und Spieler gewesen war, ein Glücksritter: 1641 aufgebrochen, um dieses gelobte Land hier zu entdecken … und weiter auf Schusters Rappen, vorbei an den Säulen einer Bank, und denk bloß nicht daran, was dort drin ist, nein, sondern weiter die Craig Street hinauf, in Gedanken daran, wie weit entfernt du jetzt bist von dem unsichtbaren Geflecht von Freundschaften und Beziehungen, in dem du, sag, was du willst, nicht hättest hungern müssen und darben, als du noch dazugehörtest; aber du bist ja freiwillig weg von zu Hause, auf eigene Faust, hast den Ozean überquert, und damit existierst du nicht mehr für deine Freunde.
Hinauf den Beaver Hall Hill, letzte Runde, linker Fuß, rechter Fuß, und er prägte sich ein, daß, wer immer es zu etwas gebracht hat, seine Chance zu packen wußte, im rechten Augenblick zuschlug und so weiter und so weiter. Aber er war ziemlich fertig heute. Nur er selbst wußte, wie fertig.
Schließlich landete er in einem großen Bürogebäude, fuhr im Expreßlift bis zum fünfzehnten Stock hinauf, wurde in eine riesige Empfangshalle ausgespien. Und er steuerte auf einen supermodernen Schreibtisch zu, der nichts als Glas und dünne Holzbeine war, so daß man die Beine der überwältigenden Blondine sehen konnte, die {16}hinter diesem Tisch als Empfangsdame thronte. Sie lächelte ihm zu, ließ dieses Lächeln aber sofort wieder erlöschen, als er seinen Namen sagte und Ginger Coffeys Anliegen vortrug. Es tat ihr leid, aber Mr. Beauchemin war gerade in einer Besprechung, und: »Würden Sie dort bitte einen Augenblick Platz nehmen, Sir?« Und würde er des weiteren dieses kleine Formular ausfüllen, während er wartete? Bitte in Druckbuchstaben! In Druckbuchstaben hielt er noch einmal die irreführenden Tatsachen seines Lebenslaufs fest.
Als er damit zu Rande gekommen war, gab er dem Mädchen das Formular zurück, und sie las es vor seinen Augen durch. Das war kränkend. Es gab so wenige Dinge, die man hinschreiben konnte, wenn man den Tatsachen eines Lebenslaufes gegenüberstand. »Gut, Sir«, sagte sie im Ton einer Lehrerin, die eine Note erteilt. »Und jetzt möchten Sie sich vielleicht, während Sie warten, mit unserem Hausorgan vertraut machen. Hier haben Sie die neueste Nummer.«
Vielen Dank, sagte er, das sei sehr freundlich von ihr. Er nahm die glänzende kleine Illustrierte entgegen und begab sich damit zur Bank zurück, um sie zu studieren. Sie hieß Nickelodeon. Er überlegte, ob das komisch gemeint war, entschied dann aber, daß nicht. Kanadier waren nun einmal so. Sie fanden auch nichts Komisches an der Bezeichnung Hausorgan. Er blätterte in den Seiten aus Hochglanzpapier. Bilder von merkwürdigen alten Käuzen, die eine goldene Uhr erhielten »für fünfundzwanzig Jahre treuer Mitarbeit«. War er nicht ausgewandert, um gerade so etwas zu vermeiden? Auf die Klatschspalte der Angestellten, »Nickelbrocken« genannt, warf er nur einen flüchtigen Blick, dafür betrachtete er sich um so {17}eingehender die Fotos auf der Seite der »weiblichen Mitarbeiter«. Einige dieser Mitarbeiterinnen waren wirklich ganz passabel. Na schön, genug davon. Er blätterte zurück zum Leitartikel, der den Titel trug: »J.C. Furniss, Vize-Präsident (Vertrieb). Profil einer Persönlichkeit!« Wie es schien, hatte sogar J.C. höchstselbst bescheiden angefangen, als Markscheidergehilfe. Die typische Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte, für die die Neue Welt so berühmt war. Hier konnte man herzerfrischenden Trost gewinnen, denn zu Hause sah es ja ganz anders aus. Zu Hause war es das ewige chinesische Kästchenspiel, ein Kästchen steckte im anderen, und wie man sich drehte und wendete und wie viele Kästchen man auseinandernahm, man endete immer nur wieder da, wo man begonnen hatte. Deshalb war er ja heute hier. Deshalb war er an diesem Morgen so fertig gewesen, als er mit den Tatsachen seines Lebenslaufs zu tun bekam.
Denn die wahren, eigentlichen Tatsachen konnte man nicht in einen Fragebogen schreiben, oder? Als Ginger zum Beispiel aus der Armee entlassen wurde, hatten Veronicas Verwandte einen gewissen Einfluß auf die Kylemore Distilleries, und die Stelle, die man ihm anbot, war das Große Los, so meinten sie. Zur besonderen Verfügung des Direktors. Großes Los! Zwei Jahre als ruhmreicher Bürojunge. »Besorgen Sie mir doch zwei Karten für das Springturnier, Ginger.« »Buchen Sie einen Platz für mich in der Maschine, die um sechs nach London startet.« »Gehen Sie mal mit dem Dings da zum Zoll, Ginger, und sehen Sie zu, daß Sie’s in Ordnung bringen.« Aufträge, Aufträge. Und schließlich, nach zwei Jahren, als Ginger um eine Gehaltserhöhung und mehr eigene Verantwortung bat, schielte der Direktor ihn sauer an und beförderte ihn die Treppe {18}hinunter zur Werbeabteilung. Als er dann dort ein paar neue Ideen ausprobierte, ließ ihn der Chef der Werbung holen, ein Neandertaler von einem Kerl, Cleery hieß er, und sagte: »Was glauben Sie eigentlich, wo Sie sind, Coffey? In New York? Denken Sie immer daran: worauf es beim Whiskyverkaufen ankommt in diesem Land, das sind gute Beziehungen zu den Gastwirten. So, und jetzt machen Sie, daß Sie wieder an Ihren Schreibtisch kommen.«
Aufträge. Dummes Gequatsche anhören und nichts sagen dürfen. So kündigte er, als sich ihm die erste Gelegenheit bot, bei einer Firma namens Coomb-Na-Baun Knitwear in Cork einen anderen Posten zu übernehmen, und trotz aller Proteste Veronicas zog er mit seiner Familie dorthin. Aber auch Cork war nicht New York. Dummes Gequatsche anhören. Keinen Augenblick Freiheit.
Tatsächlich wäre er wohl nie losgekommen, hätte nicht am Ende sein Vater das Zeitliche gesegnet und ihm zweitausend Pfund hinterlassen, genug für die Abzahlung der Schulden und einen neuen Start. Wieder geschah es gegen Veronicas Wunsch und Willen, aber er tat es dennoch! Teufel auch, diesmal war er entschlossen, dem ganzen Land den Rücken zu kehren. Viel zu spät zwar, um die Dinge zu tun, von denen er einst geträumt hatte: den Amazonas hinaufpaddeln, nur von vier Indianern begleitet, einen Berg in Tibet besteigen oder auf einem Floß von Galway nach Westindien segeln. Nicht zu spät jedoch war es, in die Neue Welt aufzubrechen, Ruhm und Glück zu erjagen. So fuhr er nach Dublin und lud seinen ehemaligen Boss zum Essen ein. Er stopfte den Direktor von Kylemore Distilleries in Jammets Restaurant mit der besten Ente à l’orange voll und fragte ihn dann geradeheraus, ob {19}Kylemore daran interessiert sei, den nordamerikanischen Markt zu erschließen. Das sei Kylemore nicht, erklärte der Direktor. »Na gut«, sagte Coffey. »Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt.« Und er begab sich geradewegs zu Kylemores größtem Konkurrenten, den Cootehill Distilleries, unmittelbar gegenüber. Von wegen! Bei Cootehill erzählte man ihm, sie hätten bereits einen Mann in New York. »Schön«, sagte Coffey. »Na schön. Und wie wär’s mit Kanada?« Ja, sie hätten nichts dagegen, daß er ihren Whisky in Kanada an den Mann brächte. Da er doch selbst für die Überfahrt aufkam, warum nicht? Ein kleines Fixum? Ja, das würde sich machen lassen.
Na also! Bevor er abreiste, organisierte er noch zwei Nebenbeschäftigungen. Die eine bestand in einer nordamerikanischen Vertretung für Coomb-Na-Baun Strickwaren, die ihm die Dubliner Zentrale gegen die Einwände der Corker Filiale anvertraute. Dazu kam dann noch eine bescheidene Tätigkeit als amerikanischer Vertreter für Dromore Tweeds in Carrick-on-Shannon, wo ein alter Schulkamerad von Ginger Teilhaber war. Und so waren denn er, Veronica und Paulie vor sechs Monaten, nach vielen Abschiedsbesuchen, nach Montreal aufgebrochen, dem großen Abenteuer entgegen. Endlich sein eigener Herr!
Nur mußte man leider davon absehen, daß er jetzt, sechs Monate später, nicht länger sein eigener Herr war. Um Viertel vor zwölf, nachdem er das Nickelodeon von vorn bis hinten durchgelesen hatte, saß er noch immer erwartungsvoll da und lächelte die Empfangsdame an. Da kam sie zu ihm herüber. »Ich fürchte, Herr Beauchemin wird über die Mittagszeit aufgehalten werden. Könnten Sie vielleicht um halb drei noch einmal vorsprechen?«
{20}Coffey stellte sich Mr. Beauchemin als verschnürtes Bündel auf dem Teppich in seinem Büro vor. Ja, sagte er, das könne er wohl tun.
Hinunter ging’s im Expreßlift, durch die Vorhalle und auf die Straße hinaus. Die mittägliche Menge hastete über die vereisten Bürgersteige, um von einer Zentralheizung zur anderen zu gelangen. In einer schwingenden Linie, wie eine Revue, mit untergehakten Armen und hohen Stimmen, die der Wind fast sofort davontrug, überholten ihn sechs Büromädchen. So eingemummelt, wie sie waren, ließ sich nicht erkennen, wie sie aussahen. Er ging eine Weile hinter ihnen her, ein altes Spiel von ihm: In diesem Augenblick hatte ihm ein überirdischer Geist zugeflüstert, es wären alles Huris aus dem Paradies, die seiner Wünsche harrten, aber nur eine einzige dürfe er auswählen und dabei keines der Mädchengesichter ansehen. Die Wahl mußte nach der Rückenansicht getroffen werden. Also gut denn, er entschied sich für die Große in der Mitte. Daraufhin folgte er ihnen bis zur Kreuzung der Peel und der Sainte Catherine Street und begutachtete ihre Gesichter, als sie am Rand des Fahrdamms hielten, um eine Lücke im Verkehrsstrom abzuwarten. Das erwählte Mädchen hatte ein Pferdegesicht. Er hätte lieber die Kleine rechts außen nehmen sollen. Wie auch immer, keine von ihnen war auch nur halb so hübsch wie seine eigene Frau. Er wandte sich ab.
Geschäftsleute, die sich die Hutkrempen festhielten, stießen beim Vorbeidrängen an seine ziellos dahinschlendernde Gestalt. Ein Taxi hielt neben ihm, die Ketten um die Reifen knirschten im braunen Zucker des bestreuten Fahrdamms; dem Wagen entstiegen sechs Rotarier, die mit ihren schneebedeckten Gummischuhen die Stufen zu {21}einem Hotel hinaufliefen und große Spuren auf dem weinroten Läufer zurückließen. Ein Packen Zeitungen, von einem Gnom in Lederjacke über die Ladeklappe eines Lastwagens geworfen, fiel ihm vor die Füße. Er blieb stehen und las die oberste Schlagzeile, als schon ein Zeitungshändler aus dem nahen Kiosk geschossen kam, um die Ware in Sicherheit zu bringen.
EHEFRAU UND LIEBHABER
ERSCHLAGEN VERKRÜPPELTEN GATTEN
Dabei fiel ihm ein, er hatte Veronica noch nicht angerufen.
Langsamer Bummel über den Dominion Square, wo jeder außer ihm Eile hatte, jedes Gesicht im stechenden Wind zu einer Grimasse erstarrt war, Augen zugekniffen, Lippen zusammengepreßt, wo jeder von der grausamen Witterung in ein anomales, gebeugtes Dahinhasten hineingetrieben wurde. Er kam an einem Denkmal von Robert Burns vorüber und dachte bei sich, daß dieser schneeverwehte Platz nicht gerade der geeignetste Ort war, den Schotten auf ein Postament zu stellen. Und auch das erinnerte ihn an seine Fehlschläge: Burns’ Gebräu wurde hierzulande, auf diesem Kontinent, sehr viel häufiger verlangt als Usquebaugh. »Usquebaugh ist der Name des Getränks, Mr. Montrose, jawohl, eine Erfindung von uns Iren, etwas ganz anderes als Rye oder Scotch. Ich habe auch eine kleine Broschüre hier, irische Kaffeerezepte …« Promotion nannte man das hier, Werbung, Reklame. Erst mußte man werben, dann konnte man verkaufen. Aber für die Dummköpfe in Irland zählte Werbung nicht zur Arbeit.
{22}Lieber Coffey,
Ihr Schreiben vom Sechsten liegt uns vor. Ehe wir diese Auslagen, die uns recht hoch erscheinen, übernehmen können, möchten unsere leitenden Herren gern wissen, wie viele feste Kunden Sie garantieren. Wir sind nämlich der Ansicht, daß Sie bislang nicht …
Das war Anfang Oktober. Er hätte das Menetekel bemerken müssen. Statt dessen griff er seine eigenen Mittel an, um das Schiff flott zu erhalten. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Die Dummköpfe weigerten sich, auch nur die Hälfte seiner Spesen zu bezahlen. Und dann, einen Monat später, erhielt er in ein und derselben Woche gleich drei Briefe mit irischen Marken, als habe sich hinter seinem Rücken ganz Irland gegen ihn verschworen.
Lieber Coffey,
es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, daß bei unserer letzten Aufsichtsratssitzung folgender Beschluß gefaßt worden ist: Infolge der gegenwärtigen Dollar-Einschränkungen und in Anbetracht der hohen »Werbekosten«, die Sie ansetzen, sehen wir uns zur Zeit außerstande, unser Arrangement mit Ihnen aufrechtzuerhalten. Wir können daher in Zukunft weder die Miete für Ihr Büro übernehmen noch Ihnen ein monatliches Fixum zahlen …
Lieber Coffey,
vier Bestellungen von Großhändlern und Einzelbestellungen von sechs Geschäften, die nicht wiederholt wurden, rechtfertigen die Summe nicht, mit der Sie uns belasten. Und eine Werbung zu den Kosten, die Sie angeben, kommt nicht in Betracht. Coomb-Na-Baun Knitwear hat stets mit {23}einem bescheidenen Absatz auf Ihrer Seite des Ozeans rechnen können, ohne jede besondere Werbung, und so halten wir es im allseitigen Interesse für das beste, unsere Zusammenarbeit mit Ihnen aufzugeben …
Lieber Ginger,
Hartigan meint, wir täten besser daran, je nach Anfall, einen Reisenden in Städte wie Boston, New York und Toronto zu schicken, der Modelle vorführen und Bestellungen entgegennehmen kann, wie es die britischen Bekleidungsfirmen tun. Die anspruchsvollen amerikanischen Methoden sind zu kostspielig für Carrick-on-Shannon, deshalb sei doch bitte so gut und schick uns die Mustermappen zurück …
Diese Briefe verbrannte er. Um zu sparen, gab er die Wohnung auf und zog in diese billige Bude. Aber Veronica gegenüber schwieg er. Zwei Wochen lang hockte er in seinem gemieteten Büro über den Stellenanzeigen in den Zeitungen und raffte sich hin und wieder lustlos auf, wegen eines Jobs nachzufragen. Aber das Problem war, was seit jeher das Problem war: Er hatte es nicht ganz bis zum B.A. gebracht, die Jahre im Wehrdienst waren verschwendet, die Stellen bei Kylemore und Coomb-Na-Baun qualifizierten ihn nicht für andere Jobs. In sechs Monaten wurde er vierzig. Er dachte an Pater Cogleys Warnung.
Rechts vorn in der Schulkapelle stand die Kanzel. Darunter saß der fünfzehnjährige Ginger Coffey, und oben predigte Pater Cogley, ein Redemptoristen-Missionar, von Zuflucht und Einkehr. »Da gibt es immer einen Jungen« – sagte Pater Cogley – »immer einen Jungen, der will {24}sich nicht so wie wir anderen Sterblichen hier auf Erden einrichten. Er ist etwas Besonderes, so denkt er. Er möchte hinaus in die große weite Welt und Abenteuer erleben. Er ist eben etwas Besonderes. Nun, schön, auch Luzifer hielt sich für etwas Besonderes. Ja, das tat er. Nun, dieser Junge, der sich für etwas Besonderes hält, das ist der Bursche, der nie Lust hat, seine Studien zu Ende zu bringen. Irland ist für ihn nicht gut genug, es muß England oder Amerika sein oder Rio de Janeiro oder irgend so ein Ort. Also, was macht er? Er verbrennt seine Bücher, und weg ist er. Und was geschieht dann? Nun, das will ich euch sagen. In neun von zehn Fällen endet der Bursche als Arbeiter mit Schaufel und Hacke, oder bestenfalls verdient er sich zwei Pennies als Federfuchser in einer Hölle auf Erden, irgendeinem Ort, wo alles in der glühenden Sonne verfault oder in Schnee und Eis erstarrt, dort, wo kein natürlich empfindender Mensch auch nur tot sein möchte. Und warum das alles? Weil ein so gearteter Junge unfähig ist, seine von Gott gegebenen Grenzen anzuerkennen, weil in einem so gearteten Jungen keine Gottesliebe steckt, weil ein so gearteter Junge nur ein ganz gewöhnlicher fauler Lump ist und sein ganzes Gerede von Abenteuern nur eine Ausrede und Entschuldigung dafür, daß er ausrückt und Todsünden begeht …« – Pater Cogley senkte den Blick: Er senkte ihn genau in die Augen Ginger Coffeys, der ihm, vor einer halben Stunde erst, hatte beichten müssen. – »Eines will ich diesem Jungen sagen«, erklärte Pater Cogley, »wenn du deine Bücher verbrennst, verbrennst du deine Boote. Und wenn du deine Boote verbrennst, gehst du unter. Du gehst in dieser Welt und du gehst im Jenseits unter. – Und dann wehe dir!«
Natürlich war das alles nur Missionarsgedröhne {25}gewesen. Aber obwohl Coffey alles vergessen hatte, was ihm je gepredigt worden war, diesen Sermon hatte er nicht vergessen. Oft hatte er daran gedacht; er hatte daran gedacht in jener dritten Dezemberwoche, als Veronica alles herauskriegte. Sie weinte. Sie erklärte, sie habe das seit langem kommen sehen. (Typisch für sie.) Sie sagte, wenn er nicht bis Weihnachten eine neue Stellung fände, müßten sie mit dem ersten Schiff heimfahren, das im neuen Jahr abging. Sie sagte, sechshundert Dollar hätten sie für die Rückreise beiseite gelegt, und er habe versprochen, daß sie heimfahren würden, wenn aus dem Leben in Kanada nichts wurde. Und es war nichts daraus geworden. »Und deshalb – sieh uns doch an«, sagte sie, »wir kennen hier niemanden. Niemand würde auch nur eine Hand rühren, wenn wir auf der Straße lägen und zu Eisklumpen erstarrten. Du hast es mir versprochen. Laß uns hier weggehen, ehe wir uns die Fahrkarten für die Heimreise erbetteln müssen. Zu Hause kennst du allerlei Leute. Da findest du immer irgend etwas. Sieh mal, am zehnten Januar geht ein Schiff von Halifax ab. Ich reserviere uns schon mal die Plätze …«
»Aber, es ist doch noch nicht einmal Weihnachten«, sagte er. »Warum denn so eilig? Ich finde schon etwas. Kopf hoch!«
Weihnachten kam und ging, aber der Schnee war das einzige Geschenk, das sie bekamen. Den Beginn des neuen Jahres feierten sie damit, daß Veronica zu packen anfing, sobald im Radio Auld Lang Syne ertönte, während er, allein im dunkelgrauen Wohnzimmer, zu dem Entschluß gelangte, am zweiten Januar, sobald die Büros öffneten, sich zu demütigen und den Gang zum Arbeitsamt anzutreten. Weil er ja schließlich irgendeinen Job finden mußte. Weil es nämlich noch eine Sache gab, die er ihr gar nicht {26}erzählt hatte. Das Geld für die Fahrkarten war nicht mehr vorhanden. Tatsächlich besaß er im ganzen nur noch – egal! Lieber nicht daran denken, es war zu schrecklich.
Und heute war der Stichtag. Der Wind hatte sich verstärkt. Der Schneefall hatte aufgehört, und seine Ohren begannen zu brennen, als hätte er einen Schlag darauf bekommen. Er sah in ein Schnellrestaurant hinein, sah Menschen zu dritt nebeneinander in der Schlange an der Theke entlang vorwärts drängen, Kellnerinnen stapelten Teller auf, legten Papiertücher und stellten frische Wassergläser vor jeden, der zu trödeln wagte: nein, einen Unterschlupf gab es nicht in Childs Restaurant. Aber er mußte Veronica anrufen – sie vorbereiten. Also trat er ein, ging zum Telefon.
»Bist du das, Schätzchen?« –
»Hast du die Fahrkarten, Ginger?«
»Also, nein, noch nicht, weißt du. Darum ruf’ ich dich ja gerade an. Siehst du, Liebling, mitten aus heiterem Himmel bin ich auf dem Weg in die Stadt einem Mann begegnet, der hat mich auf einen Job aufmerksam gemacht. Und da möchte ich doch immerhin mal anfragen.«
»Was für ein Mann?«
»Du kennst ihn doch nicht, Liebling. Die Sache ist die, ich habe heute nachmittag einen Termin um halb drei.«
»Heute ist der letzte Tag, um die Fahrkarten abzuholen«, sagte sie. »Wenn du sie nicht abholst, wird man sie anderen Leuten geben.«
»Das weiß ich, Liebling. Die Sache ist die, ich möchte bis nach diesem Gespräch warten. Um drei bin ich bestimmt damit fertig. Dann ist immer noch ein Haufen Zeit, um die Karten zu holen, wenn es mit dem Job nichts wird.«
{27}»Aber was für ein Job ist das denn?«
Verdammt! Er griff sich in die Brusttasche und zog ein Stück Papier hervor. Es war der zweite Zettel, den Donnelly ihm gegeben hatte, und er hatte schon begonnen, ihn vorzulesen, als er seinen Fehler bemerkte. »Gesucht«, las er. »Aggressiver Werbefachmann für die Akquisition von Geldspenden für die Krebsforschung. Angebote an H.E. Kahn, Zimmer 200, Doxley Building, Sherbrooke Street.«
»Das klingt aber nicht nach einer Dauerstellung«, sagte sie.
»Und wennschon, Liebling. Es hält uns vorläufig über Wasser.«
»Wenn wir hierbleiben sollen«, meinte sie, »mußt du etwas Festes finden, Ginger. In deinem Alter kannst du es dir nicht mehr leisten, ständig zu wechseln. Das weißt du doch.«
»Gewiß, Liebling. Wir – wir reden später noch darüber. Auf W …«
»Warte! Ginger, hör zu. Wenn dieser Job nur eine Zwischenlösung für ein paar Wochen ist, nimm ihn nicht an. Hol die Karten.«
»Ja, Liebling. Also dann, Wiedersehen.«
Er legte den Hörer auf und verließ die Telefonzelle. Es mußte doch auch im Leben ein Gesetz der Serie geben, genau wie im Spiel. Und wenn jemand lange genug eine Pechsträhne gehabt hatte, dann er.
Eine Kellnerin winkte ihm mit der Speisekarte, doch er dachte an die vierzehn einsamen Dollar in seiner Tasche. Er ging hinaus, aber es war zu kalt, um auf dem Platz herumzulungern. Wohin also? Er blickte über den schneebedeckten Park; drei alte Mütterchen gingen die Stufen zur Kirche empor. In Gottes Haus war es warm. Wie lange {28}schon hatte er keinen Fuß mehr hineingesetzt? Seitdem er von zu Hause aufgebrochen war – und er hatte es nicht einmal vermißt. Vielleicht …? Na gut, es würde ihm nicht schaden, oder?
Die Dunkelheit im Innern war ihm vertraut. Er lauschte auf das Gurgeln in den Wasserrohren, suchte sich eine Bank in der Nähe eines Heizkörpers und schob sich hinein. Katholische Kirchen waren überall gleich. Rechts die Kanzel (Schatten Pater Cogleys!) und links der Muttergottesaltar (Frauendomäne) mit Votivkerzen auf einem Bänkchen darunter. Er mußte daran denken, wie er als Junge der Langeweile der Messe damit zu entgehen versuchte, daß er die Kerzen zählte, Sixpence für die großen, Threepence für die kleinen, und den Profit für die Priester abschätzte.
Coffeys Vater, ein Rechtsanwalt, war im braunen Dominikanerhabit des Dritten Ordens begraben worden. Das sagte genug. Sein älterer Bruder Tom wirkte als Missionar in Afrika. Aber weder er noch Veronica waren das, was man in Dublin Frömmler nannte. Weit davon entfernt. Einer der geheimen Gründe, warum er in die Neue Welt flüchten wollte, lag ja gerade darin, daß Gottesdienst in Irland keine Frage der Entscheidung war. Verdammt noch mal, man hatte hinzugehen, sonst wurde man, ob Schuster, ob Schneider, ob reich oder Hungerleider, Soldat oder Seemann, noch auf Erden mit Pech und Schwefel gepeinigt. Hier, hier war er frei!
Und trotzdem … Wie er jetzt auf den Altar starrte, stieg ihm die Warnung des Missionars im Gedächtnis auf. Wenn es nun doch nicht alles nur Unsinn war? Wenn sein Bruder Tom, der sich darüber sorgte, daß ihm die Moslems seine afrikanischen Schäfchen abspenstig machten, {29}letztlich doch recht hatte? Nur mal angenommen. Angenommen, all die Gebete, Bußübungen, Verheißungen wären Wahrheit? Angenommen, der Arme im Geiste würde das himmlische Königreich gewinnen? Und nicht er.
Denn er war nicht arm im Geiste. Er war arm schlechthin. Wie stand es denn mit ihm? Wenn er all dies Zeug von einem Leben nach dem Tode nicht glaubte, was glaubte er dann? Was für ein Ziel hatte er im Leben? Nun – nun, vermutlich wollte er einfach sein eigener Herr sein, für Vera und Paulie sorgen, und … Und was noch? Verflucht! Er fand dafür keine Worte. Etwas aus sich machen, wie? Schön, und genügte das? Und würde es ihm gelingen? Vielleicht gehörte er zu den Leuten, die von keiner Welt das beste Teil erwischen, zu denen, für die der Herr keine Zeit hat, zu den Lauen, die nicht Fisch noch Fleisch sind, weder große Sünder noch Heilige? Und möglicherweise darum, weil er nicht arm im Geiste war, weil er nie arm im Geiste, nie für Betteln und Buße gewesen war, vielleicht hatte Gott deshalb die ganze Zeit auf ihn gelauert, hatte ihm hier ein kleines Mißgeschick und dort eine kleine Hoffnung zukommen lassen, seine Träume zunichte gemacht und ihn im Strom der Zeit immer weiter abtreiben lassen, weit weg vom Glück, bis jetzt, zu diesem Punkt, in der Mitte des Lebens, wo er in einem Land von Eis und Schnee festsaß. Wenn es dort oben einen Gott gab: war es das, was Gott wollte? Ihn arm im Geiste zu machen? Ihn so weit zu bringen, daß er um Frieden bitten, aufgeben und sich zu den anderen Schafen in die Herde einreihen würde?
Er sah zum Tabernakel hinüber. Sein breites rotes Gesicht blickte finster drein, als hätte ihn jemand geschlagen. Seine Lippen unter dem rötlichblonden Schnurrbart {30}preßten sich fest aufeinander. Tyrannen konnte ich nie ausstehen, sagte er zu dem Tabernakel. Hör jetzt genau zu. Ich bin hier hereingekommen, um, na, vielleicht ein Gebet zu sprechen, und ich bin der erste, der zugibt, daß das ganz schön unverschämt von mir war, wenn man bedenkt, wie ich dich all die Jahre vernachlässigt habe. Aber jetzt kann ich nicht beten, denn beten, weil du mich bestrafst, das wäre doch geradezu Feigheit. Und wenn du Feiglinge haben willst für deinen Himmel, dann viel Glück!
Er griff nach seinem grünen Hütchen und verließ die Kirche.
Um zwei Uhr dreißig betrat Mona Prentiss, die Empfangsdame, das Büro von Georges Paul-Emile Beauchemin, Direktor der Public-Relations-Abteilung der Firma Canada Nickel, und händigte ihm Coffeys Fragebogen aus. Jawohl, der Mann saß draußen, er wartete seit dem Vormittag. Ob Mr. Beauchemin ihn zu sehen wünsche?
Mr. Beauchemin hatte etwas Zeit totzuschlagen. Er kam gerade von einem ausgezeichneten Mittagessen, das er jemandem im Austausch für zwei Eintrittskarten zum Hockey spendiert hatte. In einer halben Stunde, bei der allwöchentlichen Besprechung, gedachte er die Karten Mr. Mansard zu überreichen. Mr. Mansard war Vizepräsident und Hockeyfan. Deshalb war Mr. Beauchemin in guter Stimmung. »Führen Sie den Burschen ’rein«, sagte er.
Miss Prentiss kam den Flur zurückgeschwebt. »Wollen Sie mir bitte folgen?« Und Coffey folgte, plötzlich von dem Wunsch gepackt, er hätte seinen blauen Anzug angezogen, obwohl er schon etwas fadenscheinig war. Und dabei betrachtete er ihre hübsch gerundeten {31}Hinterbacken, die sich am grauen Flanell des Rockes rieben, hohe schmale Absätze, tick, tack, Kaschmirpullover, blonde Locken. Eine reizvolle Rückenansicht, aber er konnte sie nicht recht genießen. Ihm wurde fast schlecht vor Aufregung, denn worin lagen eigentlich seine Qualifikationen für diesen Job? Worin?
»Mr. Coffey«, sagte sie und schloß die Tür hinter ihnen. Und – hurra! Das war der richtige Mann. Denn wunderbarerweise hatte Coffey diesen Mr. Beauchemin schon kennengelernt, hatte ihn im November auf einer Party im Presseklub getroffen, wohin Gerry Grosvenor das Ehepaar Coffey eingeladen hatte.
»Hallo!« sagte Coffey also und kam gemütlich, die große Hand ausgestreckt, die Schnurrbartenden im Lächeln erhoben, auf den anderen zu. Und Beauchemin nahm die dargebotene Hand und suchte krampfhaft in seinem Gedächtnis, um den Mann unterzubringen. Er konnte sich aber partout nicht an ihn erinnern. Vom Typ her Engländer und, wie die meisten Engländer, irgendwie eigenartig. Man brauchte sich nur diesen winzigen grünen Hut anzusehen, den weiten, kurzen Automantel und die Schuhe aus Wildleder. Ein Mann in dem Alter sollte besseres zu tun haben, als sich wie ein Collegejunge anzuziehen, dachte Beauchemin. Er blickte in Coffeys rotes Gesicht und auf seinen breiten, militärischen Schnurrbart. Georges Paul-Emile Beauchemin hatte nicht gedient. Dieser Schnurrbart konnte ihn nicht beeindrucken: O nein.
»Ich nehme an, Sie erinnern sich nicht an mich?« fragte Coffey. »Ginger Coffey. Ich war für Cootehill Destilleries hier. Hab Sie mal im Presseklub kennengelernt, mit Gerry Grosvenor, dem Karikaturisten.«
{32}»Ja, natürlich«, meinte Beauchemin unbestimmt. »Der alte Gerry, was? Sie sind – hm – Sie sind Ire, was?«
»Ja«, erklärte Coffey.
»Am guten alten Paddy’s Day, was?«
»Ja.«
»Gibt viele Iren hier, wissen Sie. Letztes Jahr bin ich mit meiner kleinen Tochter zur Paddy’s Day Parade auf der Sherbrooke Street gegangen. Ist sehr lustig, was?«
»Ja, nicht wahr?« sagte Coffey.
»Dann arbeiten Sie also nicht mehr für – hm …« Beauchemin warf einen Blick auf den Fragebogen, »für die Destillerie?«
»N-nein. Es haben sich verschiedene Veränderungen in der Geschäftsleitung ergeben, und man wollte mich zurückholen. Aber mir gefällt es hier, wir hatten uns so gut eingelebt, das Kind geht in die Schule, na und so weiter. Mitten im Schuljahr ist es nicht gut, die Schule zu wechseln, also habe ich beschlossen, mein Glück hier zu versuchen.«
»Natürlich«, sagte Beauchemin. »Zigarette?« Vielleicht war der Kerl von jemandem aus dem oberen Stockwerk geschickt worden? Besser, man sondierte erst einmal die Lage. »Woher haben Sie erfahren, daß wir nach einem Hilfsredakteur suchen?« Coffey sah seinen kleinen grünen Hut an. »Na ja, das waren – äh – die Leute vom Arbeitsamt. Die haben die Stelle erwähnt.« Beruhigt (denn wenn es eine Empfehlung von oben gewesen wäre, hätte er eine Aktennotiz hinaufschicken müssen) lehnte Beauchemin sich zurück und nahm ungeniert den Fragebogen zur Hand. Ein Niemand. Man konnte ihn aus Altersgründen wegschicken.
»Hm, schade, schade«, sagte er. »Denn – wie sagten Sie noch war Ihr Vorname?«
{33}»Ginger. Hieß schon als Junge so. Wegen dem roten Haar, wissen Sie.«
»Tja, Gin-ger, ich fürchte, diese Stelle ist nicht das richtige für Sie. Wir brauchen einen ganz jungen Mann.«
»So?«
»Ja, irgendein Jüngelchen, das vielleicht ein paar Jahre für ein Provinzblatt gearbeitet hat, jemanden, den wir anlernen können, weiterbringen, wenn er sich macht.«
»Ich verstehe«, sagte Coffey. Er saß kurze Zeit still da, blickte auf seinen Hut. Idiot! Blöder, taktloser Idiot! Warum hast du nicht abgewartet, ob er sich an dich erinnert? Er kennt dich einen Dreck, und du platzt herein mit ausgestreckter Hand! O Gott! Los, steh auf, bedank dich und hau ab!
Aber er brachte es nicht fertig. In seiner Phantasie tutete eine Schiffssirene, alle Besucher von Bord! Er, Veronica und Paulie standen mit Tränen in den Augen auf dem Zwischendeck und winkten seinem gelobten Land zum Abschied zu. Nein, jetzt war nicht die Zeit, stolz zu sein. Sollte er es versuchen? Fragen?