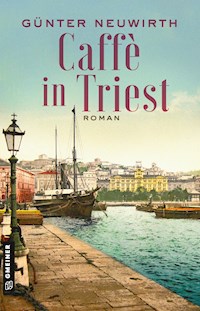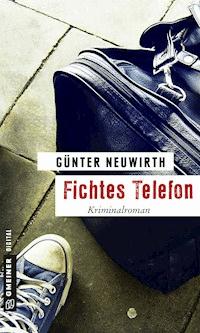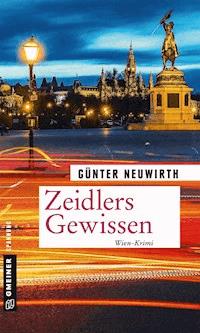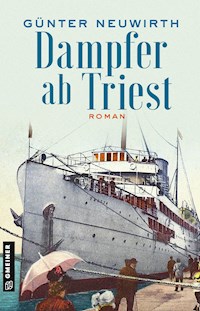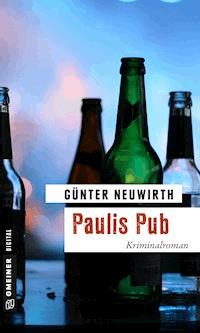Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Hoffmann
- Sprache: Deutsch
Nachts am winterlichen Donaukanal inmitten von Wien. Inspektor Wolfgang Hoffmann bemerkt in der Straßenbahn eine rätselhafte Frau, die offenbar von einem Jugendlichen verfolgt wird. Der eigentlich beurlaubte Inspektor fürchtet um ihre Sicherheit und folgt den beiden. Schon bald tauchen Fragen auf. Wozu trägt die Frau einen Revolver bei sich? Was will der Jugendliche von ihr? Es gibt nur einen Weg, um Antworten zu finden. Hoffmann muss in die dunkle Geschichte der Frau im roten Mantel eintauchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Neuwirth
Die Frau im roten Mantel
Kriminalroman
Zum Buch
Dunkle Geheimnisse Inspektor Hoffmann hat sich wegen einer Krebstherapie vom Dienst freistellen lassen. Eines Abends fällt ihm in der Straßenbahn eine Frau in einem roten Mantel auf, die offenbar von einem Jugendlichen verfolgt wird. Hoffmann befürchtet einen Überfall und folgt den beiden. Als die Frau plötzlich eine Waffe zieht, schreitet Hoffmann ein. Alice Berg hat Erinnerungslücken und weiß nicht, wie die Waffe in ihre Hand gekommen ist. Hoffmann nimmt die Waffe an sich. Tage später taucht Alice bei Hoffmann auf. So erfährt er, dass ihr Ehemann und ihre Kinder Corinne und Oscar verschwunden sind. Hoffmann begibt sich auf die Suche und wird dabei immer tiefer in die dunklen Geheimnisse der Familie Berg hineingezogen.
Günter Neuwirth wuchs in Wien auf. Nach einer Ausbildung zum Ingenieur und dem Studium der Philosophie und Germanistik zog es ihn für mehrere Jahre nach Graz. Der Autor verdient seine Brötchen als Informationsarchitekt an der TU Graz und wohnt am Waldrand der steirischen Koralpe. Günter Neuwirth ist Autodidakt am Piano und trat in jungen Jahren in Wiener Jazzclubs auf. Eine Schaffensphase führte ihn als Solokabarettist auf zahlreiche Kleinkunstbühnen. Seit 2008 publiziert er Romane, vornehmlich im Bereich Krimi. www.guenterneuwirth.at
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Totentrank (2017)
Paulis Pub, E-Book only (2016)
Fichtes Telefon, E-Book only (2016)
Hoffmanns Erwachen, E-Book only (2016)
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © unclepodger / fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5530-8
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Mittwoch
1. SZENE
»Das werde ich dir heimzahlen! Bare Münze.«
Alice Berg stand in der Tür. Ihr Blick verlor sich in den dunklen Ecken des geräumigen Zimmers. Sie hasste diesen Geruch.
»Da kannst du Gift darauf nehmen.«
Alles konnte Alice ausblenden, Lärm, Geschwätz, nervtötende Musik in Kaufhäusern, grelles Licht, die Gesichter der vielen Menschen auf Bahnhöfen oder in Fußgängerzonen. Alles einfach wegschalten. Sie hatte diese Lektion in ihrem Leben gelernt, es sogar zu einer stillen Meisterschaft darin gebracht. Eine Stärke des Geistes, eine Tugend, eine Überlebensstrategie. Alles weg außer eines: Gerüche! Das hatte sie nie geschafft. Gerüche bohrten sich in ihren Kopf. Konnte das Gehirn überhaupt riechen? Man roch doch mit der Nase. Was hatte das Gehirn mit Gerüchen zu tun? Alice dachte angestrengt darüber nach. Es fielen ihr keine Antworten ein. Ihr Gehirn versagte jeden Dienst. Sie wusste warum. Wegen des Geruchs. Hildegards Geruch.
»Wo ist Jürgen?«
Alice Berg hörte die alte Frau nicht, sie hörte das endlose Gekeife, die fortwährenden Vorwürfe, die schlechten Launen einfach nicht. Viel schlimmer. Sie roch sie. Sie musste fort von hier. Auf dem schnellsten Weg.
»Alice, verdammt noch mal, hör mir endlich zu! Ich verlange eine Antwort!«
Bestimmt gab es auf der Welt einen Ort, an dem sie glücklich sein konnte. Es musste ein luftiger Ort sein. Ein hoch gelegenes Bergtal im Wallis. Eine Palmeninsel in einem pazifischen Atoll. Eine stille Finca auf den Kanaren inmitten eines weitläufigen Pinienwaldes.
»Wo ist Jürgen? Wo ist mein Sohn?«
Alice löste sich langsam aus ihren Gedanken und schaute zum breiten Bett, auf dem Hildegard seit drei Jahren lag und starb. Würde die alte Hexe endlich ans Ziel kommen! Die Möbel müssten natürlich verschwinden, der Raum neu gestrichen und die Vorhänge verbrannt werden.
»Wo sind die Kinder?«
Alice seufzte.
»Das habe ich dir doch erklärt. Unzählige Male schon.«
»Du hast mich angelogen!«
»Nein.«
»Du lügst, sobald du nur den Mund aufmachst.«
»Nein.«
»Du hast Jürgen ermordet!«
Alice sagte nichts. Wozu sollte sie auch? Seit Jahren ging das nun schon in dieser Tonart. Welche Sünden hatte sie sich in ihren früheren Leben zuschulden kommen lassen?
»Gute Nacht, Hildegard.«
Alice knipste das Deckenlicht aus und schloss die Tür hinter sich. Sie wusste nicht, ob die alte Frau ihr noch etwas hinterher rief, ob sie wieder schimpfte, wieder mit absurden Vorwürfen um sich warf. Langsam schritt sie die Treppe hinab. Der Teppich schluckte jeden Tritt. Sie hatte gelernt, sich in diesem großen alten Haus still zu bewegen. Ein Gespenst auf den Treppen. Nur gerade so viele Lichter waren eingeschaltet, um nicht zu stolpern. Stille und Dunkelheit. Fort. Fort von hier. Alice stand in der Küche und schaute in den finsteren Garten hinaus. Nur wenig Schnee lag auf der Wiese und den Ästen der Tannen.
Draußen war die Kälte. Draußen war das Leben. Wo war sie?
2. SZENE
Wolfgang Hoffmann klappte den Kragen seiner Jacke hoch und zog die Mütze in die Stirn. Er lugte durch das Glas der Tür ins Freie. Fiel Schnee? Pfiff nach wie vor der kalte Wind durch die Straßen? Er stemmte sich gegen die Tür und marschierte mit hochgezogenen Schultern los. Mit Erleichterung nahm er zur Kenntnis, dass der kalte Wind abgeflaut war. Auf den Scheiben und Dächern der parkenden Autos lag ein hauchdünner Flaum aus Pulverschnee. Nachmittags hatte der Wetterbericht im Radio ein baldiges Ende der Kälteperiode angesagt.
Hatte er in seiner Kindheit wirklich jemals weiße Weihnachten erlebt? Oder hatte er von tief verschneiten Weihnachten nur in den Erzählungen der Großeltern gehört oder einprägsame Bilder aus amerikanischen Filmen in Erinnerung? In Hollywood war alles möglich, weiße Weihnachten mit glücklichen Kindern, ewiger Sonnenbrand vor pausenlosen Sonnenuntergängen und fesche Polizisten, die völlig unbeschadet von Dächern sprangen oder mit Cabrios durch Feuersbrünste rasten.
Er trottete gemächlich in Richtung Straßenbahnhaltestelle. Eilig hatte er es nicht. Jetzt nicht, und früher, als er noch im Dienst gewesen war, hatte er es auch nicht eilig gehabt. Also zumindest an den guten Arbeitstagen. An die schlechten konnte er sich gar nicht mehr erinnern. Man musste sich nicht an alles erinnern, auch wenn man über ein recht gutes Gedächtnis verfügte.
Loslassen!
Das hatte die Psychologin während der Therapiestunden in der Klinik wiederholt gesagt. Herr Hoffmann, Sie müssen loslassen. Ich werde es versuchen, hatte er geantwortet und an den letzten Stuhlgang gedacht. Eine nette Frau, die Psychologin, sie hatte sich wirklich bemüht. Sie hatte ihm das auch mit den Strategien erklärt. Legen Sie sich eine Strategie vorab zurecht, auf die Sie dann im Ernstfall zurückgreifen können.
Loslassen – ein Besuch auf der Toilette.
Entspannen – ein kleiner Mokka im Kaffeehaus.
Fokussieren – ein Kinnhaken für Major Koller.
Hatte prima funktioniert. Was aus Koller wohl geworden war? Hatte sein ehemaliger Chef den Schreibtischstuhl im Innenministerium, den er jahrelang angestrebt hatte, endlich besetzen können? Hoffmann wünschte es ihm, denn hinter all seinen Allüren und Wutausbrüchen hatte doch ein feiner Kerl gesteckt. Auch wenn Koller im Dienst diesen Umstand mit aller Mühe zu verstecken versucht hatte. Ein feiner Mistkerl. Wie weit das alles zurücklag!
Hatte er das wirklich selbst erlebt oder waren das Erinnerungen an Szenen der Kriminalromane, die er in seiner Jugend verschlungen hatte? Schwer zu sagen. Vielleicht musste man durch die Hölle gehen, um als neuer Mensch geboren zu werden.
Hoffmann dachte an den Arzt und Sachbuchautor, dessen Vortrag und Buchpräsentation er eben besucht hatte. Die Städtischen Bibliotheken veranstalteten immer wieder interessante Abende, er war in den letzten zwei Monaten ein richtiger Fan geworden und jede Woche irgendwo zu einer Veranstaltung gepilgert. Meistens musste er gar keinen Eintritt bezahlen, er brauchte nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, dann konnte er sich in eine der hinteren Reihen setzen, die Arme verschränken und einfach zuhören. Wenn ein kleines Buffet angeboten wurde, gab er für eine Tasse Kaffee oder Tee und ein Stück Kuchen großzügig Trinkgeld, stand irgendwo eine Sammelbox für irgendein gemeinnütziges Projekt, warf er eine Münze ein, er nickte freundlich, wenn ihn jemand ansprach, sagte vielleicht sogar den einen oder anderen Satz, war unter Leuten, saß nicht alleine vor dem Fernseher, und wenn die Zeit gekommen war, ging er wieder, ohne dass sein Abgang von irgendjemandem bemerkt worden wäre.
Der Arzt hatte sich den neuesten therapeutischen Möglichkeiten bei Alzheimer gewidmet und ein Buch darüber geschrieben. Neurofeedback, BMI, das Brain Machine Interface, Hirnströme, Aktivierungspotenziale und sonst allerlei. Sehr interessant. Hoffmann konnte nicht behaupten, dass er in den anderthalb Stunden, in denen der Arzt das Thema umrissen und auf Fragen aus dem Publikum geantwortet hatte, dem Mann gegenüber auch nur irgendeine Form von Sympathie entwickelt hätte, aber als Arzt hatte der Mann etwas von seinem Fach verstanden. Zumindest so viel, um den älteren Damen aus den benachbarten Gemeindebauten gegenüber Kompetenz zu signalisieren. Wer wusste schon, vielleicht war eine der Zuhörerinnen bald seine nächste Patientin.
Krebs veränderte die Menschen. So viel stand für Hoffmann schon mal fest. Entweder man erlag der Erkrankung oder man war nach einer erfolgreichen Behandlung ein anderer Mensch. Er war ein anderer geworden. Als nach den Chemotherapien sein Haar nachgewachsen war, hatten sich Geheimratsecken gebildet, und die Schläfen waren grau geworden. Man sagte doch, viele Frauen würden sich für Männer mit grauen Schläfen interessieren. Und manche Männer mit grauen Schläfen besuchten Vorträge zu medizinischen Themen.
Eine Straßenbahn rollte an ihm vorbei. Er hätte laufen müssen, um sie zu erreichen. Nur keine Eile. Der eisige Wind war abgeflaut, er trug warme Unterwäsche, und es war knapp vor neun Uhr abends, da fuhren noch viele Züge die Hütteldorfer Straße auf und ab.
3. SZENE
Alice knöpfte die Strickweste zu und stieg in die Winterstiefel. War sie überhaupt hier zu Hause? Sie wusste es nicht so recht. War das jenes Haus, in dem sie das Heranwachsen ihrer Kinder erlebt hatte? War das jene Stadt, in der sie versucht hatte, sich heimisch zu fühlen? War das jener Körper, in dem sie seit ihrer Geburt steckte? Sie hob nicht den Blick zum Spiegel. Was hätte sie darin sehen können? Eine blonde Frau, der man die 36 Lebensjahre nicht ansah? Eine Frau, deren jugendliche Attraktivität zu weiblicher Schönheit gereift war? Viele Männer versuchten, ihr Komplimente zu machen. Das war immer schon so gewesen. Seit sie zur Frau herangewachsen war, hatten sich Männer um ihre Aufmerksamkeit bemüht. Meist hatte sie das gar nicht bemerkt. Auch heute kein Blick in den Spiegel. Sie legte ein Kopftuch um. Du siehst aus wie Grace Kelly in diesem berühmten Film aus den 50er-Jahren, hatte Jürgen einmal gesagt, als sie ein Kopftuch zum Schutz vor Wind und Wetter umgelegt hatte. Wer war Grace Kelly? Welcher Film? Alice konnte sich nicht erinnern, diesen Film jemals gesehen zu haben. Sie vergaß Filme sofort. Verließ sie den Kinosaal, war der eben gesehene Film verschwunden, knipste sie den Fernseher aus, versanken die Gesichter der Schauspieler in der Dunkelheit des Bildschirms.
Überall im Haus lauerten Albträume. Fort von hier.
Alice nahm die Daunenjacke vom Kleiderhaken. Sie rutschte ihr aus der Hand und fiel zu Boden. Unmöglich, sich zu bücken, völlig unmöglich. Also griff sie zum nächsten Kleidungsstück in der Garderobe. Jürgen hatte ihr den Wollmantel zu einem besonderen Anlass gekauft. Sie hatte vergessen, welcher Anlass es gewesen war. Eine Hochzeit? Ein Begräbnis? Unklar heute. Alice setzte die Sonnenbrille auf und verließ das Haus. Mit schnellen Schritten durchmaß sie den Garten und trat auf die Straße. Sie dachte nicht darüber nach, wohin sie wollte, sie marschierte einfach los. Mit Verwunderung nahm sie wahr, dass es dunkel war. Nacht? Hatte sie nicht eben erst das Frühstück zu sich genommen? Alles war so verschwommen. Die Nacht war gar nicht kalt. Ihr Leben war kalt.
Sie ging zügig durch die finsteren Gassen. Da vorne war mehr Licht. Wie ein Nachtfalter von den Straßenlaternen angezogen. Wo waren die Falter in dieser Nacht? Ach ja, es war Winter, die Insekten versteckten sich zu Eis erstarrt in dunklen Höhlen.
Eine Straßenbahnhaltestelle. Alice wartete auf das Eintreffen der Zuggarnitur. Geräusche, Lichter, Gerüche fremder Menschen. Der Zug war fast leer. Sie nahm Platz und richtete den Blick aus dem Fenster. Sie sah nichts von der Stadt.
4. SZENE
Die Straßenbahn rollte heran. Ein paar Leute warteten an der Haltestelle, bis sich die Türen öffneten. Hoffmann stieg vorne beim Fahrer ein. Die neuen Zuggarnituren waren in einem Stück gebaut. Früher hatten die Wiener Straßenbahnen einen Waggon gezogen. Als Jugendlicher hatte er mit seinen Kumpels vorzugsweise den Waggon benutzt, und wenn möglich, war er ganz hinten gestanden. Weil da der Fahrer es nicht spitzgekriegt hatte, wenn sich die Jugendlichen danebenbenommen hatten. Hoffmann durchmaß den Zug. Im hinteren Bereich saßen nur wenige Fahrgäste.
Sein Blick fiel auf eine Frau an einem Fensterplatz. Sie trug ein Kopftuch. Und eine Sonnenbrille um neun Uhr an einem Winterabend. Eine muslimische Frau mit blondem Haar? Eine gerade Nase, ein schönes Kinn, volle Lippen. Wie flüchtige Geister zogen diese Beobachtungen an ihm vorbei. Ein roter Mantel und schwarze Handschuhe. So kleidete sich keine Muslimin. Hoffmann passierte den Sitzplatz der Frau und langte ganz hinten nach einem Haltegriff. Er war lange genug gesessen, ein bisschen Stehen schadete nicht, auch wenn viele Sitzplätze frei waren.
Die Tram beschleunigte. Die alten Straßenbahnzüge in seiner Kindheit hatten sich noch rumpelnd und quietschend durch die Straßen bewegt, davon war heute nichts zu bemerken. Fast lautlos sauste die Garnitur die Hütteldorfer Straße hinab. Die Lichter der Stadt zogen an ihm vorbei. Die Schaufenster waren mit Weihnachtsschmuck dekoriert.
Aus den Augenwinkeln beobachtete er die Frau mit dem Kopftuch. Der Mantel musste kostbar sein. Die Frau wirkte nicht wie jemand, der mit der Straßenbahn fuhr.
Johann, fahren Sie den Bentley vor, ich bin zur Teestunde bei Baronin von Mannsbrunn geladen.
Sehr wohl, gnädige Frau.
Hoffmann schmunzelte bei dem Gedanken.
Auch der junge Mann in der letzten Sitzreihe schaute zur Frau im roten Mantel. Und dann wieder zum Fenster hinaus. Und wieder zur Frau. Wieder zum Fenster hinaus. Hoffmann sah von hinten das Gesicht des Jugendlichen nicht. Er trug eine Schirmmütze und darüber die Kapuze seines Sweatshirts, gegen die Kälte schützte er sich mit einer ärmellosen Thermoweste. Solche Jungs kannte Hoffmann zur Genüge. Jahrelang hatte er als Drogenfahnder mit ihnen zu tun gehabt. Giftler, die sich mit schmutzigen kleinen Geschäften irgendwie über Wasser zu halten versuchten, meist aber dann doch absoffen. Gelegenheitseinbrüche, auf Partys Tabletten verhökern, Gras verticken, und die Erlöse in den Eigenbedarf investieren. Ein paar dieser Jungs hatte Hoffmann von der Straße geholt, entweder, um sie ins Gefängnis zu stecken, weil irgendeine Sache ausgeufert war, oder in die Therapie, wenn noch ein Funken Hoffnung vorhanden war.
Aber vielleicht war der Jugendliche gar kein Junkie. Hoffmann hatte ihm, als er an ihm vorbeigegangen war, nicht ins Gesicht geblickt. Die Kleidung und dass er unruhig auf dem Sitz hin und her rutschte, hatten den Gedanken an einen Junkie nahegelegt, aber vielleicht irrte er ja. Hoffmann drückte fast seine Nasenspitze an die Scheibe. Er schmunzelte. Wie oft hatte er in seinem Job falsch gelegen? Mindestens 1.000 Mal pro Tag. Ein beständiges Gefühl seiner Arbeit war gewesen, mit jeder Entscheidung wieder einen Fehler begangen zu haben. Und meist hatte sich dieses Gefühl als richtig erwiesen. Da hatten die Kollegen im Kommissariat noch so sehr behaupten können, er wäre ein Vollblutpolizist, er habe Nase, er sei zwar der langsamste Kieberer der Stadt, habe aber das höchste Aufklärungstempo. Hoffmann wusste es besser. Der Einäugige ist König unter den Blinden. Ein paar Kunden hatte er gehabt, die über Adleraugen verfügt hatten, und im Duell mit diesen Leuten war Hoffmann regelmäßig und ausnahmslos wie der letzte Trottel dagestanden. Ein Name fiel ihm immer wieder ein. Kurt Wernheim. Das Schwein war ihm durch die Finger geschlüpft. Eine kleine, aber niemals heilende Wunde.
Die Straßenbahn der Linie 49 rollte von Haltestelle zu Haltestelle. Viel war in der Stadt nicht mehr los. Morgen war ein normaler Arbeitstag, bestimmt liefen ein paar tolle Filme im Fernsehen, es war kalt und dunkel, niemand, der nicht irgendeinen Grund dafür hatte, verließ die Wohnung.
Urban-Loritz-Platz. Die Tram querte den Gürtel, diese Lebensader der Stadt. Mal fuhr die U-Bahn auf der Hochtrasse den Gürtel entlang, dann wieder grub sie eine Furche zwischen die Innen- und Außenbezirke. Wie oft war er selbst schon auf dem Gürtel unterwegs gewesen? Frühmorgens, mittags und spätnachts. Und ja, eine Zeitlang hatte er sogar am Gürtel gelebt. Und eine Zeitlang war das sogar eine gute Zeit gewesen. Seine Ehe. Diese Zeit schien so unendlich weit entfernt. Wenn es nicht in seinen Dokumenten festgehalten wäre, würde Hoffmann nicht von sich behaupten, er wäre 41 Jahre alt. 140 käme wohl besser hin. Vielleicht alterte man einfach irre schnell, wenn man ausgemergelte Drogentote aus völlig versauten Wohnungen barg und dann selbst irgendwann die Venen öffnete, um einen Giftcocktail in den Kreislauf sickern zu lassen.
Irgendjemand hatte ihm geraten, vor den Chemotherapien drei oder vier Tage lang zu fasten, die Nebenwirkungen würden dadurch erträglicher sein. Also hatte er gefastet. Richtig korpulent war er nie gewesen, großes Gewicht passte nicht zu seinem Typ, aber er war ein wohlernährter Europäer gewesen. Die paar Monate in der Therapie hatten seinem Gewicht gehörig zugesetzt. Nur langsam baute er wieder Substanz auf.
Die Tram hielt an der Haltestelle Kaiserstraße. Hoffmann wandte sich der Tür zu. Weiter vorne stand die Frau im roten Mantel vor einer der Türen. Warum trug sie zu dieser Tageszeit eine Sonnenbrille? Hatte sie einen zur Gewalt neigenden Ehemann? Polizistendenken. Polizistenfragen. Die Türen glitten auf. Hoffmann trat ins Freie. Die Frau trug kniehohe Winterstiefel. Das waren keine Stiefel aus dem Winterschlussverkauf. Und die Handtasche am Arm der Frau war ganz gewiss nicht im Einkaufszentrum am Stadtrand gekauft worden. Sah nach Innenstadtboutique aus.
Die Türen der Straßenbahn schlossen sich. Der junge Mann schlüpfte im letzten Moment ins Freie. Er rammte seine Hände in die Taschen der Thermoweste. Schnelle Schritte. Die Frau im roten Mantel, der Jugendliche und zwei arglos plaudernde ältere Frauen standen bei der Haltestelle der Linie 5. Der 49er schlängelte sich durch die Gassen des 7. Bezirks. Hoffmann ging langsam zur Haltestelle. Die Frau im roten Mantel stand im Schatten eines Haustors. Der Jugendliche entfernte sich ein Stück und kehrte wieder, die beiden älteren Frauen bemerkten Hoffmann gar nicht. Lag da etwas in der Luft? Was spürte er da? Im Gegensatz zu seinen Überlegungen, Schlussfolgerungen und Analysen hatten ihn seine Instinkte selten getäuscht.
Der 5er rollte heran. Hoffmann stieg ein. Die anderen ebenso. Sah die Frau im roten Mantel durch ihre Sonnenbrille überhaupt irgendetwas? Offenbar genug, um einen Fensterplatz zu wählen und wieder hinauszustarren. Wieder nahm der Jugendliche ein paar Reihen hinter der Frau einen Platz ein. In der letzten Sitzreihe kauerte sich Hoffmann hin. Jetzt ließ er die Blicke und Gedanken nicht zum Fenster hinaus schweifen, er blieb aufmerksam. Und er war sich jetzt sicher, der Jugendliche beobachtete die Frau im roten Mantel. Warum?
Die Straßenbahn ließ den 7. Bezirk hinter sich, durchquerte den achten. Leute stiegen ein und stiegen aus. Der 9. Bezirk, das alte AKH, die Sensengasse und das Department für Gerichtsmedizin. Kein Ort, an dem sich Hoffmann gerne aufgehalten hatte, der ihm aber dann und wann nicht erspart geblieben war. Die Straßenbahn näherte sich dem Franz-Josefs-Bahnhof, schließlich der Friedensbrücke.
Hoffmann erhob sich und trat an die Tür. Die Frau stieg aus. Hoffmann kramte in seinen Taschen, zog sein Handy und tippte darauf herum, um beschäftigt zu wirken. Da war er schon. Der Jugendliche verließ wieder knapp vor dem Schließen der Türen die Tram. Er hielt Distanz, aber blieb an ihr dran. Also hängte sich Hoffmann an beide. Er war seit vielen Monaten außer Dienst, er war unbewaffnet. In Wien war es einfach nicht nötig, als Privatmann mit einer Pistole durch die Stadt zu laufen. Außer natürlich, man war ein ausgemachter Paranoiker. Von denen gab es zwar gar nicht wenige, meistens aber zogen sie ihre Waffen nicht. War der Jugendliche bewaffnet? Nach Pistole sah er nicht aus. Ein Messer? Ein Schlagring?
Die Frau im roten Mantel überquerte die Fahrbahn und verschwand in der Dunkelheit des Donaukanalufers. Hoffmann wartete und beobachtete aus der Ferne. Der Jugendliche folgte der Frau. Hoffmann fluchte. Warum rannte sie auch von der gut beleuchteten Straße fort in die Finsternis der Uferböschung?
Hinterher. Ein paar Autos zogen mit hohem Tempo die Roßauer Lände entlang. Er musste warten, dann eilte er los. In einiger Entfernung sah er die Frau im Lichtkegel einer Laterne an der Uferpromenade. Wo war der Jugendliche? Hatte er Hoffmann bemerkt und suchte sich nun ein anderes Opfer für den Handtaschenraub? Die Frau ging schnell. Hoffmann setzte sich auf eine Bank. Wo war der Bursche? Irgendwo in einem Gebüsch versteckt? Längst über alle Berge?
Wozu sich etwas vormachen? Hoffmann spürte den Kitzel. Vielleicht sollte er bald wieder seinen Dienst antreten. Er ließ den Blick kreisen. Ferne Straßenlichter, erleuchtete Fenster in den Häusern an der Lände, über die Friedensbrücke rollte eine Straßenbahngarnitur. Hoffmann schaute wieder in Richtung Promenade.
Wo war die Frau?
Hoffmann sprang auf und marschierte eilig los. Hatte der Junkie doch noch zugeschlagen, leise, irre schnell, Hoffmanns kurze Unaufmerksamkeit nutzend? Hoffmann kam zur Stelle, wo sie zuletzt durch den Lichtkegel einer Laterne marschiert war. Er schaute sich um.
Da unten am Ufer, da stand jemand in der Dunkelheit. Hoffmann verließ die Promenade und ging langsam näher. Was hatte das zu bedeuten? Warum stand sie da am schnell vorbeiziehenden Wasser? Suchte sie den Freitod in der strömenden Kälte des Donaukanals?
Aus den Augenwinkeln entdeckte Hoffmann eine Bewegung bei einem Gebüsch. Der Jugendliche. Er trat vor den Busch, ein paar Schritte auf die Frau zu, entdeckte Hoffmann und hielt inne. Hatte er zuschlagen und ihr die Handtasche entreißen wollen? Hoffmann glaubte es immer weniger. Der Bursche hatte andere Motive. Welche? Verdammt unklare Situation. Hoffmann war verwirrt.
»Hallo! Gnädige Frau! Brauchen Sie Hilfe?«
Langsam drehte sich die Frau um. Sie hatte die Sonnenbrille über das Kopftuch hoch geschoben, so viel konnte Hoffmann in der Dunkelheit erkennen, von ihrem Gesicht aber sah er wenig.
»Kommen Sie bitte von dort weg. Die Steine sind rutschig.«
Der Blick des Jugendlichen pendelte zwischen Hoffmann und der Frau.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?«
Die Frau im roten Mantel hob ihre rechte Hand. Hoffmann erahnte in der Dunkelheit bloß die Waffe in der Hand der Frau. War sie geladen? Entsichert? War das ihr Plan gewesen? Ein Schuss in den Kopf und vornüber in den Donaukanal fallen, fort gespült in die ewige Dunkelheit? Sie richtete die Waffe gegen Hoffmann. Er hob unwillkürlich die Hände.
»Legen Sie bitte die Waffe zu Boden. Mein Name ist Hoffmann, ich bin Polizist.«
Dann entdeckte die Frau den Jugendlichen. Sie schwenkte die Waffe in seine Richtung. So schnell konnte Hoffmann gar nicht schauen, da war der Bursche auf und davon. Hoffmann atmete ein wenig durch. Ein flinker Kerl, schnell im Denken und schnelle Beine. Egal was er vorgehabt hatte, er würde nicht von der Kugel einer suizidalen Frau niedergestreckt werden.
»Ich bitte Sie, legen Sie die Waffe weg.«
Endlich ließ die Frau die Waffe sinken.
»Sie sind Polizist?«
»Ja.«
»Sie tragen keine Uniform.«
»Ich bin Kriminalpolizist.«
Die Sprache der Frau hatte eine Färbung, die Hoffmann schon nach nur ein paar Worten zuordnen konnte.
»Ich komme jetzt näher.«
Die Frau antwortete nicht.
»Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name?«
Keine Antwort. Hoffmann setzte langsam einen Schritt vor den anderen.
»Sind Sie Schweizerin?«
Keine Antwort. Hoffmann stand ihr nun direkt gegenüber. Er versuchte, in ihrem Gesicht zu lesen. Unklar, was sie fühlte oder dachte, nichts davon zeigte sich in ihrer Miene. Ebenmäßige Gesichtskonturen, eine sehr schöne Frau. Warum hatte sie ihrem Leben ein Ende setzen wollen? Hatte sie das überhaupt? Vielleicht hatte sie die Waffe loswerden wollen.
»Geben Sie mir bitte die Waffe.«
Hoffmann streckte seine Hand aus. Die Frau regte sich nicht.
»Bitte. Sie müssen mir jetzt die Waffe geben.«
Die Frau legte den Revolver in Hoffmanns Hand.
»Vielen Dank. Das haben Sie sehr gut gemacht.«
Hoffmann trat drei Schritte zurück und inspizierte die Waffe. Die Trommel war voll, die Munition scharf, die Waffe war entsichert. Sein Magen verklumpte sich. Verdammt knapp. Er leerte die Trommel, ließ die Patronen in der rechten Tasche seiner Jacke verschwinden, den Revolver in der linken Tasche.
»Nehmen Sie mich jetzt fest?«
»Nein. Jetzt begleite ich Sie erstmal vom Wasser fort. Die Steine sind rutschig, und das Wasser ist kalt. Kommen Sie, ich begleite sie hinauf zur Kreuzung. Haken Sie sich ein.«
Hoffmann bot ihr den rechten Arm, sie legte ihre Hand in seine Armbeuge. Langsam stiegen sie die Böschung zur Promenade hoch. Im Schein der Laterne hielt Hoffmann an, trat einen Schritt zurück und fasste die Frau im roten Mantel noch einmal genau ins Auge. Sie begegnete seinem Blick geradezu regungslos. Hatte sie Drogen genommen? Wenn ja, was? Hoffmann war beunruhigt. Eine verdammt undurchsichtige Situation.
»Sagen Sie mir bitte jetzt Ihren Namen.«
»Alice Berg.«
Hoffmann lächelte und reichte seine Hand zum Gruß.
»Wolfgang Hoffmann.«
Sie schüttelte seine Hand.
»Sie sind Schweizerin, nicht wahr? Ich höre es an Ihrem Akzent.«
»Ich lebe seit vielen Jahren in Wien.«
Sie trug Handschuhe, also konnte Hoffmann nicht sehen, ob sie einen Ehering trug oder nicht.
»Sind Sie verheiratet?«
Alice schaute hinüber zur Friedensbrücke.
»Ich habe Brücken immer geliebt.«
Hoffmann zog die Augenbrauen hoch.
»Aus einem speziellen Grund oder einfach, weil Brücken zwei voneinander getrennte Ufer verbinden?«
Ein Schmunzeln wischte über Alices Gesicht, kurz schaute sie Hoffmann an.
»Das haben Sie sehr schön gesagt. Getrennte Ufer verbinden. Ja, vielleicht liebe ich deswegen Brücken. Vielleicht auch wegen der verschiedenen Ebenen.«
»Was meinen Sie mit Ebenen?«
»Bei Brücken gibt es immer ein Unten und ein Oben. Hier diese Brücke. Unten fließt das Wasser, oben rollen die Autos und Straßenbahnen. Herr Hoffmann, wollen Sie mich noch ein Stück begleiten?«
»Gerne. Wohin wollen Sie?«
»Nirgendwohin. Ich will nur ein wenig spazieren gehen und die klare Luft dieser Nacht genießen.«
»Wo wohnen Sie, Frau Berg?«
»Ich weiß es nicht mehr.«
Hoffmann kaute auf seiner Unterlippe. Sollte er einen Streifenwagen rufen? Sinnvoll wäre es, immerhin war die Frau mit einer scharfen Waffe unterwegs gewesen. Und sie wirkte ziemlich verwirrt.
»Wollen Sie es mir nicht sagen oder haben Sie es wirklich vergessen?«
»Vergessen. Nein, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich wohne in einem großen Haus. Es ist ein hässliches Haus. Seit Jahren kämpfe ich darum, es heller und freundlicher einzurichten. Vergeblich.«
»Wo steht dieses Haus?«
»Neben den Tannen.«
Hoffmann kramte in seinem Gedächtnis. Eine Gasse dieses Namens gab es in Wien seines Wissens nicht. Und es gab kaum eine Gasse in Wien, die Hoffmann nicht kannte.
»Ist das in Wien?«
»Darf ich mich wieder bei Ihnen einhaken? Das hat mir sehr gut getan. Ein Mann, der sich um mich kümmert, der mir seinen Arm bietet. Ein gutes Gefühl.«
Hoffmann nickte.
»Gerne, Frau Berg, aber zuerst müssen Sie mir sagen, warum Sie bewaffnet waren. Und warum Sie mit der Waffe auf mich gezielt haben.«
Alice zuckte ein wenig zurück.
»Ich wollte Sie nicht erschrecken. Wirklich nicht. Es tut mir leid.«
»Warum waren Sie bewaffnet?«
»Weil ich große Angst vor Überfällen habe.«
»Sind Sie schon einmal überfallen worden?«
Alice dachte angestrengt nach.
»Das weiß ich nicht. Ich vergesse so viel. Vielleicht leide ich schon an Demenz, obwohl ich erst 36 Jahre alt bin, vielleicht ist die Vergesslichkeit eine Folge der Medikamente.«
»Welche Medikamente nehmen Sie?«
»Sie stellen so viele Fragen, Herr Hoffmann. Das beunruhigt mich.«
Hoffmann bot ihr wieder den Arm an.
»Gut, dann lassen wir die Fragerei und gehen ein Stück.«
Alice lächelte Hoffmann an. Ein bezauberndes Lächeln.
»Ich möchte gerne über die Brücke gehen.«
Hoffmann nickte.
»Überqueren wir also die Brücke.«
5. SZENE
Lukas stemmte sich gegen das Haustor und trat in den Flur. Hier sah es immer gleich aus, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit man eintrat: Dreck, Gerümpel, beschmierte Wände, keine Lampe, vielmehr eine Funzel. Er öffnete die Tür zum Sozialraum des Autonomen Zentrums. Ein paar Kumpels waren da. Iris nickte ihm zu. Iris war immer hier, Iris hielt hier alles zusammen. Man konnte immer zu ihr, man konnte sie alles fragen, sie wusste immer Antwort. Na ja, fast immer. Iris war in Ordnung, so lange sie hier war, würde auch Lukas immer wieder kommen. Zuletzt hatte sie sich von Lukas das Haar schneiden lassen. Iris bevorzugte Kurzhaarschnitte. Haare radikal ab, das schaffte sogar er.
»Alles im Lot?«
»Geht so.«
»Bist du gelaufen?«
Seine Atmung beruhigte sich langsam.
»Von der U-Bahn hierher. Mir war danach.«
»Willst du ein Bierchen?«
Lukas wiegte den Kopf.
»Lieber grünen Tee. Kalt heute.«
Iris deutete mit einer Kopfbewegung in Richtung Küche.
»Ich glaube, der grüne Tee ist aus. Schwarzer Tee ist da. Bediene dich.«
»Ich finde schon etwas.«
»Na klar.«
Lukas suchte eine saubere Tasse, fand keine und spülte eine ab. Dann füllte er den Wasserkocher und kramte nach den Teebeuteln. Tatsächlich war die Packung mit dem grünen Tee leer. Er warf den Karton in den Papiermüll. Iris bestand auf ordentlicher Mülltrennung. Er hängte einen Beutel Ceylontee in die Tasse und wartete, bis das Wasser blubberte.
Alle im Autonomen Zentrum wussten, dass er lief, dass er der geborene Langstreckenläufer war. Ja, wenn er von einem Ende der Stadt zum anderen musste, dann nahm er schon die U-Bahn, aber für kurze und mittlere Strecken zahlte es sich für ihn gar nicht aus, sich dem Risiko auszusetzen, als Schwarzfahrer ertappt zu werden. Obwohl er schon oft in seinem Leben mit gültigen Fahrscheinen unterwegs gewesen war, damals, als er von seinen Pflegeeltern oder von den Betreuern der Jugend-WG Fahrscheine erhalten hatte. Jetzt aber konnte er sich Fahrscheine gar nicht leisten.
Corinne hatte ihm einmal einen Fahrschein gekauft. Sie waren mit dem Bus auf den Leopoldsberg gefahren. Corinne besaß eine Jahreskarte, er nicht. Deswegen waren sie immer zu Fuß unterwegs. Sie konnte mit ihm Schritt halten. Eine der wenigen.
Corinne!
Warum meldete sie sich nicht? Lukas starrte in die dampfende Tasse. Sie hatten sich schon vor einer Woche treffen wollen. In der Schule hatte er sie nicht angetroffen. Niemand in der Schule wusste, wo sie sich aufhielt. Eine ihrer Schulkolleginnen hatte gemeint, sie und ihr Bruder wären jetzt bei ihren Großeltern in der Schweiz. Davon hatte sie ihm nie etwas gesagt. Hätte sie ihm das verschwiegen? Garantiert nicht. Ihre verdammten Eltern, denen war jede kranke Scheiße zuzutrauen. Einmal hatte er Corinne geraten, von zu Hause abzuhauen. Rucksack packen und ab. Sollten die alten Hyänen ihren Mist alleine rausbringen. Miese Bande. Geldsäcke. Aber Corinne hatte sich nicht getraut. Ich bin 14, hatte sie gesagt. Und ich bin 17, wo ist das Problem, hatte Lukas gekontert. Er lebte seit fast einem Jahr auf der Straße, er kam klar, er hatte keine Probleme mehr. Die Leute vom Autonomen Zentrum hatten ihn ohne mit der Wimper zu zucken aufgenommen, hatten das Jugendamt abgewimmelt. Iris, Ottfried, Jean-Claude, Werner und Sarka, das waren echte Freunde, keine Heuchler, keine Lügner, keiner Pisser.
Warum meldete sich Corinne nicht? Was sollte er nur tun?
Lukas schnappte die Teetasse und setzte sich zu den anderen in die Runde. Da war gerade wieder eine heiße Debatte am Kochen. Werner war in seinem Element. Politik, das war sein Ding. Er hatte sein Studium der Politikwissenschaft knapp vor dem Abschluss geschmissen, obwohl er saugute Noten gehabt hatte. Werner hatte Lukas mal ein paar der Zeugnisse gezeigt. Lukas war die Spucke weggeblieben. Werner kannte sich in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts aus wie Lukas in den Gassen Ottakrings.
Jean-Claude prostete Lukas mit der Bierflasche zu, Lukas erwiderte mit der Teetasse den Gruß. Jean-Claude hatte Lukas im Herbst ein paar Schuhe besorgt. Leichte und doch robuste Wanderschuhe mit stabiler, aber nicht zu harter Sohle. Mit solchen Schuhen konnte man stundenlang auf Asphalt laufen. Jean-Claude hatte Lukas nicht verraten, woher er die Schuhe hatte. Sie waren neu gewesen. Und sie hatten sofort perfekt gepasst. Das waren Kumpels. Hatte Lukas vorher so nicht gekannt oder für möglich gehalten. Nur beim Saufen und Kiffen konnte Jean-Claude echt nicht nein sagen.
6. SZENE
»Wenn ich all die Auslagen sehe, muss ich immer an Weihnachtsgeschenke denken. Haben Sie Ihre Weihnachtsgeschenke schon besorgt?«
Hoffmann verzog den Mund.
»Nein. Damit bin ich meist säumig. Im letzten Moment kaufe ich dann noch schnell dies oder das. Ich bin da nicht sehr kreativ.«
»Das ist häufig so bei Männern.«
»Und Sie? Haben Sie die Geschenke schon beisammen?«
»Ich weiß es nicht. Ich versuche, mir mit Listen zu helfen. Schon im Herbst beginne ich, eine Liste anzulegen. Leider finde ich die aktuelle Liste nicht. Irgendwo habe ich sie verlegt.«
»Wer steht denn alles auf der Liste?«
»Tante Sabina.«
Sie gingen ein paar Schritte.
»Nur Tante Sabina? Was ist mit Ihren Eltern?«
»Ach ja, natürlich auch meine Eltern.«
»Wo wohnen denn Ihre Eltern?«
»In Schaffhausen.«
»Sind Sie in Schaffhausen aufgewachsen?«
»Ja. Ich kann mich gut an den Rhein erinnern. Kennen Sie den Rheinfall bei Schaffhausen?«
»Ich habe davon gehört, aber ich war noch nie dort.«
»Sollten Sie sich ansehen. Eindrucksvoll. Als Kind habe ich in der Nähe des Rheinfalls gespielt. Es waren schöne Spiele. Unbeschwerte Stunden. Tante Sabina ist tot.«
Schwer, aus all den Informationsbruchstücken ein Bild zu formen. Hoffmann hielt an. Sie löste ihre Hand von seiner Armbeuge und stand ihm gegenüber.
»Woran ist sie gestorben?«
Alice dachte angestrengt nach.
»Ein Unfall. Sie hat sich am Dachboden eingeschlossen. Irgendwie ist sie zu Tode gekommen. Ich vermute, sie ist gestürzt und hat sich in einer Schlinge verfangen. Der Hals, Sie wissen schon, Herr Hoffmann, der Hals ist die Schwachstelle des Menschen.«
Hoffmann zog die Augenbrauen hoch.
»Sie hat sich also erhängt.«
Alice schüttelte den Kopf.
»Nicht erhängt! Tante Sabina hätte sich niemals selbst getötet. Es war ein Unfall.«
»Ist das lange her?«
»Ich war noch ein Kind. Ich habe sie gefunden. Das war schrecklich.«
»Und dennoch steht Tante Sabina auf Ihrer Geschenkliste?«
Alice lachte.
»Meine Güte, Herr Hoffmann, Sie haben recht! Es ist verrückt, einer toten Tante ein Geschenk machen zu wollen. Weihnachten oder nicht, es ist verrückt.«
»Weihnachten als solches ist verrückt.«
»Halten Sie mich für verrückt?«
»Aber nein.«
»Jürgen hält mich für verrückt.«
»Ist das Ihr Mann?«
»Jeden Tag lässt er mich wissen, dass ich verrückt bin.«
»Frau Berg, ich werde jetzt einen Streifenwagen rufen.«
Sie fasste nach seinen Händen.
»Nicht die Polizei! Bitte! Ich flehe Sie an, nicht die Polizei!«
»Warum nicht? Die Polizei kann Ihnen helfen.«
Alice schnappte nach Luft.
»Die Polizei bringt mich bestimmt in eine psychiatrische Klinik.«
»Vielleicht wäre das eine gute Idee.«
»Eine furchtbare Idee! Tante Sabina kam aus der Klinik zurück und hatte dann diesen entsetzlichen Unfall.«
»Aber dort kann Ihnen geholfen werden.«
»Ich komme doch erst von der Klinik.«
»Ist das so?«
»Vor ein paar Tagen erst bin ich von dort fort. Ich war wegen meiner Depressionen am Steinhof.«
»Dann kennt man Sie. Die Ärzte können Ihnen bestimmt helfen.«
»Die Ärzte verschreiben mir höchstens Medikamente.«
»Wollten Sie Ihrem Leben ein Ende setzen?«
Alice zuckte zusammen.
»Aber nein! Ich wollte vielmehr das Wasser genießen. Ich liebe Flüsse.«
Hoffmann schaute die Straße auf und ab.
»Ich nehme ein Taxi«, sagte Alice.
Hoffmann schaute Alice in die Augen.
»Und wohin werden Sie fahren?«
»Nach Hause. Ich wohne in Hütteldorf. Im Haus meines Mannes und dadurch natürlich in meinem Haus. Ja, es ist mein Haus, auch wenn ich das Haus nicht mag.«
»Sagen Sie mir die Adresse.«
»Bujattigasse. Das ist eine Nebengasse der Hüttelbergstraße.«
»Die Hüttelbergstraße kenne ich.«
»Sind Sie ein echter Wiener, Herr Hoffmann?«
»Ja.«
»Ich liebe diese Stadt. Und ich hasse sie. Man kann Wien nur gleichzeitig lieben und hassen.«
»Sind Sie sich sicher, dass Sie dort wohnen? Sie scheinen Gedächtnislücken zu haben.«
»Ja, ich habe Gedächtnislücken, aber ich bin mir vollkommen sicher. Ich wohne dort seit 15 Jahren.«
»Haben Sie ein Handy bei sich?«
»Ja.«
»Dann rufen Sie Ihren Mann an. Er wird Sie bestimmt abholen und nach Hause bringen.«
»Mein Mann ist wie so häufig auf Geschäftsreise.«
»Geben Sie mir bitte Ihr Handy. Ich werde versuchen, ihn anzurufen.«
Alice schwieg und regte sich nicht. Hoffmann wartete.
»Darf ich Sie um etwas bitten, Herr Hoffmann?«
»Worum?«
»Begleiten Sie mich bitte nach Hause.«
Hoffmann wiegte den Kopf.
»Das kann ich nicht.«
Sie war enttäuscht.
»Was hindert Sie daran?«
»Frau Berg, ich muss Sie ärztlicher Aufsicht übergeben. Ich kann nicht anders, ich bin Polizist.«
»Aber warum?«
»Sie standen ein paar Zentimeter neben dem Wasser, hatten eine Waffe in der Hand. Ich mache Ihnen einen Vorschlag.«
»Und zwar?«
»Ich fahre Sie in die Klinik und bleibe bei Ihnen, bis Ihre Situation geklärt ist.«
»Würden Sie das wirklich für mich tun?«
»Aber ja.«
»Dann bin ich einverstanden.«
»Gehen wir zu meinem Wagen. Nur ein paar Blocks in diese Richtung.«
Hoffmann wandte sich zum Gehen. Alice klammerte sich wieder an seinen Arm. Schweigend marschierten sie in Richtung Augarten. Sie kamen in die Wasnergasse. Alice hielt kurz inne und schaute zur anderen Straßenseite.
»Was ist das für eine Mauer?«
»Die Augartenmauer. Sie läuft rund um den Augarten.«
»Ich kenne den Augarten nur vom Hörensagen. Wohnen Sie in dieser Gegend?«
»Ein Stückchen die Gasse runter. Das ist mein Auto.«
7. SZENE
Es gab nur eine benutzbare Toilette. Also eine, in der sowohl der Zufluss als auch der Abfluss funktionierten, in der eine Glühlampe Licht spendete und die über einen Klositz verfügte. Lukas hatte wie alle die Toilette schon mehrmals gründlich geputzt. Iris hatte ein System entworfen, an das sich die meisten so halbwegs hielten. Jeder, der länger als eine Woche im Autonomen Zentrum wohnte, musste die Toilette putzen, da war Iris knallhart. Wer sich weigerte, auch nur einen Finger zu rühren, der flog raus.
Einmal hatten sie einen Wichtigtuer da, der glaubte, Iris verarschen zu können, weil sie übergewichtig war, weil sie dicke Brillen trug und weil sie beim Kapieren manchmal ein wenig länger brauchte. Da hatte sich der Dreckskerl mit der Falschen angelegt, denn als er Iris so richtig auf der Schaufel gehabt hatte, waren plötzlich Jean-Claude, Werner und Ottfried Schulter an Schulter vor ihm gestanden. Okay, Jean-Claude war klein und schmächtig, kein echter Kämpfer, Werner war mittelgroß und vom Temperament her alles andere als ein Raufbold, eben ein Intellektueller, aber man musste lebensmüde sein, um sich mit Ottfried anzulegen. Ein Schrank, fast zwei Meter groß, Schultern wie eine Donaubrücke und Oberschenkel wie zwei steirische Eichen. Aus der Steiermark kam er auch, aus der Gegend, wo früher die Stahlwerke für Vollbeschäftigung gesorgt hatten, wo sich jetzt aber Industrieruine an Industrieruine reihte. Und Ottfried war meist ruhig, hielt sich im Hintergrund, ließ die anderen reden, allen voran Jean-Claude, aber wenn er wütend wurde, schlug er zu. Drei Monate hatte er wegen einer Schlägerei gesessen. Zwei Neonazis hatten geglaubt, sie könnten den klein gewachsenen Anarcho ein bisschen durch die Mangel drehen. Ihr Pech war, dass Jean-Claude an diesem Abend nicht alleine unterwegs gewesen war. Ottfried hatte einen der beiden gegen die Wand geschleudert. Schürfwunden im Gesicht und eine Gehirnerschütterung, das hatte der Arzt im Krankenhaus in den Befund geschrieben. Der zweite war auf und davon gerannt. Und auch der Scheißkerl, der Iris hatte verarschen wollen, war schnell aufgebrochen. Hast ihn nicht mehr gesehen. Niemand legte sich mit Ottfried an. Und niemand verarschte Iris, solange sie mit Ottfried zusammen war.
Lukas wartete.
Die Spülung rauschte. Für ein kleines Geschäft hätte er auch in den Innenhof gehen können, tat er aber nicht oft, nur wenn er dringend musste und vor der Toilette eine Schlange stand. Sarka öffnete die Tür. Sie lächelte Lukas an. Logo, dass er auch lächelte. Wenn Sarka lächelte, musste die ganze Welt lächeln. Na klar war er in Sarka verliebt. Alle Männer im Zentrum waren in Sarka verliebt. Sogar Jean-Claude, obwohl der ja schwul war. Sarka musste man einfach lieben, ihr tschechischer Akzent, ihr hübsches Gesicht, das dichte lange Haar und ihre total unkomplizierte Art waren einfach nur toll. Aber seit sie mit Werner zusammen war, hatten alle anderen keine Chance. Lukas schon gar nicht, er war ja das Küken im Zentrum. Noch nicht einmal 18. Außerdem hatte Lukas eine Freundin.
»Schon eilig?«
Lukas winkte lässig ab.
»Kein Stress.«
»Hab den Sitz vorgewärmt.«
Ja, daran hatte Lukas auch schon gedacht. War irgendwie prickelnd, gleich nach Sarka auf die Toilette zu gehen. Verrückt eigentlich.
»Dann setze ich mich extra hin. Obwohl ich nur pinkeln muss.«
Sarka lachte und ging an Lukas vorbei. Bevor er die Tür hinter sich zuziehen konnte, wandte sich Sarka um.
»Du, Lukas?«
»Ja?«
»Wie heißt deine Freundin noch einmal?«
»Corinne.«
»Ja genau, Corinne. Entschuldige. Ich werde versuchen, mir den Namen jetzt zu merken.«
»Schon okay.«
»Sie war ja noch nicht so oft bei uns.«
»Zweimal.«
Sarkas Miene war ernst.
»Sie ist sehr jung.«
»Ja.«
»Schon 16?«
Lukas schüttelte den Kopf.
»14.«
Sarka verzog den Mund. Sie flüsterte.
»Schau, dass sie nicht zu oft mit Jean-Claude zusammen ist. Du weißt, was ich meine.«
»Die Kifferei?«
Sarka nickte zustimmend.
»Sie ist zu jung dafür.«
»Vorgemerkt.«
Sarka zwinkerte Lukas lächelnd zu. Er schloss die Tür. Warum meldete sich Corinne nicht? Wie viele SMS hatte er ihr schon geschrieben? So ein Scheiß.
8. SZENE
Hoffmann stützte seine Ellbogen auf die Knie. Er wartete seit einer halben Stunde. Der Abend verstrich, ohne dass er es bemerkte. Die Zeit war einerlei. Wie oft hatte er schon auf dies und das gewartet?
Der Verkehr auf den Straßen war gering gewesen. Hoffmann hatte den Wagen bedächtig quer durch die Stadt gelenkt. Während der Fahrt hatten sie kaum miteinander gesprochen, die meiste Zeit hatte sein abendlicher Fahrgast zum Fenster hinaus gesehen. Dann hatten sie das Krankenhaus erreicht. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Portier hatte er Alice in die Nachtambulanz begleitet. Zuerst hatten sie gemeinsam gewartet, dann war Alice aufgerufen worden. Sie hatte nicht gewollt, dass er ihr in das Arztzimmer folgte. Aus Scham. Also hatte er wieder Platz genommen.
Eine Tür öffnete sich. Alice, ein Arzt und eine Krankenpflegerin traten heraus. Der Arzt schaute kurz zu Hoffmann hinüber. Dieser erhob sich. Der Arzt rief den nächsten Patienten auf und verschwand wieder in seinem Arbeitsraum. Alice und die Pflegerin kamen auf Hoffmann zu.
»Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so lange habe warten lassen«, sagte Alice zu Hoffmann.
»Nicht der Rede wert.«
»Danke, dass Sie sich um mich gekümmert haben. Ich werde das niemals vergessen.«
Ein verlorenes Lächeln, fand Hoffmann, aber es war ehrlich und kam aus der Tiefe.
»Wir werden Frau Berg stationär aufnehmen«, sagte die Krankenpflegerin. »Sehr freundlich von Ihnen, dass Sie sie hierher gebracht haben. Und sehr aufmerksam.«
»Brauchen Sie Kleidung? Hygieneartikel? Wenn Sie wollen, kann ich etwas besorgen.«
Alice schüttelte den Kopf.
»Das brauchen Sie nicht. Ich bleibe nur eine Nacht zur Beobachtung.«
»Wir haben alles Nötige hier«, sagte die Pflegerin. »Wir sind für unerwartete Aufenthalte eingerichtet.«
Hoffmann nickte der Frau wissend zu. Er hatte mehrmals Personen hierher gebracht. Das brachte der Beruf als Drogenfahnder mit sich. Alice streckte ihre Hand aus.
»Gute Nacht, Herr Hoffmann. Und vielen, vielen Dank.«
Er schüttelte die Hand.
»Gute Nacht, Frau Berg.«
Hoffmann fuhr zügig durch die Winternacht. Er grübelte. Revolver und Munition befanden sich nach wie vor in seinen Jackentaschen. Was sollte er damit tun? In den Donaukanal werfen?