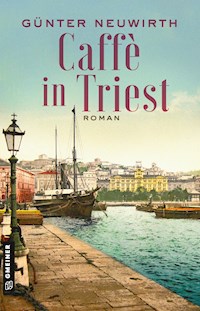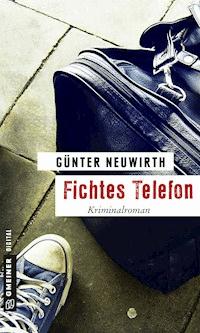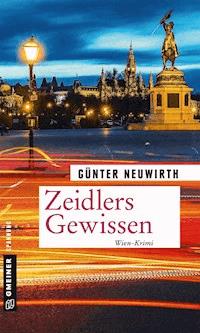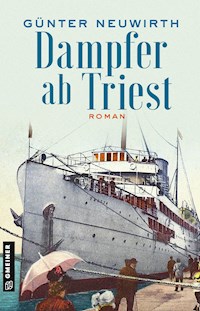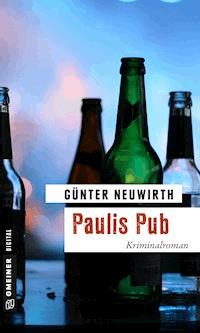Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Inspector Bruno Zabini
- Sprache: Deutsch
Über der »Stadt der Winde« tobt der Wüstensturm Scirocco und in den Straßen der Stadt wimmelt es von Agenten. Seit die k.u.k. Kriegsmarine die drei Schlachtschiffe der Radetzky-Klasse auf Kiel gelegt hat, sind die Geheimdienste aller Großmächte hinter den Bauplänen her. Nachts wird auf den Gleisen ein toter Schiffsbauingenieur gefunden. Als Inspector Bruno Zabini den Fall untersucht, ahnt er noch nicht, dass in Triest ein mörderischer Agentenkrieg droht. Zu allem Überfluss kündigt sich die frostige Bora an. Bruno hat alle Hände voll zu tun, eine Eskalation internationalen Ausmaßes zu verhindern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Neuwirth
Sturm über Triest
Roman
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Ullstein Bild Molo San Carlo, ca. 1895
ISBN 978-3-8392-7444-6
Personenverzeichnis
Brunos privates Umfeld
Bruno Zabini, 37, Inspector I. Klasse, Triest
Heidemarie Zabini, geb. Bogensberger in Wien, 59, Brunos Mutter
Salvatore Zabini (1836–1899), Brunos Vater
Maria Barbieri, geb. Zabini, 32, Brunos Schwester, Triest
Fedora Cherini, 34, Kostümbildnerin, Triest
Luise Dorothea Freifrau von Callenhoff, 27, Schriftstellerin, Sistiana und Triest
Lionello Ventura, 39, Schiffsbauingenieur, Brunos langjähriger Freund
*
Die Triester Polizei
Dr. Stephan Rathkolb, 59, Polizeidirektor
Johann Ernst Gellner, 52, Oberinspector
Emilio Pittoni, 40, Inspector I. Klasse
Vinzenz Jaunig, 47, Inspector II. Klasse
Luigi Bosovich, 26, Polizeiagent II. Klasse
Ivana Zupan, 41, Schreibkraft
*
Die wichtigsten Akteure
Leopold Freiherr von Baumberg, 36, Obersekretär aus Wien
Koloman Vanek, 37, Baumbergs Adjutant aus Mährisch Ostrau
Gustav Lainer, 36, Schiffsbauingenieur im STT aus Wien
Hartmuth Edler von Greifenstein, 53, Abteilungsleiter im STT
Gräfin Jekaterina Olenina, 29, Russin aus Sankt Petersburg
Kenneth Hudson, 56, britischer Teeimporteur aus London
Rolf Stiebke, 42, preußischer Bankier aus Potsdam
Erlinda Russo, 39, italienische Buchhändlerin aus Venedig
Casimir Morel, 35, französischer Spirituosenhändler aus Marseille
Yamada Maresuke, 41, japanischer Ingenieur aus Yokohama
Alexander Schubnikow, 47, russischer Oberst aus Moskau
Grigorij Galkin, 32, Schubnikows Adjutant aus Moskau
Sonntag, 3. November 1907
Unnachgiebig rüttelte der Scirocco an den Dachziegeln, Regenrinnen und Straßenlaternen. Auf seinem Weg übers Mittelmeer brachte er Sand mit sich, den er nun in den Gassen und Straßen von Triest zurückließ. Kaum jemand war zu dieser nachtschlafenden Zeit unterwegs, die Stadt versteckte sich hinter massiven Mauern und geschlossenen Fensterläden.
Gustav Lainer kämpfte sich durch den Wüstensturm. Noch regnete es nicht. Über mehrere Tage hatte sich der Wind aufgebaut, um sich nun in voller Stärke zu zeigen. Wie warm es war, bemerkte Lainer! Unnatürlich für November. Die erste trockene Welle des Windes war mit Sand angereichert, der sich wie Puderzucker über Triest legte. Doch der Saharastaub würde die Dächer und das Stadtpflaster nicht lange scheuern, denn dem Sand folgten schwere Regenwolken. Am nördlichen Ende der Adria bewegte sich die heiße Luft Hunderte Meilen nordwärts über das Meer und lud sich mit Feuchtigkeit auf. Lainer konnte die nahende Regenfront riechen, gar spüren. Spätestens bei Sonnenaufgang würde es wie aus Eimern schütten.
Was würde morgen sein? Würde die Gräfin ihr Versprechen halten? Würde er ein reicher Mann sein? Auf der Flucht nach Übersee? Aber wohin nur? Nach Kuba oder Kanada? Australien? Indien? Nur fort aus Österreich-Ungarn, weit fort.
Ein Verräter auf der Flucht! Der Strang des Henkers drohte. Oder Schlimmeres.
Lainer hatte noch viel vor in seinem Leben. Er konnte unmöglich weiter in dieser eintönigen Mittelmäßigkeit verharren. Er hegte hochtrabende Pläne, sah kolossale Chancen für sich. Sinnliche Abenteuer mit schönen Frauen, Jagden im Dschungel, eine Kanufahrt im Regenwald, die Pferderennen in Ascot, auf einem Dampfer durch die Inselwelt der Karibik. Die Gräfin hatte eine Tür aufgestoßen, er musste nur noch durchschreiten.
Oder vielmehr rennen.
Er eilte seit einer halben Stunde kreuz und quer durch die Stadt. Hatte er seine Verfolger endlich abgeschüttelt? Lainer drückte sich in den Schatten eines Hauseingangs und spähte in die nächtliche Gasse. Es war wohl nach Mitternacht. Er tastete nach der Taschenuhr, zog sie aber nicht heraus. Egal, er musste die zwei Männer endlich loswerden.
Wenn er nur eine Waffe bei sich hätte!
Die Gräfin hatte ihm eine angeboten. Lainer fluchte in sich hinein. Warum war er so dumm gewesen, den Revolver nicht anzunehmen?
Sie erwartete ihn sehnsüchtig auf Brioni. Einmal hatte er den mondänen Kur- und Badeort auf der Inselgruppe vor der Küste Istriens besucht. Es war nur ein kurzer Aufenthalt gewesen, als einfacher Schiffsbauingenieur konnte er sich nicht mehr leisten. Der Hochadel und die Hautevolee Österreich-Ungarns trafen sich dort, alle anderen, die Menschen aus dem einfachen Volk, konnten von den Galaabenden, Konzerten und Sportveranstaltungen nur in der Zeitung lesen.
Doch das Leben als Mann des einfachen Volkes hatte Gustav Lainer endgültig hinter sich gelassen. Auf zu neuem Gestade! Die Nacht mit der schönen Russin war atemberaubend gewesen. Der Start in eine neue Welt! In ein neues Leben!
Lainer konnte seine Verfolger nicht mehr entdecken. Die Meute war dem Fuchs lange auf den Fersen gewesen, aber er hatte sie abgeschüttelt. Er hielt mit einer Hand seinen Hut, mit der anderen umklammerte er eisern den Griff der Ledertasche. Alles hing davon ab, jetzt durchzukommen. Mit eingezogenem Kopf lief er gegen die prasselnden Sandkörner des Südsturms und tauchte wieder in die Finsternis der Nacht.
Nur fort von hier.
*
»Verdammtes Wetter. Ausgerechnet heute dieser Sturm.«
Leopold von Baumberg und Koloman Vanek steckten die Köpfe zusammen, um nicht gegen den Wind anbrüllen zu müssen.
»Hast du so etwas schon erlebt?«
»In dieser Stärke noch nicht.«
»Der vermaledeite Wind trägt den Sand Tausend Meilen über den Himmel, und just heute Nacht fällt der Dreck aus den Wolken.«
»In meiner Heimat gibt es keinen Scirocco. So ein Sturm ist beängstigend.«
Baumberg schaute überrascht seinen Adjutanten an, entdeckte aber dessen Lächeln. »Du Fallot, für einen Augenblick habe ich gedacht, dass du zum ersten Mal im Leben wirklich vor etwas Angst hast.«
»Melde gehorsamst, Herr Hauptmann, die laue Brise jagt mir keinen Schrecken ein. Aber ich befürchte etwas anderes. Nämlich, dass uns unser Mann abhandengekommen ist.«
»Die Befürchtung hege ich auch.«
Die beiden standen im Windschatten des Ospedale Civico. Als Baumberg auf höchsten Befehl nach Triest gegangen war, hatte er seinen besten Mann mitgenommen. Sie waren ein exzellent eingespieltes Duo und hatten sich in der großen Hafenstadt in gewissen Kreisen schnell Respekt verschafft. Baumberg war der Kopf des Unternehmens, er war aus adeligem Haus und verfügte über exzellente Verbindungen, sein Erfolg beruhte auf einem geradezu unfehlbaren Gedächtnis und guter Menschenkenntnis. Vanek hingegen war der kräftige Arm im Verbund, ein Mann von bulliger Statur, eiserner Ruhe und absoluter Loyalität.
»Entweder wird er ein Schiff oder einen Zug nehmen. Bei diesem Sturm kommt er mit der Kutsche nicht weit. Das Wetter mögen die Gäule nicht«, meinte Vanek.
»Die See ist bei diesem Sturm bestimmt zu rau, als dass ein Dampfer mitten in der Nacht ablegen könnte. Und mit einem Ruderboot oder Segelschiff kommt heute niemand lebend aus dem Hafen raus.«
»Also der Zug.«
»Ich tippe auf einen Güterzug.«
»Südbahnhof oder Staatsbahnhof?«
Baumberg überlegte. »Ich glaube, er muss in der Nähe der Küste bleiben.«
»Um einen Dampfer zu nehmen, sobald der Sturm sich legt?«
»Exakt.«
»Die Parenzana vielleicht? Oder ein Zug nach Pola?«
»Daran habe ich auch schon gedacht.«
Vanek nickte. »Dann der Staatsbahnhof.«
Baumberg tastete unwillkürlich nach seinem Schulterhalfter. »Wir trennen uns. Und treffen uns beim Bahnhofsgebäude.«
»Jawohl, Herr Hauptmann.«
*
Als Knabe hatte er sich auch für Lokomotiven interessiert, aber Schiffe faszinierten ihn, seit er denken konnte. Als Sohn eines Wiener Schlossermeisters war es naheliegend, sich in der 1884 neu gegründeten Schule des Technologischen Gewerbe Museums in der Währinger Straße einzuschreiben. 1886 hatte er als Schüler seine Laufbahn als Ingenieur begonnen, er hatte die Ausbildung zum Metallarbeiter mit Erfolg abgelegt, doch anstatt in die Fabrik einzutreten, in der auch sein Vater arbeitete, hatte Lainer sich um eine offene Stelle bei einer Bremer Werft beworben. Nur wenig später war er als Schiffsbaueleve für vier Jahre nach Norddeutschland gegangen. Nach seiner Rückkehr ins Kaiserreich hatte er nicht lange eine Dienststelle suchen müssen. Mit der Aussicht auf eine seriös bezahlte Anstellung und der interessanten Arbeit in einer der bedeutendsten Werften der Monarchie war er von Wien nach Triest übersiedelt. Seit sechs Jahren arbeitete er als Schiffsbauingenieur im Stabilimento Tecnico Triestino.
Das erste Jahr war noch voller Abenteuer gewesen, das Leben in der adriatischen Hafenstadt war gänzlich anders als in Wien oder Bremen, jeden Tag hatte er eine Überraschung erlebt. Und er hatte sich unsterblich in eine Italienerin verliebt. Doch ohne dass Lainer sagen konnte wann und wie, hatte sich sein Leben verändert, ja, es war, als ob sich der Wind gedreht hätte. Seine Angebetete hatte ihm einen Korb gegeben, die Arbeit in der Werft begann ihn zu langweilen, und bei seinen Pferdewetten hatte sich eine außerordentlich kostspielige Pechsträhne eingestellt. Jeder Sohn eines Industriemagnaten oder eines Herzogs verpulverte Unmengen an Geld beim Glücksspiel, zuckte dabei mit der Achsel und stellte einen Wechsel aus. Doch niemand nahm einen von ihm entgegen, er hatte bar und sofort zu zahlen. Seine mühsam gesparten Reserven waren bald verbraucht gewesen.
So war aus seinem dritten Jahr in Triest eine Serie von Niederlagen und Pleiten geworden, all seine Hoffnung und Zuversicht war wie Wachs auf einer Herdplatte geschmolzen. Aus dem adriatischen Abenteuer war grauer Alltag in einer Stadt geworden, deren Sprache er bis heute nicht richtig sprechen konnte. Das Litoral mit seiner Kultur und seinen Menschen blieben ihm fremd.
Und dann war die Gräfin in sein Leben getreten. Jekaterina Olenina. Allein ihr Name klang wie die pure Versuchung, wie der Wind der Freiheit, wie die Schönheit der Welt. Alles hatte sich verändert.
Er hatte schon vor dieser Begegnung gewisse Möglichkeiten erwogen, aber die Gräfin hatte die vagen Überlegungen zu einem konkreten Plan geformt. Und jetzt gab es kein Zurück mehr.
Lainer schlich von Gasse zu Gasse. Der Sturm pfiff über die Dächer, aber schien jetzt weniger Sand mit sich zu führen. Würde es gleich zu regnen beginnen?
Hatte er seine Verfolger endgültig abgeschüttelt?
Schon vor Wochen hatte er für seinen Abgang vorgesorgt, nichts, was in seiner Wohnung noch lagerte, war für ihn jetzt noch von Wert.
Vielleicht hatten sich im Viertel weitere Männer verschanzt. Die Gräfin hatte ihm zu Vorsichtsmaßnahmen geraten. Zwei Koffer mit Kleidung für die heranziehende kalte Jahreszeit, Rasierzeug und einem Paar Reserveschuhe lagen im Versteck bereit. Auch Geld hatte er deponiert.
Gustav Lainer war wie in einem Rausch. Das war sein neues Leben! Nächtliche Verfolgungsjagden, eine schöne Geliebte, eine Tasche voller Geheimnisse. Danach hatte er sich gesehnt. Mehr Abenteuer.
Er überquerte die Fahrbahn der Via del Corso. In ein paar Stunden würde hier wieder ein Gewimmel herrschen aus Trams, Fuhrwerken, Kutschen und unzähligen Menschen, die ihren Geschäften nachgingen und dem unmittelbar bevorstehenden Regen trotzen würden.
Der Wind fegte durch die Straße. Lainer schaute hinter sich und entdeckte eine Gestalt. In der Ferne, unweit der Piazza Goldoni. Der Mann stand mitten auf der Straße. Zweifellos erblickten die Männer einander im selben Augenblick, denn als der Mann loslief, lief auch Lainer los.
Verdammt, so ein Pech!
Waren es mehr als zwei, die hinter ihm her waren?
Nur fort. Er rannte nach Leibeskräften. Zum Glück war er ein Sportsmann. Noch hatte er Vorsprung. Wohin? Da, die verwinkelten Gassen und Treppen der Città Vecchia.
*
Baumberg überquerte die Piazza Goldoni nicht, sondern ging im Schatten der Häuser entlang. Da sich der Scirocco seit Tagen angekündigt hatte, waren bei Ladenschluss Vorkehrungen getroffen worden. Die Ladentische und Verkaufsregale waren mit Planen bedeckt und solide vertäut worden. Die Menschen in Triest waren vertraut im Umgang mit starkem Wind, egal ob er aus dem Süden über das Meer kam oder sich vom Norden von der Anhöhe des Karstes auf die Stadt herabstürzte. Baumbergs Blick wanderte systematisch über den Platz. Niemand war zu sehen. Die Straßenlaternen spendeten nur wenig Licht.
Vanek war vom Hospital in Richtung Canal Grande gegangen und würde über die Rive in Richtung Staatsbahnhof marschieren, während Baumberg den Weg durch die Città Vecchia nahm.
Baumberg fluchte in sich hinein. Seine Vorgesetzten in Wien würden toben, sollte sich die gegenwärtige Sache als echte Affäre entpuppen. Er musste herausbekommen, ob Ingenieur Lainer Dreck am Stecken hatte. Natürlich standen alle leitenden Angestellten des STT, wie der Stabilimento Tecnico Triestino abgekürzt wurde, unter Beobachtung, aber mit den wenigen Männern, die Baumberg zur Verfügung hatte, konnte er unmöglich alle Abteilungsleiter, Ingenieure und Werkmeister lückenlos observieren.
Es war eine reine Routinekontrolle gewesen. Baumberg und Vanek arbeiteten nach keinem Plan, sondern sprunghaft und daher nicht vorhersehbar die Liste aller ihrer Klienten ab. Mal wurde dieser Mann beschattet, dann ein anderer, mal wurde diese Wohnung durchsucht, dann wieder eine andere. Sie beobachteten Lainer nicht wegen eines Verdachts, sondern weil Baumberg die Arbeit gründlich erledigte. Die gegenwärtige Verfolgungsjagd war ein klarer Beleg, dass sie unversehens auf etwas gestoßen waren. Aber worauf?
Was war in der Tasche, die Lainer bei sich trug? Hatte dieser bislang völlig unscheinbare Mann ein krummes Ding gedreht? Warum war er knapp vor Mitternacht aus dem Fenster in den Hinterhof geklettert? Und warum war er auf und davon gerannt, als er Vanek im Hauseingang gegenüber entdeckt hatte?
Vanek hätte eine halbe Stunde später seinen Beobachtungsposten beim Haus verlassen, so wie Baumberg seinen ein paar Straßen weiter, irgendwann mussten auch Geheimagenten schlafen. Und dann hatte Baumberg gesehen, dass sein Adjutant einen Flüchtenden verfolgte. Binnen weniger Augenblicke war aus einer Routinesache ein Wettrennen geworden. Und Baumberg drohte, dieses Rennen zu verlieren. Der Mann war im Sandsturm entkommen.
Er bog in die Via del Corso ein und überquerte die Fahrbahn.
Da vorn! Ein gutes Stück entfernt ging eine Gestalt durch den Lichtkegel einer Laterne. Sie erblickten einander gleichzeitig, und sprinteten gleichzeitig los.
Baumberg rannte nach Leibeskräften. Der Mann war wieselflink. In den verwinkelten Gassen der Città Vecchia würde Baumberg Lainer leicht aus den Augen verlieren.
*
Koloman Vanek überquerte mit schnellen Schritten die Piazza del Ponterosso. Der Wind blies vom Südwesten über die Stadt. Vanek hielt seine Melone fest, blinzelte und stemmte seinen Körper gegen den Luftstrom. Er erreichte die Riva Carciotti, bog nach links und marschierte wie vereinbart die Rive entlang. Sein Vorgesetzter hatte recht, niemand konnte bei derart heftigem Wind in ein kleines Boot steigen. Selbst für die großen Dampfer würde es bei Tageslicht gefährlich sein, vom Molo abzulegen, erst recht in dunkler Nacht. Wütend schlugen die Wellen gegen die Kaimauer, Gischt wurde landeinwärts geweht. Vanek spürte die kleinen Wassertropfen auf seiner Wange. Es war reichlich ungemütlich für einen Spaziergang am Porto Vecchio.
Vanek hatte seine Heimatstadt Mährisch Ostrau zu Beginn seiner Dienstzeit bei der Armee verlassen und war seither nicht wieder dorthin zurückgekehrt. Er vermisste seine Heimat nicht, böse Erinnerungen an eine schwierige Kindheit in äußerstem Elend waren mit der Stadt verbunden. Sein Vater war ein Trunkenbold, der seine Frau und die drei Kinder regelmäßig mit Fäusten, Gürteln oder Rohrstäben geschlagen hatte. Seine Mutter war bis zu ihrem frühen Tod in Selbstmitleid versunken. Die Tuberkulose hatte sie geholt. Vanek hatte das Rattenloch, das seinen Eltern als Behausung gedient hatte, nur zu gern verlassen. Beim Militär hatte sich schnell gezeigt, dass er zu viel mehr als nur zu einem saufenden Kohlenträger taugte, die soldatische Disziplin hatte ihn gestählt, hatte seine besten Eigenschaften zutage treten und hatte ihn nach mehreren Beförderungen zum Adjutanten des Hauptmanns werden lassen. Dieser hatte sofort gesehen, was für ein Mann in Vanek steckte, und er hatte ihm eine erstklassige Ausbildung zuteilwerden lassen. Koloman Vanek hatte nicht eine Sekunde überlegt, den Dienst als Unteroffizier zu quittieren, um gemeinsam nach Triest zu gehen. Vanek hatte Triest nicht gekannt und dennoch sofort zugestimmt. Wohin der Hauptmann ging, da ging auch er hin. Außerdem lag Triest praktisch am anderen Ende der Monarchie, also weit von Mährisch Ostrau und seiner verdammten Familie entfernt.
Bereits nach einem Tag an der Adria hatte er sich wohlgefühlt. Das milde Klima, die fremde Sprache, das Essen und der florierende Hafen hatten ihm auf der Stelle behagt. Und natürlich lag es auch an seiner neuen Arbeit im Dienste des Kaisers. Koloman Vanek wusste, dass der Dienst als Soldat gut zu ihm passte, aber unter dem Befehl des Hauptmannes im Geheimen für das Reichskriegsministerium zu arbeiten, das kam ihm noch mehr entgegen.
Die Gischt und der herangewehte Sand vermischten sich auf dem Kopfsteinpflaster zu einer schmierigen Schmutzschicht. Vanek schaute hinter sich. Die Abdrücke seiner Schritte waren zu sehen. Das war nicht gut. Er hinterließ nicht gerne Spuren. Aber es lag Regen in der Luft, dieser würde alles fortspülen.
Nach einer Weile erreichte er die Piazza Giuseppina und beschloss, nicht länger an den Rive entlangzugehen. Sein Mantel war von der Gischt schon ein wenig durchnässt, also wollte er lieber durch die Gassen des Borgo Giuseppino marschieren. Er bog in die Via del Lazzaretto Vecchio. In der Ferne sah er den Schatten einer Person. War das der Hauptmann? Möglich.
Koloman Vanek hetzte los.
*
Es war ein gespenstisches Ambiente, wie in einem Albtraum, in dem Erinnerungen mit Visionen verschmolzen und schließlich die Angst aus den Fugen kroch. Schienen, Laternen, Wasserbehälter mit auskragenden Hälsen, ein großer Ladekran, Rampen, beständig tobender Sturm und flackerndes Licht. Er hatte den Passeggio di Sant’Andrea überquert, nicht unweit des Gebäudes des Stabilimento Tecnico, wo im zweiten Stock sein Bureau lag. Der Verschiebebahnhof befand sich zwischen den Wohnvierteln und dem Franz-Joseph-Hafen. Der Ausbau dieses Stadtviertels war weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Würde der Ausbau Triests jemals abgeschlossen sein? Seit Gustav Lainer hier lebte, waren Wohnhäuser und Fabriken aus dem Boden gestampft worden. Und gerade in Sant’Andrea waren wirtschaftlich bedeutende Bauten hinzugekommen, etwa die Molen V und VI, der Staatsbahnhof und der weitläufige Verschiebebahnhof. Auch der Endbahnhof der Parenzana war in den neuen Bahnhof verlegt worden, wodurch nicht nur Gleise in Normalspur, sondern auch die Gleise der Schmalspurbahn hierherführten.
Lainer wusste, dass täglich um drei Uhr früh ein Güterzug der Parenzana abfuhr. Die Bahnlinie verlief erst entlang der Küste und schließlich ins Innenland Istriens nach Süden, um dann wieder in Richtung Küste einzuschwenken und am Endbahnhof in der Hafenstadt Parenzo zu enden. Sein Plan war ursprünglich, bis zum Morgen im Versteck auszuharren und dann mit seinem Gepäck an Bord des Dampfers nach Pola zu steigen, doch dieser Plan war durch die Verfolgung obsolet geworden. Verdammt, dass die Kettenhunde ihn schon ins Visier genommen hatten, war erschreckend. Er war in Panik gewesen, als er sich knapp vor Mitternacht durch den Hinterhof aus dem Staub hatte machen wollen und dann plötzlich dieser vierschrötige Mann im Schatten gestanden hatte.
Er überlegte, ob er den Güterzug nehmen sollte. Es war nicht schwer, sich mitten in der Nacht auf einen Güterwaggon zu schleichen. Aber seine beiden Koffer lagerten noch im Versteck, ohne diese würde er Triest nicht verlassen können. Er musste also ausharren und seine Verfolger endgültig abschütteln, erst dann konnte er auf einen Dampfer steigen oder einen Zug nehmen.
Warum wollte die Gräfin sich mit ihm ausgerechnet auf Brioni treffen? Das war verrückt! Die Inseln lagen unweit von Pola. In dieser Stadt, dem wichtigsten Stützpunkt der Kriegsmarine, wimmelte es von Militär. Dort sollte er hin? Das war gefährlich. Dennoch hatte es die Gräfin so eingefädelt.
Der Wind wehte den fernen Pfiff einer Lokomotive herüber. Elektrische Laternen sorgten für ein bisschen Helligkeit auf dem Areal. Es war klüger, im Schatten von Lokschuppen und abgestellten Waggons unsichtbar zu bleiben.
Der Mann war ihm auf den Fersen gewesen, aber Lainer hatte ihn auf Distanz gebracht. Und hier auf dem Verschiebebahnhof würde er kaum zu finden sein. Lainer schöpfte Hoffnung.
Er griff nach dem Riegel der Schiebetür eines Waggons. Die Tür war nicht versperrt. Sollte er hineinklettern? Er überlegte kurz und entschied sich dagegen. Das war zu unsicher. Was, wenn just dieser an einen Zug nach Wien oder Prag gehängt wurde?
Lainer sah, wie eine Verschublokomotive eine Reihe von offenen Güterwaggons langsam auf ein Abstellgleis schob. Der Bahnhof stand nie still, selbst der Scirocco konnte nicht verhindern, dass nach Mitternacht noch gearbeitet wurde. Hinter dem sich nähernden Zug standen auf einem weiteren Abstellgleis mehrere gekoppelte, gedeckte Güterwaggons. Sein Blick fiel auf einen der Waggons. Dieser verfügte über ein Bremserhaus, das wie üblich die Dächer der Wagen um ein Stück überragte.
Das war es. Dort konnte er sich verstecken und hatte gleichzeitig einen guten Überblick über das Gleisareal. Er musste nur die Schienen überqueren, bevor der Zug herankam.
Gustav Lainer rannte los, sprang über die Gleise und erreichte den betreffenden Waggon, noch lange bevor ihm der näher kommende Zug den Weg versperrte.
Hatte ihn einer der Bahnbediensteten gesehen? Kaum. War sein Verfolger in Sicht? Nein. Lainer schöpfte Hoffnung. Er stieg auf die Plattform des Waggons und dann auf die Leiter zum Bremserhaus. Er zog an der Klinke. Die Tür war offen! Endlich hatte er Glück.
Lainer warf die Tasche in das Bremserhaus und stieg noch höher. Er schaute sich um. Konnte er seinen Verfolger irgendwo ausmachen? Keine Menschenseele huschte über die Gleise.
Er wollte in das Bremserhaus klettern.
Eine Windbö warf die Tür zu. Die Finger seiner rechten Hand wurden eingeklemmt. Ein Schmerzensschrei entfuhr ihm, unwillkürlich lockerte sich sein Griff. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte rücklings auf die Gleise.
Ein harter Aufprall.
Mit dem Hinterkopf schlug er auf eine Schwelle. Schmerz. Gewaltiger Schmerz sogar. Lichter taumelten vor Gustav Lainers Augen. Hatte er sich etwas gebrochen? Etwa die Wirbelsäule? Hatte er eine Gehirnerschütterung? Warum sah er nichts? War er erblindet? Oder verlor er das Bewusstsein?
*
Auf dem Trittbrett der Lokomotive stand der Verschieber. Im Halbdunkel sah er schemenhaft den fallenden Körper und griff sofort zu seiner Pfeife. Der Lokführer schien das Signal sofort gehört zu haben und betätigte die Bremse. Doch die acht mit Eisenplatten schwer beladenen Waggons waren selbst bei langsamer Verschubfahrt nicht im Handumdrehen zu stoppen. Die Bremse kreischte unendlich lang, ehe der Zug stand.
Der Verschieber sprang vom Trittbrett und rannte voran. Der Heizer kletterte von der Lok und folgte ihm, nur der Lokführer blieb auf seiner Maschine, lehnte sich aber weit aus dem Fenster, um seinen Kollegen hinterherzuschauen. Der Verschieber schaltete seine Lampe ein und beleuchte die Stelle, an der einer der acht Waggons den Mann überrollt hatte.
»Madonna!«, entfuhr es dem Heizer.
*
Baumberg hörte den Pfiff und schaute über die Gleise hinüber zum träge rollenden Güterzug. Die Bremsen der Lokomotive quietschten unüberhörbar. Eine Notbremsung. Baumberg schaute links und rechts die Gleise auf und ab und rannte los. Der Lokführer gab ein lautes Signal.
Baumberg umrundete die offenen Güterwaggons und eilte auf die beiden Männer zu, die zwischen den Gleisen standen und hektisch miteinander redeten. Die Männer schauten erschrocken hoch, als Baumberg plötzlich vor ihnen auftauchte. »Geben Sie mir die Lampe! Und gehen Sie zur Lokomotive! Sofort!«
Die beiden Männer rührten sich nicht, da zog Baumberg seinen Revolver. Der Verschieber reichte ihm sofort die Lampe, dann trollten sich die beiden Bahnbediensteten.
Baumberg wollte eben die Lampe auf den zerrissenen Körper richten, da stand Vanek schwer atmend neben ihm. »Vanek, schau, ob das unser Mann ist.«
Der Adjutant beugte sich zwischen die Räder, nahm seine Melone ab und drehte das Gesicht in den Lichtkegel. »Jawohl, Herr Hauptmann. Das ist er.«
»So ein Scheißdreck! Siehst du die Tasche zwischen den Gleisen?«
»Leuchten Sie mal hier rüber. Nein, da ist nichts.«
Baumberg suchte den Boden zwischen den Gleisen ab. Dann hob er den Blick und entdeckte die offen stehende, daher im Sturm klappernde Tür des Bremserhauses. »Steig dort hoch und schau nach.«
Vanek stieg die Leiter empor und wurde fündig. »Volltreffer, Herr Hauptmann.«
»Sehr gut! Werfen wir einen Blick hinein.«
Vanek kletterte wieder hinab und öffnete die Ledertasche. Baumberg leuchtete in die Tasche, Vanek zog den Inhalt heraus.
»Ein Atlas, ein Buch über angewandte Mathematik und ein Lehrbuch der spanischen Grammatik«, zählte Vanek auf.
»Das darf ja wohl nicht wahr sein!«, entfuhr es Baumberg wütend. »Was soll der Blödsinn?«
»Eine Attrappe? Ein Köder? Ein Fehlgriff?«
»Verflucht! Verschwinden wir hier.«
»Sollen wir die Tasche mitnehmen?«
»Natürlich. Vielleicht ist etwas zwischen den Seiten versteckt.«
Die beiden entfernten sich vom Bahnhofsareal. Die ersten Regentropfen fielen aus den Wolken.
Montag, 4. November 1907
Bruno stieg die Treppen hoch, trat durch die offen stehende Tür in die Wohnung und stellte die Badewanne aus verzinktem Eisenblech ab. Damit war das gesamte Mobiliar am Ziel angelangt. Er schloss die Wohnungstür hinter sich und wischte mit seinem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Zwei Stunden war er unermüdlich die Treppe hinauf- und hinuntergelaufen, jetzt nahm er den Wasserkrug vom Wohnzimmertisch, füllte das Glas und trank es in einem Zug leer.
Luise hatte das Wohnhaus in der Via Pietro Kandler vor knapp einem Monat gekauft und umgehend einige Sanierungsarbeiten in die Wege geleitet. Sowohl Bruno, aber noch viel mehr Fedora waren sprachlos gewesen, als Luise ihnen mitgeteilt hatte, dass sie ihrem Advokaten den Auftrag zum Kauf erteilt hatte. Wozu sei sie, so hatte Luise achselzuckend gefragt, die Baronin Callenhoff und verfüge über ein beträchtliches Vermögen, wenn sie nicht von Zeit zu Zeit eine Investition tätigen könne, ihr Mann habe bestimmt Verständnis, dass sie Geld in Immobilien veranlagte. Ein Wohnhaus in der Nähe des Giardino Pubblico war unbestreitbar eine solide Geldanlage. Die Verwaltung des Hauses würde weiterhin die bestehende Kanzlei durchführen, und die Mieter würden den Besitzerwechsel nicht in geänderten Mietpreisen, sondern lediglich an der frisch gestrichenen Fassade bemerken. Luise plante, ihre mäßig große Triester Stadtwohnung im Borgo Teresiano beizeiten aufzugeben und in eine geräumigere zu übersiedeln. In der Beletage lebte ein altes Ehepaar. Die ehemaligen Hausbesitzer benötigten eine derart große Stadtwohnung nicht mehr, deshalb hatten sie das Haus veräußert, sie wollten ihren Lebensabend auf dem Landsitz der Familie verbringen. In Jahresfrist würde die Beletage frei werden. Und für die leer stehende Wohnung im vierten Stock war flugs eine Mieterin gefunden, nämlich Fedora. Luise hatte als Mietpreis den niedrigsten Betrag gewählt, den man als Miete in Triest veranschlagen konnte, ohne den Neid anderer Hausbewohner zu erwecken. Ja, in Wahrheit hatte Luise für Fedora und ihre beiden Söhne mit einem Fingerschnippen eine Wohnung in guter Lage und Ausstattung besorgt.
Durch die Wohnungstür trat man direkt in die Küche, in der sich ein solider Küchenschrank und der Herd befanden. Eine weitere Tür führte in das recht geräumige Wohnzimmer, das mit einem Keramikofen ausgestattet war. Rechts und links lagen je ein Kabinett ungefähr gleicher Größe. Im Zimmer rechts würden Fedoras Söhne schlafen, sie selbst im Zimmer links. Die vier Fenster zur Seitengasse hinaus waren neuwertig, da pfiff nicht der Wind durch Rillen und Ritzen. Fedora wusste nicht, wie sie Luise für diese Gunst jemals danken konnte.
Bruno hörte Fedora im Kinderzimmer fluchen. »Ist etwas passiert?«
»Was?«
»Ich fragte, ob dir etwas passiert ist.«
Fedora kam in das Wohnzimmer, setzte sich zu Bruno an den Tisch und goss sich ebenfalls ein Glas Wasser ein. »Nein, nichts ist passiert. Ich habe mich nur am Knie gestoßen. Bist du schon fertig?«
Bruno streckte seine Arme von sich. »Jawohl, ich bin fix und fertig.«
Fedora schaute sich um. Möbel, Steigen und Koffer standen überall herum, es würde noch ein ganzes Weilchen dauern, bis die Wohnung fertig eingerichtet war, aber immerhin war ihr Hab und Gut jetzt hier. »Ohne deine Hilfe hätte ich die Möbel und das Gepäck niemals in so kurzer Zeit transportieren können.«
»Du hättest eine Schar Möbelpacker engagieren müssen.«
Fedora kniff die Augen zusammen. »Du kommst mir erheblich billiger. Ein Teller Suppe und genug.«
»Wasser brauche ich auch«, konterte Bruno verschmitzt lächelnd und füllte das Glas erneut.
Sie schaute zur am Boden liegenden Tischuhr. »Es ist knapp vor zwölf. Großartig, dass wir es noch vor Mittag geschafft haben.«
»Wann kommen die Buben von der Schule?«
»In einer Stunde.«
»Das heißt, die Suppe wird rechtzeitig fertig sein.«
»Bleibst du zum Essen?«
Bruno verzog seinen Mund. Da Carlo und Fedora Cherini in Trennung von Tisch und Bett lebten und das Gerichtsverfahren noch anhängig war und da Fedoras Söhne Bruno vielleicht nicht hassten, dennoch ablehnten, hielt Bruno sich, was das Familienleben Fedoras mit ihren beiden Buben betraf, lieber zurück. Es reichte ja, dass sich im neuen Wohnhaus Fedoras die Leute den Mund zerrissen. Da sowohl Carlo als auch Fedora katholischer Konfession waren, war gemäß der Rechtsprechung Österreich-Ungarns eine Scheidung nicht möglich, nur Menschen anderer Konfessionen konnten sich in der Habsburgermonarchie rechtsgültig scheiden lassen. Für Katholiken gab es nur die Möglichkeit der Annullierung einer Ehe oder das Recht auf Trennung von Tisch und Bett. Im Fall des Ehepaares Cherini war die Annullierung nicht möglich, denn der Ehe waren zwei kerngesunde Knaben entwachsen. Also blieb für sie nur die Trennung von Tisch und Bett, wodurch die Ehe aufrechtblieb, aber sowohl Mann als auch Frau keine Eherechte und -pflichten mehr zueinander hatten. Da Carlo und Fedora einander trotz beiderseitiger Verfehlungen nicht wegen Ehebruchs angeklagt hatten, steuerte das Verfahren auf eine einvernehmliche Trennung zu.
Dennoch wohnte der Affäre erhebliches Potenzial zum Skandal inne. Carlo Cherini bekleidete als Erster Offizier des Liniendampfers Baron Beck eine bedeutende Stellung im Österreichischen Lloyd. Und der Geliebte seiner treulosen Ehefrau Fedora war auch kein geringer Mann, nämlich Inspector I. Klasse im Dienste des k.k. Polizeiagenteninstituts. Dass Carlo angeblich ein Verhältnis zu einer in Bombay lebenden Engländerin unterhielt, hatte sich zwar herumgesprochen, aber, ganz ehrlich, Triest war Triest, und Bombay sehr, sehr weit entfernt.
Bruno und Fedora hatten, nachdem die Baron Beck abgelegt hatte, demonstrativ ihre zuvor heimliche Beziehung offengelegt, um damit dem Getratsche den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie waren, kaum war der Skandal ruchbar geworden, gemeinsam auf den Markt und in die Fischhalle gegangen, hatten zusammen im Caffè degli Specchi Kaffee getrunken und im Teatro Verdi einer Opernaufführung beigewohnt. Diese Strategie war insofern von Erfolg gekrönt gewesen, als dass der Skandal tatsächlich bald vergangen und vergessen war.
Bruno allerdings hatte das Bekanntwerden seiner jahrelangen Beziehung zu Fedora beruflich erheblich geschadet. Ehebruch war nach dem Gesetz ein Vergehen, das bei einer Anklage eines geschädigten Ehepartners mit bis zu sechs Monaten Haft bestraft werden konnte und im Falle einer Verurteilung zur sofortigen Entlassung aus dem Polizeidienst geführt hätte. Brunos Glück war, dass Carlo keine Anklage erhoben hatte. Und das schlicht und einfach deshalb, weil Fedora drei Briefe seiner Engländerin gefunden hatte und offen gedroht hatte, auch Carlo wegen Ehebruch anzuklagen, was mit den vorliegenden Beweisen möglicherweise zu Haft, in jedem Fall aber zu einer Entlassung aus dem Dienst als Seeoffizier geführt hätte. So hatte sich das Ehepaar Cherini geeinigt, das Trennungsverfahren ohne Anklage einvernehmlich zu eröffnen. Der Polizeidirektor hatte Bruno nicht entlassen, aber bis zum Abschluss des Verfahrens vom Dienst suspendiert.
»Lieber nicht. Ich gehe wieder nach Hause.«
»Wie du willst.«
»Wann musst du wieder ins Theater?«
»Erst in zwei Tagen. Für den Umzug habe ich mir freigenommen.«
Nicht nur mit der Wohnung hatte Luise Fedora geholfen, auch bei der Arbeit. Auf Luises Empfehlung hatte Fedora eine Anstellung als Kostümbildnerin am Politeama Rossetti erhalten. Gemeinsam mit zwei anderen Frauen hielt sie den umfangreichen Kostümbestand des Theaters instand, sie arbeitete sowohl mit der Nadel in der Hand als auch mit der Nähmaschine. Das Gehalt war bescheiden, aber sie konnte ihre geringe Miete und den täglichen Bedarf ihrer Söhne bestreiten. Und natürlich half Bruno großzügig aus, zwar erhielt er in der Zeit seiner Suspendierung kein Gehalt, aber nach fünfzehn Jahren im Dienst der Triester Polizei hatte er Reserven angespart.
Bruno erhob sich und trat ans Fenster. Der Regen prasselte seit dem Morgengrauen herab. Zum Glück hatten sie die Möbel in der Hauseinfahrt – vor dem Regen geschützt – zwischenlagern können. »Eigentlich hast du es gar nicht so schlecht getroffen. Die Schule ist im Nachbarhaus, das Theater ist nicht fern und der Volksgarten liegt fast vor der Haustür.«
Fedora stellte sich neben ihn und umfasste seine Taille, er legte seinen Arm um ihre Schulter. »Du aber auch nicht. Sobald Luise hier einzieht, hast du deine beiden Geliebten unter einem Dach vereint.«
»Ich nähere mich paradiesischen Zuständen.«
Fedora grinste schief. »Ich glaube, du wirst unter der Last der Verantwortung zusammenbrechen.«
»Da kann ich mir schlimmere Niedergänge vorstellen.«
»Bestimmt ist es ein Vorteil, dass der Weg in dein Stammcafé dich hier vorbeiführt.«
»Du meinst, ich kann in Zukunft vor, während und nach dem Billardspiel zu dir hochlaufen, um einen Teller Suppe oder ein Glas Wasser zu holen.«
»Du könntest dir auch einen Kuss holen.«
»Nun, dafür, dass ich dein Mobiliar vier Stockwerke hochgeschleppt habe, hätte ich einen verdient.«
Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Wann sehe ich dich wieder?«
»Morgen vielleicht. Ich bin um zehn Uhr zum Polizeidirektor vorgeladen.«
»Wie bitte? Und die ganze Zeit über sagst du nichts!«, rief Fedora überrascht. »Erklär mir das.«
Bruno zuckte mit den Achseln. »Gestern habe ich einen Brief erhalten. Der Direktor bittet mich höflich um pünktliches Erscheinen.«
»Was will er von dir? Das Trennungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.«
»Vielleicht häufen sich die Schwierigkeiten in der Kanzlei und sie brauchen mich wieder. Oder ich erhalte auf Weisung des Ministeriums in Wien endgültig die Entlassung. Morgen werde ich mehr erfahren.«
*
»Einen Dreck werde ich tun! Nur einem Kretin wie dir kann so etwas einfallen.«
Luise Dorothea Freifrau von Callenhoff saß wie immer bei formellen Anlässen aufrecht, nichts regte ihre Miene und sie rührte mit gemessenen Bewegungen den Zucker in den Tee. Ihre Mutter wäre stolz auf sie gewesen, Luise präsentierte ihre sorgsame Erziehung vollendet. Als vierte und jüngste Tochter des Barons von Kreutberg gehörte sie einem Geschlecht mit fünfhundertjährigem Stammbaum an. Seit Luise den Baron Callenhoff geheiratet hatte, trug sie zwar nicht mehr ihren Mädchennamen, aber Erziehung hatte man, oder eben nicht. Luise hatte. Und sie trug diese mittlerweile wie einen Harnisch. Es war keine leichte Lektion gewesen, dies zu erlernen, denn in der Tiefe ihres Wesens war sie in keiner Weise eine wehrhafte Person. Aber um sich einer Konfrontation mit der Mutter ihres Ehemanns zu stellen, hatte sie unter gewaltigen Mühen und noch schlimmeren Schmerzen ein Kettenhemd anlegen müssen. Luise hielt stand, weil die Schlacht zum Glück entschieden war. Ihrer Schwiegermutter blieben allein noch wütende Rundumschläge, die von einer derart starrsinnigen und kaltherzigen Person selbstverständlich zu erwarten gewesen waren.
»Euer Gnaden, es besteht kein Anlass für Injurien«, sagte Luise.
Sieglinde von Callenhoff schaute die Ehefrau ihres Sohnes verächtlich an. Es schien, als ob sie in jedem Moment die ekelhafte Galle ihres Lebens auf den Boden spucken wollte. »Du wirst mich nicht von meinen Ländereien jagen. Du nicht!«
»Euer Gnaden, geehrte Frau Schwiegermutter, niemand trachtet danach, Euch von Euren Ländereien oder aus Eurem Haus zu jagen, und ich, wie ich Euch inständig versichere, am allerwenigsten. Nichts läge mir ferner, als mir dieses Haus anzueignen.« Luise formulierte zwar einen weiteren Satz, behielt ihn aber für sich. In Wahrheit sähe ich es mit Wohlwollen, wenn eine Feuersbrunst den grässlichen alten Kasten hinwegfegen würde.
»Du glaubst wohl, ich weiß nicht, was du für ein Flitscherl bist. Du Metze. Eine Soldatenhur bist du.«
Dr. Andreas Salmhofer räusperte sich und schaute, ob der Entgleisung der alten Baronin, betreten zum Fenster hinaus. Sie saßen zu dritt im Salon im Stammhaus der Familie Callenhoff unweit der Stadt Görz, das Hausmädchen hatte Tee und Zwieback serviert. Der Hausarzt der Familie Callenhoff betreute die Baronin seit zwanzig Jahren, seitdem er die Arztpraxis von seinem Vater übernommen hatte, aber natürlich kannte er die Dame des Hauses bereits von Kindesbeinen an. Schon sein Vater war Hausarzt der Callenhoffs gewesen. Die Barone bezahlten alle Rechnungen pünktlich, also erhielten sie auch ehrliche Leistungen nach den besten Möglichkeiten ärztlicher Kunst, doch das Verhalten der Baronin war, wie Dr. Salmhofer Luise gegenüber zugegeben hatte, mit der Zeit zu einer echten Herausforderung für dessen Integrität geworden. Was für ein Segen, so hatte der Hausarzt Luise gegenüber formuliert, dass sie auf seine Briefe reagiert hatte und nun schon mehrmals nach Görz und auf den Landsitz der Callenhoffs gekommen war.
»Euer Gnaden, bitte verzichtet auf Unflätigkeiten. Wir wollen nur das Beste für Euch.«
»Zum Henker mit dir.«
Luise erwiderte nichts. Was hätte sie auch sagen sollen, die Mutter ihres Mannes verlor alle Fassung. Es war ein Trauerspiel.
Dr. Salmhofer räusperte sich erneut. »Euer Gnaden, es entspricht vollständig der Wahrheit, dass wir allein Euer Bestes wollen. Die Baronin hat für Euch eine sehr luxuriöse Suite im Kurhaus reserviert, die Baronin hat auf meine ärztliche Empfehlung sämtliche Maßnahmen eingeleitet und für Euch eine exquisite und medizinisch aussichtsreiche Kur bestellt. Die Fahrkarte nach Abbazia ist gekauft, ein Dienstmann wird während der Reise für Euer Wohlbefinden sorgen. Ich selbst habe den ärztlichen Leiter der Kuranstalt einen umfassenden Brief über Euren Gesundheitszustand geschrieben. Es steht völlig außer Zweifel, dass die Kur nur zu Eurem Besten sein kann und auch wird. Bitte, Euer Gnaden, Euer Gesundheitszustand erfordert unbedingt die Ergreifung klarer Maßnahmen. Sogar Euer Sohn, der Baron Callenhoff, hat mir aus Südamerika geschrieben und mich gebeten, mich um Euch zu kümmern. Die Kur wird Euch guttun.«
Sieglinde von Callenhoff schaute den Arzt unverwandt an. »Mein Sohn ist ein Trottel. Warum schreiben Sie Helmbrecht überhaupt? Was erlauben Sie sich? Wo treibt sich der Nichtsnutz schon wieder herum? Südamerika? Was will er dort? Dieser Esel!«
»Euer Gnaden, Euer Sohn, der Herr Baron, hält sich seit zwei Monaten aus geschäftlichen Gründen in Brasilien auf. Er besucht und erweitert seine Kaffeeplantagen. Darüber haben wir mehrfach gesprochen.«
»Wollen Sie behaupten, ich wäre senil und würde alles vergessen?«, keifte die Baronin.
»Ich habe Euch auch berichtet, dass sich der Herr Baron bei einem Jagdausflug mit Malaria angesteckt hat. In seinem Brief spricht der Herr Baron mir gegenüber davon, dass er eine Woche unter hohem Fieber gelitten hat und sich gegenwärtig langsam erholt. Er konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden und befindet sich in seinem Landhaus in Behandlung seines Hausarztes. Auch der Arzt hat mir aus Brasilien geschrieben.«
»Helmbrecht ist selbst schuld. Der Blödian hat in Südamerika nichts zu suchen.«
»Wir hoffen alle auf die rasche Genesung des Herrn Barons.«
»Ach was, Unkraut vergeht nicht.«
Luise betrachtete die alte, sichtlich von ihrer Krankheit gezeichnete Frau. In der letzten Phase ihres Lebens war aus der ebenso bösen, wie mächtigen Hexe eine Karikatur geworden. Ja, Luise hatte in den verletzlichsten Momenten ihres Lebens die Macht dieser Frau wie glühendes Eisen auf der Haut gespürt, ja, sie hatte Luises Leben beinahe zerstört, ja, Luise war nur um Haaresbreite dem Sprung von den Klippen entgangen, zu welchem die Baronin sie verdammt hatte. Hier und heute empfand sie daher kaum Mitleid für eine an den Möglichkeiten des Lebens vollends gescheiterten Frau. Wie oft hatte Luise sich gefragt, was aus ihrem Leben geworden wäre, wenn ihre Eltern nicht die Ehe mit Helmbrecht von Callenhoff arrangiert hätten? Tausendfach hatte sie sich das gefragt. Und nicht ein einziges Mal hatte sie eine plausible Antwort auf die Frage gefunden. Jetzt aber stand Sieglinde von Callenhoff an der Pforte des letzten Weges, während sie, Luise von Callenhoff, noch ein langes Leben mit ihrem Sohn Gerwin vor sich hatte.
Sie hatte Gerwin noch immer nicht zu Gesicht bekommen, Sieglinde hatte den beinahe sechsjährigen Knaben bis zum heutigen Tage im hinteren Teil der Villa eingeschlossen und somit vor seiner Mutter versteckt. Aber bald würde Sieglinde nach Abbazia gebracht werden, um dort ihre medizinische Betreuung zu erhalten. Und dann, endlich, würde ihr Sohn bei ihr sein, dann würde er dem Drachen entrissen und fortan bei seiner liebenden Mutter leben.
Ihr Gemahl Helmbrecht hatte bei Antritt seiner Reise nach Brasilien geplant, vor Weihnachten wieder in Europa zu sein, aber durch seine Erkrankung war dieses Vorhaben gefährdet. Der aus Portugal stammende Arzt in Santos hatte in seinem Brief an Dr. Salmhofer geschrieben, dass der Baron substanziell Gewicht verloren habe, beträchtlich geschwächt und in seinem gegenwärtigen Zustand nicht reisefähig sei. Also waren sowohl die alte Hexe wie deren Sohn krank.
Helmbrecht selbst hatte nicht Luise geschrieben, sondern nur Salmhofer. Offenbar fand er es nicht der Mühe wert, seiner Ehefrau von seinem Zustand zu berichten. In Wahrheit war Luise sogar erleichtert darüber, denn das vereinfachte die nächsten Schritte.
Natürlich kümmerte sie sich um die bestmögliche Versorgung ihrer Schwiegermutter nur aus einem Grund: um endlich ihren Sohn wiederzusehen. Luise gestand sich ein, dass ein gewisses Maß an Kaltherzigkeit ihrer Schwiegermutter auf sie ausgestrahlt hatte. Luise verstand diese Regung, und sie versuchte, diesen Krankheitskeim in sich unter Kontrolle zu halten. Sie durfte diese Krankheit der Seele nicht von sich Besitz ergreifen lassen. Ihre Schwiegermutter war der Krankheit verfallen, zuerst in der Seele, danach im Geist und jetzt auch an ihrem Körper. Die Krankheit fraß sich durch die alte Frau hindurch und gab somit Luise ein warnendes Beispiel. Aber Luise war zuversichtlich, sie war mittlerweile stark genug, der Krankheit namens Bosheit zu trotzen. Sie freute sich auf das Wiedersehen mit ihrem Sohn.
Helmbrecht von Callenhoff war kein Mann, den man sich als junge Frau zum Gatten wünschte. Wenn er nicht bekam, was er verlangte, wurde er gewalttätig. Während Gewalt lediglich in den Worten seiner Mutter lag, wandte Helmbrecht diese wiederholt an. Zusammen machten Mutter und Sohn Luise das Leben kaum erträglich. Den Sohn hatten sie ihr von der Mutterbrust gerissen und entführt. Ja, Luise hatte tiefschürfende Krisen hinter sich, sie war nach der Niederkunft ihres geliebten Sohnes in ein Loch gefallen und hätte beinahe ihren neugeborenen Sohn mitgerissen. Es war mit aller Wucht die Angst über sie gekommen, wieder Opfer ihres Ehemanns zu werden. Gerwin war ihr Sohn, ihr Ein und Alles, aber er war auch die Frucht einer Gewalttat. Helmbrecht war betrunken gewesen, hatte sie geschlagen, auf das Bett geworfen und gegen ihren Willen genommen. Diese Tat hatte zur Schwangerschaft geführt. Luises Arzt Dr. Samigli hatte ihr geholfen, diese Nacht des Schreckens zu vergessen und sich auf die Niederkunft vorzubereiten. Es war ihr gelungen, sie hatte sich auf das in ihrem Bauch regende Kind gefreut, doch nach der Geburt war sie in eine finstere Starre der Angst verfallen. Sie hatte die Vorhänge in ihrem Zimmer zugezogen, ihren Sohn nicht der Amme gegeben und sich wochenlang mit Gerwin eingeschlossen. Sie hatte kaum essen können und war merklich abgemagert, mit der Folge, dass die Milch ihrer Brüste knapp und der Säugling kaum mehr satt geworden war. Als der Hausarzt eine Warnung ausgesprochen hatte, dass dem Kind bei weiterer schlechter Versorgung Schaden drohe, hatte der Baron Maßnahmen ergriffen und die Tür zu ihrem Zimmer aufbrechen lassen. Ihr Mann und seine Mutter hatten ihr den Sohn entrissen und sie zuerst wochenlang in eine Irrenanstalt, danach monatelang in ein Sanatorium im weit entfernten Karlsbad gesteckt. Die Krankenschwestern in Karlsbad hatten mehrere ihrer Versuche vereitelt, aus dem Leben zu scheiden. Währenddessen hatte ihre Schwiegermutter den Sohn des Baron Callenhoff unter ihre Fittiche genommen, um aus ihm den Erben des Geschlechts zu formen. Nach dem Aufenthalt in Karlsbad hatte Luise rund zwei Jahre in der Einsamkeit der Villa in Sistiana vegetiert, sie war zu schwach sowohl für das Leben wie auch für den Freitod gewesen. Ihr Mann hatte sich nicht mehr um sie gekümmert, Reisen unternommen, Pferderennen besucht, seine einträglichen Geschäfte betrieben, sich schamlos mit Kurtisanen vergnügt und bei Jagdausflügen alles geschossen, was ihm vor die Flinte gelaufen war.
Dann war just in jenem Moment, als Luise zum allerersten Mal nach all dem Schrecken und der Qualen den Gedanken an ein weiteres Leben gefasst hatte, ein Mann in ihr Leben getreten. Dieser Mann hatte ihre Hilfe suchende Hand ergriffen und, ohne zu zögern, sie auf den Weg zurück ins Leben geleitet. Sie verdankte Bruno in Wahrheit alles.
So hatte Luise nach und nach Kraft gefunden, Freude und Zuversicht kennengelernt, Zärtlichkeit und Verlangen entdeckt, sie hatte in Bruno einen Seelenfreund, Gesprächspartner und Liebhaber gefunden. Sie hatte auch die Literatur für sich entdeckt und begonnen, Erzählungen in deutscher und Gedichte in italienischer Sprache zu verfassen. Sie war aus einem von existenziellen Krisen zerrissenen Mädchen, das man jung und unerfahren in eine ungewollte Ehe getrieben hatte, zur erwachsenen und eigenverantwortlichen Frau gereift.
Und Luise hatte mittlerweile den Mut, sich gegen die Macht und den Hass ihrer Schwiegermutter und ihres Gatten aufzulehnen. Nach über fünf Jahren würde sie endlich ihren Sohn wiedersehen. Sie konnte sich noch so genau an das kleine, süße Gesicht erinnern, an den kleinen Mund, der an ihren Brüsten gesaugt hatte, sie war sich sicher, ihn sofort wiederzuerkennen, obwohl sie ihn in all den Jahren nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen hatte.
»Euer Gnaden, geehrte Frau Schwiegermutter, in zwei Tagen werdet Ihr nach Abbazia zur Kur fahren. Es ist der Wille Eures Sohnes, der Wille Eures Arztes und es ist mein Wille, dass Ihr umfassende medizinische Betreuung erhaltet. Das Leben hat Euch manche Unbill aufgebürdet, doch jetzt, im Angesicht der schwerwiegenden Erkrankung, soll Euch alle Wohltat dieser Welt zuteilwerden.«
Sieglinde warf die Teetasse zu Boden, die sofort zersplitterte. »Der Bub gehört mir! Mir allein! Du kriegst Gerwin nicht! Du bist keine Frau, keine Mutter, du bist nichts!«
Luise nahm in aller Ruhe einen Schluck Tee. Ceylon, eine sehr gute Sorte. »Oh nein, Euer Gnaden, geehrte Frau Schwiegermutter, ich bin hier. Es werden noch Jahrzehnte vergehen, bis ich nicht bin. Ihr hingegen werdet in absehbarer Zeit ins Nichts vorangehen. Macht Euch bereit für diese Reise.«
*
»Baumberg, mein Freund, ich sag dir, neulich hab ich mit dem Marischka und ein paar von seinen Spezis mullatiert. Herrlich! Die Musik dazu. Klassikaner, sag ich dir. Drei Ungarn. Fesch haben die Buben gespielt, mit Paprika. Eine Riesenhetz die ganze Nacht.«
»Beim Hopfner?«
»Na, wo denn sonst? Dort kannst dich auch in der Ausgehuniform sehen lassen. Und Mädels, meiner Seel, Baumberg, da wird man wieder zum jungen Spund. Ich sag dir, da war so ein süßes Mädel, herzallerliebst, das war ein Hund. Haha, hast den Reim gehört? Spund, Hund. Ist mir so rausgerutscht.«
Baumberg lauschte verschmitzt lächelnd der Erzählung seines älteren Freundes Major Johann von Stukart. Wie lange hatten die beiden Männer einander nicht gesehen? Baumberg rechnete nach. Vor ziemlich genau drei Jahren hatten sie knapp vor Baumbergs Abreise nach Triest im Hotel Imperial bei Tisch gesessen. Wie es sich für einen anständigen Stabsoffizier gehörte, wusste Stukart zu leben.
»Ein Wetter habt ihr hier an der Adria! Ich dachte, hier scheint immer die Sonne. Der Regen will offenbar gar nicht mehr aufhören. Aber sehr warm ist es. Ich komme mir vor wie am Heustadelwasser im Prater mitten in einem Sommergewitter. Dabei habe ich die Winterwäsche eingepackt, den warmen Mantel, die Handschuh, und was muss ich vorfinden? Ein Lufterl wie in einem türkischen Bad.«
»Das ist der Scirocco. Die warme Luft der Sahara strömt nach Norden und über dem Mittelmeer nimmt der Wind die Regenwolken mit. Passiert aber eher selten.«
»Das erinnert mich an die Zeit in der Garnison in Budweis. Da habe ich das halbe Jahr einen Nebel gehabt und das andere halbe Jahr den Regen.«
»Na ja, mit Budweis kannst du Triest nicht vergleichen. Das ist klimatisch schon eine andere Welt.«
»Als ich vor vier Jahren einen Monat in Triest verbracht habe, hat immer die Sonne gestrahlt und es war herrlichstes Sommerwetter. Da habe ich mir schon gedacht, die Adria ist ganz nahe dran am Paradies. Aber das war im August, da hat offenbar der Kaiser für das Kaiserwetter gesorgt. Mir scheint, hier ist die dunkle Jahreszeit recht regnerisch und warm.«
»Wenn im Winter die Bora fällt, schaut es ganz anders aus. Da wird es kalt und stürmisch.«
»Im Winter bringen mich eh keine fünf Rösser vor die Tür. Als ich heute in aller Herrgottsfrühe im Schlafwagen aufgewacht bin, habe ich den starken Wind bemerkt. Ich konnte dann nicht mehr einschlafen.«
»War deine Reise unangenehm?«
Stukart zuckte mit den Achseln. »Ach, es ging so einigermaßen. Lieben tu ich den Schlafwagen nicht, aber es ist halt schon sehr praktikabel, Wegstrecken im Schlaf zurückzulegen. So konnte ich heute den ganzen Tag arbeiten. Was angesichts des regnerischen Wetters ohnedies gut gepasst hat.«
»Nun, das Klima an der Adria ist im Großen und Ganzen schon sehr angenehm.«
»Wenn du das sagst. Aber ich lasse mich trotzdem nicht nach Triest versetzen, obwohl die Restaurants hierorts ja vom Feinsten sind. Davon konnte ich mich schon vor vier Jahren überzeugen.«
»Aufs Kochen verstehen sich die Italiener, da gibt’s kein Kontra.«
»Ich weiß auch, dass ihr hier fesche Mädels habt’s. Die schönen Italienerinnen, das sag ich dir, eine hübscher als die andere. Gutes Essen, fesche Mädels, was soll’s, den Krieg können herzlich gern die anderen vorbereiten, ich lasse mich trotz Regen und Wind hierher versetzen.«
Die beiden lachten.
Seit mehreren Jahren war der Mittvierziger Stukart einer der Adjutanten des Chefs des Generalstabes. Franz Conrad von Hötzendorf, den selbst seine engsten Freunde mit seinem Nachnamen Conrad ansprachen, vertraute dem im Reichskriegsministerium bestens vernetzten Major vor allem repräsentative Aufgaben an, die Stukart vermöge seiner blendenden Erscheinung und seiner Leutseligkeit zur vollsten Zufriedenheit seines Vorgesetzten erfüllte. Als der General sich anschickte, zu einer Geheimkonferenz nach Triest aufzubrechen, hatte Stukart die Reisevorbereitungen getroffen. Und natürlich hatte er seinem alten Kameraden Baumberg per Telegramm die Ankunft avisiert, woraufhin Letzterer in Triest die nötigen Maßnahmen ergriffen hatte. Die beiden Männer saßen in Baumbergs Bureau der Statthalterei und ließen einen arbeitsreichen Tag bei Cognac und Zigaretten ausklingen.
Stukart schwenkte genießerisch sein Glas. »Das Gesöff ist exzellent, fast fürstlich im Geschmack. Wird der hierorts gebrannt?«
»Am Stadtrand befindet sich die Destillerie Camis & Stock. Die Qualität rührt von den verarbeiteten Trauben. Auch der Wein aus dem Karst gehört zum Besten, was man in der gesamten Monarchie kriegen kann.«
»Langsam verstehe ich, warum du Hallodri von Wien nach Triest gegangen bist. Leben lässt sich’s hier offenbar recht angenehm.«
»Ich kann nicht klagen.«
Stukart schaute sinnierend zum Fenster. Baumberg beobachtete seinen Bekannten. Ein Grund, weswegen Baumberg von Reichskriegsminister persönlich mit seiner Aufgabe betraut worden war, lag in seiner Fähigkeit, Menschen zuzuhören. Baumberg hatte eine bevorstehende glänzende Karriere als Soldat im Rang eines Hauptmanns beendet, um in einen sehr elitären und diskreten Zirkel aufgenommen zu werden. Baumberg war nicht wegen des Wetters, des guten Essens oder der edlen Weine nach Triest gekommen, sondern weil er hier etwas aufbauen hatte können, weil hier ein Mann mit seinen Fähigkeiten gebraucht und auch gefordert war. Baumberg hatte eine Aufgabe gefunden, für die er geradezu prädestiniert schien.
»Und, glaubst du, wird sich Conrad durchsetzen?«, fragte Baumberg nach einer Weile des Schweigens.
Stukart seufzte. »Sag du es mir! Du bist das ganze Jahr mit den Leuten von der Kriegsmarine zusammen.«
Die in zwei Tagen geplante Geheimkonferenz würde neben dem Chef des Generalstabs Franz Conrad von Hötzendorf, den Reichskriegsminister Franz Xaver Schönaich, den k.u.k. Außenminister Alois Lexa von Aehrenthal und den Marinekommandant Admiral Rudolf Graf von Montecuccoli zusammenführen.
»Die Marine wird nicht zustimmen. Sie kann nicht zustimmen«, meinte Baumberg.
Stukart schaute sich im Raum um. »Haben die Wände hier Ohren?«
Baumberg schüttelte den Kopf. »In diesem Zimmer führe ich alle meine Besprechungen. Du bist sicher wie in Abrahams Schoß.«
Stukart kniff die Augen zusammen. »Nicht nur Montecuccoli wird bremsen. Aehrenthal wird dem Präventivkrieg gegen Italien ebenfalls nicht zustimmen. Noch besteht der Dreibund zwischen Österreich-Ungarn, Deutschland und Italien, selbst wenn es die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass die Italiener ihre Rüstungsanstrengungen forcieren, nicht weil sie Frankreich Angst einjagen wollen, sondern um unserem geliebten Kaiser seine Ländereien an der Adria zu entreißen. Wenn du mich fragst, hat Conrad völlig recht, mit der welschen Bagage in Venedig und Mailand muss man Schlitten fahren.«
»Zweifelsfrei, aber unsere Marine ist nicht gerüstet für den Kriegsfall.«
»Und wessen Schuld ist das? Die Politiker in Wien und Budapest blockieren die vernünftige Ausrüstung der Marine, wo es nur geht. Ich halte nichts von Politikern, das sind allesamt geltungssüchtige Streithanseln und Querulanten.«
Baumberg wiegte den Kopf. »Ich habe läuten gehört, dass unser braver 24 cm Mörser einen großen Bruder kriegen wird.«
Stukart zog beeindruckt die Augenbrauen hoch. »Dafür, dass du an der Adria sitzt, bist du erstaunlich gut im Bilde. Du hältst natürlich dicht.«
»Ehrensache.«
»Ja, die Škoda-Werke haben den Auftrag zum Entwurf erhalten.«
»30,5 cm, wie ich gehört habe.«
»Gnade Gott wem auch immer, wenn das Monstrum erst pumpert.«
»Armee und Marine schreiten voran.«
»Durch den russisch-japanischen Krieg 1905 hat die Entwicklung der Militärtechnik dramatisch an Fahrt gewonnen. Auch bei der Artillerie geht es stürmisch vorwärts. Ich war bei der Erprobung von neuen Feldhaubitzen am Schießplatz in Felixdorf dabei. Baumberg, ich sage dir, als die Batterie gefuhrwerkt hat, da hat die Erde gebebt. Škoda produziert unter Hochdruck. Unsere Artillerieregimenter sind so stark wie nie zuvor. Wir sind den Italienern und Serben klar überlegen, keine Frage. Also wenn man durchgreifen will, dann jetzt. Ja, die Küste ist verwundbar, ja, unsere Marine ist zahlenmäßig unterlegen, aber lass einmal am Isonzo unsere Artillerie ihr frohes Schaffen verrichten und dann die Infanterie losmarschieren. Ein paar Tage später können wir in Mailand Chianti goutieren, das garantiere ich dir. Der Präventivkrieg ist nicht nur möglich, er ist nötig. Davon ist Conrad überzeugt, der gesamte Stab und ich sowieso. Und was wird uns diese Überzeugung nutzen? Rein gar nichts. Ich fürchte, die Bremser werden sich wieder durchsetzen.«
»Und dennoch ist der Generalstab angereist.«
»Sollen wir’s unversucht lassen? Na freilich sind wir angereist. Vielen Dank übrigens, dass du ausgesprochen diskret alles vorbereitet und mir den ganzen Tag zur Seite gestanden hast. War ja doch einiges zu erledigen. Du und deine Leute leistet ganz hervorragende Arbeit. Das ist bis zu Conrad vorgedrungen.«
Baumberg nickte geschmeichelt. »Stets im Dienst des Kaisers und der Generalität.«
Stukart öffnete seine Zigarettenschatulle und hielt sie Baumberg hin. Die beiden Männer entflammten ihre Zigaretten.
»Zum Glück erkennt der Reichskriegsminister den Wert der geheimdienstlichen Arbeit. Und zum Glück haben wir Männer wie dich, Baumberg, die den Kopf, die Disziplin und ein bisserl auch die Geduld für diese mühselige und in der Regel unbedankte Arbeit haben.«
Baumberg schmunzelte. »Da hast du recht, Stukart. Je weniger man von mir hört und sieht, desto besser. Wenn ich populär hätte sein wollen, wäre ich Schauspieler geworden. Oder noch schlimmer: Außenminister.«
Die beiden Männer lachten herzhaft.
Dienstag, 5. November 1907
Wie üblich marschierte Bruno zu Fuß die Strecke von Cologna in die Stadt. Ein Blick aus dem Fenster hatte ihm gezeigt, dass der Regen in den Morgenstunden merklich nachgelassen hatte, also hatte er seinen leichten Mantel angezogen, einen Regenschirm genommen und war aufgebrochen. Er wusste auf die Minute genau, wie lange er für den Weg zur Polizeidirektion brauchte, immerhin beschritt er diesen Weg seit einem Jahrzehnt. Noch als junger Polizist hatte Bruno die Gelegenheit erhalten, als außerordentlicher Hörer ein Jahr an der Grazer Universität zu studieren. Damals war er Student von Professor Hans Gross gewesen und vom Gründungsvater der wissenschaftlichen Disziplin der Kriminologie und Erfinder der systematischen Kriminalistik unterrichtet worden. Nach seiner Zeit in Graz war er sehr bald vom normalen Streifendienst in das k.k. Polizeiagenteninstitut übernommen worden, wo er Schritt für Schritt die Karriereleiter zum Inspector I. Klasse hochgestiegen war. Und ja, der Polizeidirektor selbst hatte es Bruno gegenüber in den Raum gestellt, dass er der ideale Kandidat wäre, dereinst, wenn Oberinspector Gellner den Ruhestand antreten würde, die Leitung der Kanzlei zu übernehmen. Doch seitdem im letzten September Brunos außereheliche Beziehung mit der Gattin des Seeoffiziers Carlo Cherini aufgeflogen war, hing seine Laufbahn als Polizist mit einem Mal am seidenen Faden.
Das ging so weit, dass Bruno bereits mit dem Gedanken kokettiert hatte, die Krise zu nutzen, um den Polizeidienst zu quittieren. Sein verstorbener Vater Salvatore hatte in seiner bestimmenden Art die Laufbahn als Polizeibeamter für Bruno vorgesehen, er selbst wäre viel lieber technischer Wissenschaftler oder Constructeur geworden. Seine jugendliche Neugier hatte den Naturwissenschaften gegolten, nicht der Fahndung nach Taschendieben, Trickbetrügern oder Totschlägern. In den ersten Jahren seiner Tätigkeit hatte er die Arbeit als Polizist nicht wirklich gehasst, aber auch keinerlei Begeisterung dafür empfunden. Er hatte sich eingefügt, weil eine Rebellion gegen den Willen seines Vaters niemals infrage gekommen wäre. Und zwar nicht, weil Salvatore Zabini ein Tyrann gewesen war, sondern ein umsichtiger, treu sorgender und von der Gültigkeit seiner Entscheidung unbeirrbar überzeugter Vater. Erst das Studium bei Hans Gross und die Erkenntnis, dass die Polizeiarbeit der Zukunft sich der exakten Methoden der Wissenschaft bediente, hatte ihn zum Polizisten werden lassen. Nicht wenige Fälle hatte Bruno gelöst, weil er der einzige Polizist in Triest war, der die Methoden der Daktyloskopie anzuwenden verstand. Er hatte bewirkt, dass das Polizeiagenteninstitut einen Photoapparat angeschafft hatte und eine Dunkelkammer eingerichtet worden war. Er hatte sich selbst eine Kommissionstasche nach dem Vorbild Hans Gross’ zusammengestellt, den manche »Zabinis Tatortkoffer« nannten. Er hatte sich Kenntnisse der Physik, Chemie und Medizin angeeignet, die er bei der Klärung von Fällen systematisch zur Anwendung brachte.
Die Wochen der Suspendierung hatten ihm nach und nach klargemacht, dass er durch die Quittierung des Polizeidienstes einen beträchtlichen Teil seines Lebens verlieren würde. Es hatte ein Weilchen gedauert, bis er in sein Leben als Kriminalist gefunden hatte, aber nun steckte er mittendrin. Und jetzt brauchte er nicht einmal mehr seine Beziehung zu Fedora verheimlichen. Das fühlte sich nach Befreiung an. Natürlich musste die Beziehung zu Luise weiterhin im Verborgenen bleiben. Was für ein Glück, dass Luise und Fedora sich nicht nur kennengelernt, sondern sich an diesem wunderbaren, verrückten, irgendwie poetischen Septemberwochenende in Luises Villa in Sistiana angefreundet hatten. Ja, Bruno liebte die klare Rationalität des Kausalitätsprinzips, er war ein Diener der ordnenden Kraft von Ursache und Wirkung, aber dennoch gestand er sich ein, in Liebesdingen ein bisschen irrational zu sein. Konnte man es verrückt nennen, zwei sehr unterschiedliche, in jeder Hinsicht einzigartige Frauen zu lieben? Wenn ja, dann musste er wohl mit dieser Verrücktheit leben.
Davon allerdings würde er Polizeidirektor Dr. Rathkolb im nun anstehenden Gespräch nichts erzählen. Manche Belange durften, sollten oder mussten Privatsache bleiben.
Bruno stand vor dem Gebäude der Polizeidirektion und schaute an der Fassade des Gebäudes hoch. Er schüttelte das Wasser vom Regenschirm. Was wartete im Gedärm des Gebäudes auf ihn? Was hatte Dr. Rathkolb ihm mitzuteilen?
Der Regen hatte den Wüstenstaub vollständig von den Straßen und Dächern gespült. Im Süden klarte der Himmel nach und nach auf.
Bruno stemmte sich gegen das schwere Haustor.
*
So amüsant und erfolgreich die gestrige Zusammenarbeit mit Stukart auch war, so zeitaufwendig war sie. Baumberg war gestern nicht um die Burg dazu gekommen, sich dem Fall Lainer zu widmen. Ja, eine Geheimkonferenz auf höchster Ebene erforderte sorgfältige Vorbereitung, aber die organisatorische Arbeit war nicht Baumbergs liebste Beschäftigung, er gefiel sich mehr in der Rolle des Ermittlers, des Aufdeckers, des Spürhundes. Und der Fall Lainer war so unvermutet aufgetaucht, beziehungsweise vor den Güterzug gefallen, dass Baumberg unbedingt die Hintergründe erforschen musste. Immerhin hatte gestern Vanek die in Lainers Tasche gefundenen Bücher genau inspiziert, und sie hatten jetzt die Gewissheit, dass an diesen Büchern nichts Verdächtiges zu finden war, keine verschlüsselten Notizen, keine Markierungen, keine eingeklebten doppelten Blätter, es waren einfach nur ein Atlas mit Landkarten der gesamten Welt, ein offenbar häufig benutztes Mathematikbuch und das Lehrbuch der spanischen Grammatik. Waren die ersten beiden Bücher noch verständlicher Besitz eines Schiffsbauingenieurs, so fand Baumberg das spanische Lehrbuch auffällig. Baumberg wusste aus dem Dossier über den Mann, dass Lainer zwar ein guter Mathematiker, aber sprachlich nur mäßig begabt war. Deutsch, seine Muttersprache, beherrschte er perfekt in Wort und Schrift, sein Französisch war nicht ganz schlecht, aber sein Italienisch war nicht gut, obwohl er seit sechs Jahren in Triest lebte. Ungarisch sprach Lainer nur ein paar Worte. Warum also lernte er Spanisch? Eine Sprache, die in Österreich-Ungarn höchstens im diplomatischen Korps benötigt wurde. Hatte Lainer vorgehabt, sich nach Spanien oder Südamerika abzusetzen? Und wenn ja, warum? Das waren die Fragen, die er klären musste.
Leopold von Baumberg saß mit übereinandergeschlagenen Beinen auf einem Stuhl im Wartezimmer der großen Fabrikanlage. In diesem Trakt befanden sich die Verwaltung und die technischen Bureaus des Stabilimento Tecnico Triestino. Ein Laufbursche war in den verzweigten Gängen unterwegs, um dem Abteilungsleiter Hartmuth von Greifenstein den Besuch Baumbergs anzukündigen. Der Mann war der Vorgesetzte von Lainer und, wie Baumberg aus dessen Dossier wusste, seit Jahren ein sehr energischer und erfolgreicher Leiter einer der wichtigsten Abteilungen der großen Werft. Baumberg schaute auf seine Taschenuhr. Das dauerte.
Endlich erblickte er den Laufburschen.
»Der Herr Abteilungsleiter kann Sie jetzt empfangen. Bitte folgen Sie mir.«
Baumberg erhob sich und richtete seine Krawatte. Seit er die Uniform abgelegt hatte, kleidete er sich bewusst unauffällig. Elegante, aber nicht offensichtlich kostspielige Anzüge und Hüte nach den üblichen Gebräuchen, robuste Schuhe für einen Mann, der viel auf den Beinen war. Der Bursche führte Baumberg durch verwinkelte Gänge. In den Bureaus wurde fleißig gearbeitet. Der Stabilimento Tecnico war keine verschlafene Fabrik am äußersten Ende der Monarchie, er war ein führender Industriebetrieb, ein Taktgeber des mediterranen Schiffsbaus, gemeinsam mit dem Marinearsenal in Pola wurde hier an der Zukunft der Kriegsmarine gearbeitet.
Der Bursche klopfte an eine geschlossene Tür und wartete auf den Zuruf. »Herr Abteilungsleiter, wie angekündigt, Herr von Baumberg.«
»Baron Baumberg, ich begrüße Sie in meiner bescheidenen Kanzlei. Treten Sie nur näher, bitte setzen Sie sich. Darf ich Ihnen etwas aufwarten? Kaffee? Tee? Um diese Zeit wahrscheinlich noch kein Cognac, oder doch?«
Baumberg schüttelte die Hand des dreiundfünfzigjährigen Mannes. »Guten Tag, Herr von Greifenstein. Herzlichen Dank, keine Getränke. Ich möchte Ihre wertvolle Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen.«
Greifenstein wandte sich dem noch in der Tür stehenden Laufburschen zu. »Vielen Dank, Johannes, Sie können jetzt die Türe schließen.«
»Sehr wohl, Herr Abteilungsleiter.«