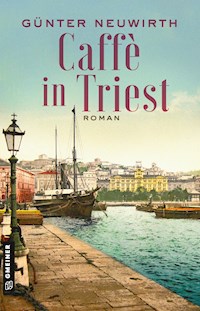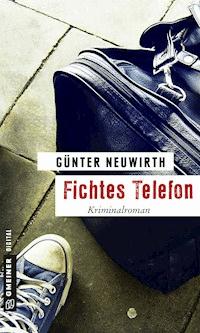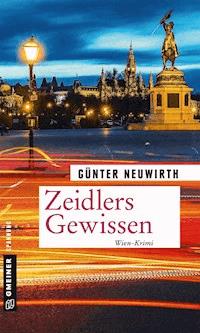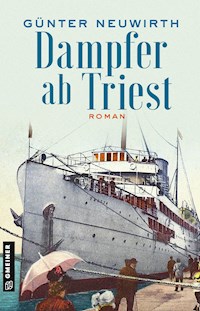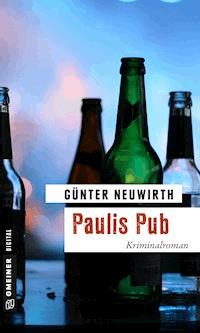Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Inspector Bruno Zabini
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte Bruno Zabini seinen Urlaub in Wien genießen. Aber das Verbrechen holt den Triester Inspector selbst hier ein. Die reiche Witwe Henriette Hohenau wurde bei einem Überfall ermordet. Und da der Fall Bezüge nach Triest aufweist, zieht die Wiener Polizei Bruno hinzu. Doch kurz darauf muss er zurück an die Adria, ohne den Mörder gefasst zu haben. In der Südbahn trifft er zufällig auf die drei Verdächtigen. Bruno nimmt inkognito Ermittlungen auf. Dann wird im Gepäckwagen eine Leiche gefunden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Neuwirth
Südbahn nach Triest
Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © ullstein bild – Imagno
ISBN 978-3-8392-7844-4
Personenverzeichnis
Brunos privates Umfeld
Bruno Zabini, 38, Inspector I. Klasse, Triest
Heidemarie Zabini, geb. Bogensberger in Wien, 60, Brunos Mutter
Salvatore Zabini (1836–1899), Brunos Vater
Maria Barbieri, geb. Zabini, 33, Brunos Schwester, Triest
Fedora Cherini, 35, Kostümbildnerin, Triest
Luise Dorothea Freifrau von Callenhoff, 28, Schriftstellerin, Sistiana und Triest
*
Die Triester Polizei
Dr. Stephan Rathkolb, 60, Polizeidirektor
Johann Ernst Gellner, 53, Oberinspector
Emilio Pittoni, 41, Inspector I. Klasse
Vinzenz Jaunig, 48, Inspector II. Klasse
Luigi Bosovich, 27, Polizeiagent I. Klasse
Romano Materazzi, 38, Polizeiagent I. Klasse
Ivana Zupan, 42, Schreibkraft
*
Die wichtigsten Akteure
Richard, 41, und Therese, 36, von Hartmannsthal, Luises Schwager und Schwester, Bad Ischl
Henriette Hohenau, geb. Kestranek (1833–1908), Witwe, Ehefrau von Stephan
Stephan Hohenau (1820–1888), Industrieller, Ehemann von Henriette
Eduard Kestranek, 33, Disponent der Südbahn, Triest
Meinrad Kestranek, 30, Kaufmännischer Hotelangestellter, Abbazia
Joseph Kestranek, 29, Offizier der k.u.k. Kriegsmarine, Pola
Karl, 58, und Liselotte, 57, Kestranek, Eltern der drei Brüder, Pola
Tassilo, 52, und Ernestine, 48, Wenzel, Gemischtwarenhändler, Görz
Ottilie Gomperz, 22, Zimmermädchen, aus Brünn
Lubomír Pospischil, 41, Kammerdiener, aus Kolleschowitz/Böhmen
Conrad Speyer, 42, Inspector I. Klasse, Wien
Isabelle de Nicolay, 28, Schauspielerin, Paris, Venedig
Prolog
Nie wieder würde sie ein Bankett ausrichten. Noch eine Woche danach war sie von der Undankbarkeit und Streitsucht ihrer Verwandten zutiefst beleidigt. Musste sie wirklich fünfundsiebzig Jahre alt werden, um mit solchen Vorwürfen konfrontiert zu werden? Sollte das Schicksal wollen, dass sie ihren achtzigsten Geburtstag erreichte, würde sie eine stille Feier in kleiner Runde veranstalten. Kaffee und Kuchen im Salon ihrer Beletage, eine Kerze für ihren geliebten Ehemann im Fenster, drei oder vier Gäste, mehr würde sie nicht wünschen. Henriette Hohenau verstand die heutige Welt kaum noch. Alles war so kompliziert und schnelllebig geworden. Natürlich war dieses Unverständnis ein Tribut an das Alter, das wusste sie sehr gut. Sie war betagt, aber nicht dumm.
Henriette Hohenau stand am Fenster der Bibliothek und schaute in den Park des Palais Schönburg. Aus der Ferne beobachtete sie, wie ein Eichhörnchen von einem Baum zum anderen lief und flink emporkletterte. Vögel zwitscherten. Sie richtete den Blick gen Himmel und verfolgte den Zug der Wolken. Die Naturbetrachtung stimmte sie milde, die Gedanken an den unschönen Ausgang des Festbanketts verschwanden. Ja, der Frühling war endgültig in Wien eingezogen, die Natur regte sich wieder. Wie oft hatte sie in Gedanken versunken hier am Fenster gestanden? Sie konnte es nicht schätzen. Sehr häufig. Sie liebte stille Tage wie diesen.
Am Vormittag hatte sie die Sonntagsmesse besucht, hatte in Andacht den Fürbitten und der Predigt gelauscht, danach die Kommunion empfangen. Nach der Messe hatte sie einen ausgedehnten Spaziergang unternommen. Trotz ihres Alters verzichtete sie nie auf kleine Rundgänge. Solange sie gut zu Fuß war, würde sie gesund bleiben, das war ihre feste Überzeugung. Natürlich, manche Alterserscheinungen plagten sie, aber im Allgemeinen hatte ihr Hausarzt wenig Grund zur Sorge um seine rüstige Patientin.
Zu Mittag hatte sie Suppe und frisches Obst als Dessert gegessen. Stephan und sie hatten ein Leben lang bescheiden gelebt, sie hatten Völlerei und Trunksucht verabscheut, sie hatten gemeinsam ungezählte Spaziergänge und Wanderungen unternommen, sie waren beide ausgezeichnete Reiter gewesen, und die Liebe zum Segeln hatte sie auch geeint. Sie hätte sich keinen besseren Ehemann wünschen können, und sie war ein Leben lang bestrebt gewesen, ihrem Stephan eine gute Ehefrau zu sein. Einmal im Monat besuchte sie sein Grab auf dem Centralfriedhof.
Dereinst würden sie im Grab wieder vereint sein.
Ein wenig hatte ihr Gehör im Laufe der Zeit nachgelassen, ebenso das Augenlicht, aber die Schritte auf dem Parkett vernahm sie eindeutig. Henriette Hohenau wandte sich überrascht vom Fenster ab und schaute hinter sich. Merkwürdig, sowohl Herr Lubomír als auch das Fräulein Ottilie waren doch außer Haus. Sie erwartete ihren Kammerdiener morgen im Laufe des Vormittags, und das Zimmermädchen würde überhaupt erst am Mittwoch zurück von der Reise nach Brünn sein. War etwas vorgefallen, weswegen Herr Lubomír früher zurückkehren hatte müssen? Hatte Fräulein Ottilie den Besuch bei ihren Eltern frühzeitig abgebrochen?
Henriette Hohenau ging in Richtung Vorzimmer. »Herr Lubomír, sind Sie es? Sind Sie schon zurück aus Stammersdorf?«
Im Gang und Vorzimmer war niemand. Die Wohnungstür war geschlossen und versperrt. Sie schaute in der Küche.
»Wo sind Sie denn? Herr Lubomír? Oder sind Sie es, Ottilie? Wo stecken Sie?«
Henriette Hohenau schritt sich umsehend durch ihre große Beletage.
»Ich habe mir das Geräusch doch nicht eingebildet«, murmelte sie.
Ein wuchtiger Schlag von hinten warf sie zu Boden. Hart prallte sie mit der Stirn auf das Parkett. Sie kam nicht dazu, einen Schrei auszustoßen, es ging so schnell. Etwas Kaltes lag plötzlich um ihren Hals. Sie griff danach. Draht, das wusste sie sofort, es war Eisendraht.
Schmerz. Unfassbarer Schmerz. Sie brachte nicht einen Laut hervor, nicht einmal ein Röcheln. Todesangst griff nach ihr. Dann brach ihr Blick.
Teil 1: Im Prater blühen die Bäume
Sonntag, 5. April 1908
Im Licht der untergehenden Sonne dampfte der Zug über den Semmering. Das Abendrot beleuchtete die letzten Schneefelder der Gipfel, während in den Nadelwäldern der Berghänge der Winter schon gewichen war. Der Frühling kündigte sich bereits im Gebirge an. Bruno, Gerwin und Grete schauten während der gesamten Fahrt über die weltbekannte Bergstrecke gebannt aus dem Fenster. Bruno stand in der Mitte, die beiden anderen saßen auf ihren Fensterplätzen. Erst als der Zug das Flachland erreichte und es zusehends dunkler wurde, setzte sich Bruno wieder.
Sie ließen die Bahnhöfe Wiener Neustadt und Baden hinter sich, der Zug näherte sich der Hauptstadt.
Gerwin stand auf und drückte seine Nase gegen die Scheibe. »So viele Lichter!«, rief der beinahe sechsjährige Knabe. »Grete, schau nur!«
Das Kindermädchen spähte zum Fenster hinaus. »Man sieht von der Stadt nicht viel, außer die Tausenden Lichter.«
Der ältere Herr, der in Baden am Gang Platz genommen hatte, blickte von seiner Zeitung hoch und suchte Augenkontakt zu Luise. »Sind Sie zum ersten Mal nach Wien unterwegs, gnädige Frau?«
Luise und Bruno saßen einander gegenüber auf den mittleren Sitzen des Coupés.
»Also ich war schon mehrmals in Wien, aber für meine Reisegefährten ist es tatsächlich die erste Ankunft«, antwortete Luise.
Der Herr lächelte freundlich. »Dann wünsche ich den beiden Herren und dem Fräulein einen schönen ersten Aufenthalt in der Kaiserstadt. Darf ich mich erkundigen, woher Sie kommen?«
Bruno wandte sich dem Mann zu. »Aus Triest.«
Dieser verzog beeindruckt seinen Mund. »So lange sind Sie schon im Zug? Die ganze Strecke von der Adria bis an die Donau?«
»Nun, wir haben uns während der Fahrt die Beine vertreten und im Speisewagen bei Tisch gesessen, aber ja, wir sitzen seit Sonnenaufgang im Zug.«
Der Mann schaute zum Gepäckträger hoch. »Anhand der Zahl Ihrer Koffer vermute ich einen längeren Besuch.«
»Wir haben für einen dreiwöchigen Aufenthalt gepackt«, erklärte Luise.
»In drei Wochen werden Sie so manches von Wien zu sehen bekommen.«
»Das ist der Grund der Reise. Im Herbst beginnt mein Sohn mit der Schule, da soll er vorher zumindest einmal die Hauptstadt besucht haben.«
»Leider war ich noch nicht in Triest, aber man liest viel in der Zeitung. Wirtschaftlich geht es stetig bergauf, der Seehandel prosperiert. Stimmt es, dass die Stadt jetzt einen zweiten Bahnhof hat?«
»Das ist richtig«, antwortete Bruno. »Vor zwei Jahren wurde in unmittelbarer Nähe zum Hafen der Bahnhof der k.k. Staatsbahnen eröffnet. Die Züge der Südbahn-Gesellschaft halten weiterhin am Triester Südbahnhof. Nicht nur der Hafen erfährt steten Ausbau, auch die Bahnstrecken. Wie Sie gesagt haben, der Seehandel prosperiert, der Schiffsbau gibt Tausenden Menschen Arbeit, also wächst Jahr um Jahr die Zahl der Einwohner Triests.«
Während der Zug auf den Wiener Südbahnhof zurollte, unterhielten sich Luise und Bruno mit dem Herrn. Kurz darauf fuhren sie in die Halle ein, und der mit leichtem Gepäck reisende Mann verabschiedete sich von ihnen. Bruno begann, die Koffer vom Gepäckträger zu hieven. Seit zwölf Stunden waren sie unterwegs, und endlich hatten sie ihr Ziel erreicht. Sie warteten ein wenig, bis sich das Gedränge am Gang aufgelöst hatte, dann nahm Luise Gerwin an der Hand.
»Jetzt aber raus aus dem Zug.«
»Ja, Mama. Ich bin so aufgeregt.«
»Das bin ich auch. Bitte nimm deinen Koffer.«
Bruno winkte ab. »Lasst nur, steigt ihr beiden schon aus, Grete und ich kümmern uns um das Gepäck.«
Luise nickte Bruno zu und gemeinsam mit ihrem Sohn verließ sie das Coupé.
Bruno ergriff zwei Koffer und schaute das Kindermädchen an. »Bist du ebenso aufgeregt, Grete?«
»Ja, Herr Zabini. Ich bin sehr neugierig auf Wien.«
Bruno lächelte Grete an. »Das bin ich auch. Lange hat es gedauert, aber jetzt sehe ich endlich die Hauptstadt.«
Montag, 6. April 1908
Conrad Speyer stand in der Telephonkabine und wartete, bis sein Anruf durchgestellt wurde.
»Hier spricht Polizeiagent Weber. Wer ruft an?«
»Speyer am Apparat.«
»Guten Tag, Herr Inspector.«
»Weber, sehr gut, dass ich Sie gleich erreiche. Ich gebe drei Namen durch, die Sie bitte notieren. Schauen Sie nach, ob wir Akteneinträge haben.«
»Sind Sie noch in der Brigittenau?«
»Ja, am Postamt. Ich fahre anschließend zurück in die Kanzlei. Haben Sie etwas zum Schreiben?«
»Jawohl, Herr Inspector.«
Speyer nannte die drei Namen der Verdächtigen, die er auf dem Bezirksamt recherchiert hatte. Der zwanzigste Bezirk Wiens war erst im Jahr 1900 vom benachbarten, deutlich größeren Bezirk Leopoldstadt getrennt worden. Gemeinsam bildeten Leopoldstadt und Brigittenau sozusagen die Wiener Insel, denn sie wurden seit der großen Flussregulierung von der Donau und dem Donaukanal umflossen und waren nur über Brücken zu erreichen. Mit dem seit Jahren ungebrochenen Zuzug aus allen Teilen der Monarchie waren auch in der Brigittenau schnell die Auwälder den Wohn- und Industriebauten gewichen. Der an der Grenze zwischen den beiden Bezirken liegende Nordwestbahnhof war einer der wichtigsten Bahnhöfe der Stadt, denn dort verkehrten die Züge in die Kronländer Niederösterreich, Mähren und Böhmen. In der Regel bearbeitete Speyer Fälle in den Stadtvierteln rund um den Wienfluss, aber als Inspector des k.k. Polizeiagenteninstituts war er häufig auch anderswo im Einsatz. Im Unterschied zu den Kommissariaten, die Rayons zugeordnet waren, erstreckte sich die Zuständigkeit des k.k. Polizeiagenteninstituts über die gesamte Stadt.
»Haben Sie die Namen notiert?«
»Jawohl, Herr Inspector.«
»Gut, dann komme ich jetzt in die Kanzlei. Vielleicht können Sie in der Zwischenzeit schon etwas herausfinden.«
»Einen Moment, Herr Inspector. Wir haben vor einer Viertelstunde eine Meldung erhalten.«
»Ein Einsatz?«
»Jawohl. Der Herr Oberinspector hat Order gegeben, dass Sie den Fall übernehmen sollen.«
»Himmelherrgott, was ist denn jetzt schon wieder passiert?«
»Offenbar ein Raubmord. Schönburg Straße 11 in unmittelbarer Nähe zum Palais Schönburg. Ein Todesopfer wurde gemeldet. Offenbar erdrosselt. Ein Dienstbote hat die ältere Wohnungsbesitzerin gefunden und die Polizei gerufen. Die Wohnung wurde durchwühlt. So weit die Meldung des Kommissariats.«
Speyer zog seine Taschenuhr. »Die Schönburg Straße auf der Wieden also. Jetzt ist es knapp nach neun Uhr. Wenn ich den Dreier nehme, bin ich in einer Dreiviertelstunde dort. Sofern nicht wieder die Straßen verstopft sind. Also, Weber, geben Sie die Namen weiter, die Akteneinsicht sollen andere übernehmen. Ich brauche Sie vor Ort.«
»Soll ich die Kommissionstasche und den Photoapparat mitnehmen, Herr Inspector?«
»Ohne brauchen Sie dort erst gar nicht aufzukreuzen. Sonst noch etwas?«
»So weit alles.«
»Gut, dann bis später.«
Speyer hängte den Hörer auf, verließ die Kabine und bezahlte am Schalter die Gebühr. Wenig später wartete er am Wallensteinplatz auf die Elektrische der Linie 3. Durch den zügigen Ausbau der Stadt und der Straßenbahnlinien war es gelegentlich herausfordernd, alle Linienpläne der Wiener Straßenbahn im Kopf zu behalten. Manche Kollegen verwendeten für ihre Fahrten durch die Stadt Kutschen oder sogar Automobile, Speyer hielt sich an die Tramway. Wenn man mit einem eigenen Fahrzeug an einem Tatort vorfuhr, bildeten sich sofort Trauben von Schaulustigen. Benutzte man allerdings wie ein gewöhnlicher Passant die Straßenbahn und ging zu Fuß durch die Gassen, war man sehr viel unauffälliger. Und genau das schätzte Speyer. Die Leute mussten ihm nicht an der Nasenspitze ansehen, dass er Inspector I. Klasse war und von seinem Vorgesetzten häufig auf die schwierigen Fälle angesetzt wurde.
Die Elektrische rollte heran. Der Fahrer stand auf der offenen Plattform und bremste die Garnitur, mehrere Passagiere stiegen aus, mehrere ein. Der Wagen war ziemlich voll. Speyer mischte sich unter die Fahrgäste, kaufte beim Schaffner eine Fahrkarte und stellte sich an ein Fenster. Die Tramway rollte los, bald überquerte sie den Donaukanal. Die beiden Fahrbahnen der Brigittabrücke waren vom Fächerwerk der Brücke umschlossen, während die Fußwege sich außerhalb des Trägerwerks befanden. Um die Belastungsgrenze nicht zu überschreiten, durfte immer nur eine Tramway den Donaukanal überqueren. Die Fahrt führte am Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof vorbei durch sämtliche Bezirke innerhalb des Gürtels bis zum Südbahnhof. So weit fuhr Speyer allerdings nicht, er stieg bei der Haltestelle Johann-Strauß-Gasse aus.
Wie immer ging er flott um den Häuserblock und sah schon aus der Ferne zwei Wachmänner vor einem Haus stehen. Als er näher kam, erkannte er einen der Polizisten, der soldatisch salutierte.
»Grüß Gott, Herr Inspector.«
»Grüß Gott. Ist Polizeiagent Weber schon hier?«
»Vor paar Minuten angekommen. Erster Stock, Herr Inspector.«
»Wie ist die Lage?«
Der Mann verzog leidend seine Miene. »Nicht besonders schön.«
»Wie heißt das Todesopfer?«
»Henriette Hohenau. Sie war fünfundsiebzig Jahre alt.«
»Wohlhabend?«
»Wir hier im Bezirk sagen nicht wohlhabend zu Frau Hohenau, sondern stinkreich.«
»Sie kannten die Dame also?«
»Wie man halt die Leut im Grätzel kennt.«
Speyer atmete einmal tief durch und nickte dem Mann zu. »Gut, dann schau ich mir den Pallawatsch einmal an.«
Samstag, 11. April 1908
In nur wenigen Tagen war es für Bruno selbstverständlich geworden, beim k.k. Hof-Operntheater aus der Straßenbahn zu steigen. Auf den Gleisen der Elektrischen am Ring verkehrten mehrere Linien, sodass man nie mit langen Wartezeiten bei den Haltestellen rechnen musste. Luise und Bruno verließen die Plattform und schlugen den Weg über die Sirk-Ecke in Richtung Hotel ein. Bruno bot seine Armbeuge, Luise hakte sich ein. Der lange Tag näherte sich dem Abend, auf den Straßen und Plätzen herrschte wie immer um diese Zeit viel Betrieb.
»Ich muss sagen, dass ich ziemlich erschöpft bin«, sagte Bruno.
»So ergeht es mir auch. Es war ein langer und ereignisreicher Tag.«
»Irgendwie fühle ich mich merkwürdig.«
»Inwiefern?«
»Natürlich habe ich gewusst, dass ich Verwandtschaft in Wien habe, und die Namen von Onkeln und Tanten waren mir ja auch bekannt, aber die Wiener Verwandten waren zeit meines Lebens Gestalten aus Geschichten und Legenden, keine echten Menschen. Und jetzt, nach achtunddreißig Jahren, habe ich viele von ihnen kennengelernt. Irgendwie fühlt es sich an, als wären sie zusammen mit Feen, Zauberern und Hexen aus den Märchen und Volkssagen meiner Kindheit nun auch Wirklichkeit – und damit Menschen aus Fleisch und Blut. Dieses Gefühl hat etwas Surreales.«
Luise schmunzelte. »Du bist also aus einem Traum erwacht. Ich vermute, dass gar nicht wenige Verwandtenbesuche eine derartige Konfrontation mit der Realität darstellen.«
In Vorbereitung auf die Reise hatte Bruno in mehreren Briefen sein Kommen angekündigt. Luise und er hatten an diesem Tag drei Wohnungen besucht, in denen sie an einem Tag alle Geschwister Heidemarie Zabinis, deren Eheleute und einige Neffen und Nichten kennengelernt hatten.
»Ein bisschen aufgeregt war ich beim Frühstück schon. Es hätte ja auch peinliche Szenen oder dumme Verwechslungen geben können. Das ist zum Glück ausgeblieben. Retrospektiv freue ich mich, all die Menschen getroffen zu haben.«
»Sie waren von deinen mitgebrachten Geschenken sehr angetan.«
»Bei deren Auswahl meine Mutter ja entscheidende Impulse gegeben hat. Ich hätte sonst ja nur Schnaps oder Wein mitgebracht. Mehr wäre mir nicht eingefallen. Vielen Dank im Übrigen, dass du mich begleitet hast. Das bedeutet mir sehr viel, du warst mir den ganzen Tag über eine große Stütze.«
»Na, deine Wiener Verwandten kennenzulernen, konnte ich mir doch nicht entgehen lassen. Bei meinem Entschluss, dich zu begleiten, spielte also eine gehörige Portion Neugier und Klatschsucht mit.«
»Außerdem hat es mächtig Eindruck gemacht, dass ich in Begleitung einer Baronin erschienen bin. Die Onkeln und Tanten sind dir förmlich zu Füßen gelegen.«
»Ich dachte eher, manche deiner Verwandten nahmen an, der Neffe aus Triest wäre ein passionierter Witwentröster.«
»Es ist erschreckend, wie boshaft du dir selbst und mir gegenüber sein kannst, meine Liebe.«
Die beiden lachten und überquerten die Fahrbahn. Wenig später betraten sie ihre Suite im Hotel Sacher.
»Guten Tag! Wir sind zurück. Ist jemand zu Hause?«, rief Luise bei der Tür.
Schon flitzte Gerwin heran, umarmte seine Mutter und reichte Bruno die Hand zum Gruß. Auch Grete erschien im Vorraum.
»Na, meine Lieben, wie ist es euch ergangen?«
»Gut, Mama, wir haben gerade in unseren neuen Büchern gelesen.«
Bruno half Luise aus dem Mantel und nahm ihren Hut. Die vier sammelten sich beim Tisch im Salon. »Seht mal, was wir mitgebracht haben.«
Bruno stellte den Korb auf den Tisch, mit dem er am Vormittag die Gastgeschenke transportiert hatte und der wieder gefüllt worden war.
Luise wandte sich an Grete. »Wie habt ihr den Tag verbracht?«
»So wie vereinbart, Euer Gnaden. Vormittags haben wir unsere Lektionen erledigt, zu Mittag waren wir im Speisesaal, am Nachmittag haben wir einen Spaziergang im Stadtpark unternommen und seit etwa anderthalb Stunden sind wir wieder zurück und lesen.«
»Die Lektionen sehe ich mir danach an, jetzt muss ich mich setzen und für eine Weile die Beine hochlegen. Grete, bitte lass uns eine Kanne Tee aufs Zimmer bringen.«
Sonntag, 12. April 1908
Das Gasthaus lag unweit des großen Parade- und Exerzierplatzes auf der Schmelz in der Herbst Straße in Sichtweite der Graf-Radetzky-Kaserne. So war es nicht verwunderlich, dass sich viele Uniformierte zum sonntäglichen Mittagessen einfanden. Karl Kestranek hatte eine Tafel für neun Personen bestellt. Er und seine Frau Liselotte wurden vom Kellner zu ihren Plätzen geführt.
»Gnädiger Herr, das ist der für die erlauchte Gesellschaft reservierte Tisch.«
»Vielen Dank«, sagte Karl Kestranek und zog seine Taschenuhr hervor. »Wir sind ein bisschen früh dran, daher warten wir noch mit der Bestellung.«
»Sehr wohl, der Herr. Ich komme dann später zu Ihnen.«
»Lisl, nimm doch bitte Platz.«
»Ich setze mich in die Mitte. Da hab ich alle im Blick.«
Karl nahm seiner Ehefrau den Mantel ab und rückte den Stuhl. Er ließ sich ihr gegenüber nieder. An jeder Seite der Tafel befanden sich fünf Stühle.
Kurz darauf erschienen Karls Schwester Ernestine, ihr Ehemann Tassilo und deren beiden Töchter Alma und Josephine. Sie begrüßten sich, das Ehepaar und die beiden Fräuleins nahmen links neben Karl ihre Plätze ein. Alma würde in einem Monat einundzwanzig Jahre alt werden, sie war verlobt, im Frühsommer würde die Hochzeit stattfinden. Die achtzehnjährige Josephine besuchte noch die Schule und stand vor der Matura.
»Wo sind denn deine Buben?«, fragte Ernestine und setzte sich neben Liselotte.
»Joseph hat erst gestern den Schlafwagen genommen und muss vor zwei oder drei Stunden in Wien angekommen sein. Eduard war gestern mit uns im Zug, und Meinrad ist seit dem Bankett in Wien. Ich hoffe, dass die jungen Herren pünktlich sind. Wenn sie sich arg verspäten, ziehe ich ihnen die Löffel lang.«
»Das wird nicht nötig sein«, sagte Tassilo mit einem Blick zum Eingang, wo Eduard und Meinrad Kestranek eben erschienen und sich umblickten. Liselotte winkte ihren Söhnen. Sie traten an die Tafel und begrüßten ihre Verwandten aus Görz.
»Habt ihr etwas von Joseph gehört?«, fragte Liselotte.
Eduard hob unwissend die Hände. »Ich habe ihn heute noch nicht gesehen, und ob sein Schlafwagen Verspätung hat, weiß ich nicht. Ich war nicht am Südbahnhof und komme da heute auch gar nicht hin. Aber, Mama, er wird schon auftauchen.«
»Na ja, Pünktlichkeit war noch nie seine Stärke.«
Die beiden Männer Anfang dreißig nahmen neben ihren Eltern Platz, der Kellner erschien, brachte die Speisekarte und notierte die Getränkebestellungen. Wenig später servierte er die Gläser. Da wehte ein uniformierter Mann in die Gaststube, der sofort Aufsehen erregte. Joseph Kestranek trug seine Ausgehuniform. Den Dienstrang eines Fregattenleutnants sah man in Wien nicht oft. Auch höherrangige Offiziere im Gasthaus grüßten salopp den Vertreter der k.u.k. Kriegsmarine, der dies mit strammem Salut erwiderte.
»Unser geschätzter Herr Bruder lässt sich einen starken Auftritt niemals entgehen«, sagte Meinrad zu seiner Tante. »In der Uniform der Kriegsmarine erregt man in ganz Wien Aufmerksamkeit.«
Joseph Kestranek trat an den Tisch und fing den Kellner ab. »Bringen Sie mir ein Bier. Habt ihr schon bestellt?«
»Ja, das haben wir«, sagte Karl. »Wir sind im Vorteil, die Uhrzeit zu lesen, können also auch pünktlich sein. Oder willst du uns erklären, dass dein Zug drei Stunden Verspätung gehabt hat?«
»Drei Stunden nicht, Papa, eine halbe Stunde war er zu spät. Aber ich musste ja noch vorher ins Hotel, um mich für das Mittagsmahl zu adjustieren«, erklärte Joseph und wandte sich dem Kellner zu. »Bringen Sie mir bitte ein Wiener Schnitzel mit Erdapfelsalat.«
Der Angesprochene nickte und ging ab.
Joseph trat auf seine Tante zu. »Geliebte Tante, ich freue mich sehr, dich nach so kurzer Zeit wiederzusehen, auch wenn der Anlass ein trauriger ist. Onkel Tassilo. Liebe Cousinen, wie ich schon vor zwei Wochen sagte, ihr seid hinreißend schön. Mein Platz ist also am Ende der Tafel.«
»Wer nicht kommt zur rechten Zeit, muss warten, bis was übrig bleibt«, meinte Eduard.
»Was du nicht sagst, hochgeschätzter Bruder. Ich bequeme mich trotzdem neben dich, weil da habe ich dich besser im Griff.«
Nachdem Joseph Platz genommen und sein Bier erhalten hatte, schaute Karl die Tafel auf und ab, räusperte sich und ergriff das Wort. »Also, werte Familienmitglieder, der Grund, weswegen wir uns wieder in Wien versammeln, ist leider ein trauriger, man sogar muss sagen, ein tragischer. Ich finde es übrigens skandalös, dass die Bestattung am Montag angesetzt wurde. Die Reise von und nach Pola dauert einen ganzen Tag, ich kann also frühestens am Mittwoch wieder in der Kanzlei sein.«
»Meine Rede, Karl«, sekundierte ihm Ernestine. »Wir sitzen ja praktisch nur mehr im Zug, und die Angestellten in unserem Geschäft machen sich ein paar faule Tage. Die Wiener haben das einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden und uns vor vollendete Tatsachen gestellt. So sind diese Hohenaus.«
»Eduard, weißt du etwas von Otto? Wann kommt er aus Triest?«, fragte Karl.
»Onkel Otto und Tante Gerda sitzen im Zug und kommen abends in Wien an.«
»Ja, aber die Kinder nehmen sie hoffentlich mit zur Beerdigung.«
»Davon gehe ich aus, aber extra darauf habe ich den Onkel nicht angesprochen. Wir sehen es dann morgen am Friedhof.«
»Es ist ein Kommen und Gehen«, jammerte Ernestine. »Dieses Frühjahr hat es in sich, so oft bin ich noch nie zwischen Görz und Wien hin- und hergefahren. Und die verflixte Polizei hat wahrscheinlich noch immer keine Ahnung, wer Tante Henriette beraubt und erwürgt hat. Das ist eine einzige Katastrophe.«
»Du sagst es, Schwester, eine Katastrophe.«
»Wer weiß, ob nicht die Polizei die Eröffnung des Testaments verschleppt, solange sie hinsichtlich des Täters im Dunklen tappt. Dürfen die das überhaupt?«, fragte Eduard.
Karl winkte verärgert ab. »Diese Trottel werden den Täter nie finden. Der ist doch längst mit dem Schmuck und dem Geld über alle Berge. Das gebe ich dir schriftlich. Aber der Kriminalfall und das Testament sind zwei Paar Schuhe.«
»Wir werden zur Testamentseröffnung noch einmal anreisen müssen.«
»Das ist schon sehr strapaziös.«
Montag, 13. April 1908
Bruno öffnete die Augenlider. Das erste Tageslicht brach durch das Fenster. Ein wohliges Brummen entstieg ihm. Sein Magen knurrte, er hatte Appetit auf ein gutes Frühstück. Bruno lag allein im Bett. Mit der Hand strich er über die Stelle des Leintuchs, an der Luise gelegen hatte. Er glaubte, noch ihre Körperwärme zu spüren. Nur ein wenig hob er den Kopf und sah zum Schreibtisch beim Fenster. Die Vorhänge waren geöffnet. Luise saß bei Tisch über ihre Schreibarbeit gebeugt. Bruno schob den Polster zurecht, bettete seinen Kopf und beobachtet Luise, ohne sich weiter zu regen oder ein Geräusch zu verursachen.
Luise hatte den Schlafrock über ihr Nachthemd gezogen, ihr langes blondes Haar bedeckte Schultern und Rücken. Bruno musterte ihr Profil aus der Ferne. Wie schön sie war. Wie sehr er sie liebte. Wie überaus er ihren Anblick genoss. Sie war offenbar völlig in ihre Arbeit vertieft und hatte noch nicht bemerkt, dass er erwacht war.
Zweifelsfrei rettete sie wieder Traumbilder vor dem Vergessen, indem sie sie niederschrieb und dabei ausformulierte. Sämtliche ihrer Gedichte verfasste sie unmittelbar nach dem Aufwachen, wenn die Gefühle und Gedanken der Träume noch nachhallten. Tagsüber bearbeitete sie die Gedichte, feilte diese oder jene Kante ab, verpasste der Sprache eine Politur, aber die ersten Fassungen entstanden ausschließlich im Morgengrauen. Sie schrieb ihre Gedichte stets auf Italienisch. Die Musikalität der Sprache eigne sich für ihre Lyrik vorzüglich, sagte sie stets. Ihre Novellen und ihren ersten Roman hatte sie auf Deutsch geschrieben. Bruno hatte nach dem Stoff für den geplanten zweiten Roman gefragt, und Luise hatte nach einigem Zögern davon erzählt. Wie Bruno war Luise zweisprachig, sie sprachen sowohl das triestinische Italienisch wie das österreichische Deutsch fließend. Untereinander verwendeten sie mal diese, mal jene Sprache.
Luise hob ihren Kopf, schaute sinnierend durch das Fenster, gestikulierte und zeichnete mit der Füllfeder Figuren in die Luft. Sie wandte sich wieder dem Papier zu und schrieb noch ein paar Zeilen. Dann legte sie die Füllfeder ab, hob den Bogen und blies über die Tinte, um sie zu trocknen. Luise erhob sich und wandte sich dem Bett zu.
»Guten Morgen, meine Schöne«, sagte Bruno leise.
»Guten Morgen. Bist du schon länger wach?«
»Nicht lang genug, um mich an dir sattzusehen.«
Luise lächelte, schritt barfuß auf das Bett zu, streifte den Schlafrock ab und kroch unter die Decke. Bruno empfing sie mit offenen Armen, sie schmiegten sich aneinander.
»Es ist angenehm warm bei dir. Die Morgenstunden sind noch recht frisch.«
»Obwohl die Räume beheizt sind. Das ist immerhin das Hotel Sacher.«
»Unter der Decke mit dir ist es immer wohliger als irgendwo sonst.«
»Ein Gedicht?«
»Ja.«
»Du musst es mich später lesen lassen.«
»Nach dem Frühstück überprüfe ich, ob es Unsinn ist oder nicht. Wenn es brauchbar ist, kannst du es gerne lesen.«
»Hast du gut geschlafen?«
»Sehr gut.«
»Ich auch. Und ich habe schon Appetit auf das Frühstück.«
»Spätestens in einer halben Stunde werden Gerwin und Grete wach sein. Also ein klein wenig Geduld musst du noch aufbringen.«
Bruno rieb seine Wange an ihrer. »Mit dir unter einer Decke fällt das überhaupt nicht schwer.«
»Du brauchst wieder eine Rasur.«
»Darauf werde ich nicht vergessen.«
»Seit über einer Woche bist du an meiner Seite, wir leben wie ein Ehepaar. Das macht mich glücklich.«
»Mich auch.«
»Und hier gibt es auch kein Gerede über unsere Liaison. Anders als in Triest.«
»Als ob du jemals etwas auf das Gerede der Leute gegeben hättest.«
»Es ist eher dein Ruf, der mir gelegentlich Sorge bereitet. Als hochrangiger Polizist bist du im letzten Jahr in allerlei amouröse Verwicklungen verstrickt gewesen. Zuerst der Skandal um Fedora und jetzt, noch vor Ablauf des Trauerjahres, bist du der Galan der Baronin Callenhoff, gehst mit ihr auf Reisen, besuchst die Hauptstadt und residierst sogar im Hotel Sacher.«
»Dr. Rathkolb ist ein sehr toleranter Polizeipräsident und den dreiwöchigen Urlaub habe ich mir redlich verdient.«
»Das hast du.«
Es klopfte leise an der Tür zum Nebenzimmer. Die beiden schauten hoch.
»Ja bitte!«, rief Luise.
Gerwin öffnete einen Spalt und steckte seine Nase herein.
Luise setzte sich auf und breitete die Arme aus. »Gerwin, mein Schatz, komm zu mir unter die Decke. Hier ist es fabelhaft warm.«
Bald feierte Luises Sohn Gerwin seinen sechsten Geburtstag, im Herbst würde er in Triest sein erstes Schuljahr antreten. Im Nachthemd lief er los und huschte unter die Decke.
»Schläft Grete noch?«, fragte Luise flüsternd.
»Ja.«
»Dann wollen wir sie nicht wecken. Und wir können auch noch ein bisschen im Bett faulenzen. Bist du damit einverstanden?«
»Ja.«
Gerwin kuschelte sich zwischen Bruno und Luise unter die Decke. Bruno strich über Gerwins blondes Haar. Er sah in dem Knaben so viel von Luise. Von Gerwins leiblichem Vater dagegen nichts beziehungsweise nichts, was Bruno nicht übersehen konnte. Sie waren jetzt eine Familie. Alles andere war nebensächlich.
*
Conrad Speyer schaute nach links und rechts, dann eilte er über die Fahrbahn. In den letzten drei Jahren hatte sich die Anzahl der Automobile auf den Straßen Wiens sicherlich verdoppelt. Nicht nur die hochwohlgeborene Adelswelt oder die Großkapitalisten bequemten sich in luxuriösen Limousinen chauffieren zu lassen, auch immer mehr Geschäftsleute und Spediteure setzten auf die Transportkapazitäten von Kraftfahrzeugen. Hinter ihm rollte ein Lastwagen vorbei, auf dessen Ladefläche sich leere Gemüsekisten stapelten. Der Transport der Frischwaren von der Großhandelshalle zum Naschmarkt wurde nicht mehr mit Fuhrwerken bewerkstelligt, sondern mit einem Lastkraftwagen. Ein einziger Laster ersetzte dank seiner hohen Zuladung und Geschwindigkeit mindestens vier Fuhrwerke. Das war ein beträchtlicher Fortschritt. Solche Entwicklungen fanden in allen Vierteln Wiens statt. Die Bevölkerung, das Liniennetz der Elektrischen und die Schnelligkeit auf den Straßen wuchsen Jahr für Jahr.
Speyer trat durch die offen stehende Tür in sein Stammcafé. Er blickte auf die Wanduhr. Es war knapp nach neun Uhr. Am Zeitungstisch schnappte er sich je eine Ausgabe der Neuen Freien Presse und der Arbeiter-Zeitung und trat an den Tisch beim zweiten Fenster, der um diese Zeit für ihn reserviert war. Speyer legte Mantel und Hut ab und setzte sich.
»Gschamster Diener, Herr Inspector. Wie ist das werte Befinden am Montagmorgen?«, fragte der herantretende Oberkellner.
»Danke der Nachfrage, Johann. Heute wie das Wetter, heiter bis wolkig.«
»Es soll recht mild werden, hat meine Göttergattin prophezeit.«
»Na, wenn sie es sagt, wird’s wohl seine Richtigkeit haben. Ihre Gattin liegt mit ihren Wetterprognosen selten daneben.«
»Was darf ich bringen?«
Speyer überlegte kurz. Er hatte gestern wegen einer blutigen Familientragödie in der Reinprechtsdorfer Straße kaum Zeit gehabt, richtig zu essen. Und gleich nach dem Aufstehen aß er nichts, sondern trank nur eine Tasse Kaffee und schmauchte seine Pfeife.
»Johann, seien Sie doch so gut und bringen Sie eine Eierspeis aus drei Eiern, zwei Butterbrote mit Schnittlauch und einen großen Mokka.«
Johann hob seine Augenbrauen. »Herr Inspector, mit Verlaub, immer wenn Sie eine Eierspeis bestellen, haben Sie am Vortag wieder nichts gegessen. Stimmt’s oder habe ich recht? Dabei ist die regelmäßige Nahrungsaufnahme für die Gesundheit des Menschen von elementarer Bedeutung. Noch dazu an einem Sonntag. Skandalös, dass Sie auch am Tag des Herrn arbeiten müssen.«
Speyer strich sich über den scharf gestutzten Schnauzbart. »Ja, so geht es einem, Dienst ist Dienst, und das Verbrechen kennt keine Feiertage. Aber Sie, lieber Johann, passen schon auf mich auf.«
»Ja freilich, Herr Inspector. Das Frühstück kommt sofort, kommt sogleich«, sagte der Oberkellner lächelnd und marschierte ab.
Inspector I. Klasse Conrad Speyer griff in die Tasche seines Sakkos und legte die Pfeife, die Streichhölzer und den Tabakbeutel auf den Tisch. Nach dem Essen würde er sich die zweite Pfeife des Tages stopfen. Abends nach Dienstschluss, wenn er zu Hause war und seine Frau ihm den Schlafrock brachte, schmauchte er in der Regel noch eine. Früher hatte er Nil-Cigaretten gekauft, war aber davon abgekommen, weil er einfach zu viel geraucht und einen hartnäckigen Hustenreiz bekommen hatte. Dreimal pro Tag eine mit mildem Tabak gestopfte Pfeife war genau das Richtige für ihn.
Er blätterte die Zeitung auf und überflog die Überschriften. Wenig später trat Johann mit dem Kaffee und einem appetitlich duftenden Teller heran.
*
Der Klangkörper in der Bahnhofshalle folgte den musikalischen Gesetzen einer bizarren Symphonie. Es war das Opus magnum eines verrückten Komponisten, der mit Dissonanzen durch die Sätze taumelte und die Kakophonie menschlicher Stimmen zum Leitmotiv erkoren hatte. Nicht Oboen, Violinen und Posaunen erschallten, sondern der Ruf der Blumentrödlerin, das Knarren der Gepäckwagen in den kräftigen Händen der Dienstmänner, das Pfeifen des Bahnhofsvorstehers auf dem Perron, die Hunderten Laute der Passanten und Fahrgäste, das Flattern der Tauben im Trägerwerk der Halle und das Lachen eines Kindes, dessen Vater nach langer Reise wieder in der Hauptstadt angekommen war.
Sie standen in der Kassenhalle des Wiener Südbahnhofs. Vor ihnen lag die prunkvolle Stiege, die zur Bahnsteighalle und zu den Perrons emporführte.
Bruno sog die Atmosphäre in sich auf. Obwohl er beinahe fehlerlos den Dialekt des Wiener Viertels Gumpendorf sprach, hatte er achtunddreißig Jahre alt werden müssen, um erstmals nach Wien zu kommen. Seine Mutter war in Gumpendorf aufgewachsen, ehe sie als Zimmermädchen in den Dienst bei Gräfin Windischgraetz genommen worden und mit ihrer Herrin nach Triest gereist war. In Triest hatte das Wiener Mädel dem stattlichen Beamten Salvatore Zabini den Kopf verdreht und war dabei so klug gewesen, nicht nur die sommerliche Affäre des Herrn, sondern dessen Braut geworden zu sein. So war Heidemarie Bogensberger aus Gumpendorf nach Triest übersiedelt, hatte geheiratet und ihrem Mann einen Sohn und eine Tochter geboren. Heidemarie hatte mit ihren Kindern stets so gesprochen, wie sie selbst es erlernt hatte, nämlich in wienerischem Deutsch. Bruno und seine jüngere Schwester Maria waren zweisprachig aufgewachsen. Wien machte einen Teil seiner Identität aus, Bruno hatte sich immer irgendwie als italienischer Wiener an der Adria gefühlt. Dennoch hatte es beinahe vier Jahrzehnte gedauert, bis er zum ersten Mal die kaiserliche Hauptstadt mit eigenen Augen zu sehen bekam. Er würde es Luise ein Leben lang danken, dass sie die Reise möglich gemacht hatte.
Luise hatte für drei Wochen eine Suite im Hotel Sacher reserviert, in einem der vornehmsten Häuser der Hauptstadt. Sie hatten in den letzten Tagen Stadtausflüge und Besichtigungen unternommen. Jeden Tag waren sie woanders. Wien hatte so viel zu bieten, selbst drei Monate würden nicht reichen, um sich ein umfassendes Bild der Stadt zu machen. Für den heutigen Nachmittag hatte sich Gerwin gewünscht, einen Bahnhof zu besichtigen, also waren sie mit der Elektrischen von der Ringstraße zum Südbahnhof gefahren.
Natürlich hätten sie auch zu Wiens größtem Bahnhof, dem Nordbahnhof, in die Leopoldstadt fahren können. Sie hätten den Westbahnhof, den Ostbahnhof oder andere Bahnhöfe besuchen können, aber sie hatten sich für den Südbahnhof entschieden, den zweitgrößten Bahnhof der Hauptstadt und jenen, der für sie, die sie aus den österreichischen Küstenlanden kamen, der wichtigste war. Täglich verkehrten mehrere Züge zwischen Wien und Triest, nachts rollten Schlafwagen über die Strecke. Mit dem Nachtzug konnte man abends in Triest einsteigen und am nächsten Morgen in Wien das Frühstück einnehmen. Eigentlich war es ganz einfach, von der Adria an die Donau zu reisen, rund zwölf Stunden Fahrt trennten die beiden Städte Triest und Wien, dennoch hatte sich in Brunos Leben nie zuvor die Gelegenheit für eine Reise ergeben.
Erst als Luise ihren Willen bekundet hatte, mit ihrem Sohn Gerwin Riesenrad im Prater zu fahren, hatte Bruno die Möglichkeit ergriffen. Zu viert hatten sie den Frühzug nach Wien bestiegen, Bruno, Luise, Gerwin und das Kindermädchen Grete.
Luise Dorothea von Callenhoff war im Alter von achtundzwanzig Jahren zur Witwe geworden, ihr Sohn Gerwin hatte noch vor seinem sechsten Geburtstag den Vater verloren. Baron Helmbrecht Engelbert von Callenhoff hatte nach einigen Jahren unglücklicher Ehe die Güte besessen, in Brasilien an Malaria zu erkranken und an einem Fieberschub zu sterben. Er hatte als narzisstischer Gewalttäter das Leben seiner jungen, kaum erwachsenen Ehefrau zur Hölle gemacht, hatte sie mittels Gewaltanwendung geschwängert, sie mit ihren Ängsten und ihrer Verzweiflung allein gelassen, sie für ihre Persönlichkeit und Intelligenz verachtet und verspottet, ihr den Sohn entwendet und ihn seiner notorisch boshaften Mutter zur Obsorge übergeben. Mit einem Wort, Helmbrecht von Callenhoff hatte alles Menschenmögliche getan, seinem Eheweib einen standesgemäßen Erben abzutrotzen und sie dann in den Freitod zu treiben.
Luise war nicht von den Klippen gesprungen, obwohl sie schon vor dem Abgrund gestanden hatte. Sie war einfach zu schwach gewesen, um sich fallen zu lassen. Und dann hatte sie begonnen, auch mit der Hilfe ihres Arztes Dr. Samigli, ihre Verzweiflung niederzuschreiben. Aus der Therapie war eine Leidenschaft geworden, sie hatte die Literatin in sich entdeckt, und der Freitod war ein Stück in die Ferne gerückt. Vor allem aber hatte sie sich dank Brunos Hilfe ins Leben zurückgekämpft. Und als ihr Ehemann in Übersee verstorben war, war Luise dem Joch einer unglücklichen Ehe entkommen.
Ja, es war Brunos Verdienst gewesen, dass sie sich nicht von der Steilküste in Duino kopfüber dem Meer übergeben hatte. Nicht nur deswegen liebte sie Bruno, sie liebte ihn, weil er sie liebte. Und weil Bruno ihren Sohn Gerwin an seiner Begeisterung für das moderne Leben teilhaben ließ. Nur deswegen waren sie zum Bahnhof gefahren, nur deswegen standen sie nun am Perron und beobachteten die Menschen, die dem eben eingefahrenen Zug entstiegen, ihr Gepäck sammelten und nun über den Bahnsteig schwärmten.
Als die meisten Passagiere den Perron verlassen hatten, traten Bruno und Gerwin an die Lokomotive heran. Sechs vierachsige Personenwagen und ein zweiachsiger Gepäckwaggon bildeten den Zug, an dessen Kopf die Lokomotive scheinbar voll unerschöpflicher Kraft, doch jetzt in aller Ruhe im Stillstand vor sich hin schnaufte.
Bruno hielt die Hand des Knaben. »Gerwin, ich habe dir das letzte Mal erklärt, wie man die Achsformel von Lokomotiven nach den neuesten Richtlinien des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen bestimmt. Kannst du dich daran noch erinnern?«
»Ja, Herr Zabini.«
»Also, was ist das für eine Lok?«
Gerwin löste sich von Bruno und zählte die Achsen der Lokomotive. Bruno wusste, dass Gerwin ganz nach seiner Mutter kam, er war überaus gelehrig und konnte jetzt schon, noch vor seiner Einschulung, gut lesen und verstand sich auf Addition und Subtraktion. Aber die Typenbestimmung einer Dampflokomotive fiel ihm dennoch schwer. Er zählte ein zweites Mal die Achsen.
»Nun, weißt du es oder soll ich es dir sagen?«, fragte Bruno.
Gerwin kratzte sich am Kopf und dachte angestrengt nach. Dann blickte er Hilfe suchend zu Grete.
»Das ist eine vierzylindrige 1C1 Verbundlokomotive mit Schlepptender.«
Bruno und Luise fassten das Kindermädchen überrascht ins Auge.
Bruno nickte bestätigend. »Liebe Grete, das ist korrekt.«
»Die Lokomotive gehörte zur Serie SB 110 und ist eine der leistungsfähigsten Schnellzuglokomotiven der Gegenwart. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit beträgt achtzig Kilometer pro Stunde.«
Bruno lachte erfreut auf. »Völlig richtig.«
Gerwin stellte sich stolz neben Grete und ergriff ihre Hand. »Das wollte ich auch gerade sagen.«
»Die Serie 110 hat 1906 eine Goldmedaille gewonnen«, führte Bruno aus. »Anlässlich der Eröffnung des Simplontunnels wurde in Mailand eine große Eisenbahnausstellung veranstaltet und die besten Lokomotiven Europas prämiert. Die Lokomotivfabrik Floridsdorf hat mit einem Exemplar der 110 den Grand Prix gewonnen.«
»Wo liegt denn der Simplontunnel?«, fragte Gerwin.
»Er unterquert das Simplongebiet, das ist eine Berglandschaft an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien. Die Städte Brig und Iselle di Trasquera werden durch den mit fast zwanzig Kilometern längsten Eisenbahntunnel der Welt verbunden.«
»Im Simplontunnel verkehren elektrisch betriebene Lokomotiven«, ergänzte das Kindermädchen.
Luise schmunzelte. »Grete, ich bin überrascht, dass du dich derart für das Eisenbahnwesen interessierst und so gut Bescheid weißt.«
»Ich höre gern zu, wenn Herr Zabini Gerwin die Funktion von Maschinen und Apparaten erklärt.«
»Ja, ich höre das auch laufend«, sagte Luise amüsiert, »aber offenbar bin ich nicht so aufmerksam und gelehrig wie du, meine Liebe.«
»Ich finde die Ausführungen sehr aufschlussreich.«
Bruno nickte anerkennend und zwinkerte Luise zu. »Siehst du, meine Teure, es gibt also doch Menschen, die sich für meine technologischen und naturwissenschaftlichen Vorträge interessieren.«
»Jetzt tust du mir unrecht, geschätzter Bruno, ich interessiere mich auch für Fahrzeuge und Maschinen, und deinen überaus kundigen Vorträgen könnte ich stundenlang lauschen. Doch die Frage bliebt bestehen, ob ich mir all die vielen Details auch merken kann.«
»Der Zug hat eine Vakuumbremse«, rief Gerwin.
Bruno klatschte lachend in die Hände. »Sehr richtig, junger Mann. In Österreich ist es Vorschrift, dass Personenzüge mit Vakuumbremse ausgerüstet sind.«
»Ich weiß auch, warum«, sagte Gerwin.
»Nun, dann lass uns an deinem Wissen teilhaben, mein Sohn«, forderte Luise Gerwin auf.
»Wegen der vielen Bergstrecken in den Alpen. Die Vakuumbremse ermöglicht ein fortlaufendes Bremsen bei der Abfahrt auf Bergstrecken, dadurch erhöht sich der Komfort der Fahrgäste. Bei der anderen Bremse wird immer gebremst, nicht gebremst, gebremst, nicht gebremst. Daher werden die Fahrgäste durchgerüttelt.«
»Ich bin begeistert, Gerwin, das hast du dir sehr gut gemerkt. Weißt du noch, wie das andere in Europa weit verbreitete Bremssystem heißt?«
Gerwin kaute auf seiner Unterlippe. »Das ist … das ist …« Er schaute wieder Hilfe suchend zu Grete hoch.
»Weißt du es, Grete?«, fragte Bruno.
»Ja, Herr Zabini.«
»Nichts sagen!«, rief Gerwin. »Mir ist es eingefallen. Das ist die Druckluftbremse.«
Die vier lachten herzlich auf dem Bahnsteig.
Bruno nickte dem Buben anerkennend zu. »Gerwin, ich glaube fast, dass du dereinst ein hervorragender Ingenieur wirst. Bravo.«
»Aber ich weiß nicht mehr«, sagte Gerwin zerknirscht, »warum das eine 1C1 Lokomotive ist.«
Bruno schaute Grete an. Das hübsche Fräulein aus den Tiroler Bergen war mittlerweile einundzwanzig Jahre und seit fünf Jahren als Gerwins Kindermädchen beschäftigt. Die beiden waren wie Geschwister. Hier die große Schwester, dort der noch nicht schulpflichtige kleine Bruder. Als Luises Schwiegermutter, die alte Baronin Callenhoff, im letzten Herbst schwer erkrankt war, hatte Luise die Gelegenheit ergriffen, ihren Sohn den Klauen seiner Großmutter zu entreißen. Fünf Jahre lang hatten ihr Ehemann und dessen Mutter verhindert, dass Luise ihren Sohn sehen konnte, und sie selbst war lange Zeit zu schwach gewesen, gegen die Macht der beiden anzukämpfen. Aber Luise war mit der Zeit stärker geworden, sie hatte sich für den Kampf gerüstet, und als dann die Kunde von Sieglinde von Callenhoffs Erkrankung zu ihr gedrungen war, hatte Luise gehandelt.
Zu ihrer grenzenlosen Überraschung hatte ihre Schwiegermutter den Enkelsohn noch nicht zu einem geistesgestörten Psychopathen geformt, sondern sie hatte das Kleinkind völlig der Obhut des Kindermädchens überlassen. Mit fünfzehn Jahren war Grete als jüngste Tochter eines Tiroler Bergbauern von der Baronin in den Dienst genommen worden. So war Grete aus den Alpen an das Küstenland gekommen und hatte verloren, verstört und verängstigt das Einzige getan, was ihr Leben erhalten hatte können. Sie hatte sich aufopfernd um den kleinen Knaben gekümmert und ihn dank ihrer Bescheidenheit, ihres Fleißes und ihrer Gutherzigkeit vor dem bösen Treiben der alten Hexe bewahrt.
Bis heute war es Luise nicht klar, warum ihre Schwiegermutter Gerwin nicht mit ihrem Hass auf das Leben und die Menschen infiziert hatte. Zwei Möglichkeiten sah Luise vor sich, zum einen, weil ein kleiner Rest von Menschlichkeit und Wärme in der alten Frau übrig geblieben war, oder zum zweiten, weil Gerwin noch zu jung für die jedes menschliche Feingefühl vernichtenden Erziehungsmethoden der alten Baronin gewesen war. Egal welcher Fall auch zutraf, Luise hatte für ihre Schwiegermutter eine erstklassige medizinische Betreuung im Kurhaus von Abbazia organisiert, sie war dabei tatkräftig vom Hausarzt der Familie Callenhoff unterstützt worden. Als sie zum ersten Mal Gerwin und sein Kindermädchen gemeinsam erlebt hatte, hatte Luise sofort gewusst, dass die beiden unzertrennlich waren. Grete bezog natürlich das Gehalt eines Kindermädchens, aber für Luise war sie keine Dienstbotin, sie war ein Teil der Familie.
»Grete, hast du dir die Bestimmung der Achsformel für Lokomotiven eingeprägt?«
»Jawohl, Herr Zabini. Soll ich sie erklären?«
Bruno schaute Gerwin an. »Soll Grete erklären?«
Gerwin nickte. »Ja, bitte.«
»Die Achsformel bezeichnet den Aufbau der Achsen einer Lokomotive von vorne nach hinten. Antriebslose Laufachsen werden immer in Zahlen angegeben, gekuppelte Treibachsen in Buchstaben. Wobei jeder Buchstabe im Alphabet für eine Treibachse steht. A steht für eine angetriebene Achse, B für zwei und C für drei angetriebene Achsen. Die SB 110 ist eine 1C1, weil sie eine Vorlaufachse hat, drei gekuppelte Treibachsen und eine Nachlaufachse.«
Gerwin sprang und klatschte. »Danke, Grete, jetzt weiß ich es auch wieder. Da drüben, das ist eine 1C. Stimmt das, Herr Zabini?«
Bruno schaute hinüber zum nächsten Perron. »Ja, Gerwin, das ist korrekt, das ist eine Lokomotive mit der Achsformel 1C. Die SB 60 ist eine weit verbreitete, robuste und sparsame Lokomotive. Die k.k. Staatsbahnen setzen diese Lokomotive seit 1895 im großen Stil ein, ungefähr zweihundert Maschinen sind in der gesamten Monarchie im Dienst, und die Fabriken liefern immer noch weitere Exemplare. Die k.k. privilegierte Südbahn-Gesellschaft hat von der erfolgreichen Serie mehrere Dutzend Stück gekauft und nutzt sie im Allgemeinen Personen- und Güterverkehr. Die mächtige SB 110 hier vor uns wird im hochrangigen Schnellzugverkehr auf den Hauptstrecken verwendet. Der Eilzug ist vor Sonnenaufgang in Villach abgefahren, über Klagenfurt nach Marburg unterwegs gewesen, hat unter anderem in Graz, Mürzzuschlag, Gloggnitz und Wiener Neustadt Halt gemacht, ehe er jetzt am Wiener Südbahnhof sein Ziel erreicht hat. Wie üblich wurden je nach Teilstrecke verschiedene Lokomotiven den Waggons vorgespannt. In jedem Fall haben die sieben Waggons heute schon eine große Strecke zurückgelegt.«
Luise schaute zwischen den beiden Maschinen hin und her. »Also, ich muss schon sagen, der Unterschied zwischen den Lokomotiven ist augenscheinlich. Die SB 60 wirkt in ihrer Anmutung zweifelsfrei tüchtig, aber ein klein wenig bieder. Wenn man das bei einer fünfzig Tonnen schweren Lokomotive überhaupt so sagen kann. Habe ich das Gewicht einigermaßen richtig geschätzt, Bruno?«
»Du hast sehr gut geschätzt.«
»Na, wer sagt es denn, langsam kriege ich einen Blick für die Eisenbahn. Und dieser legt nahe, dass die 110 trotz ihrer Größe regelrecht elegant aussieht. Da sind bei Weitem nicht so viele Rohre am Kessel wie bei der 60. Die am hinteren Ende der 110 unter dem Führerstand und unmittelbar vor dem Tender abgesetzte Nachlaufachse wirkt, als ob die Lokomotive wie ein weit ausschreitendes Pferd im Galopp liefe.«
Bruno lachte. »Luise, das ist ein sehr bildhafter Vergleich. Und ja, Ingenieur Gölsdorf hat mit der 110 ein Meisterwerk geschaffen. Er hat so viele Rohre wie möglich innerhalb des Kessels angebracht, was bei der Wartung Arbeit macht, aber den Betrieb erleichtert. Dadurch sieht die Lokomotive trotz ihrer Größe windschlüpfig aus.«
»Ist der Zug auch über den Semmering gefahren?«, fragte Gerwin.
Bruno nickte. »Natürlich. Die Bahnstrecke über den Semmering gehört zum Schienennetz der Südbahn-Gesellschaft und ist die wichtigste Verbindung zwischen der Hauptstadt und dem Süden der Monarchie.«
»Ich kann mich noch gut an den Semmering erinnern. Überall die schönen Berge und der grüne Wald.«
»Auch für mich war der Ausblick einprägsam. Ich werde meine erste Überquerung der Bergstrecke niemals vergessen. Da haben wir beide uns an der Fensterscheibe die Nase zerquetscht, nicht wahr?«
Luise griff nach Gerwins Hand. »Wollen wir noch bis zum Ende des Perrons gehen? Ihr könnt ja während des Spaziergangs eure hochinteressanten Fachgespräche über Achsformeln, Bremssysteme und Einsatzgebiete von Lokomotiven weiterführen.«
»Ja, Mama, gehen wir ganz zum Ende. Vielleicht sehen wir einen abfahrenden Zug.«
»Das ist hier der Wiener Südbahnhof, mein Bub, hier verkehren viele Züge. Ich bin zuversichtlich, eine Ab- oder Einfahrt zu erleben.«
*
Da Conrad Speyer ohnedies in der Innenstadt zu tun gehabt hatte, war er die Kärnthner Straße hochgegangen und in der Endstation Walfischgasse in eine Garnitur der Linie 71 gestiegen. Während der Fahrt hatte er mehrmals auf die Uhr geschaut, er war knapp dran und hoffte, die Trauergemeinde noch vor dem Kondukt anzutreffen. Sein Vorhaben war, den Trauerzug von der Aufbahrungshalle zum Grab in diskretem und pietätvollem Abstand zu begleiten. Immer mehr Familien entschieden sich dafür, die verstorbenen Angehörigen nicht mehr im Haus aufzubahren, sondern in der stilvollen Aufbahrungshalle beim neu gebauten Eingangsportal. Der ehemals ungeliebte Centralfriedhof hatte sich in den letzten Jahren durch die Neu- und Ausbauten und durch den Anschluss an das Straßenbahnnetz gemausert.
Er stieg an der Haltestelle bei Tor 2 aus und betrat das Areal. Schon beim Durchschreiten des Portals entdeckte er den Kondukt, der eben aus der Aufbahrungshalle kam. Der Sarg wurde von den Friedhofswärtern auf einem dezent geschmückten Zweispänner abgestellt. Der Kutscher saß nicht auf dem Bock, sondern führte gehend die Pferde am Zügel. Speyer wartete abseits, bis sich der Trauerzug in Bewegung setzte. Der vor zwanzig Jahren verstorbene Stephan Hohenau hatte nur ein schlichtes Grabmal für sich gewünscht, er wollte auch im Tode nicht durch Geltungssucht und Pomp auffallen. Seine Ehefrau würde ihm in dieses Grab nun folgen. Wenn Friedhofsbesucher und Passanten den Kondukt sahen, hielten sie inne, zogen ihre Hüte oder bekreuzigten sich.
Nach etwa zehn Minuten erreichte der Trauerzug die offene Grabstelle. Speyer sah aus der Ferne, wie der Pfarrer die Einsegnung vornahm und danach der Sarg abgesenkt wurde. Die Trauergemeinde folgte der Zeremonie, soweit Speyer beobachten konnte, mit gefassten Gesichtern und in stiller Trauer. Weinende Gesichter waren nicht zu erkennen.
Speyer wurde, wie so oft, wenn er an einer Bestattung teilnahm, auch wenn er nur ein entfernter Beobachter war, von der Trauerstimmung erfasst. Selbst das frühlingshafte Wetter vermochte die Stimmung nicht zu heben. Nach Abschluss der Zeremonie ging er mit den Händen in den Taschen seines Mantels und den Hut tief in die Stirn gezogen noch eine Weile durch den parkähnlich angelegten Friedhof. Hatte er irgendetwas über den Fall in Erfahrung bringen können? Nein. Die einzige Erkenntnis war, dass sich die Trauergesellschaft fast ein bisschen zu schnell in alle Windrichtungen zerstreut hatte.
*
Bruno öffnete die Tür zum Kaffeehaus und ließ die drei eintreten. Das Café Kaiserhof in der Krugerstraße war in der kurzen Zeit ihres Aufenthalts zum Stammcafé der Gäste aus Triest geworden. Nur ein paar Schritte vom stets belebten Hotel Sacher entfernt bot es gediegene Ruhe, gehaltvollen Kaffee und darüber hinaus erstklassige Mehlspeisen. Ihre Excursion zum Südbahnhof hat die kleine Gesellschaft hungrig gemacht, also hatten sie schon in der Elektrischen beschlossen, im Kaiserhof einzukehren. Bruno trat als Letzter durch die Tür und schaute sich um. Der Kaiserhof war ein typisches, eher kleines Wiener Kaffeehaus, im hinteren Bereich standen ein Billardtisch und einige Tische, die vor allem von den Schachspielern besetzt wurden, im größeren vorderen Bereich befanden sich die Sitzgruppen für die Gäste. Das Kaffeehaus war gut besucht, nur zwei Tische waren noch frei.
»Meine Verehrung, was für eine Freude, die gnädigen Herrschaften aus Triest wieder begrüßen zu dürfen«, sagte der Ober mit galantem Kopfnicken und wandte sich an Bruno. »Belieben Euer Gnaden sich an diesen Tisch zu bequemen?«
»Vielen Dank, der Tisch ist für unsere Zwecke ganz ausgezeichnet.«
Bruno half Luise, der Ober Grete aus dem Mantel. Bruno half auch Gerwin und platzierte die Kleidungsstücke auf dem Garderobenständer. Der Ober wartete diskret im Hintergrund, bis sie sich gesetzt hatten, dann trat er an den Tisch heran. Sie beratschlagten, was sie essen und trinken sollten, und entschieden sich für zwei Tassen heiße Schokolade und zwei große Mokka. Gerwin orderte ein Stück Sachertorte mit Schlagobers, Grete ein Stück Topfenstrudel, Luise und Bruno wählten Apfelstrudel. Noch ehe der Mann abging, fügte Bruno der Bestellung noch ein Glas Cognac hinzu.
Wenig später wurden die Getränke und Mehlspeisen serviert. Gerwin schaute den Ober aus großen Augen erwartungsvoll an. Dieser schmunzelte.