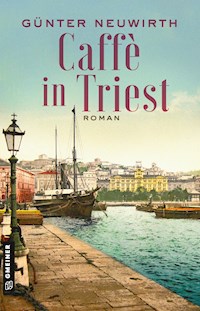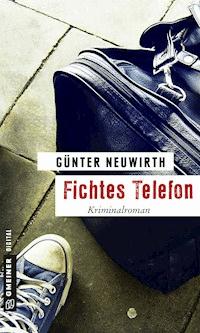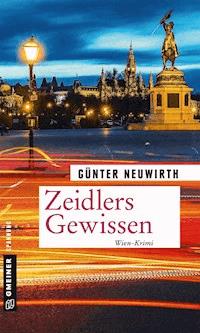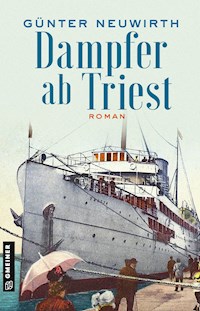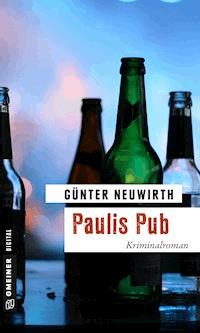Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Polizistin Christina Kayserling
- Sprache: Deutsch
Der Steyrer Fleischbaron Herbert Felder wird in seiner Lagerhalle von einer Maschine überrollt und getötet. Sofort ist klar, dass es sich um Mord handeln muss, denn Felder ist von außen in die Automatikanlage eingesperrt worden. Die Kriminalpolizistin Christina Kayserling stößt bei ihren Ermittlungen auf geprellte Geschäftspartner, einen gekränkten Sohn und auf Felders zweite Frau, die psychische Probleme hat. Keine leichte Aufgabe, bei der Tätersuche den Überblick zu bewahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Neuwirth
Neumondnacht
Kriminalroman
Zum Buch
Tod im Kühlhaus In einer Neumondnacht wird der Fleischbaron Herbert Felder in seinem Lager von einem Regalbediengerät überrollt. Kriminalpolizistin Christina Kayserling und ihre Kollegen schließen einen Unfall aus, denn Felder ist in die Automatikanlage eingesperrt worden. Der Unternehmer war ein äußerst streitbarer Mann, der ohne Rücksicht nur an seinen Gewinn gedacht hat. Neider und Feinde hatte er nahezu überall. Seinen Sohn hielt er für einen Versager, seine zweite und wesentlich jüngere Ehefrau hat psychische Probleme. Hinzu kommt, dass kurz vor der Tat in das Areal der Fabrik eingebrochen wurde. Unbekannte Täter haben in riesigen Lettern das Wort „MORD“ auf eine Außenwand geschmiert. Eine Warnung? Oder das Werk militanter Tierschützer? Christina Kayserling taucht in einen dunklen Kriminalfall ab, in dem es an Motiven, Abgründen und Obsessionen nicht mangelt.
Günter Neuwirth wuchs in Wien auf. Nach einer Ausbildung zum Ingenieur und dem Studium der Philosophie und Germanistik zog es ihn für mehrere Jahre nach Graz. Der Autor verdient seine Brötchen als Informationsarchitekt an der TU Graz und wohnt am Waldrand der steirischen Koralpe. Günter Neuwirth ist Autodidakt am Piano und trat in jungen Jahren in Wiener Jazzclubs auf. Eine Schaffensphase führte ihn als Solokabarettist auf zahlreiche Kleinkunstbühnen. Seit 2008 publiziert er Romane, vornehmlich im Bereich Krimi.
Mehr Informationen zum Autor unter: www.guenterneuwirth.at
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
(erstmals erschienen 2013 im Styria Verlag)
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Andreas / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7714-0
Ende September, Freitagabend
1
»Der gravierende Unterschied zwischen einem Koch und einem Küchenköter ist, dass sich der Koch niemals hetzen lässt. Merkt euch das, meine Herren! Wenn der Chef de Rang, der Maître de Cuisine, der Kellermeister, der Kerkermeister, der Henkermeister und der Leibhaftige höchstpersönlich hinter dem Koch stehen und wenn sie alle ihre Messer wetzen, ihn zu höchster Eile antreiben, weil draußen eintausend Gäste des Galadiners halb verhungert auf den Tellern scharren, dann verliert der Koch niemals die Nerven, sondern schmeckt in aller Ruhe die Soße oder Suppe ab, verfeinert das Hauptgericht mit einer Prise Salz, einem Hauch Pfeffer oder einer Nuance von Wildkräutern. Wenn im Restaurant alle verrückt werden, vom Wahnsinn in die Tobsucht verfallen, wenn die ersten Leichen aus der Küche getragen werden, bleibt ein echter Koch bei seiner Arbeit und gibt sie erst frei, wenn sie gelungen ist, wenn der Braten durch, die Suppenterrine von ihm persönlich gefüllt oder das Dessert vollständig dekoriert ist. Jedem, der euch, wenn ihr dereinst echte Köche sein werdet, was ich schwer hoffen will, meine Freunde, etwas anderes erzählt, der behauptet, Köche müssen schnell, schnell, schnell sein, Köche müssen Rendite bringen, Köche müssen Massen auswerfen, dem könnt ihr in meinem Namen ein paar saftige Ohrfeigen verpassen. Koch zu sein, ist kein Job! Koch zu sein, ist eine Verpflichtung. Man muss sich würdig erweisen, ein Koch zu sein. Na gut, viele Gäste in den Restaurants wissen gar nicht, was man ihnen vorsetzt, sie fressen alles in sich hinein, Hauptsache, es sieht am Teller hübsch aus und ist teuer. Davon darf sich ein echter Koch nicht verrückt machen lassen, denn der wahre Koch weiß besser über das Leben und das Essen Bescheid als irgendein neureicher Schnösel oder inzestuös verkümmerter Adeliger. Wir Köche, meine Herren, wir haben die Verantwortung für die Menschen von der Auswahl der Zutaten bis zum Durchzug der Toilettenspülung. Wenn auf diesem Weg Fehler passieren und Leute an scheußlichem Essen krepieren, ist das unsere Schuld.«
Albrecht Kammerhofer holte tief Luft und musterte seine zwei Lehrbuben, die wie immer geduldig seinem Vortrag lauschten. Anfangs hatten sie noch lange Mienen gezogen oder blöde Fratzen geschnitten, mittlerweile aber erkannt, dass sie vom Souschef im Hause allerhand lernen konnten. Da nahmen sie seine manchmal bombastischen Vorträge ohne Murren in Kauf.
»Merkt euch diese Worte gut, meine Herren! Und jetzt an die Arbeit. Wir haben zu tun. Und wer nicht jeden Tag in der Küche sein Bestes gibt, wird von mir eigenhändig in die Sauce Sanglier verarbeitet.«
Albrecht stemmte schmunzelnd seine Fäuste in die Hüften und sah die Lehrbuben an ihre Arbeitsplätze eilen. Das vielstimmige Orchester der Küche lag in seinen Ohren, mit großem Vergnügen lauschte er dieser ihm lang vertrauten konzertanten Dichtung. Kurz dachte er an seine Lehrzeit vor dreißig Jahren, an das sinnlos strenge Regiment seines ersten Maître, bei dem er zwar viele Rezepte kennengelernt, aber auch gesehen hatte, wie man sich als Küchenchef mit Wein ruinieren konnte. In Albrechts letztem Lehrjahr hatte der Maître eine halbe Flasche Wein gebraucht, um den Arbeitstag in der Küche anzutreten, über die Stunden des Arbeitstages verteilt eine weitere Flasche, um sich in Schwung zu halten, und nach Abschluss der Arbeit hatte er noch eine Flasche Wein gebraucht, um abschalten zu können. Erstaunlicherweise war er aber nicht im Vollrausch zusammengebrochen, sondern war kollabiert, als er völlig verkatert seinen Hund überfahren hatte. Ein Nervenzusammenbruch war für Chefköche in vorgerücktem Alter, wie Albrecht im Lauf der Jahre beobachten konnte, eine erwartbare Karrierestation. Die Bürohengste nannten das Burnout, eine Bezeichnung, über die Albrecht nur schmunzeln konnte. Erstens war ihm in dreißig Jahren Arbeit in Großküchen nie eine Speise an- oder gar ausgebrannt, und zweitens würden diese Stubenhocker nicht eine Woche lang jeden Tag bei fünfunddreißig Grad vierzehn Stunden en suite am Herd stehen können. Gewichtheber, Forstarbeiter und Köche benötigten eine robuste Konstitution, und Albrecht Kammerhofer war heilfroh, über eine solche zu verfügen.
2
Sie befand sich in einem Zustand vollster Konzentration, war auf das Ziel fokussiert, in eine Form des meditativen Selbstverlustes gefallen. Der Kolben lag an ihrer Schulter, ihre Beine waren ausgestreckt und gespreizt, beide Ellbogen ruhten auf dem Boden, ihr gesamter Torso ruhte auf dem Boden, verschmolz damit, sie ließ die Kühle und Stabilität des Untergrundes zu einer des Körpers werden. Dann drückte sie vorsichtig das rechte Auge gegen das Okular, schloss das linke. Das Ziel lag genau im Fadenkreuz. Sie ließ sich Zeit. Die rechte Hand bewegte sich um Nuancen, zeitlupengleich umfasste der Zeigefinger den Abzugshahn. Ein Atemzug noch. Die Luft anhalten. Der Knall, der Stoß gegen die Schulter, der scharfe Geruch nach verbranntem Pulver.
Christina setzte das Gewehr ab und schaute zur Zielscheibe. Sie erhob sich und streckte ihre Glieder. Der Trainer stand ein paar Schritte neben ihr und nahm das Fernglas von seinen Augen sowie die Ohrenschützer vom Kopf. Er lächelte Christina breit an und hob den Daumen. Auch sie streifte die Ohrenschützer ab.
»Tadellos, Frau Kollegin!«, rief der Mann. »Das waren jetzt eine Menge Ringe. Die genaue Auswertung schau ich mir später an. Sie haben wirklich Talent, Frau Kayserling. Ein gutes Auge, eine ruhige Hand.«
Christina fühlte, wie die Spannung von ihr abfiel, ein Lächeln legte sich in ihr Gesicht. »Vielen Dank.«
Sie begann das Scharfschützengewehr, so wie sie es im Kurs gelernt hatte, zu zerlegen und zu reinigen. Präzisionsinstrumente erforderten penible Pflege und Wartung, das war die erste Lektion gewesen.
»In drei Monaten findet der Kurs für Fortgeschrittene statt. Ich hoffe stark, dass wir uns wiedersehen. Da werden wir die großen Distanzen in Angriff nehmen«, sagte der Trainer und machte einen Vermerk auf seiner Liste.
Christina wiegte den Kopf. »Na, ich weiß nicht.«
Der Trainer starrte Christina an. »Was soll das heißen? Zaudern wird nicht gestattet.«
Christina zuckte mit den Schultern. »Das Kurszeugnis kriege ich, damit habe ich die Fortbildungsmaßnahme für heuer erledigt. Ich glaube, dabei werde ich es bewenden lassen.«
Der Trainer stemmte seine Fäuste in die Hüften. »Das will ich aber jetzt nicht gehört haben. Ich habe nicht jeden Tag so talentierte Schützen auf dem Schießstand.«
»Erstens bin ich eine Schützin und zweitens reicht der Basiskurs für meinen Geschmack vollständig aus. Ich kann jetzt mit einem SSG69 umgehen. Das ist genug.«
Der Trainer verzog seine Miene. »Na geh, Frau Kollegin, Sie haben das Zeug zur Scharfschützin. So ein Talent muss doch gefördert werden.«
Christina schloss den Gewehrkoffer. »Scharfschützin will ich eigentlich gar nicht werden. Der Job gefällt mir nicht.«
»Ein Job wie jeder andere bei der Polizei.«
»Das schon, aber dafür bin ich schon zu alt und ich habe nicht die richtigen Nerven.«
»Glaub ich weniger. Mit etwas Übung wird Ihre Hand noch ruhiger und sicherer.«
»Die Hand ist nicht das Problem«, gab Christina zurück. »Eher der Kopf. Als Scharfschütze muss man, wenn es darauf ankommt, auch abdrücken.«
»Das natürlich schon«, räumte der Trainer ein.
»Ich habe schon einmal auf einen Menschen geschossen. Vorschriftsmäßig in den Oberschenkel, keine bleibenden Verletzungen, die Untersuchungskommission hat meinen Einsatz sogar gelobt. Aber mir ist es monatelang nicht gut gegangen. Trotz psychologischer Betreuung«, erläuterte Christina und grinste verschmitzt. »Oder vielleicht gerade deswegen.«
Der Trainer lachte kurz und nickte ihr zu. »Alles klar, Frau Abteilungsinspektor. Das Zeugnis für den Kurs kriegen Sie in ein paar Tagen zugestellt. Hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Und wenn Sie mal etwas brauchen, jetzt wissen Sie ja, wo ich zu finden bin.«
Christina schüttelte dem Polizeimajor die Hand, packte den Gewehrkoffer und marschierte zum Depot, während er die Ohrenschützer überstreifte und zum nächsten Kursteilnehmer trat, um dessen Schussleistung beim Abschlusstest zu beobachten.
Tatsächlich hatte das viele Blut dieses einen Abends sie nicht nur monatelang verfolgt, sondern in manchen Momenten tauchte nach wie vor die Erinnerung an diesen Nachtdienst in ihr auf. Jetzt zum Beispiel. Es hatte sich im zweiten Jahr ihrer Dienstzeit zugetragen, sie war mit einem erfahrenen Kollegen unterwegs gewesen, sie hatten einen Funkspruch erhalten, waren zum Ort des Geschehens gefahren und hatten in einer Wohnung einen Mann völlig außer Kontrolle vorgefunden, der zuvor seine Exfrau mit einer Serie von Messerstichen schwer verletzt hatte. Der Mann war auf den Kollegen gestürzt und hatte auch ihm das Messer in den Bauch gerammt. Danach war er auf Christina losgestürmt und war nur durch einen Schuss zu stoppen gewesen. Ein klarer Fall von Notwehr im Einsatz, dennoch war dies der scheußlichste Abend ihres Lebens gewesen. Zum Glück hatte sie danach nie wieder ihre Waffe gegen einen Menschen abfeuern müssen.
Sie hasste die Erinnerung an dieses Ereignis, aber mit der Zeit hatte sie sich daran gewöhnt, diese Erinnerung als einen Teil ihres Lebens zu akzeptieren. Mit einem Gedanken an den vor ihr liegenden gemütlichen Abend mit Wilhelm gelang Christina die Vertreibung der alten Bilder.
Als Polizistin brauchte man durchaus ledrige Haut. Und ein dichter Pelz konnte auch nicht schaden.
3
Verglichen mit den Aufgaben, denen er sich in Paris, Brüssel und Genf hatte stellen müssen, war die Arbeit im Steyrtalerhof ein leichtes Spiel. Siebzig Gäste standen auf der Liste, nicht dreihundert, fünfhundert oder wie in Genf immer wieder eintausend. Hier war alles viel familiärer, überschaubarer, auch vertrauter. Albrecht liebte den Klang der Sprache seiner Kindheit, die er selbst in den Jahrzehnten in französischsprachigen Ländern nicht aus den Ohren verloren hatte. Er war Chantal dankbar, dass sie mit ihm gegangen war, dass sie zugestimmt hatte, nach Österreich zu ziehen, dass sie sich sogar darauf gefreut hatte, das Heimatland ihres Mannes kennenzulernen. Sie hatten ausgemacht, hier in Steyr so lange zu bleiben, bis die Kinder groß sein würden, danach schwebte ihnen ein beschaulicher Lebensabend in der Bretagne vor, in Chantals Heimatdorf am Atlantik. Mit sechzig, so plante Albrecht für sich selbst, also in fünfzehn Jahren, würde er die Kochlöffel nur mehr in seiner Privatküche für seine Familie und seine Freunde schwingen. Nach fünfundvierzig Jahren Küchenarbeit würde er, so Albrechts Meinung, das hart erworbene Recht haben, leiser zu treten, alles langsamer anzugehen, sich mit den kleinen und nahen Dingen zu beschäftigen. Noch lag ein weites Stück vor ihnen, noch war ihre Jüngste, Sofie, nicht schulpflichtig, aber dieses Stück würden sie nicht im Höllentempo von Paris, Brüssel oder Genf nehmen, sondern im etwas gemächlicheren Tempo in Albrechts Heimatstadt am Rande der Alpen. Mit fünfundvierzig Jahren, vier Kindern und einigem Kapital auf der hohen Kante musste und konnte er nicht mehr das Tempo seiner früheren Jahre halten.
Heute also Steirisches Wurzelfleisch für siebzig geladene Gäste des Directeurs. Der Steyrtalerhof hatte einen guten Ruf, die hundertdreißig Plätze des Restaurants waren zwar nicht immer besetzt, aber vor allem für noble Firmenempfänge, exquisite Hochzeitsfeiern oder Galadiners war der Steyrtalerhof eine der ersten Adressen in der Region. Albrecht polierte die bereitliegenden Messer, legte sie fein säuberlich ab und ließ den Blick kreisen. Er liebte die Ordnung vor Beginn der Arbeit. Hier die Messer, dort die Kochlöffel, die Gewürzgefäße, die Schneidebretter. Sauberkeit und Ordnung, das war die erste Lektion, die er als Lehrbub erlernt hatte, die er drei Jahrzehnte lang praktiziert hatte und die er den Lehrlingen, die ihm zur Ausbildung anvertraut worden waren, zuallererst beigebracht, und wenn nötig auch eingebläut hatte.
Albrecht griff in die Wanne mit der Jungzwiebel und sog deren Duft ein. Gut, sehr gut sogar, frisch geerntet. Er nahm eine Karotte, schnitt ein Stück davon ab und warf es sich in den Mund. Gut. Vorsichtig roch er am Kren und spürte gleich die Reaktion in den Augen. Wunderbar. Fein gerieben war frischer Kren wohldosiert das Tüpfelchen auf dem I von Steirischem Wurzelfleisch. Er zerkaute eine Wacholderbeere. Albrecht blickte um sich, ob ihn jemand beobachtete. Da alle in ihre Arbeit vertieft waren, holte er aus dem Regal seine spezielle Zutat herbei. Er hatte jahrelang französische und internationale Gerichte gekocht, doch auch manch weniger bekannte Rezepte seiner Heimat waren ihm gut vertraut. Schon vor Jahren hatte er einmal Steirisches Wurzelfleisch zubereitet und war auf die Idee gekommen, zu Karotten, Sellerie, Petersilienwurzeln und Zwiebeln auch Löwenzahnwurzeln zu mengen. Niemand musste von dieser Idee wissen, daher mischte er die Löwenzahnwurzel schnell unter die ähnlich aussehenden Petersilienwurzeln. Ein feines Schmunzeln legte sich in sein Gesicht. Als er vor einer Woche das Motto »Ein steirischer Abend« und den Menüplan für den Empfang des Directeurs erfahren hatte, war er an seinem freien Tag aufgebrochen, um auf den Wiesen, Weiden und Wegrändern nach kräftigen Löwenzahnpflanzen zu suchen. Er liebte diesen Teil seiner Arbeit.
Albrecht nickte zufrieden und wandte sich dem Kühlraum zu. Jetzt die Schweineschulter. Hoffentlich hatte Wendelin genug Fleisch besorgt. Dem Einkauf der Naturalien ging Albrecht mit Akribie nach. Er wusste, warum. Zu oft hatten Stümper und Ignoranten mäßige oder gar miserable Zutaten eingekauft, mit denen er dann qualitätsvolle Speisen hätte kochen sollen. Wenn er denn eines Tages mit einem Nervenzusammenbruch im Sanatorium stranden sollte, dann bestimmt wegen minderwertiger Zutaten. Zum Glück bestand diese Sorge im Steyrtalerhof nicht, denn Albrecht hatte praktisch freie Hand beim Einkauf, und zum Geschäftsführer des Restaurants, zu Wendelin Sattler, hatte Albrecht bald Vertrauen schöpfen können. Wendelin verfügte über eine feine Nase und kannte vertrauenswürdige Lieferanten in der Region. Es war völlig unmöglich, ein erstrangiges Restaurant zu führen, wenn man nicht über erstrangige Lieferanten verfügte.
Albrecht öffnete die Tür zum Kühlraum, entdeckte zwei gedeckte rote Kunststoffwannen und trug sie an seinen Arbeitsplatz. Anhand des Gewichts der Wannen schätzte er, dass ausreichend Fleisch für siebzig Gäste vorhanden war. Er öffnete den Deckel einer Wanne.
Ein Faustschlag ins Gesicht? Ein Tritt gegen die Nase? Ein Knüppelhieb auf den Schädel?
Albrecht taumelte zwei Schritte zurück. Panik griff nach ihm. Er öffnete die zweite Wanne. Auch hier. Jedes Lächeln, jede Freude, jede Zuversicht waren aus seinem Gesicht gewichen. Nicht das schon wieder. So etwas hatte er schon einmal erlebt. Die größte Küchenpleite an der Seine seit der Erfindung des Lagerfeuers, der Ruf des Restaurants war auf Jahre ruiniert und er war mittendrin gewesen. Albrecht sog den Geruch des Fleisches mit geradezu selbstmörderischer Verbissenheit ein. Eine Katastrophe.
»Richard, wir haben ein Problem! Lukas! Komm her. Lukas.«
Nicht nur der Maître und der Lehrbub schreckten durch den Tonfall in der Stimme des Souschefs hoch. Der ältere der beiden Lehrbuben lief heran.
»Lukas, lauf zu Wendelin und sag ihm, hier bahnt sich eine Katastrophe an.«
Der junge Mann blickte verstört um sich.
»Na los, lauf schon.«
Der Lehrbub tat, wie ihm geheißen. Albrecht schaute auf die große Küchenuhr. Mit etwas Glück würden sie noch Fleisch kaufen können. Zumindest ein wenig, denn dass sie die ganze Menge für siebzig Gäste so kurzfristig bekommen konnten, wagte er zu bezweifeln. Albrecht fluchte vor sich hin. Er würde auch Rindfleisch nehmen müssen. Alles, was er kriegen konnte.
Richard, der Maître de Cuisine, beschäftigt, die Schilcherrahmsuppe anzufertigen und den Arbeitsfortschritt zu überwachen, trat mit schnellen Schritten heran und blickte besorgt in die Fleischwannen. »Was ist los?«
Noch ehe Albrecht antworten konnte, wurde die Tür zur Küche aufgestoßen. Albrecht sah Wendelin, den Geschäftsführer, hereinrauschen und in seinem Schlepptau den Directeur. Ein flaues Gefühl erfasste Albrecht. Der Directeur. Er war also auch hier. Und er würde die Katastrophe mit eigenen Augen erleben. Schlecht für Wendelin. Sehr schlecht. Albrecht hatte gar kein Interesse, Wendelin bloßzustellen, schon gar nicht vor dem Directeur, Wendelin war ein guter Mann, Albrecht und er hatten sich schnell auf einer zwar rein beruflichen, dafür aber soliden Art und Weise verstanden. Aber in vier Stunden würden siebzig Gäste eintreffen und diese erwarteten mit Fug und Recht ein delikates Diner. Eine Scheißsituation.
»Albrecht, was ist los?«, rief Wendelin Sattler und eilte heran.
Alle Augen waren auf Albrecht gerichtet. Er schluckte. Egal, er konnte niemanden schonen, es war ja zu offensichtlich. »Wendelin, Monsieur le Directeur, wir haben ein Riesenproblem. Die Schweineschulter ist nicht gut.«
Tatsächlich verfärbte sich die Miene des Geschäftsführers. Er stürzte zu den Wannen, schaute hinein und schnupperte. Auch der Maître de Cuisine schnupperte.
»Äh, was meinst du?«, fragte Wendelin verstört.
Auch der Maître blickte irritiert.
»Dieses Fleisch kann man keinem Menschen als Nahrung vorsetzen. Es ist für den Verzehr nicht geeignet. Und wir haben praktisch keine Zeit mehr, frisches und gutes Fleisch zu kaufen.«
Herbert Felder drängte sich an dem Geschäftsführer und dem Küchenchef vorbei und roch an dem Fleisch. Er nahm ein Stück heraus, befühlte es und grub förmlich seine Nase in die Fasern. »Was soll daran verdorben sein?«
»Nein, nicht verdorben, Monsieur le Directeur, es ist schlechtes, ungesundes Fleisch. Riechen Sie genau daran.«
»Hören Sie mal«, dröhnte die tiefe und laute Stimme des Directeurs, »ich weiß sehr gut, wie Fleisch riecht, zufälligerweise arbeite ich seit ein paar Jährchen damit. Das ist ganz normales Schweinefleisch. Und sicher nicht verdorben.«
Albrecht sah sich durch die fragenden Blicke der Umstehenden und den zornigen Tonfall des Directeurs in die Defensive gedrängt, also roch er noch einmal an der Wanne. Und musste sich fast übergeben. Zorn stieg in ihm hoch. »Monsieur le Directeur, das Fleisch ist nicht verdorben, wie ich sagte, aber es ist meiner Meinung nach ungenießbar.«
Herbert Felder wandte sich grantig an Wendelin Sattler. »Wer ist er eigentlich? Den Mann kenne ich gar nicht.«
Es wunderte Albrecht nicht, dass der Directeur ihn nicht kannte, zum einen war ja der Steyrtalerhof nur eine Art Steckenpferd des Großunternehmers Herbert Felder, wie Albrecht schon am Anfang seiner Tätigkeit gehört hatte, zum anderen beachtete Felder seine Nachbarn nicht, wenn er mit seinem BMW 7 an deren Häusern vorbeibrauste. Zweifellos war dem Mann die Familie, die in der Einfamilienhaussiedlung unterhalb seines weitläufigen Anwesens vor wenigen Monaten zugezogen war, gar nicht aufgefallen. Albrecht Kammerhofer und Herbert Felder wohnten zwar am Hang desselben Hügels in Aschach an der Steyr, dennoch aber in völlig unterschiedlichen Welten, der eine in einem schmucken Häuschen aus den Siebzigerjahren am Fuße des Hügels, der andere in einer ausladenden Villa auf dem sonnenhellen Gipfel.
Wendelin Sattler versuchte gestikulierend im sich anbahnenden Konflikt zwischen dem Besitzer des Restaurants und dessen zweitem Küchenchef zu vermitteln. »Albrecht ist ein Vollprofi, Herr Felder. Seit einem halben Jahr ist er unser Souschef. Ich habe ihn beauftragt, das Steirische Wurzelfleisch zuzubereiten. Er genießt mein vollstes Vertrauen.«
Felder wandte sich an den Maître de Cuisine. »Ist das Fleisch verdorben oder ungenießbar?«
Der Maître zuckte mit den Schultern und hob abwehrend die Hände. »Meiner Meinung nach ist das ganz normales Schweinefleisch.«
Albrecht wunderte sich nicht, dass der Maître nichts roch. Richard war ein guter Handwerker und solider Koch, aber ein Mann, der mindestens eine Packung Zigaretten pro Tag rauchte, konnte weder irgendetwas riechen noch schmecken.
»Aber riecht ihr das nicht? Ich falle fast aus den Schuhen«, fuhr Albrecht angesichts solcher Ignoranz erbost hoch. »Die Tiere sind ein Leben lang falsch ernährt worden! Wenn ich einer zwanzigjährigen Balletttänzerin die Hand schüttle, wird sie nach Schneeglöckchen und Flieder duften. Wenn ich einem fünfzigjährigen Kettenraucher die Hand schüttle, wird er nach Teerpappe und Terpentin riechen. Wenn ich einem siebzigjährigen Krebspatienten nach einer Chemotherapie die Hand schüttle, wird er Pharmaprodukte und den Hauch des Leichenschauhauses ausdünsten. Diese Schweineschultern riechen wie ein siebzigjähriger Krebspatient. Oder eben wie Schweine, die ein Leben lang miserables Futter fressen mussten, häufig krank waren und mit Medikamenten vollgepumpt worden sind. Ja, ich weiß, Millionen Schweine werden so gehalten, aber diese hier mussten ein besonders elendes Dasein fristen. Riecht man doch. Solches Fleisch ist eines Restaurants wie dem Steyrtalerhof nicht würdig, solches Fleisch ist Menschen nicht zuzumuten, solches Fleisch gehört am Waldrand in stiller Trauer bestattet.«
Stille lag in der Küche. Alle starrten den Souschef an. Sprachlos.
»Sagen Sie mal, Sie eingebildeter Affe«, brüllte der Directeur mit hochrotem Kopf los, »was bilden Sie sich eigentlich ein? Sie bereiten jetzt auf der Stelle und mit Tempo das Wurzelfleisch zu, sonst trete ich Ihnen höchstpersönlich in den Arsch! Und wenn das Gericht nicht tadellos und einwandfrei dekoriert auf die Teller kommt, können Sie sich morgen einen anderen Job suchen! Vielleicht in einem Tierasyl. Oder bei den beschissenen Biobauern. War das auch für Sie klar genug?«
Albrecht war nicht eingeschüchtert. Nicht ein bisschen. Er hatte sieben Jahre mit Claude Ratinier gearbeitet, einem gnadenlosen Psychopathen der Pariser Gastronomie, und sieben Jahre lang jeden Abend ein Gefecht ausgefochten, das jenes hier wie einen Kinderspaziergang anmuten ließ, nein, ein oberösterreichischer Provinznapoleon konnte ihm keinen Schrecken einjagen. Aber er brauchte den Job hier. Und er wollte Wendelin Sattler nicht schaden. Albrecht schluckte die Antwort, die ihm schon auf der Zunge lag, hinunter. Nicht mehr lange, dachte er für sich, nicht mehr lange musste er sich verbiegen und verbeugen.
»Oui, Monsieur le Directeur. Das war klar genug.«
»Na dann los, verdammt noch mal.«
Herbert Felder verließ mit energischen Schritten die Küche.
»Albrecht, ich flehe dich an«, stieß Wendelin Sattler mit gefalteten Händen hervor. »Mach das Beste daraus. Bitte.«
Albrecht vollführte eine wegwerfende Handbewegung. »Jajaja, ich schau, was ich machen kann.«
Wendelin Sattler eilte zur Küchentür, hielt inne und drehte sich noch einmal um. »Und, Albrecht, Herr Felder hat das Fleisch persönlich gebracht.«
4
Benjamin lenkte seinen kleinen Mazda flott über die Straßen. Als die Gegenfahrbahn frei war, setzte er zu einem Überholmanöver an und drückte das Gaspedal tief durch. Der Motor drehte hoch, Benjamin ließ den schwer beladenen Lkw hinter sich und näherte sich der Stadtgrenze von Steyr. Richtig übel war ihm, er brauchte frische Luft, also kurbelte er das Fenster auf und schnappte nach dem Luftstrom. Er hasste Steyr und all die Erinnerungen, die er mit dieser Stadt verband. Seine Kindheit im Schatten der väterlichen Launen, seine Jugend mit der als zutiefst verletzend empfundenen Scheidung seiner Eltern, die Mühsal in der Schule, das Fremdsein in der Welt, all das war an die Stadt Steyr geknüpft. Zum Glück hatte er sich schon vor Jahren davon befreien können, war nach der Scheidung der Eltern mit seiner Mutter nach Linz gezogen und hatte dort mit vierzehn Jahren ein fast neues Leben anfangen können. Eine neue Schule, neue Freunde, die ersten vorsichtigen Kontakte zu Mädchen, ja, in Linz war es ihm viel besser gegangen, auch wenn Mutter und Sohn nun mit einer kleinen Mietwohnung Vorlieb nehmen mussten. Aber für Luxus, einen Swimmingpool und Skiurlaube am Arlberg oder in Kitzbühel hatte er sich ohnedies nie wirklich begeistern können, vielmehr waren ihm insbesondere die Urlaube ein Gräuel gewesen. Sein Vater war am leichtesten zu ertragen gewesen, wenn er gearbeitet hatte, was zum Glück die meiste Zeit der Fall gewesen war. Er verdrängte die Erinnerungen an seine frühen Jahre.
Benjamin Felder reduzierte das Tempo des Wagens und passierte die Ortseinfahrt von Steyr. Natürlich kannte er jeden Winkel und jede Straße, auch wenn er schon seit elf Jahren in Linz lebte. Er wusste, wohin er an diesem Abend zu fahren hatte. Verbissen kaute er auf seinen Lippen, fuhr sich immer wieder nervös über das Haar. Ein steiniger Weg lag vor ihm, aber er musste ihn einfach gehen, es gab keine Alternative. Er brauchte das Geld. Unbedingt. Und es gab nur einen Mann, der ihm das Geld geben konnte. Nur einen.
5
Da stand er also, ein begossener Pudel vor einem ekelhaft ausdünstenden Futternapf. Was sollte er tun? Er griff nach der Krenwurzel und rieb eine kleine Menge auf einen Teller. Albrecht kippte den geriebenen Kren auf seine Hand, rieb die weißen Wurzelfäden und atmete tief ein. Sofort schossen Tränen in seine Augen, sofort legte sich der Duft des Krens in seine Nasenhöhlen und in seinen Rachen. Er kaute die Wurzelfäden. Der Kren war wirklich von erlesener Qualität, stark, würzig, saftig, seine Geschmacksknospen und Geruchsnerven waren gereinigt. Albrecht erinnerte sich, er hatte schon einmal in einer ähnlichen Situation gesteckt und sich irgendwie herauswinden müssen. Reinigen, das war die Devise. Das Fleisch musste gereinigt und mit intensiven Aromen gewürzt werden. Schnell mischte er einen kräftigen Schuss Apfelessig mit Wasser und begann das Fleisch oberflächlich zu waschen. Der Essig machte sich sofort bemerkbar. Als er alle Fleischstücke gewaschen hatte, hielt Albrecht inne und dachte nach. Die äußerliche Reinigung war notwendig gewesen, aber wie sollte er die Geschmackssubstanz des Fleisches beeinflussen? Der frische Kren würde auf dem Teller wichtige Dienste leisten, aber nicht die Substanz verbessern können. Außerdem gab es immer wieder Leute, die geriebenen Kren nicht mochten, für Albrecht unverständlich, aber er nahm zur Kenntnis, nicht alles verstehen zu können, diese Leute würden das gesottene Fleisch ohne die geschmackliche und verdauungstechnische Wirkkraft des Krens zu sich nehmen, und diese Leute würden sich berechtigterweise beim Chef de Rang über einen solchen Fraß beschweren. Was also tun?
Er erinnerte sich an die Tollerei mit Albert und Sofie auf der Wiese. Die Kinder hatten Grasbüschel ausgerissen und nach ihrem Vater geworfen, der ihnen hinterhergelaufen war, sie gefangen und durch die Luft gewirbelt hatte. Chantal hatte die Tollerei durch den Ruf zum Nachmittagstee beendet. Und genau bei dieser Tollerei hatte er ein paar Halme Schafgarbe zerkaut. Und exakt dieser Geschmack lag nun Albrecht im Gaumen. Schafgarbe! Das war es. Damit konnte er es versuchen. Seit Jahren sammelte Albrecht allerlei Wiesen- und Wildkräuter für seine Küchenarbeit und natürlich hatte er sich hier an seinem Arbeitsplatz eine umfassende Sammlung von getrockneten Kräutern angelegt, aber hier und jetzt musste die Schafgarbe frisch sein, nicht getrocknet. Dennoch griff er zum Gefäß mit der trockenen Schafgarbe und atmete den Geruch tief ein. Könnte klappen. Damit könnte er den gestrandeten Kahn wieder flottmachen. Hoffte er zumindest. Das Fleisch musste mit frischer Schafgarbe gesotten werden. Und er wusste, wo in der Nähe Schafgarbe wuchs. Zum Glück waren Ende September die Kräuter noch saftig. Im Winter hätte er sich mit getrockneter Schafgarbe behelfen müssen.
Als er die Nottaschenlampe aus dem Schrank holte und mit fliegenden Schritten aus der Küche stürzte, lag ein kämpferisches Lächeln in Albrechts Gesicht. Er bemerkte gar nicht die gaffenden Blicke der Kollegenschaft und auch nicht, dass sich der Maître de Cuisine mit dem Zeigefinger an die Stirn tippte.
6
Er zog die Handbremse an und warf hinter sich die Autotür zu. Benjamin Felder schritt langsam über den Parkplatz auf das hell erleuchtete Gebäude des Steyrtalerhofes zu. Er hatte Bauchschmerzen, sein Gaumen war trocken und die Hände schwitzten. Er rieb seine Handflächen an seiner Hose. Durch die breite Fensterfront konnte er in den Speisesaal blicken. In seiner Kindheit war er gelegentlich hier zum Essen gewesen, da war der Steyrtalerhof ein Gasthaus der gehobenen Klasse gewesen, noch kein schicker Gourmettempel. Benjamin hatte extra für den Anlass sein Hemd gebügelt und ein Sakko angezogen. Er biss die Zähne zusammen. Keine Chance, die Angelegenheit zu verschieben oder gar zu vergessen, er musste hier durch.
Benjamin trat ein und wurde vom Empfangschef begrüßt. Er wurde befragt, ob er einen Tisch reserviert habe und ob er allein zu speisen gedenke. Mit dem Hinweis, der Sohn von Herrn Felder zu sein und nur etwas Persönliches mit seinem Vater besprechen zu wollen, wurde er mit einer Verbeugung eingelassen, nicht ohne einen Begrüßungstrunk offeriert zu bekommen. Gut gekühlter Schilcherol mit einer Zitronenscheibe. Benjamin nippte nur am Glas.
Die Abendgesellschaft saß gerade bei der Suppe. Benjamin stellte sich an die hintere Bar des weitläufigen Saals und ließ den Blick kreisen. Sehr stilvoll, das musste er zugeben, die Renovierung des Gasthofes war wirklich von kundiger Hand durchgeführt worden, hier war ein einfallsreicher Innenarchitekt am Werke gewesen. Was die Arbeiten allerdings gekostet haben mochten, wagte sich Benjamin nicht vorzustellen.
Er sah seinen Vater an einem der Tische sitzen, die Suppe löffeln, plaudern, lachen. Zwei Frauen und acht Männer saßen an diesem Tisch. Zweifellos die wichtigsten Geschäftspartner seines Vaters. Natürlich war die Sitzordnung hierarchisch abgestimmt. Am Tisch des Wirtschaftskapitäns saßen ebenfalls nur Wirtschaftskapitäne. Benjamin war mit einem kühlen Kalkül hierhergekommen. Hier, inmitten seiner Gäste, würde sein Vater, anders als in seinem Büro oder in der Villa, das Anliegen seines Sohnes nicht lautstark abschmettern können. Nun, er würde natürlich ablehnen können, aber immerhin nicht laut. Benjamin wartete, bis das Personal die Suppenteller abserviert hatte. Sollte er hinübergehen? Sich in die Abendgesellschaft mischen? Sollte er einen Kellner bitten, eine Botschaft zu überbringen?
Herbert Felder entdeckte seinen Sohn. Für einen Moment fror sein Lächeln ein, dann wandte er sich wieder seinem Geschäftspartner zu und lauschte dessen Ausführungen. Er lachte zu der Pointe, der ganze Tisch lachte. Die Kellnerin ging herum und füllte die Weingläser. Auch Herbert Felder ließ sich einschenken. Er entschuldigte sich bei seinen Gästen für einen Moment, erhob sich und marschierte geradewegs auf die Toilette.
Benjamin Felder nahm nun doch einen tiefen Schluck aus seinem Glas. Er wartete. Nervös. Verspannt. Hätte er vielleicht doch im Büro vorstellig werden sollen? Sollte er die Sache abblasen und einen zweiten Anlauf nehmen? Im vorderen Teil des Restaurants saßen die normalen Abendgäste an den Tischen, plauderten, dinierten, tranken, der hintere Teil war der Abendgesellschaft vorbehalten. Was hatte er in diesem Lokal eigentlich zu suchen? Nichts. Die Welt der Reichen und Schönen war nicht seine Welt, war sie nie gewesen, und er war froh, nicht ein Teil dieser Welt geworden zu sein.
»Schau an, schau an, mein Sohn lässt sich also wieder einmal blicken.«
Die tiefe, immer irgendwie grantig klingende Stimme seines Vaters riss Benjamin aus seiner Grübelei.
»Willst du einen Teller Suppe herausschinden? Oder mir die Laune verderben?«
Die Augen der beiden Männer trafen sich. Da war sie wieder, diese alte Distanz, dieses Fremdsein zwischen Vater und Sohn, so, als ob die letzten fünfzehn Jahre nicht existiert hätten.
»Guten Abend, Papa.«
»Bist du wegen mir hier? Oder bist du mit deiner neuen Flamme zum Abendessen gekommen und stehst nur zufälligerweise wie bestellt und nicht abgeholt hier an der Bar herum, weil dein Mädchen sich einen anderen aufgegabelt hat? Vielleicht einen echten Kerl zur Abwechslung, keinen Jammerlappen.«
Benjamin Felder schluckte, versuchte den süffisanten Tonfall seines Vaters zu ignorieren. Er durfte die Feindseligkeit nicht an sich heranlassen, er musste in der Rüstung, die er angelegt hatte, den Hieben trotzen, er musste vorankommen. »Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Papa.«
»Gut schaust du aus, Benjamin. Du heulst heute gar nicht. Gefällt mir. Und, hast du einen Job?«
»Ja. Mein zweites Schuljahr hat begonnen.«
»Bravo. Hast du also diese Dingsbumsakademie geschafft. Respekt. Du arbeitest doch mit Türken- und Zigeunerkindern? Habe ich das richtig in Erinnerung?«
»Es ist eine Integrationsklasse. Ich arbeite mit lernschwachen Kindern mit Migrationshintergrund der Sekundarstufe, um genau zu sein.«
»Was der Blödsinn auch immer heißen mag. Wahrscheinlich bist du total glücklich mit diesem Job, nicht wahr?«
»Allerdings. Es ist eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe. Und mit etwas Mühe kann ich die Lebenschancen zumindest einiger Kinder erheblich verbessern.«
Herbert Felder lachte dröhnend. »Mein Sohn, der Weltverbesserer! Wenn du nicht meiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten wärst, hätte ich gesagt, dass du nicht von mir sein kannst, dass dich deine Frau Mama vom Briefträger, Gärtner oder Gemüsehändler eingefangen hat. Lehrer für Zigeunerkinder. Nicht zu fassen.«
Herbert Felders Lachen verstummte so schnell, wie es gekommen war. Er schaute kurz hinüber in den hinteren Teil des Speisesaals zu seinen Gästen, stemmte seine schweren Fäuste in die Hüften und hob seine breiten Schultern. »Also, wie viel willst du?«
Der Vater fasste seinen Sohn mit harter Miene in den Blick. »Denn wegen des Geldes bist du ja gekommen.«
Benjamin Felder schluckte. »Einhundertachtzigtausend Euro.«
Herbert Felder verzog anerkennend seinen Mund. »Na, zum Glück raubst du meine Zeit nicht wegen ein paar Groschen. Einhundertachtzigtausend, das ist dann schon ordentlich. Willst du einen Ferrari kaufen? Eine Motoryacht? Willst du im Obdachlosenasyl der Spender des Jahrzehnts werden?«
Benjamin Felder griff in die Innentasche seines Sakkos und zog die vorbereiteten Papiere heraus. Zuerst reichte er seinem Vater eine farbige Infobroschüre. »Du kennst vielleicht das Pflegeheim in Bad Hall. Es bietet die besten Bedingungen für eine umfassende Pflege und ausgezeichnete ärztliche Kontrolle. Die sind spezialisiert auf Parkinsonkranke, auf Alzheimerpatienten, auf Menschen mit Multipler Sklerose. Die haben dort auch eine geriatrische Abteilung. Allerdings ist das ein privat geführtes Haus. Man kriegt öffentliche Zuschüsse, aber ein Selbstbehalt ist von den Patienten oder deren Angehörigen zu leisten.«
Herbert Felder blätterte die Infobroschüre durch. »Ist es also schlimmer geworden?«
Benjamin sah die Eindrücke des heutigen Nachmittags wieder vor sich. Hörte die Worte des Arztes. Sah die Augen seiner Mutter. »Die Multiple Sklerose ist jetzt in einem fortgeschrittenen Stadium. Der Oberarzt im Krankenhaus hat, nachdem ich nachgebohrt habe, gemeint, dass die Wahrscheinlichkeit, dass meine Mutter, deine Exfrau, in zehn Jahren noch leben wird, gleich null ist. Deswegen das Pflegeheim. Deswegen das Geld. Der Selbstbehalt beträgt pro Jahr achtzehntausend Euro. Mal zehn sind das die einhundertachtzigtausend.«
Benjamin Felder nahm nun ein Papier aus einem Kuvert und präsentierte es seinem Vater.
»Wenn du diesen Vertrag unterzeichnest, wird das Geld auf ein Treuhandkonto gelegt, das von Notar Vinzenz Baumann in Steyr verwaltet wird. Der Notar erledigt die Zahlungen an das Pflegeheim. Sollte Mama früher sterben, wird der Restbetrag an dich zurückgegeben. Sollte sie länger als zehn Jahre leben, werden weitere Kosten an dich verrechnet. Die Gebühren für den Notar bitte ich dich auch zu übernehmen.«
Herbert Felder nahm das Papier und warf einen Blick darauf. »Du hast dir das ja gut überlegt.«
»Papa, ich bin vielleicht nicht zum Großunternehmer geeignet, bei mir reicht es halt nur zum Weltverbesserer, das heißt aber nicht, dass ich ungeschickt oder gar blöd bin.«
Herbert Felder las den Vertrag schnell durch. Benjamin wartete.
»Du kannst die Angelegenheit in zwei Hinsichten sehen. Erstens. Du kannst für die Frau, die du in jungen Jahren geliebt hast, mit der du ein Heim gegründet hast, mit der du ein Kind in die Welt gesetzt hast und die unheilbar krank ist, einen würdevollen und medizinisch optimal betreuten letzten Lebensabschnitt schaffen.«
Vater und Sohn blickten einander an.
»Oder zweitens. Du kannst um einhundertachtzigtausend Euro, ich habe noch deine Worte im Ohr, den stinkenden Kadaver dieses blöden Trampels ein für alle Mal aus deinem Leben schaffen.«
Benjamin Felder griff in die Brusttasche seines Sakkos. »Ich habe sogar an eine Füllfeder gedacht.«
7
Christina stieg aus der Duschkabine und wickelte das Badetuch um ihren Körper. Die Fahrt vom Schießplatz der Polizei bis nach Hause hatte sich gezogen, knapp zehn Kilometer war sie im Schneckentempo über die Bundesstraße gekrochen. Die Bausaison neigte sich Ende September langsam dem Ende zu, da wurden noch einmal alle Kräfte mobilisiert, um das Straßennetz auszubessern, und Freitagnachmittag spielte der Berufsverkehr vor dem nahenden Wochenende alle Stücke. Wilhelm war schon zu Hause gewesen, als sie angekommen war, und hatte ein kleines Abendessen in Arbeit gehabt. Penne mit Gorgonzola, dazu grüner Salat, ein Gericht, das er immer wieder gerne auftischte, einerseits weil es seine knappen Zeitressourcen nicht zu sehr in Anspruch nahm, andererseits weil er es wirklich köstlich zuzubereiten in der Lage war. Sie hatten gegessen, über den in den Abend versickernden Arbeitstag geplaudert, Wilhelm hatte mit dem Hinweis, noch eine Kleinigkeit erledigen zu müssen, sich in sein Arbeitszimmer begeben und Christina hatte eine ausgiebige Dusche genommen.
Sie huschte barfuß in die Küche, griff in den Schrank nach einer Weinflasche, inspizierte das Etikett und setzte den Korkenzieher an. Langsam schwenkte sie den Rotwein im Glas, roch daran und ließ einen Tropfen über ihre Zunge rollen. Genau das Richtige für diesen Abend, ein gehaltvoller Raboso aus dem Veneto, der nach Sommer und Sonne schmeckte. Sie füllte ihr Glas.
»Willi, willst du auch einen Schluck Rotwein?«, rief sie in die geräumige Wohnung.
Christina wartete vergeblich auf eine Antwort. Sie verzog ihre Miene. Wilhelm immer mit seiner Arbeit, es war ein Jammer. Sie nahm das Glas, öffnete das Fenster und blickte hinunter in die von den Straßenlichtern durchbrochene Dunkelheit über der Enns und der Steyr. Langsam nippte sie am Glas, dachte an gar nichts Besonderes, ließ einfach nur das ferne Tosen der ineinanderfließenden Flüsse auf sich wirken. Genau wegen dieses Fensters, genau wegen dieses Ausblicks auf die Wassermassen der Flüsse hatte sie sich für diese Wohnung im Stadtteil Ennsdorf entschieden. Wasser war der Ursprung allen Lebens, fließendes Wasser trug seinen elementaren Grund in der Zeit, Flüsse gebaren Hoffnung, Liebe und Vergänglichkeit, gaben in ihrer beständigen Bewegung Anlass zu Zuversicht, und traten sie über die Ufer, brachten sie die Angst. Christina fühlte sich, wenn sie längere Zeit an ihrem Küchenfenster stand und auf die wasserreiche Enns und die kristallklare Steyr hinabsah, wie ein Brunnen, dem es vergönnt war, einige Augenblicke das Wasser der Flüsse in sich zu tragen. Wasser, oder den Wein.
Sie leerte das Glas und schaute auf die Uhr. Nun, der Abend lief dahin, aber noch nicht ganz so, wie sie sich das gedacht hatte. Sie musste zur Tat schreiten, also schloss sie das Fenster, füllte noch einen Schluck Wein ins Glas und marschierte in das Vorzimmer zum Spiegel. Sie knipste die Lampen an, stellte sich vor den Spiegel, streifte das Badetuch ab und drehte sich nackt vor dem Spiegel. Regelmäßiger Sport machte sich für Frauen, die langsam, aber unaufhaltsam auf die vierzig zuliefen, bezahlt. Sie wog vielleicht drei, höchstens vier Kilogramm mehr als vor fünfzehn Jahren. Christina lugte durch die offen stehende Tür in Wilhelms Arbeitszimmer, sah das Laptop und ihren konzentriert davor kauernden Mann. So konnte das nicht weitergehen, also nahm sie die Bürste und strich sich durch das Haar, ein glockenhelles Liedchen trällernd.
Und es dauerte gar nicht lange, bis sie durch den Spiegel sah, dass Wilhelm mit verschränkten Armen im Türstock stand und keck lächelte. Wie überrascht hielt sie inne und schaute über ihre Schulter. »Gibt es da etwas zu gaffen?«
Wilhelm nickte entschieden. »Allerdings.«
»Musst du nicht deine total wichtige Arbeit erledigen, am Freitagabend um halb neun?«
»Der Akku meines Laptops war ganz plötzlich leer und ich habe zufälligerweise das Netzkabel im Büro vergessen.«
»So ein Pech aber auch.«
»Immerhin konnte ich noch vor dem Systemabsturz die Dateien speichern.«
»Na, Glück muss man haben.«
Wilhelm trat an Christina heran und umfasste sie von hinten. Durch den Spiegel schauten sie einander in die Augen. »Ich sehe, du bist beim Wein angelangt, meine singende Abendfee?«
»Ich habe dich gefragt, ob du auch ein Glas willst, aber offenbar waren deine Ohren gerade etwas verlegt. Macht wohl der Elektrosmog.«
Wilhelm ließ seine Handflächen über ihre Haut streichen, tastete nach ihren Brüsten, knabberte an ihrem Nacken. »Du hast recht, meine Liebe, wie so oft, der Elektrosmog macht nur Umstände. Also wenden wir uns dem Rotwein und Kerzenlicht zu.«
Christina rieb ihr Gesäß an seinem Becken. »Wilhelm, du immer mit deinen Ideen.«
8
Albrecht nippte an seinem Glas. Die kühle Abendluft und die feinherbe Note des südsteirischen Weißburgunders taten ihm gut. Eine passable Wahl, wie Albrecht fand. Er schaute in den finsteren Himmel hoch. Obwohl sich eine wolkenlose Neumondnacht über ihn erstreckte, sah er von den Milliarden Sternen kaum etwas. Im Umkreis eines in Kunstlicht gegossenen Gebäudes war das Beobachten von Sternen eine vergebliche Mühe, also lauschte Albrecht den in einem leisen Lüftchen raschelnden Kastanienbäumen. Ein beruhigender Klang, der für einen Augenblick die mühselige Plackerei der letzten Stunden vergessen machte. Nun, er hatte das Menschenmögliche getan, so wie Wendelin ihn gebeten hatte, die Teller waren serviert worden, die Gäste widmeten sich dem Hauptgericht, damit lag das Gelingen des Abends nicht mehr in seiner Hand. Er hoffte das Beste. Ein paar Minuten Auszeit am Hinterausgang hatte er sich genommen und einen Tropfen des Weines. Zu viel durfte er nicht trinken, denn einerseits war der Arbeitstag noch lange nicht beendet, zum anderen musste er nach Dienstschluss seinen Motorroller sicher die paar Kilometer nach Hause lenken können.
Er blickte hinüber zu den Lichtern der unweit gelegenen Wallfahrtskirche Christkindl. Unwillkürlich musste er schmunzeln. Er hatte die ersten dreiundzwanzig Jahre seines Lebens in Steyr gelebt, daher kam ihm der Ortsname Christkindl nicht merkwürdig vor, aber seine Kinder, die vor einem Jahr zum allerersten Mal in Steyr zu Besuch gewesen waren, hatten wegen des Namens gekichert. Wohnt hier das Christkind? Hat das Christkind hier seine Geschenkfabrik? Können wir hier mit dem Christkind mal ein ernstes Wörtchen reden? Diese und ähnlich alberne Fragen hatten sie gestellt. Wobei die kleine Sofie diese Fragen nicht albern gefunden hatte, sondern im Gegenteil den spöttischen Tonfall der älteren Geschwister. In Sichtweite der Wallfahrtskirche lag der Steyrtalerhof, ein altehrwürdiges Gebäude und seit zwei Jahrhunderten eine Gaststätte, welche vor Kurzem generalsaniert und somit für die nächsten Jahrzehnte nutzbar gemacht worden war. Es war natürlich ein Glücksfall gewesen, dass Albrecht nicht lange nach einem adäquaten Arbeitsplatz hatte suchen müssen. Wendelin und er hatten sich schnell geeinigt. Natürlich lag sein Gehalt hier weit unter jenem, welches er in Genf erhalten hatte, einerseits lag das Lohnniveau in Österreich generell unter jenem der Schweiz, und andererseits verkehrten im Steyrtalerhof die Einwohner einer zwar wohlhabenden, dennoch aber überschaubaren Provinzstadt, während an seiner letzten Arbeitsstelle am Genfer See Diplomaten und Geschäftsleute aus aller Welt dinierten. Albrecht hatte das Gehalt und die Arbeitsbedingungen schnell akzeptiert und war mit seiner Familie übersiedelt. Zum Glück sprachen seine Kinder fast ebenso gut Deutsch wie Französisch. Es war ihm ein Herzensanliegen gewesen, ihnen seine Muttersprache beizubringen, und Chantal hatte ihn diesbezüglich tatkräftig unterstützt.
»Albrecht? Ah, da bist du ja.«
Albrecht schrak aus seinen Gedanken hoch und blickte zur Hintertür. Wendelin Sattler winkte ihm.
»Ich habe dich schon gesucht. Komm doch bitte mal herein. Die Gäste fragen nach dir.«
Ein bitterer Geschmack lag plötzlich auf seiner Zunge. Er eilte auf Wendelin zu. »Die Gäste? Merde! Gibt es viele Beschwerden? Ich habe getan, was ich konnte, ich habe sogar den ersten Sud ausgegossen, aber …«
Wendelin Sattler legte seine Hand auf Albrechts Schulter und schob ihn voran durch die Tür. »Halt die Luft an und komm mit.«
Albrecht stellte das Weinglas ab, zu zweit durchquerten sie die Küche, gefolgt von den Augen der Kollegen. Albrecht erwischte einen flüchtigen, irgendwie merkwürdigen Blick des Maître. Wendelin marschierte mit schnellen Schritten voran. Sie traten in den Speisesaal. Albrecht wurde von der brodelnden Menge beinahe umgeworfen. Applaus brandete ihm entgegen. Der Directeur trat mit breitem Lächeln auf Albrecht zu, schüttelte seine Hand, legte seinen Arm um die Schulter des Souschefs und präsentierte ihn wie eine kostbare Trophäe. Er winkte um Ruhe.
»Liebe Freunde«, posaunte Herbert Felder, »hier unser Küchenchef, dem wir dieses hervorragende Steirische Wurzelfleisch zu verdanken haben. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und einen internationalen Spitzenkoch, der in den besten Restaurants Frankreichs gearbeitet hat, hierher an den Steyrtalerhof gebracht. Ein Prosit auf die Küche!«
Albrecht schluckte den Knödel im Hals mühsam hinunter und legte ein professionelles Lächeln auf. Er mochte solche Inszenierungen nicht. Im Laufe der Zeit hatte er einige Köche kennengelernt, die dieses Theater liebten und nur deswegen zu Spitzenleistungen aufliefen, er stand nicht gern im Rampenlicht, er stand lieber am Herd. Albrecht schüttelte viele Hände, nahm Komplimente entgegen, grinste bemüht in Fotoapparate, musste immer wieder mit dem Weinglas anstoßen und hütete sich redlich, zu viel Wein zu trinken. Der Motorroller. Betrunken mit dem Auto zu fahren, war für die anderen Verkehrsteilnehmer gefährlich, betrunken Motorrad zu fahren, in erster Linie für den Fahrer selbst. Nach und nach verebbte das Interesse an ihm und Albrecht konnte sich zurückziehen. Wesentlich mehr Männer als Frauen befanden sich in dieser Gesellschaft, und viele von ihnen waren dem südsteirischen Weißwein mehr als auffällig zugetan.
Noch bevor er durch die Personaltür entschwinden konnte, fasste ihn jemand von hinten am Oberarm und hielt ihn zurück.
»Na, Maestro, so schlecht war also die Schweineschulter doch nicht«, brummte der Directeur düster.
Albrecht dachte an die knifflige Arbeit der letzten vier Stunden. Er konnte diesen Mann nicht leiden. Und auch nicht seine Gäste, die wegen eines mäßigen Tellers ein solches Aufheben machten. Albrecht schüttelte die Hand des Directeurs brüsk ab. Das war kein Mann der Gastronomie, das war ein Geschäftemacher. »Wir haben Glück gehabt, Monsieur le Directeur.«
Herbert Felder trat nahe an Albrecht heran. Seine Fahne war unverkennbar, der Weißwein also. »Sie haben Glück gehabt, Kammerhofer. Nur Sie.«
Damit stapfte Felder davon und mischte sich scherzend und lautstark lachend unter seine Gäste.
9
Sie hob das Zeichenblatt hoch, blies den Kohlestaub fort und betrachtete das Bild. Gelungen. Vielleicht kein Meisterwerk, aber allemal gelungen, und nicht jeden Tag fielen das Handwerk, die Vorstellungskraft, die Inspiration, die innere Ruhe und Ausgeglichenheit in eine so vollkommene Harmonie, dass ein Meisterwerk zustande kam, manchmal musste und konnte sie sich auch mit einem gelungenen Bild zufriedengeben. Befand sich ein Bild auf dem Wege des Misslingens oder war es bereits gescheitert, so zögerte Selma Felder keinen Augenblick, es zu vernichten. Manchmal fand wochenlang kein Bild Zugang zu ihrer Sammlung, dann wieder zeichnete sie täglich Bilder, die ihren strengen Kriterien der Meisterschaft sehr nahe kamen oder diese gar erreichten.
Selma wiegte den Kopf. Dieses Bild durfte in die Sammlung, auch wenn es keine Glanzleistung darstellte. Berge, immer Berge, sie liebte die Berge und zeichnete sie, ausnahmslos, jedes ihrer Bilder zeigte Berge. Manche Höhenlinien erfand sie, manche malte sie vor der Kulisse echter Berge, manche aus dem Gedächtnis. Insbesondere der Bosruck hatte es ihr angetan. Die auffälligen Spitzen der Große Phyrgas und der beiden Prielgipfel fand sie zu aufreizend, zu gefällig, fast anbiedernd, der wuchtige Buckel des Warschenecks und vor allem der schroffe Grat des Bosrucks waren ihre Lieblingsmotive. Sie hatte viele Male diese beiden Berge aus den verschiedensten Perspektiven gezeichnet. Beim Gipfelkreuz des Bosrucks zu sitzen und mit dem Kohlestift die Felsen und die jähen Stürze zu porträtieren, war eine Tätigkeit, die sie in eine andere Zeit und eine andere Welt versetzte. Nichts liebte Selma Felder mehr als die Berge des Toten Gebirges, egal, ob sie in Bergsteigerschuhen Grate erstieg oder in ihrem Atelier auf dem Malschemel saß, egal ob ihr Höhenwinde um die Ohren pfiffen oder ob sie Kräutertee in der Stille ihres Refugiums in der Villa schlürfte.
Selma legte das Zeichenblatt sorgsam in die Mappe, trat an die Spüle in ihrem Atelier und wusch ihre Hände. Genug für heute, eine gelungene Zeichnung an einem Abend war ohnedies eine Leistung, mit der sie zufrieden sein konnte. Sie gähnte und sortierte die Zeichenutensilien auf dem Werktisch. Sie blickte auf die Uhr. Halb elf Uhr abends in der Neumondnacht. Zeit zu schlafen. Herbert hatte wieder Verpflichtungen, die den ganzen Abend seine Anwesenheit banden, sie würde, wie häufig, nicht auf ihn warten, sondern sich in ihrem Atelierzimmer zu Bett legen.
Selma ging in das Bad, nahm aus dem Schrank eine ihrer Pillen und putzte danach die Zähne. Wie müde sie war.
Beim Frühstück würde sie Herbert nach dem Verlauf der Abendgesellschaft im Steyrtalerhof befragen. Er erzählte ihr gerne von seinen Konferenzen und Gesellschaften, von seinen Erfolgen, von den Risiken seiner Geschäfte, von den Männern, mit denen er handelseinig geworden, und von jenen, mit denen dies nicht gelungen war. Sie selbst erzählte sehr wenig von ihrer Arbeit und den entstandenen Bildern. Herbert hatte nie eine besondere Nähe zu ihren künstlerischen Arbeiten entwickelt. Das nahm sie ihm nicht übel, im Gegenteil sogar, Herbert war kein Künstler, ja, nicht einmal kunstsinnig, Herbert war ein Mann der Tat, ein Mann, der das Leben meisterte, der anderen voranging und ihnen den Weg wies. Dafür liebte und bewunderte sie ihn. Die Künstler hatten und machten zu viele Probleme, das hatte Selma während der Zeit ihres Kunststudiums in Wien leidvoll erfahren. So wie Selma es empfand, stärkte es gerade ihre Ehe, dass sich manche ihrer Lebensbereiche nicht deckten und sich auf diese Art Freiräume eröffneten, denn der Bund, in dem sie sich trafen und in dem sich ihre Lebensläufe ehelich verschränkten, war unauflöslich und beständig.
Mit einem Lächeln auf den Lippen knipste Selma Felder das Licht in ihrem Zimmer aus.