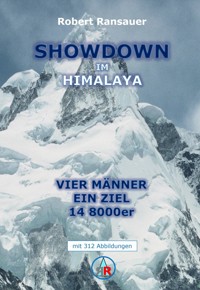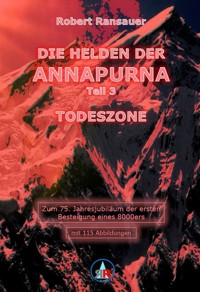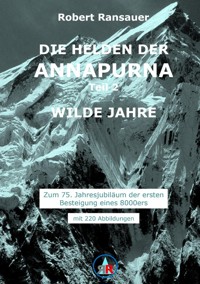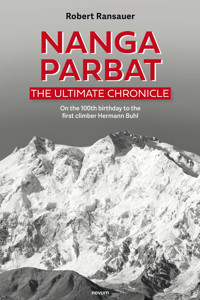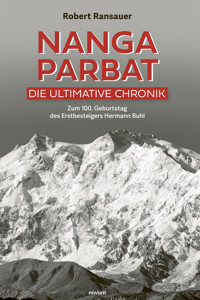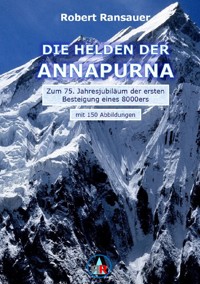
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Annapurna I, mit einer Höhe von 8091 m der zehnhöchste Berg unseres Planeten, gilt als die Wiege der 8000er-Erstbesteigungen. Am 3. Juni 2025 jährt sich dieses Ereignis zum 75. Mal. Eine französische Expedition schrieb Alpingeschichte und löste damit einen Run auf alle Gebirgsriesen im Himalaya aus. Binnen eineinhalb Jahrzehnten waren alle 8000er bestiegen. Dieses Buch erzählt, im Gleichschritt mit der Entstehung und Entwicklung Nepals, die Ersteigungsgeschichte dieses Himalayariesen aus längst vergessenen Tagen bis in die heutige Zeit. Die beiden ersten deutschen Expeditionen zum Berg und eine umfassende Bergsteigerbiographie des Franzosen Lionel Terray runden die Erzählung ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Ransauer
DIE HELDEN DER ANNAPURNA
ZUM 75. JAHRESJUBILÄUM DER BESTEIGUNG DES ERSTEN ACHTTAUSENDERS
Texte: © 2025 Copyright by Robert Ransauer
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright Abbildung: Alessandro Gogna. Weiterbearbeitet Robert Ransauer
Verlag:
Robert Ransauer
Leopold Stipcakgasse 9
2331 Vösendorf
Österreich
Autoren Webiste www.ransi-berge.at
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH,
Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung
Was ist eigentlich eine Heldin, ein Held?
Übernimmt man die Bezeichnung aus der Mythologie, so ist eine Heldin oder ein Held eine Person edler Herkunft, die sich durch große und kühne Taten besonders im Kampf und im Krieg ausgezeichnet hat. Um sie sind Mythen und Sagen entstanden. Man bezeichnet sie auch als die Helden des klassischen Altertums.
Übernimmt man die Bezeichnung aus dem täglichen Leben, so handelt es sich bei einer Heldin oder einem Helden um eine Person, die sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt und dabei eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihr Bewunderung und Bekanntheit einbringt. Manche opfern sich gar für andere.
Bergsteiger und Alpinisten wurden nach ihrer erfolgreichen oder auch nicht erfolgreichen Heimkehr ihrer zum Teil halsbrecherischen Expeditionen zu den höchsten Bergen der Welt als Helden gefeiert.
Dieses Buch handelt von Helden. Von Männern, die sich einer apokalyptischen Atmosphäre über 8000 m Höhe unerschrocken entgegenstemmten und außeralltägliche Leistungen vollbrachten. Die ihr Leben für einige Zeit in eine Zone des Todes verlagerten, um ihren großen Lebenstraum zu verwirklichen. Am Gipfel eines 8000ers zu stehen.
Furchtlos, tollkühn, draufgängerisch, risikobereit, belastbar und verwegen,
‚Die Helden der Annapurna‘
Vorwort:
Schon knapp vor Fertigstellung meines ersten Buches über den Nanga Parbat habe ich mich in meinen Gedanken damit beschäftigt, ob ich nicht noch ein zweites Buch über einen 8000er folgen lassen sollte. Denn das erste Buch hatte einfach zu viel Spaß gemacht. Nicht nur das Schreiben selbst. Sondern vor allem das Recherchieren nach Informationen über die Geschichte des Alpinismus, der Berge, der Bergsteiger und das Allerlei rund um dieses Themengebiet. Der Kontakt mit berühmten und bekannten Alpinisten war spannend und hat mein Buch inhaltlich und vor allem mit tollen Bildern bereichert. Also war die Devise, dem ersten Buch ein zweites folgen zu lassen. Obwohl das Befassen mit der Materie für mich eine sinnvolle und kurzweilige Beschäftigungstherapie ist, musste ich weitere Monate, gerne betriebenen Aufwand, einkalkulieren. Mit großer Freude bin ich daher an die Arbeit gegangen.
Der Nanga Parbat befindet sich im Karakorum-Gebirge. Ich wollte meinen nächsten 8000er aus jenem Repertoire von Bergen wählen, die in Nepal stehen. Die Auswahl an 8000ern ist ja dort nicht gerade klein. Auch noch acht an der Zahl. Meine Wahl fiel auf die Annapurna, den zehnt höchsten aller 8000er. Der Berg war der erste 8000er, der erstiegen wurde. Von Franzosen in den Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkrieges. Auch nicht so selbstverständlich, wenn man weiß, dass vor allem Briten, Deutsche und Italiener diejenigen waren, die bereits in den 1920er- und 1930er-Jahren intensiv Erfahrung im Himalaya gesammelt hatten. Nur wenige werden wissen, dass es auch Frankreich in den 1930er Jahren einmal versuchte. Aufregend auch deshalb, weil sich die Franzosen als Entdecker erweisen mussten. Was wusste man denn eigentlich im Jahr 1950 über Nepal, über die Annapurna? Oder wo dieser Berg überhaupt steht? Man wusste nichts außer ihren Namen. Was wusste man über die Höhenkrankheit und die Akklimatisation?
Es bedurfte einiger hartgesottener Franzosen, um all das herauszufinden, die bereit und mutig genug waren, als erste Ausländer einen Schritt in Nepals unberührte und unbekannte Bergwildnis zu setzen. Die Dramaturgie dieser Besteigung war in die Geschichte menschlichen Heldentums eingegangen und wird im Ringen mit der Natur für immer unvergesslich bleiben. Ein halsbrecherisches Unternehmen mit unglaublich anstrengenden Märschen im Monsunregen, Stürmen, Problemen beim Nachschub, Auseinandersetzungen, Aussöhnungen und schrecklichen Menschenschicksalen. All das in einer Kulisse, in welcher ein Mensch eigentlich nichts zu suchen hat. In einer Höhe weit über 7000 m. In der sogenannten Todeszone.
Im Jahr 2025 jährt sich die Erstbesteigung der Annapurna am 3. Juni übrigens zum 75. Mal. Auch ein idealer Anlass, um dafür dieses Buch zu veröffentlichen.
Im Laufe der Jahrzehnte erhielt die Annapurna den Nimbus, der gefährlichste aller 8000er zu sein. Sie wies bis zuletzt die höchste Unfallrate mit tödlichem Ausgang auf. Dieser Mix aus Feierlichkeit, Erstbesteigermut, Pioniertätigkeit und Gefährlichkeit war für mich die Küche, in welcher ich diese Geschichte zubereiten wollte.
Zudem wollte ich ein interessantes Rahmenthema mit Nähe zum Genre Bergsteigen im Himalaya berücksichtigen. Dabei habe ich mich für eine Erzählung über die sagen- und legendenumwobene Entstehung und Geschichte Nepals von der Urzeit bis in die heutigen Tage als Rahmenhandlung entschieden. Hinzu kommt eine ausführliche Bergsteigerbiographie des französischen Alpinisten Lionel Terray.
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie sich von mir in die Höhe von 8000 m und darüber entführen lassen. Steigen Sie mit mir auf den ersten 8000er, der bestiegen wurde, und lernen Sie den gefährlichsten Berg der Erde aus der Nähe kennen. Steigen wir in die Wiege der 8000er-Eroberungen ein.
Einige Bilder im Buch sind nicht immer der heutigen Zeit entsprechend qualitativ illustriert. Dies liegt nicht an der Druckqualität des Buches, sondern am Alter der Fotos bzw. der Dia-Scans. Viele der Bilder stammen aus Zeiten der analogen Fotografie und Diaserstellung. Auch hatte ich die Erlaubnis, Snapshots aus Expeditionsfilmen aus der Pionierzeit als Fotos berücksichtigen zu dürfen. Diese Bilder wurden bis dato noch nie veröffentlicht. Die Qualität der Abbildungen ist daher der damaligen Zeit und der jahrzehntelangen Aufbewahrung geschuldet. Bitte um entsprechende Berücksichtigung.
Um den nostalgischen Beigeschmack bestehen zu lassen, wurden die Fotos in Schwarz/Weiß illustriert.
Ihr Autor wünscht Ihnen eine interessante Lektüre.
Zum 75. Jahresjubiläum der Erstbesteigung
der
Annapurna (8091 m)
„Was vielleicht keinen Sinn hat,
hat mitunter doch eine Bedeutung.
Das ist die einzige Rechtfertigung
eines an sich grundlosen Beginnens.“
Maurice Herzog, 1950
Erstbesteiger der Annapurna
(Annapurna, Erster Achttausender, Vorwort)
Der Grat ist schmal und messerscharf.
Der letzte Felsen ist nicht mehr weit.
Die Faust umfasst den Eispickel.
Das Steigeisen krallt sich in das knallharte Eis.
Der Sturm mit seinen schweren Stößen entblößt das Gleichgewicht.
Auf Händen und Füßen und mit letzter Kraft.
Auf allen Vieren der kleinen Gipfelfläche entgegen.
Darüber nur das Nichts eines dunkelblauen Firmaments.
Die Weite des Weltraums.
Geschafft!
Mit Willensstärke und Ausdauer –
anerzogen durch die Liebe zum Berg.
Nach tagelangen und wochenlangen Anstrengungen.
Der Gipfel wird betreten.
Der Blick in die Runde, in die Tiefe.
Gletscher, sich windend wie Schlangen.
Flüsse sich schlängelnd wie seidene Fäden.
Täler im Dunst und Nebel verschwindend.
Ein Winzling am obersten Punkt.
Am obersten Punkt eines Giganten aus Fels und Eis.
Der Winzling Mensch.
Annapurna I
Berg der Lawinen
Wiege der 8000er-Erstbesteigungen
Die vierzehn höchsten Berge der Erde:
INHALT
EINLEITUNG – DER BERG
NEPAL – ÜBER MYTHEN UND SAGEN BIS ZUM JAHR 1950
ERSTE SCHRITTE
IDEE UND VORBEREITUNG
IM UNENTDECKTEN LAND
DURCHBRUCH
STERNSTUNDE
ABSTIEG INS DESASTER
RÜCKZUG IM MONSUN
NACHBETRACHTUNG
NEPAL – DER SCHWIERIGE WEG AB DEM JAHR 1950
15 JAHRE SPÄTER
NEPAL – AB DEM JAHR 1965 BIS IN DIE GEGENWART
FACTS & FIGURES
EINLEITUNG – DER BERG
Annapurna
Geographische Koordinaten: 28° 35′ 45′′ N, 83° 49′ 12′′ O
Der Zeitunterschied zu GMT (Greenwich Mean Time) beträgt 5 Stunden
Vor weit über 100 Millionen Jahren driftete der indische Subkontinent mit einer Geschwindigkeit von etwa neun Metern pro Jahrhundert als Insel in Richtung Asiens Festland. Dabei legte er eine Entfernung von 6400 km zurück und schob sich vor 50 Millionen Jahren unter die eurasische Platte. Bis heute ganze 2000 km weit. Über Millionen Jahre hinweg erzeugte dieser Drift eine Schubkraft, die eine Masse aus Fels und Stein aus der Erde emporhob. Bis in eine Höhe von weit über acht Kilometern des heutigen Meeresspiegels bauten sich riesige Gesteinsmassen auf, die in ihrer durchschnittlichen Breite 220 km betrugen und sich über eine Länge von über 2400 km erstreckten. Es war die Geburtsstunde eines Gebirgssystems, das wir heute als den Himalaya kennen. In der deutschen Sprache übersetzt bedeutet der Name so viel wie ‚Schneewohnstätte‘. Das Massiv, sich auch heute noch um mehr als einen Zentimeter pro Jahr erhebend, erstreckt sich im Westen von Afghanistan bis nach China im Osten und ist gespickt mit unzähligen Berggipfeln jenseits der 6000 m- und 7000 m-Marke. Diese Riesen werden noch einmal von weit höheren Bergen überragt. Den höchsten Bergen der Erde. Den vierzehn 8000ern. Sie teilen sich geographisch auf drei Länder auf. Fünf von ihnen stehen im nördlichen Pakistan. Einer im südlichen China und acht verteilen sich über das nördliche Staatsgebiet von Nepal. Der Himalaya selbst wird in mehrere Einzelgebirgsketten untergliedert. Eines davon, das Annapurna Himal-Massiv, erstreckt sich über die Distrikte Kaski und Myagdi im zentralen Nepal-Himalaya. Die Bergkette umfasst über 20 Gipfel mit einer Höhe jenseits der 6900 m-Marke. Zu ihnen gehören mit der Annapurna I (8091 m) und der Annapurna II (7937 m) zwei Erhebungen, die zu den 16 höchsten Bergen der Erde zählen. Dem Hauptgipfel, der Annapurna I, ist dieses Buch gewidmet. Sie ist mit ihren 8091 m der zehnthöchste Berg des Planeten. Ihre Bezeichnung stammt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie ‚die Nahrung spendende, fürsorgende göttliche Mutter‘. ‚Anna‘ steht für ‚Nahrung‘ und ‚Purna‘ für ‚erfüllt von‘. In der hinduistischen Mythologie werden ihr Wohlstand und Ernährung zugeschrieben. Sie gilt nicht nur als Göttin des Getreides und der Fülle, sondern ist auch eine der vielen Ehefrauen des Gottes Shiva, einer der drei Hauptgottheiten des Hinduismus. In früheren nepalesischen und indischen Darstellungen ist sie kaum vertreten. Wohl ist ihr aber ein Tempel im Westen Kathmandus, einem Ort namen Asan, gewidmet. Asan ist ein zentraler Platz in der Altstadt, in der das Leben pulsiert. Die Skulptur der Göttin thront dort in rotem Gewand auf einem Lotos und ist mit einem gefüllten Topf voll Brei in einer Hand zu sehen. In der anderen Hand hält sie einen Löffel, um die Nahrung verteilen zu können. Bewacht wird sie von zwei nackten mythischen Kreaturen, die der Tradition der Newar, einem Urvolk Nepals, zuzuschreiben sind. Khyah, ein wohlgenährtes Wesen, welches seine Zunge zeigt, und Kawancha, eine skelettartige Figur. Dem Berg wurde der Name nicht durch eine einzelne Person oder einen Entdecker verabreicht, sondern entwickelte sich im Laufe der Zeit aus der kulturellen und religiösen Bedeutung für die Menschen rund um seine Region. Auf Grund der femininen Namensgebung des Berges stellte sich daher immer wieder die Frage nach dem bestimmten Artikel zum Berg Annapurna. Aufgrund seines hinduistischen göttlichen Hintergrundes lautet sie auf ‚die Annapurna‘.
Gebirgsaufbau und nähere Geographie:
Der Kernaufbau des Annapurna-Massivs sieht einen langen Rücken/Hauptkamm vor, der sich von Westen nach Osten erstreckt. Seine Masse besteht aus Eis und Fels und ist oft messerscharf, sodass man bei Besteigungen oft auf die Gratflanken ausweichen muss. Außerdem ist er extrem anfällig für Höhenstürme. Im Osten startet der Kamm bei 7000 m Höhe mit dem Lamjung Himal und führt fast 1000 m höher bis zur Annapurna II. Über die Annapurna IV senkt sich der Grat auf fast 5500 m ab, um dann zur westlich gelegenen Annapurna III steil auf über 7500 m wieder anzusteigen. Fast gleich hoch entpuppt sich die anschließende Erhebung der Gangapurna. Danach fällt der Grat wieder 500 m bis zum Gipfel des Glacier Dome ab. Als nächste Station lässt sich der Khangsar Kang erkennen. An diesem Punkt stellt der Kammverlauf eine Weiche dar. Nach Nordwesten verläuft der Grat mehrere Kilometer lang fast waagrecht in einer Höhe von stetig 7000 m und endet am Tilicho Peak in einer Höhe von 7134 m. Die Franzosen hatten an die senkrechte Mauer, die von diesem Grat nach Westen abfällt, einst den Namen ‚Grand Barriere‘ vergeben. Einst und heute galt/gilt diese Mauer als unüberwindbar. Noch weiter westlich des Tilicho Peak folgen die Gipfel der Nilgiri-Kette, mit ihrer höchsten Erhebung von über 7100 m. Der zweite Gratverlauf vom Khangsar Kang erfolgt leicht südwestlich. Im Bergsteigerkreis wird er einfach ‚Ostgrat‘ genannt. Auf seinem Weg erreicht man mit dem Annapurna Ostgipfel, Annapurna Mittelgipfel und dem Annapurna Hauptgipfel drei Erhebungen jenseits der 8000 m-Grenze. Vom Hauptgipfel senkt sich der Kamm etwa um 500 m zum Annapurna Fang. Aufgrund seines westlichen Verlaufs vom Hauptgipfel erhielt er auch den Namen ‚Südwestgrat‘. Danach biegt er nach Süden ab und senkt sich, um dann wieder auf über 7200 m zur Annapurna Süd anzusteigen.
Im Westen ist die Annapurna-Gruppe vom Kali Gandaki-Tal begrenzt, welches die Massive der Annapurna und des leicht nordwestlich gelegenen Dhaulagiri durchschneidet. Die Kali Gandaki bildet in Teilbereichen die tiefste Schlucht der Erde und misst vom Boden bis zu den höchsten Erhebungen 6000 m. Sie verläuft von Norden nach Süden und deckt mehrere Klimazonen, die in kurzen räumlichen Abständen ineinander übergehen, ab. Bedingt durch diese kurzfristigen klimatischen Veränderungen ist die Siedlungsstruktur im Kali Gandaki-Tal, ebenso wie die Vegetation und die Form der Nutzung des Landes, durch zahlreiche der Witterung bedingte Anpassungen gekennzeichnet. Zu den Hauptorten des Kali Gandaki-Tals zählen Tatopani mit seinen heißen Thermalquellen, Jomsom mit einem Flugplatz, Ghorepani mit dem bekannten ‚Poon Hill‘ und seiner Aussicht auf ein umwerfendes Bergpanorama zu jeder Tageszeit, und der Ort Lete/Ghasa, Umschlagplatz aller Expeditionen zur Annapurna und auch zum Dhaulagiri. Die nördliche und östliche Grenze zum Annapurna-Massiv verbindet das Kali Gandaki-Tal zum Manang-Tal mit seinem Hauptort Manang (3500 m). Östlich davon erhebt sich das nächste Massiv eines 8000ers, jenes des Manaslu, welches durch die Marsyangdi Khola von der Annapurna-Gruppe getrennt wird. Im Norden steigt die Kette des Damodar Himal an und grenzt Nepal von China ab. Zwischen Annapurna-Massiv und Damodar-Massiv liegt mit dem Tilicho-See (4920 m) eines der höchstgelegenen Gewässer der Erde. Die unmittelbare Verbindung zwischen Annapurna Himal und Damodar Himal stellt ausschließlich der Thorang La Pass dar. Weiter nordwestlich liegt das ehemalige Königreich Mustang, mit seinem berühmten Wallfahrtsort Muktinath.
Der Ausgangspunkt für alle Bergfahrten zur Annapurna ist die südlich der Gebirgskette gelegene Stadt Pokhara, mit über 300000 Einwohnern, die heute die zweigrößte Stadt Nepals ist. Bemerkenswert an Pokhara ist der Anstieg der Bevölkerungsdichte. Anfang 1960 zählte Pokhara nicht einmal 10000 Einwohner. Heute ist die Stadt neben der Hauptstadt Kathmandu das wichtigste Touristenzentrum. Sie ist auch der Ausgangspunkt des berühmten ‚Annapurna Circuit‘, eines Trekking-Parcours, der rund um das gesamte Annapurna-Massiv führt. Um die Strecke zu bewältigen, sind gut drei Wochen zu veranschlagen und 230 km zu bewältigen, wobei der Weg hauptsächlich durch das ‚Annapurna Conservation Area Project‘, das größte Landschaftsschutzgebiet Nepals, führt. Höchster Punkt ist der Thorang La Pass mit einer Höhe von 5416 m.
Die Annapurna hat zwei prägnante Flanken aufzuweisen. Eine nach Norden hin und eine Richtung Süden. Für Besteigungen galt auch die Nordwestflanke als große Herausforderung, wurde aber nicht oft versucht. Falls doch, dann endeten die Besteigungsversuche zumeist spektakulär.
Die Südflanke:
Die südliche Annapurna-Gruppe stürzt in ein ovales Gletscherbecken ab. Der einzige Zugang besteht von der Südseite über einen schmalen Schluchteingang. Durch diese Schlucht fließt der aus den Gletschern der Südseite entspringende Modi Kola-Fluss. Das Felsportal wird im Osten durch den Machapuchare (6997 m) und im Westen durch den Hiunchuli (6441 m) bewacht. ‚Machapuchare‘ bedeutet ‚Fischschwanz‘. Der Berg erhielt diesen Namen, weil seine Doppelspitze vom Osten betrachtet eben einem Fischschwanz ähnelt. Der Hiunchuli erhielt seinen Namen von Colonel Roberts, einem englischen Expeditionsleiter, der 1957 als erster weißer Mensch in dieses Gletscherbecken gelangte. Die Bezeichnung Hiunchuli, was so viel wie ‚Schneeberg‘ bedeutet, gab es allerdings bereits für einen anderen Berg. Im Rahmen einer deutschen Expedition in den 1960er-Jarhen wurde die Vorsilbe ‚Patal‘ hinzugesetzt. Es ist der Name des Tals, welches von diesem Berg herunterführt. Das gesamte Becken ist ringsum von steil abfallenden Felswänden eingekesselt. Wie in einer Kathedrale streben kilometerhohe Felspfeiler empor. Das Himmelszelt darüber wirkt winzig. Im Hochsommer lässt das Becken gerade einmal sieben Stunden Sonnenlicht zu. Im Norden zieht der Westgrat vom Hauptgipfel nach Westen Richtung Fang (7647 m), der seinen Namen den Engländern verdankte, die ob seiner Form in ihm den Fangzahn eines Raubtieres sahen. Vom Fang startet der Südgrat in südliche Richtung und begrenzt den Westen des Beckens mit der Annapurna Süd (auch Modi-Peak oder Ganesh, 7219 m). Auch im Norden wird das Gletscherbecken vom Hauptgipfel (8091 m) und dem nach Osten davonziehenden Ostgrat dominiert. Der Ostgrat selbst, durchgehend über 7000 m hoch, besteht aus einer Masse von Fels und Eis und ist oft messerscharf, sodass man bei Besteigungsversuchen seiner Gipfel auf die nördliche oder südliche Gratflanke ausweichen muss. Außerdem ist er bekannt für seine verheerenden Höhenstürme. Der Ostgrat trägt mit dem Roc Noir (7485 m) und im Nordosten mit dem Glacier Dome (7193 m) und der Gangapurna (7455 m) die höchsten Gipfel. Der Roc Noir oder auch ‚Schwarzer Fels‘ bekam seinen Namen von den französischen Erstbesteigern 1950, die ihn lediglich als schwarzen Fels von der Nordseite her sahen. Der Roc Noir ist eher der markante Eckpunkt des Ostgrates als ein eigener Berg. Auch der Glacier Dome erhielt seinen Namen von den Franzosen. Deshalb, weil auf seinem Gipfel eine Gletscherkuppe aufliegt. Diese bricht nach allen Seiten als Hängegletscher oder in Eisbrüchen ab. Im Osten schließt sich das Becken über die Annapurna 3 (7555 m) und das Gabelhorn (Gandharva Chuli) (6248 m) zum Machapuchare hin. Das Becken selbst ist von Norden nach Süden durch zwei Gebirgskämme dreigeteilt. Zwischen den Kämmen fließen drei Gletscher, der südliche, der westliche und der östliche Annapurna-Gletscher, direkt in die Modi Kola-Schlucht. Das Gletscherbecken selbst erreicht eine ungefähre Höhe von circa 4000 m. Im Laufe der Jahre erhielt das Becken auch den Beinamen ‚Annapurna Sanctuary‘. Deshalb, weil die dort wohnenden Ureinwohner der Gurung glauben, dass in der Umgebung Unmengen von Gold und seltene Schätze der Schlangengottheit Nagas lagern. Der Machapuchare gilt als der Sitz des Gottes Shiva, Gott der Zerstörung. Die Einheimischen sehen in den Schneewehen vom Gipfel seinen göttlichen Weihrauch. Früher durfte die Umgebung aus Aberglaube von Männern und Frauen niederer Kasten gar nicht betreten werden. Heute stehen dieser weiße, von Felsen mit Grautönen untersetzte Schneepalast und dieses heilige Märchenland für ein geschütztes Naturreservat mit einem beeindruckenden und spektakulären Bergpanorama, welches auch ‚Amphitheater der Gletscher‘ genannt wird.
Die Gipfel des Annapurna Himal werden nur sehr selten von der Südseite bestiegen. Neben den objektiven Gefahren und technischen Schwierigkeiten ist ein sehr großer Höhenunterschied von den Talsohlen bis zu den Gipfeln zu überwinden. Dazu kommt, dass die Südwände sehr überraschenden und heftigen Wetterwechseln ausgesetzt sind. Die warme, herantreibende Luft aus dem Tiefland hält an den kilometerhohen Wänden an und wird zum Aufsteigen gezwungen. Dabei kühlt sie ab, es bilden sich Wolken und Schneefall setzt ein. Oft hieß die Devise: Am Morgen Sonne und nachmittags einsetzende Niederschläge. Daher ist die Sicht auf die Bergkette vom Süden aus gesehen oft getrübt, insbesondere während der durch den Monsun entstehenden Regenfälle im Sommer. Besser sind die Verhältnisse im Spätherbst und Winter. Im Winter kommt allerdings die Absolvierung des Annapurna Circuits nicht in Frage und selten nur der Trek ins Annapurna Sanctuary.
Die Nordflanke:
Die Nordflanke und die Nordwestflanke ziehen aus einem Talkessel mehrere Tausend Meter gegen den Himmel. Begrenzt wird dieser Talkessel im Norden durch die Höhenzüge der Nilgiri und Tilicho, die in ihrer weiteren Ausdehnung nach Süden den Talkessel vom Westen begrenzen. Im Osten überragt die ‚Grand Barrier‘ das Tal. Den Gletschern der Nordseite entspringt die Miristi Kola (oder auch Nilgiri Kola), die sich in Richtung Westen über Jahrtausende hinweg durch die Berglandschaft ein Flussbett gegraben hat. Sie mündet weiter im Südwesten in den Kali Gandaki–Fluss. Die Schlucht wäre ein idealer Weg zur Nordflanke, ist aber aufgrund ihrer wilden Beschaffenheit nicht begehbar. Lediglich eine deutsche Expedition aus dem Jahr 1980 versuchte sich auf dem Rückweg durch die Schlucht und litt unter fürchterlichen Bedingungen. Wer in frühen Jahren zur Nordwand wollte, musste daher einen langen Anmarsch in Kauf nehmen, der je nach Witterungsverhältnissen und Schneelage elf bis vierzehn Tage in Anspruch nahm. War der Weg von der Stadt Pokhara durch das Kali Gandaki-Tal noch relativ harmlos, so hatte es der Weg ab Lete in sich. Zuerst durch dschungelähnliches Waldgebiet und extrem steile Grashänge schlängelten sich die Pfade auf Pässe jenseits der 4000 m empor, allen voran der Thulobugin-Pass. Durch hohe Passagen und kaum zu überwindende Felsabschnitte bricht der Pfad in weiterer Folge 2000 m bis in die Miristi Kola-Schlucht ab und mündet in Areale unterhalb der Nordwestflanke, bevor es über Gletschermoränen Richtung Nordflanke geht. Heute geht keiner mehr zu Fuß zur Nordflanke. Per Helikopter werden die Bergsteiger zumeist aus Jonsom oder aus Pokhara zum Basislager geflogen.
Die Nordwand ist bekannt für ihre vielfachen Lawinenabgänge großen Ausmaßes. Es gibt Tage, an denen die Lawinen im 20-Minuten-Takt von den hohen Regionen des Berges abgehen. Bedingt durch oft kombiniertes Gelände sind die Aufstiegsrouten auch vielfach Steinschlag ausgesetzt. Seracs behindern in hohem Ausmaß die Wege der Bergsteiger und müssen rasch unterquert werden, damit man nicht von einem kollabierenden Serac erfasst wird. Ansonsten zieren Eisbrüche, versteckte Gletscherspalten und senkrechte Eiswände die Routen. Die Erstbesteiger wählten vor allem aus Mangel an Zeit eine gefährliche Route bis zum Gipfel. Eine Linie, die stark lawinengefährdet ist. Erst Jahrzehnte später gelang einer holländischen Expedition der Durchbruch über eine markante Rippe östlich der Erstbesteigerroute. Sie führt direkt hinauf zum Gletscher im oberen Bereich der Nordflanke und erscheint sicherer als die Route der Erstbesteiger, da die Lawinen, die den Berg hinabjagen, links und rechts der Rippe ins Tal stürzen. Einfach ist der Weg trotzdem nicht. Denn der Grat der Rippe ist messerscharf, ausgesetzt, und links und rechts brechen die Steilwände hunderte Meter ab. Außerdem stellt sie mit sehr steilen bis senkrechten Eis- und Schneepassagen wesentlich höhere Anforderungen an Bergsteiger als die Erstbesteigerroute.
Die Nordwand wird von der Nordwestwand des Berges von einem mächtigen Bergkamm getrennt. Dieser zieht aus dem Miristi Kola-Tal direkt bis zum Gifpel hoch. Die Nordwestseite ist durch einen weiteren mächtigen Grat in zwei Teile gespalten. Dieser Grat zieht ebenfalls von der Miristi Kola hoch bis zu einer Erhebung am Westgrat, die im Laufe der Zeit durch französische Expeditionen den Namen ‚Sans Nom (Namenloser Gipfel)‘ erhielt. Westlich und südlich dieses mächtigen Grats fallen die Wände des Gebirges senkrecht Tausende Meter ab.
Gefürchtet an der Nordflanke sind die Wetterumschwünge. Denn sie veranlassen kurzfristig intensive Schneemassen, die in weiterer Folge zu fatalen Lawinenabgängen führen. Die schnell umschlagenden Wetterverhältnisse und unberechenbaren Stürme haben Dutzende Bergsteiger im Laufe der Jahre ins Verderben geführt.
Geologischer Aufbau und Gletscher:
Geologisch betrachtet verfügt die Annapurna-Gruppe über einen heterogenen Aufbau. Zahlreiche Mineralieneinschlüsse sowie Gneisse und Marmor unterschiedlicher Zusammensetzung sind Kennzeichen lokaler Temperatur- und Druckunterschiede während der Gesteinsmetamorphose.
Im Annapurna Himal sind so gut wie keine Talgletscher vorhanden. Eine Vergletscherung findet man ausreichend an den Berghängen in Form von gefährlichen Hängegletschern. Der Grund hierfür sind die relativ tief gelegenen, das Massiv umgebenden Täler. Die hohen Durchschnittstemperaturen in den unteren Bereichen des Gebirges verhinderten von jeher, dass abfließendes Gletschereis sich in den Talsohlen halten konnte. Der größte Gletscher, der Südgletscher, liegt im Annapurna Sanctuary mit einer Ausdehnung von in etwa neun Kilometern.
Die wichtigsten Gipfel rund um den Hauptgipfel:
Wetterkapriolen:
Die Annapurna ist eine Teufelsküche tödlicher Faktoren. Ihr Cocktail aus blankem Eis und senkrechtem Fels, Kälte in der Nacht und Hitze am Tag, ihren plötzlichen Wetterumschwüngen, unmittelbar auftretenden Stürmen, Steinschlag und riesigen Lawinen sowie der dünnen Luft in den oberen Regionen macht das Gebirgsmassiv zu einem kaum berechenbaren Risikofaktor für Bergsteiger. Gerade auf der Südseite der Annapurna herrschen merkwürdige klimatische Verhältnisse und Gegensätze innerhalb nur weniger Kilometer vor. Dafür sorgt die sich rasch entwickelnde Höhendifferenz zwischen dem Tiefland und einer Höhe bis über 8000 m. Regelmäßig ballen sich an der Südseite des Gebirgsmassivs von April an zur Mittagszeit Kumuluswolken, die sich bis zum Abend hin in heftigen Gewittern entladen. Schnee oben und Regen in unteren Regionen. Zur Sommerzeit hin entwickeln sich diese Gewitter bereits um die Mittagszeit und prophezeien den nahenden Monsun. Wenn es Juni wird, erreicht die langsam von Südosten über Indien ziehende Monsunfront auch die Annapurna-Gruppe. Die Bergwelt wird in dicke Wolken und tiefen Neuschnee getaucht. Die ringsum liegenden Schluchten füllen sich mit Hochwasser. Lawinen donnern dann aus den Wänden auf die nur kurzen Gletscher herab. Spätestens dann müssen Expeditionen zum Berg abgeschlossen sein oder sollten erst nach Ende des Monsuns starten. Eine Regelmäßigkeit kennt das Wetter allerdings nicht. Denn manchmal verzögert sich der Monsunbeginn bis zu Beginn des Winters, oder der Winter nimmt kein Ende und der Monsun kommt früher.
Unter Extrembergsteigern gilt die Annapurna daher als unberechenbarer und schwieriger Berg. Daher zählt er zur Königsdiziplin im Höhenbergsteigen. Es gibt nicht viele, die ihn ein zweites Mal besteigen würden. Wahrscheinlich ist dies auch der Grund, dass die Annapurna der am wenigsten bestiegene 8000er ist, wohl aber der gefährlichste. Von der Erstbesteigung im Jahr 1950 bis zum Jahr 2019 gelangten 239 Expeditionen zu den Wänden des Massivs. Weniger als ein Drittel, nämlich 78, gelangten bis zum Gipfel. 296 Bergsteiger standen am höchsten Punkt. 70 Personen kamen zu Tode. Bringt man die Anzahl der Gipfelerfolge mit jenen der Verunglückten in ein mathematisches Verhältnis, so beträgt der Faktor 4,23. Das bedeutet, dass jeder vierte Gipfelerfolg ein Todesopfer forderte. Eine katastrophale Bilanz und die schlechteste unter allen 8000ern. Die Annapurna wird daher auch als der tödlichste aller Himalayariesen bezeichnet.
NEPAL – ÜBER MYTHEN UND SAGEN BIS ZUM JAHR 1950
Götter, Mythen und Legenden:
Nepal ist das Land der Heiligen und der Götter. Zutiefst verbunden mit Jahrhunderten alter Traditionen, ist es zutiefst religiös und von Sagen und Legenden beeinflusst. Eine Vielzahl von Geschichten berichten über Wunder, (Halb)Wahrheiten und übernatürliche Kräfte, die Nepal zu dem machten, was es heute ist. Noch heute ist der Alltag der Menschen von Glauben und Religion bestimmt. Eine unendliche Anzahl von Tempeln, Schreinen, Klöstern und Palästen, die das Land überziehen, zeugt von einer mythenhaften Vergangenheit. Eine dieser sagenumwobenen Erzählung handelt davon, wie alles begann.
Das Mahabharata, oder auch die große Geschichte der Bharatas, ist das bekannteste indische Epos. Man geht davon aus, dass es zwischen 400 v. Chr. und 400 n. Chr. verfasst wurde. ‚Was hier gefunden wird, kann woanders auch gefunden werden. Was hier nicht gefunden werden kann, kann nirgends gefunden werden.‘ So wird die Bedeutung des Epos, das aus einer großen Anzahl von Geschichten und unzähligen philosophischen und religiösen Parabeln besteht, mit einem einfachen Satz zusammengefasst. Der Schöpfer des Epos soll der von Mythen umgebene Weise Vyasa gewesen sein. Die Legende sagt, dass er es selbst komponiert und dem elefantenköpfigen Gott Ganesha diktiert haben soll. Das Epos besteht aus achtzehn Geschichten, so genannten Maha Puranas, die dem Hindusimus wichtig waren. Darin enthalten sind das Leben der Geschöpfe, der Tod, die Wiedergeburt, das Karma, die Rechtschaffenheit, Glück und Leid, die guten und schlechten Taten sowie Götter und Hymnen.
Eine der vielen Geschichten handelt von einer Flutsage, niedergeschrieben in der Harivamsha-Purana. Dabei spielten die drei Hauptgötter des Hinduismus eine wichtige Rolle: Brahma, das erste Lebewesen überhaupt, als Schöpfer, Vishnu als Erhalter und Shiva, der das Prinzip der Zerstörung und des Neubeginns verkörperte. Brahma hatte zwei vollkommen gleichgestellte Wesen geschaffen. Das starke, männliche Wesen erhielt den Namen Adima und das zarte, weibliche Wesen hieß er Heva. Ihren Sitz hatten die beiden im südlichen Ceylon, wo sie glücklich lebten. Doch ungleich ihrer Ahnen waren ihre Nachfahren sündig und widersprachen den göttlichen Geboten. Lediglich eine Familie hatte sich der Tugend nicht entzogen. Die Familie des Vaivasvata. Trotzdem trat der enttäuschte Shiva, Gott der Zerstörung, auf den Plan, die Schöpfung zu vernichten. Das wollte Vishnu, Gott der Erhaltung, vermeiden und die Familie Vaivasvata vor ihrem Fall bewahren. In der Gestalt eines Fisches offenbarte er sich dem im Fluss Ganges badenden Vaisvasvata. Er bat ihn, ihn vor seinen Verfolgern ins offene Meer zu retten. Der fromme Vaisvasvata hatte Mitleid und erfüllte den Wunsch des Fisches.
Dafür warnte der Fisch den Anständigen vor einer Sinflut ungeahnten Ausmaßes und bat ihn, eine Arche zu bauen und sie mit Nahrungsmitteln, Menschen, Tieren und Anbausamen jeder Art auszustatten. Als dann das Wasser vom Himmel schoss und alle Ufer verschwinden ließ und die wilden Wogen die Arche zu versenken trachteten, erschien der Fisch wieder. Er war ungeheuerlich gewachsen und versprach Vaisvasvata zu helfen. Vishnu, der Fisch, hatte eine hornartige Schwellung am Kopf. Die verwuchs er mit dem Schiffsrumpf und rettete so die Arche. Nach langer Irrfahrt und nach dem Ende der Sintflut begannen die Wassermassen abzulaufen, und die Arche machte auf dem sich zuerst zeigenden Eiland Halt. Diese Insel war der Bergrücken des heutigen Nepal-Himalaya. Den Insassen der Arche lehrte Vishnu Acker-, Haus- und Tempelbau. Dann schwamm er wieder davon. Zuvor hatte er den Überlebenden, den so genannten Brahmanen, das Geheimnis von der Erschaffung der Welt und ihren Zusammenhängen gelehrt. So hatte Vishnu in seiner Inkarnation als Fisch die Menschheit vor der Sintflut gerettet, und der erste Teil der Legende von der Entstehung des Kathmandu-Tals ist erzählt.
Das Tal war ein riesiger See, Nag Hrad genannt, der von hohen Bergen und vielen Wäldern umringt wurde. Auf seinem Grund sollen übernatürliche und dämonische Fische und Schlangen gewohnt haben. Deshalb wurde das Gebiet auch die Schlangengrube genannt. Die Wassertiere bewachten tief am Grund des Sees einen riesigen Schatz. Eines Tages besuchte den See der Buddha Vipassi, warf Lotossamen in den See und prophezeite eine heilige Stätte an genau dieser Stelle. Es vergingen Tausende Jahre. Dann erbebte die Erde, und der Samen war aufgesprungen. Mitten auf dem See wuchs ein riesiger Lotosbaum mit Pollen aus glitzernden Juwelen und riesigen goldenen Blättern. In der Mitte des Baumes leuchtete ein blau strahlendes Licht. Das Licht Swayambhu, das Selbstgeborene, strahlte mit überirdischer Weisheit und Intensität. Von überall kamen die Propheten herbei und sagten eine große Zukunft voraus. Dann priesen sie das Licht mit den Worten ‚Om mani padme hum – o du Juwel im Lotos‘.
Es vergingen Ewigkeiten, bis der Buddhaanwärter Manjushri aus China über die Schneeberge erschien, weil er von dem leuchtenden Lotos gehört hatte. Er saß auf einem der Gipfel, die den See umringten, und stellte fest, dass er zu dem Lotos nicht vordringen konnte. Nach Beratung mit der Muttergöttin Tara traf er eine rigorose Entscheidung. Er schnappte sein Schwert und schlug damit auf die südlichen Berge ein. Die Berge spalteten sich durch die Hiebe des Schwertes und das Wasser des Sees begann in den Spalten abzulaufen. Und mit dem Wasser flossen auch die Schlangen ab. Nur eine hielt Manjushri zurück. Den Schlangenkönig Karkotaka. Er überredete ihn zu bleiben und über das magische Licht und die Fruchtbarkeit des Tales zu wachen. Dafür würde er ihn zum Herren allen Reichtums des Tales machen und richtete ihm einen See ein, wo Karkotaka seine Schätze behüten konnte. Dort. Wo die Lotosblüte abgesunken war, schuf er einen Hügel und baute seinen Jüngern eine Stadt. Sie waren die ersten Newar, Ureinwohner, die noch heute das Kathmandu-Tal im Herzen Nepals bevölkern.
Noch Jahrhunderte strahlte das blaue Licht. Eines Tages kam ein buddhistischer Mönch des Weges, nahm es an sich, und versteckte es in einem Loch. Damit wollte er es vor dem sich anbahnenden Zeitalter der Sünde schützen. Das Licht verdeckte er mit einem Edelstein. Genau darüber errichtete er den Swayambhu-Stupa, nach dem Namen des Lichts. Am obersten Ende der Stupa ließ er eine goldene Spitze anbringen.
Viel später kam wieder ein Prophet mit seinen Jüngern ins Tal. Und auch ihn hatte es das Swayambhu-Licht angetan. Als er siebenhundert seiner Jünger zu Bettelmönchen weihen wollte, fand er kein Wasser vor. Also stieß er einen seiner beiden Daumen in einen Berg nördlich des Tals. Dabei erbat er vom Wassergott Ganga Devi, aus dem Loch Wasser strömen zu lassen. Das war die Geburtsstunde des heiligen Stroms Bagmati, der durch die Kerbe, welche Manjushri mit seinem Schwert einst in die südlichen Berge schlug, das Tal wieder verließ. Seitdem verehren die Menschen den größten Fluss Nepals und sein heiliges Wasser, ähnlich wie die Inder jenes des Großen Ganges. Zum Dank an den Wassergott schnitt der Prophet seinen Jüngern die Haare ab und warf sie in die Luft. Wo immer sie landeten, formten sie Bäche, die sich im Norden des Tals zu einem großen Nebenfluss des Bagmati vereinigten. Überträgt man die Legende in die Gegenwart, so handelt es sich bei dem damals entstandenen Tal um das heutige etwa 950 km2 große und 1300m hoch gelegene Kathmandu-Tal. Einer der Bergeinschnitte, der durch die Schwerthiebe des Manjushri entstand, wird als die heutige Chobar-Schlucht südwestlich der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu bezeichnet. Der See mit den Schätzen entspricht dem heutigen Taudaha-See, südwestlich der Chobar-Schlucht gelegen. Die Swayambhu-Stupa liegt heute an der westlichen Peripherie von Kathmandu und zählt zu den bedeutendsten Heiligtümern Nepals.
Auch Geologen hatten den Mythen nicht viel entgegenzusetzen. Heute weiß man, dass das Kathmandu-Tal einst ein riesengroßer See war, der vom Schmelzwasser der Berge im Norden gespeist wurde. Und da war auch noch ein Erdbeben vor mehr als 20000 Jahren. Es soll das Kathmandu-Tal im Süden vollkommen zerstört und damit das Ablaufen des Sees ermöglicht haben.
An wohl keinem anderen Ort der Welt wie im Kathmandu-Tal war und ist die Realität mit den Legenden so eng verwoben wie hier. Die Götter waren schon immer ein Teil des Tagesablaufs der Menschen. Gebetsfahnen, Gebetsmühlen, Butterlampen, Götterstatuen, Reiskörner, Gewürze und Brotfladen gehörten von Anfang an dazu. Und natürlich nicht zu vergessen die betenden Gläubigen. Gottesdienste ohne Ende. Nicht beschränkt auf einen Tag pro Woche oder nur ein Gotteshaus.
Im Kathmandu-Tal, welches heute etwa 1,5 Millionen Menschen beherbergt, thronen heute noch tausende Schreine und Tempel, ganz zu schweigen von den Altären, die in fast jedem Haus der Bevölkerung untergebracht sind. Im Herzen der Königsstädte Kathmandu, Patan und Bhatgaon gibt es heute mehr Tempel als Häuser. Immer wurden die Götter intensiv verehrt. Es verging kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo ein Fest oder eine Feierlichkeit ihnen zu Ehren stattfand. Sie wurden angebetet und verehrt, und die üppige Mythologie der Geschichte des Landes wurde weitergelebt. Die unsterblichen Götter haben Taten vollbracht, die dazu Anlass geben, dass es mehr Feste im Lande gibt, als das Jahr Tage hat. Dabei werden der Regen, die Ernte, die Berge, die Natur oder das Wohlergehen von Mensch und Tier gefeiert. Und das ist nur ein kleiner Auszug. Um die Gunst der Götter zu erwirken, ist der Bevölkerung kein Aufwand zu groß. Oft fließt Blut. Blut von Tieren, die auf grausamste Art und Weise den Göttern als Opfer dargebracht werden. Ziegen, Schafe, Hähne, Enten, Ochsen, Büffel – alles wurde und wird zu Tausenden dahingeschlachtet. Ausnahme sind Kühe, denn diese sind den Hindus heilig, seit Gott Krishna in die Obhut einer Hirtenfamilie gegeben wurde, dort mit den Milchmädchen und den Kühen aufwuchs und von ihnen ernährt wurde. Die Religion bestimmte das Leben der Nepalesen seit Menschengedenken, und von Geburt an wurden sie damit konfrontiert. Es prägte die Kunst, die Architektur der Städte und die zahllosen Zeremonien der Feste. Der Hausaltar war immer schon wichtiger als der Herd in der Küche. Dort fanden die meisten Riten des Lebenszyklus statt. Geburts- und Totenrituale, persönliche Reife, der erste Haarschnitt – für alles wurde den Göttern Dank ausgesprochen.
Aus der Steinzeit in die Neuzeit:
Funde nördlich von Kathmandu weisen darauf hin, dass das Tal in der Steinzeit, etwa 20.000 v. Chr., besiedelt war. Allerdings wiesen keine gesicherten Verbindungen der damaligen Bewohner zur späteren Bevölkerung hin. In den indischen Epen wurde der Name Nepal nie erwähnt. Lediglich im Mahabharata wird ein Land mit dem Namen ‚Kiratadesa‘ erwähnt. Es könnte sein, dass es einen Bezug zur Dynastie der ‚Kirata‘ gibt, die von etwa 700 v. Chr. bis 400 n. Chr. im Kathmandu-Tal herrschten. Die ‚Kirata‘ sollen in mehreren Einwanderungswellen das heute zentrale Nepal besiedelt haben und sind Vorgänger des Ureinwohnervolks der Newar, die im Laufe der Jahrhunderte das Kathmandu-Tal in einen kulturellen Brennpunkt verwandelten. Ebenso sollen tibetisch-mongolische Stämme über ‚das Dach der Welt‘ vom Norden wie auch indisch-arische Volksgruppen vom Süden in das heutige Nepal vorgedrungen sein und sich niedergelassen haben. Noch heute sind die Unterschiede der Rassen und ihre Gewohnheiten zwischen dem nördlichen und südlichen Teil Nepals stark ausgeprägt, während sie sich in der Mitte des Landes vermischt haben. Aus dieser Zeit ist vor allem das Volk der Newar anzuführen. Sie behaupteten, mit dem göttlichen Manjushri aus Tibet in das Kathmandu-Tal gekommen zu sein. Sie waren von kleiner und zartgliedriger Statur, und nichts wies auf ihre mongolische Herkunft hin. Dort, wo sie lebten, waren sie aufgrund der Topographie der Berge von der Außenwelt so gut wie abgeschnitten und konnten ungestört vor bösen Feinden ihre Götter zu irdischem Leben erwecken und ihren transzendenten Gedanken nachgehen. Später sollte sich daraus die kulturelle Blüte Nepals entwickeln. Die damals kleine Newar-Kolonie entpuppte sich als Schöpfer unzähliger religiöser Kunstdenkmäler.
Doch wie jede Geschichtsschreibung eines Landes beginnt diese anhand konkreter dokumentierter Ereignisse. Erstmals wurde der Name ‚Nepal‘ auf einer Säule in der Stadt Allahabad (heute: Prayagraj) im vierten Jahrhundert nach Christi erwähnt.
Unter ‚Nepala-Nripati‘ wurde das Land als lehensabhängiges Territorium an das indische Gupta-Reich geführt. Die damaligen Herrscher des Himalayalandes waren damit dem indischen Kaiser Gupta steuer- und tributpflichtig. Mit dieser Dokumentation wurde erstmals Nepals Geschichte mit jener Indiens verknüpft. Die Gupta-Dynastie war ursprünglich eine indische Fürstenfamilie, die sich in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach Christi im Nordosten Indiens, im Bereich des heutigen Bengalen, etabliert hatte. Zu ihrer Zeit erfolgte ein Aufleben des Hinduismus, und der damals dominierende Buddhismus erhielt einen neuen religiösen Wettbewerber. Einem der damaligen Könige Nepals, Hariddatta Varma, wird auch nachgesagt, dass er den Vishnuismus, einen Ableger des Hinduismus, nach Vorbild der indischen Gupta-Dynastie eingeführt haben soll. Die Brahmanen, damals wie heute Angehörige der obersten Kaste in Indien, prägten das hinduistische Ritual am Hofe des königlichen Nepals, während das Volk allerdings dem Buddhismus zugeneigt war. Ebenso wurde von Feldzügen und Eroberungen des Licchavi-Königs Manadeva I. während der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts nach Christi berichtet. Trotzdem sind die dokumentierten Überlieferungen, die zum Teil aus Inschriften auf Pfeilern und Säulen stammen, gering. Daher lässt sich auch kein genauerer geschichtlicher Überblick darstellen. Ein Ereignis ließ sich aber in die Regierungszeit Manadevas zurückführen. Der Bau der berühmten Stupa von Boudha. Um ihr Entstehen ranken sich Sagen und Märchen, aber auch eine durchaus weltliche Anschauung, welche durch das Volk der Newar auch historisch nachweisbar aufgezeichnet wurde. Es herrschte eine unglaubliche Dürreperiode. Es war nichts mehr zu ernten und auch die Wasservorräte waren versiegt. Das Volk war am Ende. Der damalige Astronom des Königshofes suchte seinen Herrscher auf und teilte ihm mit, dass ihm die Vorhersehung mitgeteilt habe, dass nur das Opfer eines edlen Menschen der Dürre ein Ende bereiten könne. Der König fasste einen Plan. Er beauftragte seinen Sohn, in der folgenden Nacht zu einem bestimmten Ort zu gehen, um den dort anwesenden Mann zu enthaupten. Der Sohn tat, wie ihm beauftragt wurde, doch mit Schrecken stellte er fest, dass der Mann, dessen Kopf er soeben abgeschlagen hatte, jener seines Vaters war. Um seine Tat zu sühnen, rief er die Götter an. Und die antworteten ihm, er solle ein Heiligtum für den Verstorbenen bauen. Der Sohn tat wieder, wie geheißen, und errichtete den Stupa von Boudha. Alles soll sich im 5. Jahrhundert abgespielt haben, was in späterer Zeit wiederum als gesicherter Ursprung erwiesen wurde. Der Stupa von Boudha ist seit 1979 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und eines der bedeutendsten Ziele buddhistischer Pilger aus Nepal und den umliegenden Himalayaregionen.
Erstmals lagen Schriften in Sanskrit ab dem 5. Jahrhundert vor. Diese Schriften gaben einen Überblick über die Herrschaftsdynastie der ‚Licchavi‘, die einen guten Überblick über das politische, gesellschaftliche und religiöse Leben der damaligen Zeit darstellen. Damals existierten zahlreiche buddhistische Gemeinschaften. Ihr Zusammenschluss hatte nicht nur spirituellen, sondern auch weltlichen Einfluss auf die damalige Zeit. Einer der Licchavi-Herrscher, König Narendradeva, der im siebten Jahrhundert regierte, übertrug ihnen die Verwaltung ihrer Gemeinschaften und auch vieler angeschlossener Dörfer und Siedlungen. Sie hatten die Erlaubnis, juristische Angelegenheiten zu regeln, Prozesse und Strafen zu verhängen. Die Gunst der Herrscher bestand darin, dass sie ihre Länder pachtfrei bearbeiten sowie Steuern eintreiben und behalten durften. Die Könige bauten auch buddhistische Gotteshäuser und Tempel bis zum Stupa, dem damals wie heute höchsten Kultobjekt. Eines dieser königlichen Geschenke war der Stupa Swayambhu, der aus der Zeit König Vrsadevas aus dem beginnenden fünften Jahrhundert stammen dürfte.
Viele Inschriften aus der Takhuri-Zeit, unter anderem von König Amsuvarman, belegen die große Bedeutung und Verehrung der Stupa während der Licchavi-Epoche. Heute ist die Bedeutung dieses buddhistischen Stupas mit jener des Shiva-Heiligtums in Pashupatinath der Brahmanen zu vergleichen.
Die Herrscherepoche der Licchavi dauerte in etwa 400 Jahre an und endete Mitte des 8. Jahrhunderts. Unter den Licchavi-Königen entwickelte sich deren Herrschaftsbereich zu einem kulturellen und wissenschaftlichen Zentrum, das auch der Religion des Buddhismus huldigte. Geprägt wurde diese Entwicklung von den damaligen Bewohnern des Kathmandu-Tals, den Newar. Sie sorgten dafür, dass erste Ansiedlungen und Landwirtschaft entstanden, und beschäftigten sich mit sakralem und profanem Skulpturen- und Gebäudebau. Darf man Historikern Glauben schenken, dann stammt auch Nepals Beitrag zur Weltarchitektur aus dieser Zeit. Die Geburtsstätte des Pagodenbaus soll im vierten Jahrhundert nach Christi ihren Anfang gefunden haben und in weiterer Folge ihren Weg bis nach China angetreten haben. Aus chinesischen Schriften ging hervor, dass nepalesische Architekten nach China gerufen wurden, um die Kunst des Pagodenbaus einzuführen. Denn die wie zerbrechliches Spielzeug aussehenden Bauten, die eigentlich jeder irdischen Statik widersprachen, entpuppten sich als kompakte Gebilde und hinterließen bei ihren Betrachtern Respekt und Anmut. Die Pagoden waren übrigens aus Holz gebaut und Sturm und Wetter ausgeliefert. Daher wurden die Nepalesen auch für die Erfinder der ‚Blitzableiter‘ gehalten. Besondere Zauberkräfte seien notwendig, um die tödlichen Blitze, die in ihrer göttlichen Anbetung für Jungfrauen gehalten wurden, von dem Holz abzuleiten. Entsprechend wurden die Blitzableiter in vielen Variationen und origineller Kreativität als verführerische Pärchen dargestellt. Sie hatten den Zweck, den ‚Jungfrauen-Blitz‘ von den Liebesspielen der Pärchen erschreckt wieder zurück in den Himmel fahren zu lassen.
Unter den Licchavi wurden auch die ersten Münzen hergestellt. Viele davon stammten aus dem Distrikt ‚Mustang‘ und ‚Gandaki‘. Kein Wunder, denn seit Jahrhunderten strömten durch Mustang und Gandaki Händlerkarawanen. Für die Händler war die Route der einzige Transhimalaya-Pfad, der eine Verbindung zwischen Tibet und Indien sicherstellte. An keiner anderen Stelle ließ sich der Himalaya einfacher durchqueren als durch die Schlucht, welche der Fluss Kali Gandaki quer durch die Himalayariesen im Laufe der Jahrhunderte grub. Im Westen begrenzt durch das weit über 8000 m hohe Dhaulagiri-Massiv und im Osten durch die ebenso hohe Gebirgskette der Annapurna-Berge, ist diese Schlucht mit einer Tiefe von 6000 m der tiefste Gebirgseinschnitt der Erde. Nördlich von Nepal, in Tibet, galten die abflusslosen Salzseen des Changthang als Quelle dafür, Salz an die südliche Seite des Himalayas zu transportieren, um Handel zu betreiben. Entgegengesetzt konnten aus Indien und Nepal Güter wie Gewürze, Stoffe und andere Güter nach Tibet gelangen. Den Durchhandel ließ sich Nepal, als Land in der Mitte, mit reichlich Zollgebühr abstatten, was zu erheblichem Wohlstand im Königreich führte. Im 7. Jahrhundert bestieg der letzte Herrscher der Licchavis, König Amsuvarman, den Thron.
Er folgte König Shiva-Deva, für den er jahrelang den Premierminister gab und der nicht ganz freiwillig wich. Das Land hatte bereits in Kunst und Wissenschaften prosperiert. Amsuvarman komplettierte den Handel und die Wirtschaft mit einem normierten Münzsystem. Das hatte sich schnell hoch bewährt und begünstigte das Kathmandu-Tal als ersten Umschlagplatz für den Handel von Tibet und Indien. Schon damals hatten die Münzen die Symbole von Sonne, Mond und eines Drachen eingraviert. Sonne und Mond befinden sich auch heute noch auf Nepals Staatsflagge. Der Handel mit Tibet wurde verstärkt und neue Waren wie Eisen, Yakwolle, Kupfer und vieles mehr fanden Austausch. Eine weitere Hochblüte der urbanen Kultur und der Künste Nepals war die Folge. Als König mit strategischem Weitblick führte er auch die erste Sanskrit-Grammatik im Reiche ein und hieß Gelehrte in seinem Land willkommen. Ihm und seinem Vorgänger Shiva Deva wird auch die Gründung der damaligen Hauptstadt, des heutigen Bhaktapur, des damaligen Kathmandu-Tals zugeschrieben. In heutigen Inschriften ist nachzulesen, dass sie als gut entwickelte Stadt und Handelszentrum gegolten haben soll. Später wuchs sie zu einem politischen Machtzentrum und nahm auch eine wichtige Rolle bei der Förderung und Bewahrung des Buddhismus und des Hinduismus ein.