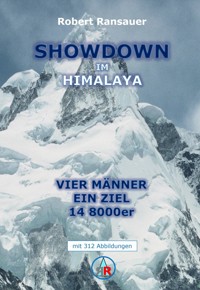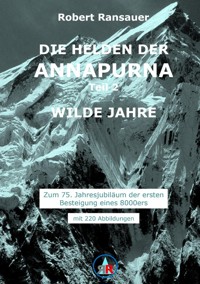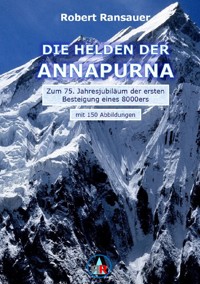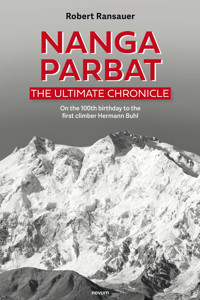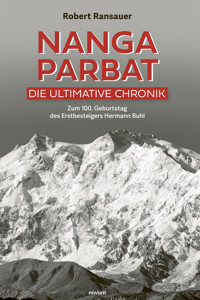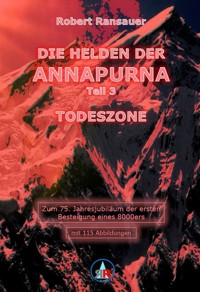
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
'Todeszone' - nennt sich der letzte eil der Annapurna-Trilogie. Die Annapurna, mit einer Höhe von 8091 m der zehnthöchste Berg unseres Planeten, gilt als der gefährlichste aller 8000er. Bis Mitte der 1980er-Jahre hielt die Anzahl der tödlich Verunglückten mit der Anzahl von Expeditionen beinahe im Gleichklang Schritt. Auch die nachfolgenden Jahrzehnte verliefen fatal. Dieses Buch erzählt die Schicksale jener Bergsteigerinnen und Bergsteiger an der Annapurna ab den 1990er Jahren bis in die heutigen Tage. Glanzlichter des Alpinismus, Kommerz, Massenansturm und der Gipfelwahn von Unverdrossenen lösten sich in drei Jahrzehnten laufend ab. Naturkatastrophen rahmten die Besteigungsversuche dramatisch ein. Auch war die Annapurna Schauplatz des 'Wettkampf' um die Himalaya-Krone für die Damen. Wer stand als erste Frau auf allen 8000ern? Die Annapurna war ebenso Schauplatz dieser Entscheidung wie auch für die Vergabe eines Piolet d'Or. Eine bergsteigerische Biographie des französischen Klettergenies Jean-Christophe Lafaille, und ein Beitrag zur 'Unwahrheit am Berg' runden diesen Bücherband ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Ransauer
DIE HELDEN DER
ANNAPURNA
Band 3
TODESZONE
DIE JAHRE 1990 BIS 2019
Texte: © 2025 Copyright by Robert Ransauer
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright Abbildung: Alessandro Gogna. Weiterbearbeitet Robert Ransauer
Verlag:
Robert Ransauer
Leopold Stipcakgasse 9
2331 Vösendorf
Österreich
Autoren Webiste www.ransi-berge.at
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH,
Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung
Vorwort:
Der dritte Band der Annapurna-Trilogie ‚Die Helden der Annapurna‘ trägt den Untertitel ‚Todeszone‘.
Die Bezeichnung ‚Todeszone‘ an einem Berg der 8000 m-Kategorie kennen wir ab einer Höhe oberhalb von 7000 m. Ab einer Höhe von 5500 m nimmt die Luftdichte ab. Erreicht man eine Höhe von 8000 m, so steht dem Menschen nur noch ein Drittel des Sauerstoffs, den er auf Meereshöhe einatmen kann, zur Verfügung. Der menschliche Organismus baut ab und kann sich nicht mehr erholen. Die Atemnot nimmt beträchtlich zu und die Leistungsfähigkeit sinkt. Schlaf ist kaum oder nur erschwert möglich. Der Sauerstoffmangel fördert die Dehydrierung und beeinträchtigt das Denkvermögen. Es fällt sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Viele Menschen beginnen zu halluzinieren. Selbstbewusstsein und Willenskraft werden auf die härteste Probe gestellt. Leben und Tod gehen eine innige Gemeinschaft ein. Die Zuverlässigkeit des menschlichen Verstandes in großen Höhen ist daher als kritisch zu betrachten. Dazu kommen die äußeren Einflussfaktoren von Witterung wie Kälte, Sturm und trockener Höhenluft, die dazu beitragen, dass der Sauerstoffwechsel des Menschen auf ein Minimum zurückgefahren wird. Die Gefahr von Erfrierungen steigt überproportional, und die Körpertemperatur nimmt rapide ab. Die psychische und mentale Belastung in der Todeszone ist enorm. Nicht nur die Physis leidet und steht stark unter Druck, sondern auch die Psyche.
Den Raum, der diese für Menschen unwirtlichen Einflüsse birgt, nannte der Schweizer Expeditionsarzt einer Everest-Expedition, Dr. med. Wyss-Dunant, im Jahr 1952 Todeszone.
Aber aus diesem Grund habe ich den Untertitel dieses Buches, ‚Todeszone‘, nicht ausschließlich gewählt. Denn die Annapurna und ihre, den Flanken nahen Gebiete sind eine Todeszone für sich. Auf keinem anderen 8000er starben im Verhältnis zu den Gipfelerfolgen so viele Bergsteiger wie an der Annapurna. Obwohl sie zur Gruppe der ‚kleineren‘ 8000er gehört, ist sie brandgefährlich. In einer Zeitspanne von 50 Jahren, vom Jahr 1950 bis zum Jahr 2019, kamen 235 Expeditionen zum Berg. 78 von ihnen standen am Gipfel. So ziemlich genau jeder dritte Versuch war erfolgreich. Es starben 73 Menschen. Davon nicht weniger als 41 in den 1970er und 1980er Jahren. In dieser Zeitspanne gelangten 66 Expeditionen zum Berg. Davon standen 19 am Gipfel. Die Erfolgsquote betrug knapp 29 % und war verdammt niedrig. Schlimmer noch war das Verhältnis der Gipfelerfolge verglichen mit den Todesopfern. 57 Expeditionsteilnehmer standen am Gipfel und 41 Personen ließen ihr Leben am Berg. Bei weniger als zwei Gipfelerfolgen war ein Todesopfer zu beklagen. Eine erschütternde Bilanz. 44 der 73 Bergsteiger starben in Lawinen. Deshalb wird der Berg auch gerne als ‚Lawinenberg‘ bezeichnet.
Die Bezeichnung ‚Todeszone‘ für diesen Buchband ist daher nachweislich argumentierbar. Denn auch die nachfolgenden Jahrzehnte verliefen fatal. Dieses Buch erzählt die Schicksale jener Bergsteiger an der Annapurna von den 1990er Jahren bis in die heutigen Tage. Glanzlichter des Alpinismus, Kommerz, Massenansturm und der Gipfelwahn von Unverdrossenen lösten sich in drei Jahrzehnten laufend ab. Naturkatastrophen rahmten die Besteigungsversuche dramatisch ein. In diese Periode fällt auch der ‚Wettkampf‘ um die Himalaya-Krone für die Damen. Wer stand als erste Frau auf allen 8000ern? Die Annapurna war ebenso Schauplatz dieser Entscheidung wie auch für die Vergabe eines Piolet d‘Or. Abgerundet wird das Buch durch eine bergsteigerische Biographie des französischen Klettergenies Jean-Christophe Lafaille. Ebenso habe ich mich etwas der ‚Unwahrheit‘ am Berg gewidmet.
‚Die Helden der Annapurna‘
…sie schreiben auch in diesem Band einen Teil der Himalayageschichte.
Ihr Autor wünscht Ihnen eine interessante Lektüre.
Vorwegnehmen möchte ich, dass in diesem Buch ausschließlich über die Besteigungsgeschichte der Annapurna I berichtet wird. Die Nebengipfel habe ich ausgenommen, es sei denn, sie wurden gemeinsam mit dem Hauptgipfel erreicht.
Dieses Buchprojekt wurde im Eigenverlag erstellt. Die Lektoratstätigkeit, wie Rechtschreibung und Interpunktion, wurde vom Autor selbst vorgenommen. Das gilt auch für das Seitenlayout sowie die Gestaltung des Buchumschlags. Ein professionelles Vier-Augen-Prinzip konnte nicht realisiert werden. Es besteht daher keine Garantie für eine grammatikalische Fehlerfreiheit. Ich bitte den Leser, dies nachzusehen.
Einige Bilder im Buch sind nicht immer der heutigen Zeit entsprechend qualitativ illustriert. Dies liegt nicht an der Druckqualität des Buches, sondern am Alter der Fotos bzw. der Dia-Scans. Viele der Bilder stammen aus Zeiten der analogen Fotografie und Diaserstellung. Die Qualität der Abbildungen ist der damaligen Zeit und der jahrzehntelangen Aufbewahrung geschuldet. Bitte um entsprechende Berücksichtigung.
Zum 75. Jahresjubiläum der Erstbesteigung
der
Annapurna (8091 m)
‚Der Weg zum Gipfel ist wie der Weg zu sich selbst –
ein Alleingang‘
Alessandro Gogna
Italienisches Expeditionsmitglied zur Annapurna, 1973
Die vierzehn höchsten Berge der Erde
INHALT
01 GLANZLICHTER UND KOMMERZ
02 DIE UNVERDROSSENEN
03 DAMENKRONE & MASSENANSTURM
Facts & Figures
Lassen wir zu Beginn des dritten Bands der Trilogie ‚Die Helden der Annapurna‘ die ersten vier Jahrzehnte Höhenbergsteigen an diesem 8000er noch einmal im Zeitraffer an uns vorbeiziehen.
„Sie sind tapfer, und wir begrüßen Sie hier als einen tapferen Mann.“ Als Maurice Herzog am 11. Juli 1950 bei seiner Audienz beim nepalesischen Premierminister Mohan Shumsher mit diesen Worten begrüßt wurde, verkündete er, als erster Mensch am Gipfel eines 8000ers gestanden zu haben. Es waren gerade einmal fünf Wochen seit seinem großen Wurf vergangen, den er mit seinem Bergkameraden Louis Lachenal vollbracht hatte. Der Abstieg der beiden endete im Desaster, war Folter und Tortur, begleitet von Schmerz und Wahnvorstellungen. Mit schwersten Erfrierungen, gefangen in Gletscherspalten und von Lawinen verschüttet, kamen sie gerade noch mit dem Leben davon. Nicht ohne bis zu ihrem Lebensende, bedingt durch Amputationen diverser Körperteile, schwere physische Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen. Doch sie waren zu Superstars des Alpinismus geworden, begleitet von Ruhm und Ehre bis zu ihrem Lebensende. Und die Annapurna mit ihren 8091 m war seit dem 3.6.1960 der höchstbestiegene Berg der Erde. Obwohl sie ‚nur‘ die zehnthöchste Erhebung unseres Planeten ist. Lange sollte sie aber diese Rangliste nicht anführen. Denn ihre Erstbesteigung war der Weckruf an die Welt, alle anderen dreizehn 8000er in Angriff zu nehmen. Die französischen Gipfelsieger lösten einen Run auf die 8000er aus, und das lange von der Außenwelt abgeschottete Nepal öffnete fortan, als Paradies für Höhenbergsteiger, seine Grenzen.
Mitte und Ende der 1960er Jahre versuchten sich Deutsche an der Südwand der Annapurna, gaben sich aber mit am Ostgrat liegenden Nebengipfeln des Gebirgsmassivs zufrieden.
Weitere 11 Jahre vergingen, ehe Briten zur Nordflanke und Südflanke kamen. Beide schafften es bis zum höchsten Punkt. Die Briten im Süden unter Leitung von Chris Bonington schrieben dabei Alpingeschichte. Sie durchstiegen eine der höchsten und steilsten Himalayawände – die Annapurna-Südwand – 3,5 Kilometer hoch mit einem Neigungswinkel von durchschnittlich 55 Grad. Dieses Ereignis war der Startschuss in ein Zeitalter ‚der wilden Jahre‘ im Himalaya. Gerne wurde diese Periode auch als der ‚Aufbruch in neue Zeiten‘ bezeichnet. Deswegen, weil der Aufstieg an technischer Schwierigkeit nicht zu überbieten war. Noch nie zuvor war in einer Höhe von 7000 bis 8000 m mit oder ohne künstlicher Sauerstoffzufuhr geklettert worden. Das Format des Anstiegs hatte sich von den ‚einfacheren‘ Aufstiegsrouten zu innovativen, direkten und schwierigen Routen verlagert. Nicht mehr unbedingt der Gipfel stand im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Schwierigkeit der Route selbst. Es galt der neue Leitspruch „Je schwieriger, desto herausfordernder, desto interessanter“. Tragisch allerdings der Umstand, dass diese Expedition für das erste Todesopfer am Berg zeichnete.
In den 70ern erreichten Spanier in einer interessanten Linie, welche man später auch zum Hauptgipfel nutzen würde, den Ostgipfel. Holländer legten an der Nordseite eine neue Linie über eine Rippe östlich der Erstbesteigerroute bis ganz nach oben an. Wenig überraschend, dass diese Rippe seit jenen Tagen unter Holländer-Rippe oder auch Dutch-Rip bekannt ist. Unter dem Banner ‚A Woman’s Place is on the Top‘ setzte eine fröhliche Gruppe amerikanischer Frauen unter Leitung von Arlene Blum ihre Steigeisen in den Gipfelschnee. Leider kehrten aber auch sie, um zwei Damen dezimiert, vom Berg zurück. Der französische Bergskipionier Yves Morin stand am Gipfel und fuhr als erster Mensch von einem 8000er mit seinen Brettern ab. In den Tod. Und das Jahrzehnt der 70er endete genauso, wie es begonnen hatte. Mit dem Tod. Gleich drei Amerikaner starben im Jahr 1979 in einer Höhe von 6500 m, als an der Nordseite eine Lawine alles hinwegfegte. Von den ursprünglich acht Mann hatten wenigstens fünf Riesenglück, wieder den Rückmarsch antreten zu können. In den 1970ern gab es ebenso viele Tote wie Expeditionen zur Annapurna.
Und in diesem Muster startete man auch in das folgende Jahrzehnt. Die Dekade der Draufgänger. Denn ein Draufgänger musste man sein, um sich an diesem tödlichen Lawinenberg zu wagen. Gevatter Tod lag stets auf der Lauer. Der Deutsche Gustav Harder bestieg mit seinem Team nicht nur von Norden den höchsten Punkt, sondern er wagte auch den für ausgeschlossen gehaltenen Rückmarsch durch die Schluchten der Miristi Kola – ein abenteuerlicher Leidensweg ohne Ende, den man aber wenigstens ohne Verluste hinter sich brachte. Deutsche erreichten als erste den Mittelgipfel und der sich in schwindelnder Höhe am wohlsten fühlende Österreicher Sepp Mayerl gelangte am Südwestgrat über die westliche Südwand bis zu einem Felszahn namens ‚Fang‘. Auf Grund der Schwierigkeit des Unterfangens eine Meisterleistung. Auf den Hauptgipfel wurde verzichtet. Man hatte sich eigentlich schon im Jenseits gewähnt und war froh, wieder im Diesseits zu sein. Gefolgt wurde Mayer von Schweden, die sich als erste am kilometerlangen Ostrgrat versuchten. Sie waren chancenlos. Für eine aufsehenerregende Expedition sorgten Polen mit einer Durchsteigung der Südwand über ihren östlichsten Pfeiler bis zum Mittelgipfel. Nur das Wetter verwehrte ihnen den totalen Triumph, bis zum Hauptgipfel zu kommen. Franzosen sorgten für ein entsetzliches Fazit, als sie versuchten, an der Nordseite über den Nordwestpfeiler nach oben zu kommen. Sie erreichten weder den Gipfel noch kamen sie vollzählig vom Berg zurück. Vier ihrer Männer blieben für immer im Lawinenschnee begraben. Währenddessen baggerten sich Japaner am Mittelgipfel der Südwand empor. Eine spektakuläre Route, die mit einem tollen Ausblick am höchsten Punkt des Berges, aber auch mit einem Toten endete. Das tödliche Schicksal der Annapurna machte auch vor dem 'James Dean des Bergsteigens', dem Briten John McIntyre, nicht halt. Als er 28-jährig aus der Südwand der Annapurna stürzte, galt er als das große Idol der damals jungen Bergsteigergeneration. Im Jahr 1983 zählte man seit den ersten Versuchen im Jahr 1950 28 Tote an den Flanken der ‚Ernte spendenden Göttin‘. Japaner steuerten die 30. Expedition und nicht weniger als drei Todesopfer bei. Es galt nach wie vor die durchschnittliche Devise: 1 Expedition bedeutet 1 Toter. Mitte der 1980er Jahre griffen Franzosen und Schweizer die schwierige und gefährliche Nordwestflanke an. Und Sie liegen richtig, wenn Sie annehmen, dass auch dort der Tod lauerte. Die Franzosen verloren zwei ihrer Männer. Die Nordwestflanke blieb im Brennpunkt. Erst die beiden Alleskönner Reinhold Messner und Hans Kammerlander erreichten im Alleingang unter apokalyptischen Rahmenbedingungen den Gipfel. Ein Meisterstück. Das absolvierten bereits ein Jahr zuvor, im Jahr 1984, zwei Schweizer an der Südflanke. Sie ritten tagelang durch die Hölle des Ostgrats und erreichten tatsächlich den Hauptgipfel. Als keiner mehr damit rechnete, dass sie zurückkommen würden, tauchten sie vollkommen ausgelaugt im Basislager an der Nordseite auf. Sie hatten nicht nur den Ostgrat begangen und das Gebirgsmassiv von Süden nach Norden überquert, sie hatten auch Alpingeschichte geschrieben. Deswegen war eine neue, äußerst spektakuläre Linie durch zwei Spanier in der Südwand vollkommen an der Öffentlichkeit vorbeigegangen. Erst im Nachhinein wurde erkannt, dass die Leistung des spanischen Duos jener der Schweizer in keiner Weise nachstand. Im Winter 1986/1987 erstieg man die Annapurna erstmals im Winter. Natürlich waren es die polnischen ‚Ice Warriors‘ diesmal in Person von Jerzy Kukuczka und Artur Hajzer. Es ging bis ans Ende der Dekade aufsehenerregend und ereignisreich weiter, wobei eine tschechische Expedition zum Gipfel mit einer neuen Route durch die Nordwestflanke herauszuheben ist. Was übrig bleibt, sind die vielen zu beklagenden Toten. Die statistischen Fakten konnten Sie bereits im Vorwort dieses Buches nachlesen. Eines darf ich der nun folgenden Geschichte bereits vorwegnehmen: Die Bilanz der folgenden Jahrzehnte wies kaum Besserung auf. Man darf sich an spannenden, beeindruckenden und eindrucksvollen Bergexpeditionen erfreuen.
Wer alle Einzelheiten seit dem Jahr 1950 in Erfahrung bringen möchte, eine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Landes Nepals inbegriffen, dem lege ich die ersten beiden Bände meiner Annapurna-Trilogie ans Herz.
01GLANZLICHTER UND KOMMERZ
1990 – 1999
…die letzten Herausforderungen …
Prägnante Ereignisse
Neue Südwand-Routen
Das mysteriöse Verschwinden des Gabriel Dunamur
Jean-Christophe Lafaille – Schicksalsberg Annapurna
Der Ritt auf dem Blumenkohl-Grat (‚Cauliflower-Ridge‘)
Der Tod des Anatoli Boukreev
Prägende Persönlichkeiten
Pierre Beghin
Jean-Christoph Lafaille
Juan Oiarzabal
Andrzej Marciniak
Vladyslav Terzyul
Das neue Jahrzehnt an der Annapurna, die 1990er-Jahre, begann erfolglos. Im Jahr 1990 fand keine einzige der fünf zugelassenen Expeditionen einen Weg zum Gipfel. Drei fanden sich an der Nordflanke und zwei an der Südflanke ein. An der Nordseite waren 6500 m erreichte Höhe das Höchste der Gefühle, während die Südwand keinen Anstieg oberhalb von 6800 m zuließ. Zwar waren 1990 keine Todesopfer zu beklagen, aber der Berg sollte über das ganze Jahrzehnt hinweg seiner tödlichen Aura treu bleiben.
1990: Für kommerzielle Kunden zu gefährlich
Malcolm Duff führte eine gemischte Expedition aus Briten, Neuseeländern und Amerikanern an die Nordwand der Annapurna. Gekommen waren sie wie so viele Expeditionen vor ihnen über die einzig mögliche und etwa 10 Tage andauernde Anmarschroute via dem Kali Gandaki-Tal und Lete. Dort rackerten sie sich, entsprechend ihrer Vorgänger, durch dschungelähnliches Waldgebiet und extrem steile Grashänge, die sich auf Pässe jenseits der 4000 m emporschlängelten, hoch. Allen voran der Thulobugin-Pass. Durch hohe Passagen und kaum zu überwindende Felsabschnitte brach ihr Weg in weiterer Folge fast 2000 m ab bis in die Miristi Kola-Schlucht ab und mündet in Areale und in einen Talkessel unterhalb der Nordwestflanke, die kilometerhoch über ihnen aufragte, bevor es über Gletschermoränen weiter Richtung Nordflanke ging. Begrenzt wird dieser Talkessel im Norden durch die Höhenzüge der Nilgiri und Tilicho, die in ihrer weiteren Ausdehnung nach Süden den Talkessel vom Westen begrenzen.
Dabei mussten sie mit der Zuhilfenahme von Baumstämmen den reißenden Fluss Miristi Kola (oder auch Nilgiri Kola) queren, der den Gletschern der Nordseite entspringt und der sich in Richtung Westen über Jahrtausende hinweg durch die Berglandschaft ein Flussbett gegraben hat. Der Fluss mündet weiter im Südwesten in den Kali Gandaki–Fluss. Die Schlucht der Miristi Kola wäre eigentlich ein idealer Weg zur Nordflanke gewesen, war aber aufgrund ihrer wilden Beschaffenheit nicht begehbar. Lediglich eine deutsche Expedition aus dem Jahr 1980 versuchte sich auf dem Rückweg durch die Schlucht und litt unter fürchterlichen Bedingungen. Ergo hatten es die Südkoreaner erst gar nicht versucht. Als sie im Basislager angekommen waren, stellte sich vor ihnen eine Mauer auf. Die ‚Grand Barriere‘ mit ihrem 7000 m hohen, kilometerlangen Grat überragte im Osten das Tal, im Süden stieg die Nordflanke der Annapurna gegen den Himmel.
Insgesamt waren die Bergsteiger zu acht und hatten am 24.4. ihr Basislager am üblichen Platz vor der Nordwand platziert. Für die Versorgung der Hochlager hatten sie noch zwei Sherpas engagiert. Über die Holländer-Rippe wollte man nach oben. Seinen Namen erhielt der Bergkamm von seinen Erstbegehern aus dem Jahr 1977.
Es waren eben Holländer, die der Annapurna mit jener Route ihren Stempel aufdrückten und nachfolgenden Expeditionen einen alternativen Weg zur Erstbesteigerroute zum Gipfel ebneten. Der Weg führte direkt hinauf zum Gletscher im oberen Bereich der Nordflanke und erschien sicherer als die Route der Erstbesteiger, da die Lawinen, die den Berg hinabjagten, links und rechts der Rippe ins Tal stürzten. Einfach war der Weg trotzdem nicht. Denn der Grat der Rippe war messerscharf, ausgesetzt, und links und rechts brachen die Steilwände hunderte Meter ab. Außerdem stellte sie mit sehr steilen bis senkrechten Eis- und Schneepassagen wesentlich höhere Anforderungen an Bergsteiger als die Erstbesteigerroute. Dazu kam, dass sie wesentlich sicherer war.
Am 9.5. hatte man Lager 3 auf der Spitze der Rippe in 6500 m Höhe aufgestellt. Davor hatten sie zwei Lager in Form von Schneehöhlen ausgestattet. Lager 3 wurde in den Folgetagen mit Ausrüstung und Proviant versorgt, um einen weiteren Anstieg sicherzustellen. Keiner hatte dort aber jemals übernachtet. Immer wieder war man nach Lager 2 abgestiegen. Am 14.5. brach man wieder nach oben auf. Der Expeditionsleiter Duff, Ian Woodall, der Amerikaner Richard Nowack und der Neuseeländer Lester Gray schufteten sich nach oben, bis sie in einen Abschnitt von Seracs gerieten, der stark zerklüftet und aufgrund seiner überhängenden Eisstrukturen sehr gefährlich war. So gefährlich, dass ein Passieren des Geländes lebensgefährlich gewesen wäre. Vor allem deswegen, da man den Bereich zwecks Versorgen von weiteren Lagern mehrmals hätte passieren müssen. Außerdem hätte man den Abschnitt mit Fixseilen sichern müssen (Fixseile sind fix im Felsen oder Eis verankerte Seile. Sie werden zumeist am Beginn einer Saison von einem separaten Team angebracht. Sie dienen dazu, Expeditionsteams steile Aufstiege und Abstiege zu erleichtern. Die Seilsicherung der Route erfordert, ähnlich wie die Rotation bei der Akklimatisierung, eine Wiederholung der Anstiege beim Befestigen. Nur die besten Bergsteiger werden für diese Tätigkeit ausgesucht. Es handelt sich um eine anstrengende Arbeit, die sich auch über Wochen hinziehen kann, weil sich Terrain und Wetterverhältnisse laufend ändern). Doch das hätte eine zu lange Anwesenheit von Bergsteigern in dieser Aufstiegsetappe nach sich gezogen. Eine Etappe, durch welche man eigentlich schnell durchmusste. Dem Serac-Bereich auszuweichen, war unmöglich gewesen. Dazu kam, dass Duff Kunden dabei hatte, die ihn für diesen Ausflug zur Annapurna bezahlt hatten. Deren Erfahrung reichte nicht dazu aus, schnell durch das Serac-Gelände hinwegzukommen. Wäre einem Kunden etwas zugestoßen, wäre das ganz schlecht für sein Geschäft gewesen. Daher entschied er nach Rücksprache mit seinen Kunden, den Aufstieg abzubrechen.
1990: Südkoreaner an der Bonington-Route gescheitert.
Mit 11 Bergkameraden erschien der südkoreanische Expeditionsleiter Doo-Sung Chun an der Südwand, um die Bonington-Route in Angriff zu nehmen. Die Route wurde nach dem Briten Chris Bonington benannt, der 1970 als Expeditionsleiter einer hochkarätig besetzten Expedition zwei seiner Bergkameraden zum Gipfel brachte. Die Expedition wurde in Großbritannien als der größte Erfolg im Himalaya seit der Erstbesteigung des Mount Everest 1953 gefeiert. Nicht nur deswegen, weil der Gipfel eines 8000ers erreicht wurde, sondern vor allem deswegen, weil der Aufstieg an technischer Schwierigkeit nicht zu überbieten war. Noch nie zuvor war in einer Höhe von 7000 m bis 8000 m mit oder ohne künstliche Sauerstoffzufuhr geklettert worden. Zwischen dem Lager 3 und dem Ausstieg auf dem Felsband auf 7550 m beträgt der durchschnittliche Neigungswinkel der Südwand 55 Grad. Es kam nicht nur einmal vor, dass die Bergsteiger für eine einzige Seillänge mehr als drei Stunden benötigten. Fünf Meter in der Stunde oder lediglich 30 Höhenmeter am Tag waren keine Seltenheit. Viel zu oft wurden sie vom Gelände zu Pendelquergängen gezwungen. Nur Meter für Meter konnten die einzelnen Etappen erkundet werden, und was man sich morgens vornahm, war drei Stunden später bereits wieder verpufft. Je höher man kam, desto unübersichtlicher und desto gefährlicher kam den Kletterern Fels, Eis und Schnee entgegen. Immer unwirtlicher setzte ihnen die Natur zu. All das würde den Südkoreanern nun bevorstehen. Natürlich hatte die Entwicklung der letzten zwanzig Jahre in Sachen Ausrüstung, Logistik und Organisation enorme Fortschritte gemacht. Leicht würde es für die Asiaten aber dennoch nicht werden. Denn seit 1970 hatten es auf Boningtons Originalroute nur zwei weitere Expeditionen versucht. Eine südkoreanische Expedition war 1984 gescheitert und 1988 schaffte es der Franzose Benoit Chamoux bis zum höchsten Punkt.
Und noch etwas ist zur Bonington-Expedition anzumerken. Sie galt als Meilenstein und Paradigmenwechsel im Höhenbergsteigen. Auch deswegen, weil sich ihr Format von den ‚einfacheren‘ Aufstiegsrouten zu innovativen, direkten und schwierigen Routen verlagerte. Nicht mehr unbedingt der Gipfel stand im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Schwierigkeit der Route selbst. Es galt der neue Leitspruch „Je schwieriger, desto herausfordernder, desto interessanter“. Die breite Öffentlichkeit, die nach den großen Ersteroberungen der 8000er mehr und mehr das Interesse verloren hatte und auf Nischenaugenmerk geschrumpft war, erreichte wieder eine Aufbruchstimmung. Ein weiteres Mal wurde das Interesse an den höchsten Bergen der Welt wieder in den Mittelpunkt gerückt. Für die Südkoreaner konnte die Herausforderung nicht größer sein.
Gekommen waren sie durch die Schlucht der Modi Kola. Der Modi Kola-Fluss entspringt aus den Gletschern der Südseite des Annapurna-Massivs. Der Ausgang aus der Schlucht führt in ein riesiges Gletscheroval. Das ‚Eingangsportal‘ wird im Osten durch den Machapuchare (6997 m) und im Westen durch den Hiunchuli (6441 m) gebildet. Wie zwei riesige Wachtürme ragen sie vor dem Gletscheroval auf. ‚Machapuchare‘ bedeutet ‚Fischschwanz‘. Deswegen, weil seine doppelte Spitze vom Osten betrachtet eben einem Fischschwanz ähnelt. Der Hiunchuli, was so viel wie Schneeberg bedeutet, erhielt seinen Namen von Colonel Roberts, einem englischen Expeditionsleiter, der 1957 als erster weißer Mensch in dieses Gletscherbecken gelangte. Das gesamte Gletscherbecken gleicht einem durch steil abfallende Wände, die kilometerhoch emporstreben, eingerahmten Kessel. Sieben Stunden Sonnenlicht aus einem winzig erscheinenden Firmament gestattet der Hochsommer. Im Norden zieht der Westgrat vom Hauptgipfel nach Westen Richtung Fang (7647 m), seinem Aussehen nach dem Fangzahn eines Raubtieres gleich. Der Fang ist Ausgangspunkt des Südgrats, der von ihm in Richtung Annapurna Süd (auch Modi-Peak oder Ganesh, 7219 m) abzweigt. Ihr Gebirgszug begrenzt das Gletscheroval nach Westen. Ebenfalls im Norden, aber nach Osten vom Hauptgipfel, zieht der Ostgrat ganze sieben Kilometer lang und fast durchgehend 7000 m hoch. Er ist oft messerscharf und bekannt für seine verheerenden Höhenstürme. Der Ostgrat trägt mit dem Roc Noir (7485 m), was so viel wie schwarzer Fels bedeutet, und im Nordosten mit dem Glacier Dome (7193 m) und der Gangapurna (7455 m) die höchsten Erhebungen. Im Osten schließt sich das Becken über die Annapurna 3 (7555 m) und das Gabelhorn (Gandharva Chuli) (6248 m) zum Machapuchare hin. Das Becken selbst umfasst eine ungefähre Höhe von 4000 m und wird von Norden nach Süden durch zwei Gebirgskämme dreigeteilt, aus deren Becken drei Gletscher direkt in die Modi Kola-Schlucht fließen. Der südliche, der westliche und der östliche Annapurna-Gletscher. Das Gletscherbecken trägt den Namen ‚Annapurna Sanctuary‘. Die Ureinwohner des dort lebenden Gurung-Stammes glauben, dass in der Umgebung Unmengen von Gold und seltene Schätze der Schlangengottheit Nagas lagern. Der Machapuchare gilt als der Sitz des Gottes Shiva, Gott der Zerstörung. Die Einheimischen sehen in den Schneewehen vom Gipfel, seinen göttlichen Weihrauch.
In der Nachmonsunzeit, am 19.8., waren die Südkoreaner am Platz des Basislagers angekommen. Lager 1 entstand am 21.8., gefolgt von Lager 2 am 25.8. auf 5500 m Höhe. Auf der Route nach Lager 3 hinauf wurde es spannend. Denn weicher Schnee und laufend abgehende Lawinen machten das Vordringen zum nächsten Lagerplatz gefährlich. Täglich nach 09.00 Uhr setzte dann auch noch Steinschlag ein, losgelöst von wärmeren Temperaturen und der Sonneneinstrahlung. Trotzdem kletterten sie bei Tag und nicht bei Nacht. Meter für Meter kamen die Südkoreaner höher, bis sie am 31.8. eine Höhe von 6100 m erreichten. Nach Lager 3 wichen sie von der Bonington-Route ab und versuchten sich links davon in einem Couloir. Doch auch im Couloir herrschte akute Lawinengefahr. Und tatsächlich wurden drei Expeditionsmitglieder über 100 m weit von einem Schneebrett mitgespült. Verletzt wurden sie nicht, dafür ging viel an Ausrüstung verloren.
Die Südwände der Annapurna sind sehr überraschenden und heftigen Wetterwechseln ausgesetzt. Die warme, herantreibende Luft aus dem Tiefland hält an den kilometerhohen Wänden an und wird zum Aufsteigen gezwungen. Dabei kühlt sie ab, es bilden sich Wolken und Schneefall setzt ein. Oft hieß die Devise: Am Morgen Sonne und nachmittags einsetzende Niederschläge.
Ab dem 11.9. bekamen dieses Phänomen dann auch die Südkoreaner zu spüren. Es begann unaufhörlich zu schneien. Alle Bergsteiger zogen sich für vierzehn Tage ins Basislager zurück.
In weiterer Folge wurde anstelle des Couloirs links der Bonington-Route doch der Eisgrat versucht. Aber Tiefschnee sorgte dafür, dass man nicht weiterkam. Dann doch wieder das Couloir, in welchem man von Lawinen abermals verjagt wurde. Man landete wieder am Eisgrat. Doch mittlerweile waren die Bergsteiger müde geworden. Ein Weiterkommen war nicht in Sicht. Um nicht noch mehr Gefahren in Anspruch zu nehmen, brach man die Expedition ab. Trotz widriger Umstände hatten die Südkoreaner bei ihren Bemühungen eine Höhe von 6700 m erreicht.
1990: …ein netter Berg, aber zu gefährlich …
Ein spanisches Quartett mit Javier Ignacio Bermejo Garde an der Spitze wollte sich an der Nordseite versuchen. Am 13.9. waren sie angekommen und errichteten bis 19.9. zwei Lager. Ein weiterer Vorstoß war bis auf 6500 m geplant, doch dieser scheiterte an einer Serac-Wand. Am 21.9. wurde Lager 2 durch eine Lawine verwüstet und viele Ausrüstungsgegenstände gingen verloren. Man stieg wieder ins Basislager ab, wo man tagelang die Zeit absass, da das Wetter miserabel war. Erst am 30.9. konnte man wieder darüber nachdenken, einen erneuten Anstieg zu riskieren. Wieder gelangte man auf 6400 m in die Serac-Zone, doch man wollte nicht die Gefahr eingehen, durch diesen Bereich zu steigen. Außerdem fehlten Hunderte Meter an Fixseilen, um den Abschnitt entsprechend zu sichern. Die Spanier zogen sich nach Spanien zurück.
1990: War er oder war er nicht? – Besteigung à la ‚illegale‘
Der Italiener Giancarlo Gazzola hielt sich, eigener Aussage nach, bereits im Mai 1989 im Annapurna-Gebiet auf. Doch schlechtes Wetter hielt ihn damals davon ab, einen Aufstiegsversuch zu wagen. Im Herbst des Jahres 1990 probierte er es ein zweites Mal. Was ihn dazu antrieb, es ohne offizielle Genehmigung der nepalesischen Behörden zu versuchen, blieb ein Geheimnis. Nach Jomsom war er geflogen und mit sieben Hochträgern über den schwierigen Franzosenpass und durch die Miristi Kola zum Platz des Basislagers an der Nordseite gelangt. Am 5.10. war er dort angekommen. Zwei Sherpas hatten ihm in weiterer Folge dabei geholfen, bis auf eine Höhe von 5600 m aufzusteigen und ein erstes Lager zu errichten. Ab da stand ihm keine Hilfe mehr zur Verfügung und er kletterte jeden Tag mit seiner Ein-Mann-Ausrüstung ein Stück die Nordwand höher. Seiner Hartnäckigkeit hatte er es zu verdanken, dass er neben Tausenden Metern Anstieg auch Magenbeschwerden und Höhenkrankheit hinter sich ließ. Seine Route wurde auch laufend von starkem Wind begleitet. Einhundert Meter unterhalb des Gipfels hätte er beinahe aufgegeben. Aber es gelang ihm, diese Entfernung innerhalb von vier Stunden doch noch zu überwinden. So stand er am 25.10. am Gipfel. Alleine. Weitere fünf Tage benötigte er, um wieder ins Basislager abzusteigen. Dort erwarteten ihn seine Sherpas. Abgesehen davon, dass die Besteigung aufgrund des fehlenden ‚Permits‘ offiziell nie anerkannt wurde, bestanden auch in seiner Heimat erhebliche Zweifel, ob er tatsächlich den Gipfel erreicht hatte.
1990/1991: Ohne Motivation durch die Südwand – unmöglich
Der Amerikaner Kenneth Reville, bereits 1987 an der Annapurna gewesen, war der Anführer jener neun Bergsteiger, die es im November an die Südwand der Annapurna verschlagen hatte. Die US-Boys wollten mit einem Winterversuch die östliche Südwand bis zum Ostgrat vordringen und dann zum Gipfel weitergehen. Doch die Amerikaner sahen sich auf dieser Route mit starken Winden konfrontiert und wollten einen Aufstieg nicht riskieren. So wechselten sie über zur Bonington-Route. Um sich zu akklimatisieren, bestiegen sie den Tent-Peak. Bis zum 6.12. schaffte man drei Lager und gelangte auf eine Höhe von 6200 m. Dann verschlechterte sich zwar das Wetter, aber die Amerikaner versuchten trotzdem, bei extremster Kälte hochzukommen. Sie gelangten am 7.12. bis auf eine Höhe von 6800 m. Dann mussten sie erkennen, dass gegen den Annapurna-Winter kein Kraut gewachsen war. Die Bergsteiger waren von der Anstrengung müde geworden und auch die Motivation nagte an den Kletterern. Sie beschlossen, ihren Versuch aufzugeben.
1990/1991: Ein Serac verbreitete Furcht und Schrecken
Der Jugoslawe Darko Berljak leitete im Winter 1990/1991 eine 12-köpfige Expedition zur Nordwand der Annapurna. Es war übrigens die 75. Expedition überhaupt. Mit dabei hatten sie auch einen Amerikaner. Am 25.11. richteten sie ihr Basislager ein. An einer Stelle, an welcher auf der Nordseite im Winter noch Sonnenstrahlen hinfielen. Das Ziel der Jugoslawen war es, über die Holländer-Rippe nach oben zu gelangen.
Ein ABC-Lager auf 5750 m Höhe war von sechs Expeditionsmitgliedern am Fuße der Nordwand schnell eingerichtet worden (Ein ‚ABC‘-Lager (Advanced Base Camp) oder vorgeschobenes Basislager wird dann errichtet, wenn das ‚normale‘ Basislager aus logistischen oder sicherheitsbedingten Gründen weiter entfernt vom Einstieg in den Berg errichtet werden muss). Als nächsten Schritt plante man die Route über die Holländer-Rippe. Zwei Seilgefährten brachen am 2.12. auf, um die Route zu sichern. Dabei gelangten sie im letzten Teil der Rippe in einen Serac-Bereich. Wie es das Schicksal wollte, brach ein Serac, der 100 m über der Rippe aufragte, genau zu jenem Zeitpunkt in sich zusammen. Als Lawine strömte er links und rechts der Rippe hinunter zum Gletscher und schlug mit der Lautstärke eines Erdbebens auch im oberen Bereich der Rippe ein. Die beiden Jugoslawen Danilo Tic und Marjan Freser flüchteten, von Angst getrieben, die Rippe runter ins Basislager. Als Todesopfer in den Statistiken der Annapurna wollten sie nicht aufscheinen. Als man sich an der Basis besprochen hatte, entschied man sich, einen Boten nach Lete zu schicken, um die Träger für den Rücktransport zu aktivieren. Es ging wieder nach Hause.
Zwölf Expeditionen verschlug es 1991 zum Berg. Acht von ihnen marschierten vor der Nordseite auf – eine von ihnen durfte sich über den höchsten Punkt freuen. Drei probierten es an der Südflanke und alle drei waren erfolgreich. An der Nordwestflanke biss man sich die Zähne aus. Was viel schlimmer war, war, dass man 1991 sieben Todesopfer in Kauf nehmen musste. Sechs kamen während des Aufstiegs in Lawinen um, ein Bergsteiger ging verschollen.
1991: Zu hohe Lawinengefahr durch zu viel Schnee
Für das Jahr 1991 stellten die nepalesischen Behörden nicht weniger als zwölf Genehmigungen zur Besteigung des Hauptgipfels aus. Den Anfang machten Österreicher. Der Tiroler Arthur Haid führte in der Vormonsunzeit ein kleines sechsköpfiges Team, darunter einen deutschen Bergsteiger, zur Nordseite. Dort langte er am 30.3. ein und errichtete bereits am 1.4. mit seinen Leuten Lager 1 auf 5000 m Höhe. Dann setzte tagelang Schneefall ein und verzögerte alle weiteren Bemühungen bis zum 15.4. Am 17.4. gelang es, Zelte am Platz von Lager 2 auf 5600 m vor dem Aufschwung zur Holländer-Rippe aufzustellen. Das war nicht einfach gewesen, denn immer wieder donnerten Lawinen aus der tiefverschneiten Nordwand. Vier Mann hatten Glück, als sie 50 m in einer Lawine mitgeschwommen waren und unverletzt blieben. Noch einmal versuchte man, höher zu kommen. Doch 5900 m waren die höchste Höhe gewesen, die man erreichen konnte. Am 19.4. öffnete der Himmel wieder seine Schleusen und es schneite wie aus Konfettikanonen. Die Österreicher verließen am 26.4. die Nordwand.
1991: Österreicher und Deutsche – geteiltes Leid
Eine Woche nach den Österreichern traf der Deutsche Ralf Dujmovits im Rahmen seiner selbst gegründeten ‚Amical Alpin Bergschule‘ mit weiteren vierzehn Bergsteigern und vielen Kunden am Fuße der Nordflanke ein. Es erging den Deutschen ähnlich wie den Österreichern. Obwohl sie teilweise versuchten, gemeinsam gegen die Schneemassen anzukämpfen, blieben sie machtlos. Immerhin schaffte es Dujmovits, dass alle seine Teilnehmer Lager 2 auf etwa 5600 m erreichten. Es war das Höchste der Gefühle. Denn die Traverse von Lager 2 zur Einstiegswand der Holländer-Rippe war stark exponiert und enorm lawinenanfällig gewesen. Am Tag, als die österreichische Expedition des Arthur Haid abreiste, erreichte das Dujmovits-Team mit 5750 m ihren höchsten Aufstiegspunkt. Danach verließen auch die Deutschen den Berg. Es handelte sich übrigens um die erste kommerzielle Expedition zur Annapurna-Nordflanke.
1991: Ein Desaster mit sechs Toten
Vierzehn Südkoreaner und vier Sherpas nahmen in der Nachmonsunzeit Mitte August vor der Nordflanke Aufstellung. Das Ziel des koreanischen Expeditionsleiters Ko Yong-Chul war es, seine Leute über die Holländer-Rippe zum Gipfel zu führen. Immerhin hatten es bereits im Laufe der Jahre sechzehn Teams versucht, aber lediglich fünf waren erfolgreich gewesen. Am 25.8. errichteten die Südkoreaner auf 5000 m ein ABC-Lager und ließen am 27.8. ein erstes Lager auf 5600 m folgen. Lager 2 folgte am 7.9. Schon am 11.9. wurde es durch eine Lawine teilweise zerstört. Am 15.9. wurde auch das ABC-Lager vom Luftdruck einer Lawine dem Erdboden gleichgemacht und musste neu aufgebaut werden. Lager 3 konnte am 17.9. eingerichtet werden und stand in einer Höhe von 6850 m. Später wurde bekannt, dass die Koreaner kaum Führungsarbeit am Berg verrichteten und hauptsächlich die Sherpas die Route spurten und Sicherungsseile montierten. Wann immer es am Berg gefährlich wurde, schickte man die Sherpas vor. Man trieb sie an, indem man sie als faul und lasch bezeichnete. Dabei arbeiteten die Sherpas tüchtig und eng mit einer sich ebenfalls am Berg befindlichen amerikanischen Expedition zusammen. Am 19.9. beabsichtigte man einen weiteren Aufstieg bis auf 7600 m und wollte Lager 4 einrichten, als in einer Höhe von 7500 m das Aufstiegsteam, bestehend aus sechs Sherpas und zwei Südkoreanern, von einer Lawine, welche oberhalb ihres Standortes abging, überrascht wurde. Sechs der acht Bergsteiger wurden 1000 m die Wand mitgerissen und fünf von ihnen wurden in der Nähe von Lager 3 von der Lawine wieder nach oben gespült. Die beiden Sherpas, welche ganz oben am Berg den Lawinenabgang überlebt hatten, stiegen mit einer sich am Berg befindlichen amerikanischen Expedition ab. Auch in Lager 3 befanden sich Amerikaner, die sofort Hilfestellung leisteten. Es kam für die Verunglückten aber jede Hilfe zu spät. Alle Reanimationsversuche scheiterten. Sie verstarben alle sehr schnell nach ihrer Bergung an ihren inneren Verletzungen. Ein Sherpa konnte nicht geborgen werden und blieb verschollen. Die Körper der Toten wurden in der Nähe von Lager 3 beigesetzt. Die Südkoreaner hatten am folgenden Tag einen Angriff auf den Gipfel geplant. Die Besteigung wurde abgebrochen und am 22.9. das Basislager verlassen. Die Todesbilanz am Berg hatte enormen Zuwachs bekommen. Die Annapurna hielt nun bei 78 Expeditionen und bereits 47 tödlich Verunglückten.
1991: Im Zeichen der Nächstenliebe auf den Gipfel verzichtet
Am 28.8. erreichten zehn amerikanische Bergsteiger das Basislager an der Nordseite der Annapurna. Das Team bestand vorwiegend aus professionellen Bergführern und wurde von Matt und Julie Culberson geleitet. Als sie ankamen, war bereits die vorher genannte koreanische Expedition nach Lager 1 hochgestiegen. Die Amerikaner teilten sich die Aufstiegsaktivitäten mit den Sherpas der koreanischen Expedition bis in eine Höhe von 7300 m. Die Südkoreaner selbst sollen kaum einen Beitrag geleistet haben. Die Lawinengefahr im August und September dieses Jahres war enorm gewesen. Auch die Lager der Amerikaner blieben nicht verschont. Ununterbrochen fetzten Lawinen die Fels- und Eiswände der Nordseite hinunter. Mitte September verwüstete der Luftdruck einer Mega-Lawine Lager 1 und blies einen der Bergsteiger 50 m aus dem Lager. Er blieb beinahe unverletzt. Am 18.9. hielten sich in Lager 4 der Amerikaner in einer Höhe von 7325 m die Eheleute Culberson und Bill Crouse auf. Alle technischen Kletterschwierigkeiten lagen hinter ihnen, und das Lager lag versteckt an der Basis eines Seracs, der vor den gewaltigen Lawinen schützte. Der 19.9. sollte ein Rasttag werden, bevor man am 20.9. zum Gipfel aufbrechen wollte. Am 19.9. mittags passierten sechs Sherpas und zwei Südkoreaner ihr Lager. Es wurde gemunkelt, dass die Südkoreaner ihre Sherpas dazu nötigten, rasch ein Lager auf 7500 m zu errichten. An einem Platz, der nicht lawinensicher gewesen sein soll. Zwei Stunden später toste eine Riesenlawine durch das Lager der Amerikaner und begrub es teilweise, insbesondere die ‚Culbersons‘, unter sich. Rouse musste sie freischaufeln. Schnell hatte das amerikanische Gipfeltrio mitbekommen, dass die Aufsteigenden der koreanischen Expedition Opfer der Lawine geworden waren und von dieser in die Tiefe gerissen worden waren. Zwei der Sherpas konnten sich in das Lager der Amerikaner retten. Selbstlos brachen die Amis ihren Gipfelangriff ab und stiegen mit den beiden Sherpas ab, um Hilfe zu leisten. Das Schicksal der koreanischen Bergsteiger und Sherpas wurde im vorhergehenden Kapitel ausführlich dargestellt, deshalb muss man in diesem Abschnitt nicht nochmals darauf eingehen. Fünf Tage nach den tragischen Ereignissen stiegen Paul Valiulis, Ron Johnson und Matt und Julie Culberson abermals nach Lager 3 hoch. Sie wollten prüfen, ob ein Angriff zum Gipfel noch möglich war. Doch oberhalb von Lager 3 wurden sie mit einer instabilen Schneeauflage und starkem Wind konfrontiert. Die Lawinengefahr war zu hoch. Die Amerikaner bliesen ihr Vorhaben ab.
Julie Culberson kam im August 1993 auf dramatische Weise ums Leben, als sie und ihr Mann in den Rocky Mountains im Banff Nationalpark den Mount Temple besteigen wollten, aber von einer Lawine überrascht wurden. Beide konnten sich schwerverletzt aus der Lawine retten. Julie hatte zwei Oberschenkelbrüche weggetragen und möglicherweise auch innere Verletzungen gehabt. Jim hatte sich einige Rippen gebrochen. Das Paar einigte sich darauf, dass Jim Hilfe holen sollte. Jim hinterließ seine Frau und alle Habseligkeiten, welche ihr zum Überleben helfen sollten, und machte sich, selbst schwer verletzt, auf den Weg. Aber er kam nur langsam voran und hatte selbst Glück, bei tiefen Temperaturen und starken Niederschlägen am Leben zu bleiben. Nach mehr als 48 Stunden Irrfahrt war er glücklicherweise auf zwei Wanderer gestoßen. Einer blieb bei ihm, während der zweite einen Park Ranger informierte. Innerhalb kürzester Zeit war ein Rettungshelikopter in der Luft. Doch es war zu spät. Als man zum Platz der Schwerverletzten kam, war sie bereits verstorben. Alleine in der Wildnis der Rocky Mountains im 36. Lebensjahr.
In ihrem Namen wurde ein Stipendienfonds innerhalb der American Mountain Guides Association eingerichtet. Er war an Frauen gerichtet, die gerne kletterten und an Frauenexpeditionen teilnehmen wollten. Er unterstützte auch Frauen, die den Beruf als Bergführerin ausüben wollten.
1991: Spanier folgten Südkoreanern und Amerikanern
Vierzehn Spanier besetzten für achtzehn Tage die Nordflanke der Annapurna. Ihr Leiter war der aus Galizien stammende Albino Quinteiro. Am 6.9. bauten die Spanier am Platz des Basislagers ihre Zelte auf. Und natürlich bekamen sie mit, wie sich die Südkoreaner und die Amerikaner am Berg abrackerten, um mit den Schneemassen und den Lawinen fertig zu werden. Eine Lawine war es auch, die den Spaniern zu schaffen machte. Sie brach am 14.9. vom Ostgipfel ab und traf Lager 1, welches am 9.9. auf 5050 m aufgestellt wurde. Alle Zelte wurden geknickt. Lager 2, in Form einer kleinen Eisgrotte, war gerade erst am 13.9. errichtet worden, als auch die Höhle von der Riesenlawine getroffen wurde. Allerdings lag sie gut geschützt und die Lawinenausläufer konnten keinen Schaden anrichten. Am 19.9. gelangten die Spanier auf eine Höhe von 6300 m. Doch Tiefschnee und immer stärker werdende Lawinengefahr ließen sie zögern, weiter aufzusteigen. Dazu kamen die Ereignisse mit vielen Toten einige Tage zuvor. Die Spanier machten das Richtige und entschieden am 22.9., es sein zu lassen. Am 24.9. war von ihnen am Platz des Basislagers nichts mehr zu sehen. In den Fußstapfen der Südkoreaner hatten sie schon ihre Heimreise angetreten.
1991: Japaner folgten Spaniern, Amerikanern und Südkoreanern
Am 10.9. trudelten dann noch 11 Japaner an der Nordflanke ein und verwandelten den Platz des Basislagers endgültig in eine Zeltstadt. Die ‚Hokkaido Central Workers Alpine Federation‘ war Sponsor des Besteigungsversuchs über die Holländer-Rippe und Masaru Otani der Leiter der Expedition. Es ist wohl nicht mehr erforderlich zu erwähnen, dass auch die Japaner mit denselben Herausforderungen zu kämpfen hatten wie alle anderen Expeditionen, die sich an der Nordflanke aufhielten. Bis zum 1.10. schafften sie es bis auf eine Höhe von 6450 m. Ihr letztes Lager hatten sie in einer Höhe von 6300 m aufgeschlagen. Knapp oberhalb der Holländer-Rippe. Am 1.10., als sie nur noch alleine am Berg waren, weil zu diesem Zeitpunkt bereits alle anderen Expeditionen den Berg verlassen hatten, wurden sie von einer Lawine überrumpelt, die einen Bergsteiger unter sich begrub. Nur schnelles Handeln aller ermöglichte das Überleben des Bergkameraden. Er wurde unverletzt aus den Schneemassen ausgegraben. Nachdem auch am 3.10. am frühen Vormittag eine Lawine das Basislager und das ABC-Lager verwüstete und mehrere Zelte zusammenbrachen, hatten die Spanier genug. Sie verließen die Stätte von Schnee und Lawinen am 8.10.
1991: Wielicki brachte sein ganzes Team zum Gipfel
Eine namhafte polnisch/internationale Expedition unter Leitung des Polen Krzysztof Wielicki machte es sich unter der Südwand der Annapurna bequem. Man wollte jene Linie durch die Wand steigen, die Chris Bonington im Jahr 1970 vorgelegt hatte. Wielicki hatte nicht nur Bergsteiger verschiedener Nationen, sondern auch Frauen dabei. Keine Geringere als Wanda Rutkiewicz gehörte zum Team, wie auch Jolanta Patynoska. Ansonsten hatte er Ryszard Pawlowski, Bogdan Stefko und Mariusz Sprutta an Bord. Der Deutsche Rüdiger Schleypen, die Belgierin Ingrid Baeyens, der Brite John Keska und der Portugiese Goncalo Velez rundeten sein internationales Ensemble ab. Am 11.9. war das Basislager errichtet und lediglich zwei Tage später folgte ein ABC-Lager auf 4850 m Höhe direkt am Einstieg in die Wand. Der Weg dorthin über den Gletscher glich einem Zickzackkurs, weil man sich laufend um riesige Felsblöcke seinen Weg bahnen musste. Zur gleichen Zeit befand sich unterhalb der Südwand eine weitere polnisch/internationale Expedition. Beide Mannschaften kooperierten bei ihren Aufstiegsaktivitäten und teilten sich auch den Platz des Basislagers. Bis zum 11.10. hatten Wielicki und sein Team drei Lager errichtet. Letzteres stand in einer Höhe von 7350 m. Die Zelte in Lager 1 wurden in einer Höhe von 6100 m am 20.9. aufgeschlagen. Von da an ging es schleppend voran. Die technischen Schwierigkeiten zwischen Lager 1 und dem anvisierten Lager 2 waren enorm. 700 vertikale Höhenmeter galt es zu überwinden, gespickt mit Eisrinnen von 55 bis 60 Grad Neigung und knallhartem Eis. Die Vorbereitungen zum Durchstieg nach Lager 2 nahmen zwei ganze Wochen in Anspruch. Immer wieder wurden die Arbeiten durch Steinschlag unterbrochen. Unter anderem wurden bei starkem Wind in einem Eiscouloir alle bereits befestigten Fixseile durch niedergehende Steine und Eis durchschlagen. Das Team arbeitete am Anschlag. Am 4.10. war man in der Lage, Lager 2 einzurichten. Insgesamt wurden bis nach Lager 3 2500 m Fixseile montiert. Knapp unterhalb von Lager 3 wurde es nochmals knifflig und gefährlich, als Felsüberhänge zu überwinden waren. Nachdem ein erster Gipfelangriff noch durch starke Winde vereitelt wurde, gelangte Krzysztof Wielicki am 20.10. nach Lager 2 und stieg weiter nach Lager 3. Bogdan Stefko war in Lager 3 bereits anwesend. Am 21.10. gegen 04.30 Uhr verließ Stefko das Zelt Richtung Gipfel. Wielicki folgte ihm im Abstand von 1,5 Stunden. Getrennt waren sie zum Gipfel unterwegs. Wielicki war sogar noch in der Lage, an Stefko vorbeizuziehen, und stand gegen 11.30 Uhr am obersten Punkt. Stefko folgte zwanzig Minuten später. Das Duo verließ den Gipfel wieder um 12.00 Uhr und stieg direkt bis Lager 1 ab, welches es im Mondlicht erreichte.
Ein zweites Team mit Pawlowski, Schleypen und Rutkiewicz führte seine Gipfelattacke einen Tag später durch. Im Morgengrauen waren sie getrennt Richtung Gipfel aufgebrochen und hatten ihren Aufstieg erfolgreich zu Ende gebracht. Die Polen waren die dritte Crew, die es über die Bonington-Route bis zum Gipfel schaffte. Separat verließen sie auch wieder den Gipfelbereich. Pawlowski stieg direkt nach Lager 2 ab. Schleypen biwakierte knapp oberhalb von Lager 3 und Rutkiewicz biwakierte auf 7700 m direkt am Gipfelgrat.
Am 23.9. erreichten auch noch Baeyens, Sprutta und Velez ihr Ziel. Auch sie standen am Gipfel. Velez war der erste Portugiese am Gipfel der Annapurna und der erste auf der Spitze eines 8000ers überhaupt. Übrigens: Alle drei Teams schafften es ohne künstliche Sauerstoffzufuhr. Besser hätte es für Wielickis Team nicht laufen können. Lediglich die Polin Patynoska erreichte den Gipfel nicht. Sie war angeschlagen, weil sie offensichtlich die Höhe nicht vertrug, und hatte stark an Gewicht verloren. Am 26.10. verließ das Expeditionsteam das Annapurna Sanctuary wieder. Sie waren die vierte Mannschaft, der der Durchstieg der Bonington-Route gelang. Wielicki und Rutkiewicz hamsterten jeweils ihren achten 8000er ein, während die Belgierin Baeyens zum dritten Mal, nach Dhaulagiri und Gasherbrum II, auf der Spitze eines Himalaya-Riesen stand. Baeyens würde 1992 mit dem Everest noch einen vierten folgen lassen und war die erste Belgierin am höchsten Punkt unseres Planeten.
Die Erfolge von Kryzstzof Wielicki im Extrembergsteigen waren zum Teil unglaublich. Im Jahr 1980 gelang ihm die erste Winterbesteigung des Mount Everest. 1984 legte er am Broad Peak nach – er bestieg den Berg an einem Tag und war damit der erste, dem dieses Kunststück an einem 8000er gelang. Noch im selben Jahr stand er am Manaslu, den er über eine neue Route bezwang. 1986 gelang die erste Winterbesteigung des Kantsch, und 1988 stand er im Winter am Lhotse ganz oben. Er war vor allem dafür bekannt, rasch auf- und wieder abzusteigen – viele seiner 8000er bestieg er im Alleingang (5) oder auf neuen Routen oder während der Winterzeit (3). Er ist der fünfte Mensch, der alle vierzehn 8000er bestiegen hatte. Dafür ließ er sich 16 Jahre Zeit. Für sein bergsteigerisches Lebenswerk erhielt er im September 2019 den Piolet d‘Or Lifetime Achievement Award (Wie bei allen anderen Sportarten auch werden im Höhenbergsteigen für außerordentliche Leistungen die betroffenen Akteure und Athleten geehrt. Im Rahmen von aufsehenerregenden Leistungen im Extrembergsport wird man mit dem ‚Piolet d‘Or‘ geadelt – die deutsche Bezeichnung für diesen Titel lautet ‚Goldener Eispickel‘. Der Preis wird jährlich verliehen – dies seit dem Jahr 1991. Langjährige und renommierte Bergsteiger erhalten auch einen Preis für ihr Lebenswerk. Nach dem ersten Preisträger benannt, lautet er ‚Piolet d‘Or Lifetime Achievement – Walter Bonatti Award‘. Die Preisverleihung, organisiert von der Zeitschrift ‚Montagne Magazin‘ und dem französischen).
Die in Litauen geborene Polin Wanda Rutkiewicz gehörte zu den wichtigsten Frauen des Alpinsports des 20. Jahrhunderts. Von 1978 bis 1992 bestieg sie acht 8000er. Im Jahr 1978 bestieg sie als erster polnischer Staatsbürger, erste Europäerin und dritte Frau überhaupt den Mount Everest. 1982 und 1984 scheiterte sie mit Frauenexpeditionen am K2. Nachdem sie 1984 den Nanga Parbat bezwang, holte sie 1986 den K2 nach – sie war auch die erste polnische Person am K2 überhaupt. 1987 folgte gemeinsam mit Jerzy Kukuczka der Shishapangma. Im Jahr 1989 wurde der Film ‚Die Schneefrauen‘ anlässlich einer weiteren Frauenexpedition zum Gasherbrum II gedreht. 1990 folgten der Hidden Peak und 1991 Cho Oyu und Annapurna – jeweils alleine. Ihr achter 8000er, der Kangchendzönga, sollte ihr 1992 zum Verhängnis werden. Am 12.5.1992 begann für Wanda Rutkiewicz und ihren Kletterpartner Carlos Carsolio die letzte Etappe beim Anstieg zum Gipfel des Kantsch. Rutkiewicz versuchte den Kantsch bereits zum dritten Mal. Durch eine Verletzung wurde sie langsamer und Carlos Carsolio erreichte den Gipfel alleine. Beim Abstieg traf er sie auf 8300 m an, als sie ihr Biwak für den Gipfelaufstieg am nächsten Tag vorbereitete. Sie hatte jedoch keinen Schlafsack und auch keinen Kocher, kein Wasser und keine Verpflegung dabei. Dennoch bestand sie darauf, den Gipfel noch zu besteigen, und erkundigte sich bei Carsolio nach den Schwierigkeiten und Details des weiteren Aufstiegs. Carsolio war der Letzte, der Wanda Rutkiewicz lebend gesehen hatte. Er stieg alleine zum Lager ab, in dem er noch drei Tage wartete – doch Wanda kam nicht – sie sollte nie mehr wiederkehren. Wanda Rutkiewicz blieb 49-jährig in ihren geliebten Bergen verschollen. Sie wurde nie gefunden. Selbst hatte sie einmal geschrieben, nichts dagegen zu haben, in den Bergen zu sterben. Sie würde dann dort fast alle ihre Freunde treffen. Nun, das Warten ihrer Freunde hatte ein Ende genommen. Eine Gedenktafel an Rutkiewicz befindet sich heute am ‚Symbolischen Friedhof der am Berg Verunglückten‘ in der Hohen Tatra.
Ryszard Pawlowski gehört zur Garde der polnischen Hochalpin-Pioniere. Er kletterte mit Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki, Janusz Majer und Piotr Pustelnik. Er stand auf 10 8000ern – den Mount Everest bestieg er fünfmal.
Der Deutsche Rüdiger Schleypen stand in den 1980er-Jahren auf sechs 8000ern. Er starb im Jahr 2016 79-jährig.
1991: Das Verschwinden von Gabriel Dunamur
Eine weitere polnisch/internationale Expedition führte der Pole Mieczyslaw Jarosz zur Südwand. Sein bunt zusammengewürfeltes Team bestand aus sechzehn Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus Polen, Tschechoslowakei, Belgien und Italien. Ursprünglich wollte Jarosz auf der Route seiner Landsmänner aus dem Jahr 1981 zum Gipfel. Damals wurde der östlichste Pfeiler der Südwand bis zum Mittelgipfel geklettert. Aber in diesem Jahr wurde diese Route durch laufenden Stein- und Eisschlag in Mitleidenschaft gezogen, sodass man zur Bonington-Route wechselte. Das Basislager bezog man am 12.9. und arbeitete mit der polnisch/internationalen Expedition unter Leitung von Krzysztof Wielicki eng zusammen. Natürlich hatte auch Jarosz' Team mit denselben Herausforderungen wie Wielickis Team (im vorhergehenden Kapitel beschrieben) zu kämpfen.
Am 18.10. wurden der Pole Kazimierz Stepien und der Belgier Gabriel Dunamur nach Lager 2 geschickt, um es zu räumen. Aber die beiden Bergsteiger stiegen weiter an bis Lager 3. Offensichtlich taten sie dies ohne Rücksprache mit der Expeditionsleitung. Ab dem 18.10. war auch jeder Funkkontakt zu ihnen abgebrochen. Zuletzt hatten sie sich aus Lager 2 gemeldet. Ihren ersten Gipfelversuch starteten sie in der Nacht vom 19.10. auf den 20.10. von Lager 3 aus 7300 m Höhe. Doch der Versuch scheiterte nach zwei Stunden wegen extremer Kälte. Sie kehrten wieder nach Lager 3 zurück. Man wollte es ein zweites Mal probieren. Am kommenden Morgen, dem 20.10., machte sich Dunamur gegen 06.00 Uhr alleine Richtung Gipfel auf. Stepien sollte der Letzte gewesen sein, der mit Dunamur Worte gewechselt hatte. Nie mehr hatte man etwas von ihm gesehen oder gar gehört. Stepien blieb noch bis mittags im Schlafsack und brach erst gegen 12.00 Uhr auf. Selbstverständlich ohne künstlichen Sauerstoff – Ehrensache. Schnell stellte sich heraus, dass er es am selben Tag nicht mehr schaffen würde. Es wurde dunkel und er drohte, die Spur zu verlieren. Also entschloss er sich für ein Biwak auf 7700 m, in der Hoffnung, seinen Weg am nächsten Morgen fortsetzen zu können. Doch während der Nacht begann Stepien, sich nicht wohlzufühlen. Offenbar begann er an der Höhenkrankheit zu leiden. Außerdem begannen, bedingt durch die extreme Kälte der Nacht, seine Füße zu frieren. Er entschloss sich dazu, den Weg nicht fortzusetzen, und drehte um. Das Schicksal von Dunamur war ihm zu diesem Zeitpunkt unbekannt. Während er abstieg, traf er gegen 09.00 Uhr auf Kryzsztof Wielicki, den Leiter der zweiten polnisch/internationalen Expedition, der gerade auf dem Weg zum Gipfel war, und erklärte ihm in konfusen Worten, möglicherweise war er durch die Höhenkrankheit schon beeinträchtigt, die Situation. Dann stieg er bis Lager 2 ab. Wielicki informierte Jarosz via Funk über den Status von Dunamurs Verbleib.
Dunamur hatte bei seinem Aufbruch kein Funkgerät dabeigehabt. So konnte keiner mit ihm, betreffend seinen Kletterstatus, Kontakt halten. Doch den Gipfel dürfte er mit Sicherheit erreicht haben. Denn Krzysztof Wielicki, der den Gipfel am 21.10. gegen die Mittagszeit erreichte, hatte Fußspuren festgestellt. Das bedeutete, dass Dunamur entweder in den Nachtstunden den Gipfel erreicht haben musste oder am frühen Vormittag. Beim Aufstieg Wielickis war ihm ein Dunamur nicht entgegengekommen. Auch den beiden anderen Gipfelpartien aus Wielickis Team war kein Dunamur aufgefallen. Im Gegenteil, die Fußspuren am Gipfel deuteten darauf hin, dass Dunamur die Nordseite der Annapurna hinab abgestiegen sein dürfte. Anders konnte es nicht sein, denn von der Nordseite hatte im Jahr 1991 bis zum 21.10. kein Mensch den Gipfel betreten, um dort Spuren zu hinterlassen. Erst am 24.10. gelangten Bergsteiger einer russischen Expedition, Nikolai Cherny und Sergei Arsentiev, über die Nordwand zum Gipfel. Bei ihrem Aufstieg konnten sie auf ihrer Route aber keine Abstiegsspuren feststellen, noch fanden sie irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, die auf den Verbleib von Dunamur hätten schließen lassen. Andererseits wehte auf der Nordseite so starker Wind, dass Fußspuren innerhalb von 2–3 Stunden nicht mehr erkennbar gewesen wären. Schon am 20.10. und 21.10. hatten die Russen vom Basislager aus, nachdem sie über das Verschwinden von Dunamur informiert worden waren, mit Ferngläsern Ausschau in den oberen Bereich der Nordflanke gehalten. Irgendeine menschliche Spur war aber nicht festzustellen gewesen. Ihre Beobachtungen setzten sie auch noch einige Tage fort, ohne eine Bewegung am Berg feststellen zu können. Möglicherweise war Dunamur auf einer anderen, nicht einsehbaren Route durch die Nordwand unterwegs gewesen. Hatte Dunamur tatsächlich die Überschreitung des Massivs vorgehabt, obwohl er weder Proviant, Gas, Daunenjacke noch Biwaksack mit dabeihatte? Diese Annahme galt als reine Spekulation und als eher nicht zutreffend. Genauso wie die Annahme, er könnte am Gipfel verwirrt gewesen sein, hatte den falschen Weg eingeschlagen und war irgendwann abgestürzt.
Bis zum 26.10. war Dunamur nicht ins Basislager an der Südwand zurückgekommen. Einen zweiten Gipfelversuch hatte Jaroszs Team nicht mehr unternommen, weil die Proviantvorräte zu Ende gegangen waren. Ebenso wurde kein Suchtrupp losgeschickt, da man gar nicht wusste, wo man in der Weite der Südwand hätte suchen sollen. Man musste den Heimweg antreten. Ohnehin war man davon ausgegangen, dass man spätestens bis zum 23.10. abreisen musste. Auch die anwesenden Expeditionen auf der Nordseite des Berges, welche zwischenzeitlich von den Vorkommnissen informiert worden waren, konnten Dunamurs Verbleib nicht eruieren. Die letzte Meldung rund um Dunamurs Verschwinden gab der kroatische Bergsteiger Miroslav Svesticic ab, der Ende Oktober einen Soloaufstieg durch die Westflanke riskiert hatte. Bei seinem Abstieg aus der Nordwestflanke war er zur Nordseite traversiert. Dabei waren ihm am Fuße eines Eiscouloirs auf einer Höhe weit über 7000 m Fußspuren aufgefallen. An einem Ort, an den normalerweise kein Bergsteiger gelangen konnte …
Dunamur blieb verschollen und sein Verbleib blieb bis heute ein mysteriöses Geheimnis des Berges. Die Annapurna hatte ihr 48. Todesopfer gefordert.
1991: Südwand - Am Mittelpfeiler gescheitert – an der Bonington-Route erfolgreich
Unter dem Logo ‚First Moscow Expedition to Himalaya‘ führte Vasili Senatorov elf Russen zur Südwand der Annapurna. Die Japaner hatten es 1981 über den Mittelpfeiler vorgemacht. Die Russen wollten über diese Route ebenfalls nach oben gelangen. Am 18.9. hatte man das Basislager aufgeschlagen, und bis Ende September erreichten neun Bergsteiger eine Höhe von 6500 m. Dabei hatte man kein stationäres Lager etabliert, sondern war nach 2–3 Nächten immer höher gestiegen. Am 30.9. war die Aufstiegsgruppe starkem Steinschlag ausgesetzt. Valeri Karpenko erlitt dabei einen Beinbruch und Dmitri Egorov wurde am Rücken verletzt. Die Russen waren nun mit einer Rettungsaktion konfrontiert. Die Verletzten mussten vom Berg. Und das dauerte. Ganze 60 Stunden benötigten die Bergsteiger, um die beiden Schwerverletzten 2,5 Kilometer tiefer ins Basislager zu transportieren. Dort wartete bereits ein Evakuierungshubschrauber und flog die beiden Leidgeplagten ins Spital nach Kathmandu. Die Russen starteten einen zweiten Versuch und gelangten innerhalb von zwölf Tagen mit sieben Bergsteigern in eine Höhe von 7350 m. Die Route war durch hartes Eis und schwierigen Fels extrem anspruchsvoll. Am 17.10. erkrankte Alexander Shinov an der Höhenkrankheit. Es hieß, so rasch wie möglich nach unten zu gelangen. Alle sieben stiegen ab. Aber der Schwung war nun draußen, die Bergsteiger waren müde, und außerdem begann der Proviant auszugehen. Mithilfe einer amerikanischen Expedition wurden die Russen gut versorgt. Als man bereits abreisen wollte, traf man auf Krystzof Wielicki, der den Russen die Bonington-Route schmackhaft machte. Ein Quartett von vier Russen schickte sich an, die 1970er-Route in Angriff zu nehmen. Am 22.10. erreichten sie das ABC-Lager der Polen und stiegen einen Tag später nach Lager 1 auf 6150 m auf. Am 24.10. waren sie bereits in Lager 2 angelangt und stiegen einen Tag später auf 7300 m. Alles war glatt gegangen, denn die Russen konnten die mit Fixseilen gesicherte Route der Polen nutzen. Sie befanden sich im Ausgangslager Ihres Gipfelsturms. Am 26.10. wollte das russische Quartett gegen 06.00 Uhr zum Gipfel aufbrechen, aber es war viel zu kalt. Sie blieben vorerst im Zelt. Um 09.00 Uhr war es immer noch extrem kalt und dazu war starker Wind aufgekommen. Trotzdem entschieden sie sich, in zwei 2er-Gruppen aufzubrechen. Und sie hatten Erfolg. Vladimir Bachkirov und Vladimir Obichod standen gegen 14.00 Uhr ganz oben, und Sergei Isaev und Nikolai Petrov waren ihnen 15 Minuten später gefolgt. Am Gipfel hielten sie sich weit über eine Stunde auf, hissten die russische und nepalesische Flagge und drehten einen Gipfelfilm. Lager 3 erreichten sie wieder um 17.30 Uhr, und am 28.10. waren sie retour im Basislager.
1991: Kapituliert knapp über 6000 m
Sechs Österreicher hatten sich im Herbst an der Nordseite des Bergmassivs eingefunden. Unter der Leitung von Hubert Fritzenwallner wollte man über die Holländer-Rippe nach oben gelangen. Schon beim Transport gab es Probleme mit den Trägern, und die Expeditionsmitglieder mussten ihre Ausrüstung eine letzte Etappe lang selbst zum Platz des Basislagers schaffen. Schnell war klar geworden, dass man die Holländer-Rippe nicht hochkommen würde. Die Schneeverhältnisse waren zu labil und unberechenbar. Einer Lawine wollte man natürlich nicht zum Opfer fallen. Man wich auf den Nordwestpfeiler aus und errichtete zum bis 8.10. drei Lager bis auf eine Höhe von 6000 m. Davor hatte man noch großes Glück, als eine Riesenlawine während der Frühstücksstunde ihren Weg bis ins Basislager fand. Während man im Basislager noch halbwegs glimpflich davongekommen war, wurden die Fixseile auf der Route nach Lager 1 komplett zerstört. Am 13.10. versuchte man einen weiteren Vorstoß, stoppte aber bei 6120 m. Auch hier waren die Schneebedingungen zu weich und man traf sich wieder in Lager 2. Dort diskutierte man die Situation und entschied, dass es zu gefährlich sei, weiter aufzusteigen. Am 17.10. verließ man die Annapurna.
1991: Drei Biwaks oberhalb der Holländer-Rippe
Von der russischen Expedition, welche im Herbst an der Nordseite ihr Glück versuchte, hatten wir schon in vorhergehenden Kapiteln gehört. Sie hatten tagelang nach einem Belgier Ausschau gehalten, der von der Südseite den Gipfel erreicht haben soll und möglicherweise über die Nordseite einen Abstiegsversuch lancierte. Die Russen konnten allerdings keine Beobachtungen machen.
Nun können wir uns mit der Expedition der Russen und ihrem Vorhaben etwas näher beschäftigen. Im Namen der ‚Vistonik Annapurna Expedition‘ waren vier Bergsteiger unter Leitung von Alexander Glushkovski an der Nordseite angekommen. Sie hatten, wie so viele ihrer Vorgängerexpeditionen, vor, über die Holländer-Rippe zum Gipfel zu gelangen. Am 8.10. bezogen sie ihr Basislager. Lager 1 lag auf 5200 m und Lager 2 kurz vor der Traverse zur Holländer-Rippe auf 5800 m. Lager 3 wurde am obersten Punkt der Rippe auf 6450 m aufgeschlagen. Es war der 13.10. Danach stiegen die Russen wieder ab und starteten am 19.10. erneut vom Basislager aus. Diesmal mit der Absicht, den Gipfel zu erreichen. Am 20.10. hatten sie die Holländer-Rippe hinter sich gelassen und übernachteten im Lager 3. Danach hatten sie keine fixen stationären Lager mehr geplant. Innerhalb der folgenden drei Tage biwakierten sie dreimal. Zuletzt am 23.10. auf über 7800 m. Am 24.10. war das Wetter, als sie aufbrachen, sehr windig. Gegen 11.00 Uhr erreichten Nikolai Cherny und Sergei Arsentiev den Gipfel, wo sie sich eine Stunde lang aufhielten. Dann stiegen sie wieder zu ihrem Biwakplatz auf 7300 m ab. Am 25.10. kletterten sie weiter Richtung Lager 1, welches sie bei Dunkelheit erreichten. Am 26.10. morgens langten sie im Basislager ein. Cherny hatte sich beim Gipfelversuch leicht die Finger erfroren. Am 30.10. waren die Träger eingelangt und man trat die Heimreise an.
Sergei Arsentiev war einer der erfolgreichsten russischen Bergsteiger seiner Zeit. Er war auch als der ‚Snow Leopard‘ bekannt. In Russland hatte er alle 7000er-Gipfel bestiegen. Berühmt wurde er auch aufgrund seiner Beziehung zu seiner amerikanischen Frau Francys Distefano. Gemeinsam gaben sie ein ausgezeichnetes Kletterpaar ab und feierten viele Erfolge im Himalaya. Ihr größter Traum war es, am Gipfel des Mount Everest zu stehen. Diesen Traum erfüllten sie sich am 22. Mai 1998. Francys war die erste amerikanische Frau, die ohne künstliche Sauerstoffzufuhr am Gipfel des höchsten Berges der Erde stand. Doch die fehlende Sauerstoffzufuhr sorgte dafür, dass sie beim Anstieg nur sehr langsam vorankamen und erst sehr spät am Gipfel standen. Die Folge war ein Biwak während ihres Abstiegs in einer Höhe von 8000 m. Dabei wurden sie während eines Schneesturms getrennt und mussten jeder für sich alleine ausharren. Am nächsten Morgen stieg Sergei bis ins letzte Lager ab. Seine Frau war noch nicht anwesend. Also begann er, sich Sorgen zu machen. Mit einer Sauerstoffflasche und Medikamenten machte er sich auf, sie zu finden. In den Morgenstunden traf eine usbekische Expedition nur einhundert Meter unterhalb des Gipfels auf die halb bewusstlose Francys. Sie litt an schwerem Sauerstoffmangel und Erfrierungen. So trugen sie die Schwerverletzte, solange ihr eigener Sauerstoff noch Luft gab, so weit wie möglich nach unten, mussten sie dann aber liegen lassen. Beim weiteren Abstieg trafen sie Sergei. Die Usbeken wussten nicht, dass sie die Letzten waren, die ihn lebend gesehen hatten. Am nächsten Morgen kamen der Brite Ian Woodall und die Südafrikanerin Cathy O'Dowd bei Francys vorbei. Sie brachen ihren Gipfelversuch ab, um ihr zu helfen, und fanden in unmittelbarer Nähe auch noch Ausrüstungsgegenstände von Sergei. Aber nach einer Stunde mussten sie ihre Hilfeleistungen aufgrund der Wetterlage abbrechen. Sie mussten danach trachten, ihr eigenes Leben zu retten. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als Francys ihrem Schicksal zu überlassen. Jenes ihres Ehemannes blieb für ein Jahr lang ein Geheimnis. Sergei wurde 1999 tiefer am Berg tot aufgefunden. Er war abgestürzt. Wie es dazu kam, blieb Geheimnis des Berges. Seine Frau Francys lag neun Jahre lang an derselben Stelle, an welcher sie starb. Gut sichtbar für hunderte Bergsteiger, die auf dem Weg zum und vom Gipfel waren. Ian Woodall, der sie vor ihrem Tod zurücklassen musste, weil er sonst selbst gestorben wäre, kehrte 2007 an den Ort der Geschehnisse zurück. Seine Unfähigkeit, ihr zu helfen, hatte ihm jahrelang keine Ruhe gelassen, und er wollte nicht, dass ihr Körper zu einem Wahrzeichen am Everest wurde. In der Bergsteiger-Community hatte man ihr bereits den Beinamen ‚Sleeping Beauty‘ gegeben. Nach einem kurzen Ritual überließ er ihren mumifizierten Körper den unendlichen Hängen des Everest-Massivs. Keiner sollte mehr an Francys Arsantievs sterblichen Überresten vorbeiklettern. Woodall würde später erzählen, dass es sich um den härtesten Job seines Lebens gehandelt hatte – härter als jede Besteigung eines 8000ers. Das Ehepaar, beide wurden 40 Jahre alt, hinterließ einen Sohn und eine Tochter, jeweils aus erster Ehe.
1991: Miroslav Sveticic und sein Solo in der Nordwestflanke