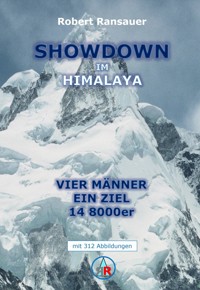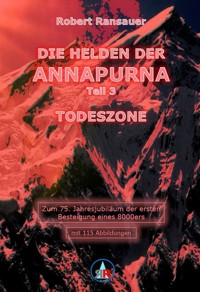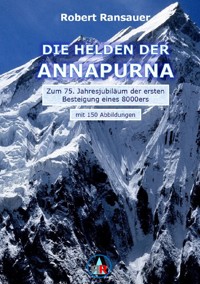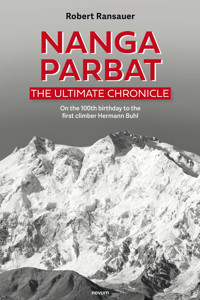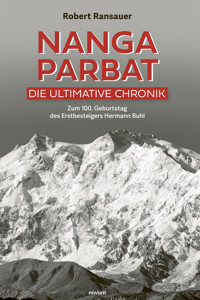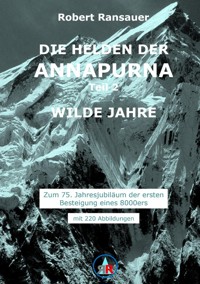
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mitte der 1960er Jahre waren alle 8000er erstbestiegen. Es folgten die alternativen Routen über unbesteigbar wirkende Grate so wie senkrechte und überhängende Wände. Man nannte diese längst vergangene Epoche im Himalaya, welche in den 1970er und 1980er Jahren spielte, auch 'die wilden Jahre' und sprach auch vom 'Aufbruch in neue Zeiten des Alpinismus'. So auch an der Annapurna, mit einer Höhe von 8091 m der zehnhöchste Berg unseres Planeten. In jene Periode fallen auch die Bezwingung der gefürchteten Annapurna-Südwand und Nordwestflanke, der kilometerlange und teuflische Ritt entlang des Ostgrats mit der Überschreitung des Gebirgsmassivs, als auch abenteuerliche An- und Rückmarschwege durch unwegbares Gelände. Der medienwirksame Einbruch einer amerikanischen Frauenexpedition in eine traditionell von Männern beherrschte Domäne ergänzen zwei Dekaden Himalayageschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Ransauer
DIE HELDEN DER
ANNAPURNA
Band 2
WILDE JAHRE
DIE JAHRE 1970 BIS 1989
Texte: © 2025 Copyright by Robert Ransauer
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright Abbildung: Alessandro Gogna. Weiterbearbeitet Robert Ransauer
Verlag:
Robert Ransauer
Leopold Stipcakgasse 9
2331 Vösendorf
Österreich
Autoren Webiste www.ransi-berge.at
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH,
Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung
Vorwort:
Der zweite Band der Annapurna-Trilogie, welche man als Fortsetzung meines ersten Buchs ‚Die Helden der Annapurna‘ betrachten darf, trägt den Untertitel ‚Wilde Jahre‘.
Nachdem auch Mitte der 1960er-Jahre alle 8000er bestiegen waren, fragte man sich das, was man sich schon immer auf den Bergen fragte: Was kommt als Nächstes? Man gab dieselbe Antwort, denn eine andere gibt es nicht. Wenn alle Gipfel bestiegen sind, dann folgen die alternativen Routen, die ‚Schwierigeren‘, die scharfen, unbesteigbar wirkenden Grate, die senkrechten und überhängenden Wände. Derer gab und gibt es im Himalaya und auf den 8000ern Unmengen – auch an der Annapurna. Und deswegen folgte an der Annapurna als Nächstes die Suche nach alternativen und neuen Herausforderungen.
Man nannte diese Periode, die in den 1970er- und 1980er-Jahren spielte, auch ‚die wilden Jahre‘ oder sprach vom ‚Aufbruch in neue Zeiten des Alpinismus‘.
Nach der Erstbesteigung durch Franzosen im Jahr 1950 waren es die Deutschen Günter Hauser und Ludwig Greißl die es 1965 und 1969 versuchten, um über alternative Routen zum Hauptgipfel zu gelangen. Beide scheiterten und gaben sich mit Nebengipfeln am Ostgrat des Bergmassivs zufrieden. Es dauerte weitere 11 Jahre, bis sich wieder Bergsteiger, es waren Briten, im Jahr 1970 am Hauptgipfel versuchten. Auf beeindruckende Weise. Sie nahmen eine der höchsten Steilwände des Planeten ins Visier. Die dreieinhalb Kilometer hohe und als unbezwingbar geltende Annapurna-Südwand. Mit tragischem Ausgang.
Es folgten neue Linien an den Flanken des Nordens und des Südens.
Auch die Damen drückten dem Berg ihren Stempel auf. Über eine legendäre amerikanische Frauenexpedition aus dem Jahr 1978, die für bahnbrechende Schlagzeilen sorgte, wird in diesem Buchband ausführlich berichtet. Der medienwirksame Einbruch von Frauen in eine traditionell von Männern beherrschte Domäne. Ein halsbrecherisches Unternehmen mit unglaublich anstrengenden Märschen im Monsunregen, Stürmen, Problemen beim Nachschub, Auseinandersetzungen, Aussöhnungen und tödlichem Ausgang.
Im Jahr 1980 stand der Abenteurer Gustav Harder nicht nur am Gipfel des Berges, sondern er wagte mit seinen Leuten den für undenkbar gehaltenen Rückweg durch eine der gefährlichsten Schluchten des Bergmassivs.
Der mehrere Tage andauernde Ritt auf dem kilometerlangen Ostgrat von zwei Schweizern, durchwegs in einer Höhe weit über 7000 m, und die anschließende Überschreitung des Gebirgsmassivs von Süden nach Norden gehören heute zu einem der unvergesslichen Erlebnisse des Himalayabergsteigens.
Genauso wie der erstmalige Durchstieg der extrem schwierig zu kletternden und gefährlichen Nordwestflanke des Berges durch das italienische Kletterduo Reinhold Messner und Hans Kammerlander.
In die 1980er Jahre fällt auch die erste Winterbesteigung der Annapurna durch die ‚Ice Warriors‘ – die Polen.
In den Aufbruchsjahren im Himalaya war aber einer an der Annapurna immer zugegen. Der Tod. Die Annapurna hatte sich während dieser Zeitspanne zum tödlichsten aller 8000er entwickelt. Nicht weniger als 41 Todesopfer waren in den 1970er und 1980er Jahren zu beklagen. In jener Zeit gelangten 66 Expeditionen zum Berg. Davon standen 19 am Gipfel. Die Erfolgsquote betrug knapp 29 % und war verdammt niedrig. Schlimmer noch war das Verhältnis der Gipfelerfolge verglichen mit den Todesopfern. 57 Expeditionsteilnehmer standen am Gipfel und 41 Personen ließen ihr Leben am Berg. Bei weniger als zwei Gipfelerfolgen war damit ein Todesopfer zu beklagen. Eine erschütternde Bilanz. 44 der 73 Bergsteiger starben in Lawinen. Deshalb wird der Berg auch gerne als ‚Lawinenberg‘ bezeichnet.
Dieser zweite Band meiner Annapurna-Trilogie berichtet daher nicht nur über alpinistische Heldentaten, sondern auch über die Schicksale der für immer am Berg verbliebenen Bergsteiger. Steigen wir daher mit jenen hoch, welche mit ihrer Furchtlosigkeit, Tollkühnheit, Draufgängertum, Risikobereitschaft, Belastbarkeit und Verwegenheit in die unwirtlichste Gegend unseres Planeten vorgedrungen sind. Steigen wir mit jenen Menschen, die wir zu Recht als
‚Die Helden der Annapurna‘
bezeichnen, auf über 8000 m Höhe. Sehen wir uns den gefährlichsten 8000er der Erde aus der Nähe an.
Ihr Autor wünscht Ihnen eine interessante Lektüre.
Vorwegnehmen möchte ich auch, dass in diesem Buch ausschließlich über die Besteigungsgeschichte der Annapurna I berichtet wird. Die Nebengipfel habe ich ausgenommen, es sei denn, sie wurden gemeinsam mit dem Hauptgipfel erreicht oder sie waren auf Grund ihres besonderen bergsteigerischen Wertes zu berücksichtigen.
Einige Bilder im Buch sind nicht immer der heutigen Zeit entsprechend qualitativ illustriert. Dies liegt nicht an der Druckqualität des Buches, sondern am Alter der Fotos bzw. der Dia-Scans. Viele der Bilder stammen aus Zeiten der analogen Fotografie und Diaserstellung. Die Qualität der Abbildungen ist der damaligen Zeit und der jahrzehntelangen Aufbewahrung geschuldet. Bitte um entsprechende Berücksichtigung.
Dieses Buchprojekt wurde im Eigenverlag erstellt. Die Lektoratstätigkeit, wie Rechtschreibung und Interpunktion, wurde vom Autor selbst vorgenommen. Das gilt auch für das Seitenlayout sowie die Gestaltung des Buchumschlags. Ein professionelles Vier-Augen-Prinzip konnte nicht realisiert werden. Es besteht daher keine Garantie für eine grammatikalische Fehlerfreiheit. Ich bitte den Leser, dies nachzusehen.
Das Zitat auf Seite acht dieses Buches entstammt einem Interview des Sir Chris Bonington mit dem Magazin ‚Bergsteiger‘ aus 12-2016.
Zum 75. Jahresjubiläum der Erstbesteigung
der
Annapurna (8091 m)
‚Dass ich lebe, ist pures Glück‘
Sir Chris Bonington
Expeditionsleiter der Annapurna-Expedition 1970
Die vierzehn höchsten Berge der Erde
INHALT
01 AUFBRUCH IN NEUE ZEITEN
02 DIE DRAUFGÄNGER
FACTS & FIGURES
01AUFBRUCH IN NEUE ZEITEN
1970 – 1979
…der Tod kletterte immer mit …
Prägnante Ereignisse
Erstmals durch die mächtige Südwand
Die Alternative im Norden: die Holländer-Rippe
Mächtige Damenexpedition
Erste Schiabfahrt – Tod eines Pioniers
Prägende Persönlichkeiten
Chris Bonington
Xander Verrjin-Stuart
Arlene Blum
20 lange Jahre waren seit dem Jahr 1950 vergangen. Damals, im Sommer des Jahres 1950, am 11. Juli, bat der damals 31-jährige Franzose Maurice Herzog um Audienz beim Premierminister von Nepal, Mohan Shumsher. In einem Land, in welchem zu dieser Zeit politische Unruhen und Verwirrspiele vorherrschten und es fast unmöglich gewesen war, eine Einreiseerlaubnis zu erlangen. Über Jahrhunderte hinweg hatte sich das Land gegenüber dem Ausland verschlossen und abgeschottet präsentiert. Für den Premierminister des Himalayastaates war Herzog aber nicht irgendwer. Er war der Expeditionsleiter einer französischen Himalaya-Expedition, der es gelungen war, einen der höchsten Berge der Erde, die Annapurna, und damit den ersten Berg, der eine Höhe von 8000 m überstieg, zu besteigen. Die Franzosen waren auch die ersten Privilegierten, die eine Einreisegenehmigung für eine Himalayaexpedition in Nepal erlangten. Geschuldet war dies der ausgezeichneten Freundschaft des Vaters des nepalesischen Premierministers mit dem hochgeachteten französischen Gelehrten und Sanskritologen Silvain Levi. Entsprechend überreichte der französische Attaché in Nepal, Christian Belle, während der Audienz Geschenke an die nepalesische Regierung als Dank und Kompensation für den Aufenthalt im Lande. Herzogs Anwesenheit am königlich nepalesischen Hof war die vorletzte Etappe seiner langen Reise gewesen. Die Begrüßung zwischen ihm und dem Premierminister war eigenartig und entsprach nicht der Hofetikette. Hatte aber ihre Gründe. Herzog war nicht in der Lage, seinem Gegenüber die Hand zu schütteln, noch war er in der Lage zu stehen. Herzog konnte lediglich sitzen und selbst dieser Umstand verlieh ihm große Schmerzen. Angekommen war er in einem großen tragbaren Sessel. Begleitet wurde er von seinem Expeditionsarzt und Expeditionsfotografen. Herzogs Gipfelsieg an der Annapurna, den er gemeinsam mit seinem legendären Klettergenie Louis Lachenal erreichte, sorgte für Alpingeschichte. Auf Grund immensen Zeitdrucks – der Monsun stand kurz bevor – schaffte man es in nicht einmal 14 Tagen bis zum höchsten Punkt. Aber nicht nur deswegen benannte man das Abenteuer mehr als die Erstbesteigung eines 8000er-Riesen. Sie war zu einer Überlebensschlacht geworden. In deren Verlauf hatten sich Herzog und Lachenal Hände und Füße erfroren, waren zeitweise erblindet und hatten fast ein Drittel ihres ursprünglichen Körpergewichts verloren. Bereits auf dem Weg zum Gipfel hatte sich das Duo schwere Erfrierungen zugezogen. Der Abstieg vom Berg entwickelte sich zur Tortur, zur Folter und zu einem Desaster unglaublichen Ausmaßes. Man war in Gletscherspalten gefangen, wurde von Lawinen verschüttet und erreichte in Begleitung von Mannschaft und Sherpas nur mit letzter physischer und psychischer Anstrengung nach Tagen das ersehnte Basislager. Als wäre dies nicht bereits genug, mussten Herzog und Lachenal beim wochenlang andauernden Rückmarsch vom Expeditionsarzt Jacques Oudot eine Vielzahl von Fingergliedern und Zehen amputiert werden. Entsprechend geschwächt, fast schon gebrochen, saß Herzog während der Begrüßungszeremonie dem sich in Galauniform befindlichen und mit einem von zentimetergroßen Smaragden und anderen Edelsteinen besetzten Kopfschmuck geschmückten Premierminister gegenüber. „Sie sind tapfer, und wir begrüßen Sie hier als einen tapferen Mann.“ Das waren die Worte, die an Herzog gerichtet wurden, während er mit dem höchsten militärischen Orden Nepals, der ‚Tapferen Rechten Gurkha-Hand‘, geehrt wurde. Selbst diese Zeremonie war für Herzog zu viel. Er konnte nicht mehr und hatte seine letzte, diesmal politische Verpflichtung als Expeditionsleiter erfüllt. Herzog und seine Expedition hatten mit ihrem nie erwarteten Mannschaftserfolg am Gipfel der Annapurna Nepal dazu verholfen, internationales Ansehen zu erlangen. Dem Königreich sollte es in Zukunft gelingen, sich als Ziel für Bergsteiger und Abenteurer zu präsentieren. Immerhin besiedelte man das Land mit den höchsten Bergen des Planeten. Damit waren Herzog und seine Expeditionsmannschaft Wegbereiter für eine breitere Öffnung des Landes geworden. Als zum Abschied die Marseillaise, die französische Nationalhymne, erklang, hatte Herzog nur noch eines im Sinn. Er wollte zurück nach Frankreich. Seine letzte Etappe beginnen. Dorthin, wo ihn bis ans Ende seiner Tage Ruhm und Ehre erwarteten. Seine Rückkehr und der Jubel über den ersten bezwungenen 8000er waren der Startschuss zum Sturm auf 13 weitere Himalaya-Riesen. Nepal würde seine Grenzen und das Tor zum Dach der Welt, dem Himalaya, öffnen. Der Wettlauf auf die höchsten Gipfel der Erde konnte beginnen. Die 1950er Jahre würden zu einem unglaublich erfolgreichen Bergsteiger-Jahrzehnt im Himalaya und in Nepal werden.
Seit dem 3.6.1950 war nun die Annapurna der höchste Berg, den Menschen je bestiegen hatten. Bis dahin gehörte dieser Titel dem Nanda Devi (7816 m) in Indien, der am 29.8.1936 durch eine amerikanisch/britische Expedition bestiegen wurde.
Die Annapurna-Expedition der Franzosen 1950 war eine neue Art des Höhenbergsteigens auf Achttausendern. Hatte man bisher mit einer großen Anzahl von Lagerketten versucht, 8000er zu besteigen, so kam die französische Expedition mit lediglich fünf Lagern bis zum Gipfel aus. Vom Aufstellen des ersten Lagers auf der Aufstiegsroute bis zur Ankunft am Gipfel vergingen gerade einmal 11 Tage. Im Unterschied zu anderen 8000er-Expeditionen waren auch keinerlei Verluste an Menschenleben zu beklagen. Andererseits hatten die beiden Gipfelsieger einen immens hohen Preis, eine Vielzahl von Amputationen ihrer Glieder an Händen und Füßen, für ihren Erfolg in Kauf genommen. Aber hätten sie es nicht gewagt, dann hätten sie auch nicht gewonnen. Nachfolgenden Bergsteigergenerationen kam ihr Erfolg zugute. Vom ersten 8000er-Erfolg ließ sich ein Erfahrungsschatz ableiten, der bis in die heutige Zeit reicht. Von Wagnissen und Wissen bis hin zu Irrtümern und Versuchen. Die Expedition brachte eine breite Palette für die Zukunft mit.
Der Mythos der Besteigung, der bis in die heutigen Tage anhält, ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass sie ‚by fair means‘ erfolgte, ohne künstliche Sauerstoffzufuhr.
Einige Expeditionsmitglieder zeigten ihre Überraschung darüber, wie lange man in großer Höhe den eigenen Energiehaushalt aufrechterhalten und dabei ohne Essen auskommen konnte. Später führte man dies auf den vom Expeditionsarzt Jacques Oudot verabreichten Tablettenmix zurück, der auch eine Menge Aufputschmittel enthielt. Im Nachgang wurde auch behauptet, dass ohne diese Zufuhr an ‚Drogen‘ der Gipfel gar nicht hätte erreicht werden können. In den 1930er Jahren waren Aufputschmittel, um zum Gipfel zu gelangen, verpönt gewesen. Die Franzosen waren als erste Erstbesteiger eines 8000ers in den 1950er Jahren als Vorreiter von Drogeneinnahmen vorgeprescht. Viele machten es ihnen nach. Die Öffentlichkeit nahm daran lange keinen Anstoß. Bergsteigen wurde nicht als Sport im wahrsten Sinne des Wortes gesehen. Eher betrachtete man Drogencocktails als Mittel zum Überleben über 8000 m …
Ich möchte aber dieser gesonderten und in sich abgeschlossenen Geschichte keine Inhalte vorwegnehmen. Man kann sie gerne in meinem Buch ‚Die Helden der Annapurna‘ nachlesen.
20 Jahre lang war die Nordflanke der Annapurna verwaist geblieben. Dies lag daran, dass während der 1950er-Jahre die Welt des Höhenbergsteigens hauptsächlich darum bemüht war, die restlichen 8000er zu besteigen. Das nahm doch ein ganzes Jahrzehnt in Anspruch. In den 1960er Jahren war es nicht mehr so einfach, nach Nepal zu gelangen. Die Anforderungen für Expeditionen stiegen und erforderten oft jahrelange Planung. Dazu kam, dass Nepal während der 1960er-Jahre aufgrund politischer Entwicklungen in der nahen Umgebung des Landes nicht mehr so einfach zugänglich war.
Die Nordflanke und die Nordwestflanke ziehen aus einem Talkessel mehrere Tausend Meter gegen den Himmel. Begrenzt wird dieser Talkessel im Norden durch die Höhenzüge der Nilgiri und Tilicho, die in ihrer weiteren Ausdehnung nach Süden den Talkessel von Westen begrenzen. Im Osten überragt die ‚Grand Barrier‘ das Tal. Den Gletschern der Nordseite entspringt die Miristi Kola (oder auch Nilgiri Kola), die sich in Richtung Westen über Jahrtausende hinweg durch die Berglandschaft ein Flussbett gegraben hat. Sie mündet weiter im Südwesten in den Kali Gandaki–Fluss. Die Schlucht wäre ein idealer Weg zur Nordflanke, ist aber aufgrund ihrer wilden Beschaffenheit nicht begehbar.
Lediglich eine deutsche Expedition aus dem Jahr 1980 versuchte sich auf dem Rückweg durch die Schlucht und litt unter fürchterlichen Bedingungen. Wer in frühen Jahren zur Nordwand wollte, musste daher einen langen, anstrengenden und zum Teil brandgefährlichen Anmarsch in Kauf nehmen, der je nach Witterungsverhältnissen und Schneelage elf bis vierzehn Tage in Anspruch nahm. War er von der Stadt Pokhara durch das Kali Gandaki-Tal noch relativ harmlos, so hatte es der Weg ab Lete in sich. Zuerst durch dschungelähnliches Waldgebiet und extrem steile Grashänge schlängelten sich die Pfade auf Pässe jenseits der 4000 m empor, allen voran der Thulobugin-Pass. Durch hohe Passagen und kaum zu überwindende Felsabschnitte bricht der Pfad in weiterer Folge 2000 m bis in die Miristi Kola-Schlucht ab und mündet in Areale unterhalb der Nordwestflanke, bevor es über Gletschermoränen Richtung Nordflanke geht. Heute geht keiner mehr zu Fuß zur Nordflanke. Per Helikopter werden die Bergsteiger zumeist aus Jonsom oder aus Pokhara zum Basislager geflogen.
Die ersten, die es zwei Jahrzehnte nach den Erstbesteigern an der Nordseite des Berges wieder versuchten, waren Briten.
1970: ‚English Army‘ – Zum Gipfel über die Erstbesteiger-Route
Im Frühjahr entsandte die ‚British Army Mountaineering Association‘ in militärischer Präzision und unter der Patronatschaft eines fünfköpfigen britisch/nepalesischen Komitees eine 8-köpfige englisch/nepalesische Delegation an die Nordflanke der Annapurna. Expeditionsleiter war der damals 34-jährige Major Bruce Niven. Niven war kein Kletterer, aber ein hervorragender Logistik- und Transportoffizier, der für die gesamte Organisation und Durchführung der Expedition zuständig war. Im Vorfeld hatte er sich eng mit Maurice Herzog, dem Expeditionsleiter von 1950, abgestimmt. Mit dabei waren der bergsteigerische Leiter M. W. Henry Day, Gerry F. Owens, Richard A. Summerton, J. Anderson, G. Douglas B. Keelan, Expeditionsarzt David P. M. Jones und Kameramann E. F. Taylor. Während Day, Owens und Summerton ein Jahr zuvor erfolgreich von einer Expedition zum Tirich Mir (7708 m), dem höchsten Berg im Hindukusch, zurückkamen, war es für Keelan und Jones ihre erste Reise in den Himalaya. Die Nepalesen stellten Yudda Bikram Shah und Bagirath Nassimha Rana aus der königlich nepalesischen Armee. Ergänzt wurde das Team durch 5 Sherpas mit dem Sirdar Sonam Girmi und einen Expeditionskoch. Das Ziel war die Wiederholung der Route der französischen Erstbesteiger aus dem Jahr 1950. Nach 20 Jahren war es der erste Versuch, wieder über die Nordflanke zum Gipfel zu gelangen. Während dieser Zeit hatte es kein Mensch an der Nordseite versucht. Am 10.3. war eine Royal Air Force-Maschine aus England abgehoben. Über Singapur gelangte man mit dem gesamten Expeditionsgepäck nach Kathmandu und von dort am 20.3. nach Pokhara. Mit einer Vintage DC3 Dakota aus dem 2. Weltkrieg, einem von zwei Flugzeugen, welche zur ‚King’s Flight‘-Flotte des Königshauses von Nepal gehörten, war das gesamte Team auf der Graslandebahn nahe Pokhara gelandet. Mit einer Hupe am Flugzeug wurde vor der Landung das dort grasende Vieh verscheucht. Nepal ‚anno 1970‘. Eine für motorisierte Vehikel geeignete Straßenverbindung nach Pokhara gab es noch nicht. Und von Pokhara waren Materialtransporte nur mit Trägern oder Maultieren möglich. Dabei hatte man auch fast eine Tonne Gepäck einer englischen Expedition unter Chris Bonington, die zur gleichen Zeit versuchte, über die Südwand den Gipfel der Annapurna zu erreichen. Gemeinsam bezog man auch am Rande von Pokhara eine Gurkha-Militärbasis, wo sich beide Expeditionen sehr freundschaftlich gegenüberstanden. Unter anderem traf Henry Day auf seinen langjährigen Kletterkameraden Nick Estcourt, mit dem er einige unvergessliche Touren in England vollbracht hatte. Da Bonington auch mit seiner Seefracht Pech hatte, da sie sich wegen eines defekten Schiffes um drei bis vier Wochen verspätete, unterstützte man ihn auch noch mit Proviant und Ausrüstung, damit er über die ersten Wochen der Expedition hinwegkam.
Als Träger hatte der Expeditionsleiter Niven tibetische Flüchtlinge rekrutiert, da man in den umliegenden Dörfern nicht in der Lage war, genügend einheimische Träger aufzustellen. Über das Kali Gandaki-Tal nahm man die Anmarschroute in Angriff. Davor musste allerdings noch ein mühsamer Weg von Pokhara nach Tatopani über viele Bergkämme und reißende Gebirgsströme absolviert werden. Immer wieder litt die Expeditionskarawane unter zu wenig Trägern. Immer wieder mussten Etappen doppelt absolviert werden. Als man nach dem Dorf Choya am Thulobugin-Pass, südwestlich des Nilgiris Massivs, ankam (die Franzosen nannten ihn noch ‚Pass vom 27.4.‘), war man, verglichen mit den Franzosen, zeitlich gesehen eigentlich um einen Monat voraus. Doch das war nicht unbedingt ein Vorteil gewesen, eher ein großer Nachteil. Denn es hatte in diesem Winter extrem viel geschneit und die weiße Pracht lag knietief um und auf 4000 m Höhe. Deswegen waren nur 40 Kulis bereit gewesen, über Choya hinaus Lasten zu transportieren. Das hatte zur Folge, dass jeder Mann jede Marsch-Etappe mindestens fünfmal zu absolvieren hatte. Das sollte zur Folge haben, dass die letzte Last erst Ende April im Basislager eintreffen sollte. Es wurde erst mit erheblicher Verspätung auf 4350 m Höhe errichtet. Während die Bergsteiger-Sahibs selbst mit Lasten von bis zu 30 kg vorangingen, blieben die Sherpas zurück, um den Nachschub über die hohen Pässe des Nilgiris-Massivs zu überwachen. Während dieser Zeit erkrankte beim Anmarsch Taylor an einer Lungenentzündung und musste per Hubschrauber am 4000 m hohen Thulogubin-Pass evakuiert werden.
Am 22.4. gelang es den vorgeeilten Sahibs, ein Advanced Base Camp (ABC), später Lager 2, auf knapp unter 6000 m einzurichten. In dieser Höhe stießen die Sherpas erstmals zu den bereits bestens akklimatisierten Sahibs und konnten diese am Berg mit Lastenschleppen unterstützen. Der Platz des ABC war aber nicht lawinensicher gewesen. Das Frühlingstauwetter sorgte dafür, dass immer wieder Ausläufer von Lawinen, die sich vom Sichelgletscher lösten, bis zum ABC-Lager vordrangen. Am 23.4. erkundeten Owens und Summerton erfolgreich die französische Route von 1950 zum Platz von Lager 3 auf 6700 m, kehrten aber wieder zurück. Am 24.4. saßen sie gegen 06.00 Uhr beim Frühstück, als sie von einer Lawine getroffen wurden. Das Zelt, in dem sie sich befanden, wurde zerstört. Selbst von riesigen Eissplittern verletzt, konnten sie sich aus dem Zelt befreien, mussten aber feststellen, dass das Materialzelt und damit ihre gesamte persönliche Ausrüstung für immer verschwunden waren. Zwei Tage später hatte man Lager 2 an einem lawinensichereren Ort neu errichtet. Man einigte sich aber darauf, die französische Route wegen zu hoher Lawinengefahr aufzugeben, und wandte sich dem Nordostpfeiler zu. Dieser schien den Zugang zu den oberen Schneefeldern, die in weiterer Folge zum Gipfel führten, zu ermöglichen.
Die Nordwand ist bekannt für ihre vielfachen Lawinenabgänge großen Ausmaßes. Es gibt Tage, an denen die Lawinen im 20-Minuten-Takt von den hohen Regionen des Berges abgehen. Bedingt durch oft kombiniertes Gelände sind die Aufstiegsrouten auch vielfach Steinschlag ausgesetzt. Seracs behindern in hohem Ausmaß die Wege der Bergsteiger und müssen rasch unterquert werden, damit man nicht von einem kollabierenden Serac erfasst wird. Ansonsten zieren Eisbrüche, versteckte Gletscherspalten und senkrechte Eiswände die Routen.
Day und Keelan gingen nun an die Spitze. Am ersten Tag auf ihrer neuen Route hatten sie erfolgreich die ersten 100 m des steilen Eispfeilers erklommen, indem sie den ganzen Weg über Stufen gesägt und Fixseile angebracht hatten (Fixxseile sind fix im Felsen oder Eis verankerte Seile. Sie werden zumeist am Beginn einer Saison von einem separaten Team angebracht. Sie dienen dazu, Expeditionsteams steile Aufstiege und Abstiege zu erleichtern. Die Seilsicherung der Route erfordert, ähnlich wie die Rotation bei der Akklimatisierung, eine Wiederholung der Anstiege beim Befestigen. Nur die besten Bergsteiger werden für diese Tätigkeit ausgesucht. Es handelt sich um eine anstrengende Arbeit, die sich auch über Wochen hinziehen kann, weil sich Terrain und Wetterverhältnisse laufend ändern.). Am Tag darauf schafften sie weitere 100 m. Dann wechselte man sich mit dem zweiten Kletterduo Anderson und Owens an der Spitze ab. In weiterer Folge bahnten sich die Bergsteiger zehn Tage lang einen Weg den Eispfeiler nach oben. Das Schnee- und Eisklettern an diesem Fels war technisch gesehen das Schwierigste, was sie in ihrer Bergsteigerkarriere bisher erlebt hatten. Aber das waren nicht die einzigen Schwierigkeiten, mit welchen sie zu kämpfen hatten. Regelmäßig wurden sie von kleineren Eislawinen in ihren Aufstiegsambitionen gestoppt. Zweimal wurden durch Eisschlag ihre Fixseile durchtrennt. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt nie jemand beim Anstieg. Sie kletterten und kletterten, bis sie an eine Stelle gerieten, an welcher hoch aufragende Seracs und tiefe Gletscherspalten den Weg versperrten. Damit war auch dieser Weg zum Gipfel versperrt geblieben und die Route über den Nordostpfeiler musste aufgegeben werden. Sie erreichten eine Höhe von 6400 m. Aufgeben wollten Engländer und Nepalesen aber nicht. Während man den Nordostpfeiler geklettert war, war aufgefallen, dass sich das Lawinengeschehen auf der Franzosen-Route beruhigt hatte. Und so beschloss man, die Aufmerksamkeit wieder auf diese Route zu verlegen. Doch dann setzten schwere Schneefälle ein und man musste sechs lange Tage in den Zelten pausieren und versorgte Lager 1 auf 5300 m und Lager 2 auf 6000 m pausenlos mit Nachschub. Diese Zeit nutzte man auch, um Ausrüstung, welche sich noch am Nordpfeiler befand, zu bergen. Die Schneebedingungen dort waren sehr tückisch und lediglich die Fixseile boten Sicherheit. Summerton hatte von Taylor die Filmarbeiten übernommen. Mit der Kamera balancierte er an den Seilen entlang. Als er gerade zum Filmen beginnen wollte, löste sich unter seinen Füßen ein Schneebrett und Summerton stürzte 15 m über eine Eisklippe ab. Er hatte Glück im Unglück. Er landete im weichen Schnee, überlebte, brach sich aber einige Rippen. Er musste von Day und Keelan geborgen und ins Basislager begleitet werden. Der Ausfall von Summerton wog schwer. Denn damit hatten sich die Bergsteiger auf eine Anzahl von vier reduziert, da auch die beiden nepalesischen Armeeangehörigen, welche ausgezeichnete Arbeit verrichteten, unter zunehmenden Anzeichen der Höhenkrankheit litten. Sonam Girmi verkündete, dass lediglich er selbst und ein weiterer Sherpa in der Lage sein würden, bis zu einer Höhe von 6700 m klettern zu können. Dann würden die Sahibs auf sich alleine gestellt sein. Dazu kam, dass der Verlust von Kletterausrüstung durch Lawinen und der sich bald zu Ende neigende Vorrat an Proviant die Situation nicht erleichterten. Außerdem stellte man sich die Frage, wie man die schweren Sauerstoffflaschen in höhere Teile des Berges transportieren wolle. Der bergsteigerische Leiter war gefragt und Day offenbarte den noch verbliebenen und einsatzfähigen Expeditionsmitgliedern seinen Plan. In militärischer Manier wurden die Proviantierungen gekürzt und nur ein Minimum an benötigter Ausrüstung in die höheren Lager transportiert. Die Sauerstoffflaschen konnten aufgrund ihres Gewichtes nicht in planmäßiger Menge hochbefördert werden. Man beschloss, vier Flaschen bis ins geplante letzte Lager 5 zu transportieren, um den Weg zum Gipfel und die Nacht davor abzusichern. Zwei weitere Sauerstoffzylinder sollten einem eventuell zweiten Gipfelpaar zur Verfügung stehen. Gesagt, getan: Am 12.5. brachen Day, Anderson, Keelan, Owens und der Sherpa-Sidar Richtung Lager 3 in 6700 m auf. Die Schneefälle der letzten Tage hatten die Route vollkommen verlegt. Der Schnee lag knietief und ab einer Höhe von 6500 m hüfthoch. Bevor man sein Körpergewicht in den nächsten Schritt verlagern konnte, musste diese Stelle zuerst niedergestampft werden. Mit dem schweren Gepäck am Rücken war diese Arbeit extrem anstrengend. Auch die Errichtung von Lager 3 machte die letzten Kräfte aller erforderlich. Die Nacht war sturmumtost und schlaflos. Daher waren am nächsten Tag Keelan und Owens bereits wieder früh unterwegs. Sie bahnten sich einen Weg über die steilen Schneefelder nach oben in Richtung Sichelgletscher. Dabei nahmen sie eine Variation der Route der Franzosen von 1950 und entschieden sich für eine Eisrinne zwischen zwei Felsbändern. Immer wieder hatten sie mit Stein- und Eisschlag zu kämpfen. Am 15.5. gelangten die vier Bergsteiger, nachdem sie ihre Aufstiegsroute mit Fixseilen gesichert hatten, an den Fuß des Sichelgletschers. Ein Band von mächtigen Seracs grenzte ihn nach oben hin ab. Ziel war es nun, auf den oberen Bereich des Gletschers zu gelangen, der mit einer Neigung von 45 Grad einfacher als die unteren Bereiche am Berg zu begehen war. Tempo war nun angesagt, denn die Zeit war fortgeschritten und der Monsun stand Anfang Juni vor der Türe. Neben Lager 4 war es notwendig, Lager 3 und Lager 4 mit Ausrüstung und Proviant zu belegen. Während der 16.5. dämmerte, erreichte die Bergsteiger die nächste Hiobsbotschaft. Keelan musste wegen Erfrierungen an den Füßen aufgeben. Doch die beiden Sherpas, Sonam Girmi und Per Temba, der Jüngste, erklärten, einspringen zu wollen. Gemeinsam mit Day, Owens und Anderson gelang es ihnen, auf den Gletscher aufzusteigen, die Route abzusichern und den Lagerplatz 4 in 7100 m Höhe zu erreichen, wo sie ihre Lasten ablegten. Dann kehrten sie nach Lager 3 zurück, wo sie eine Bestandsaufnahme der Situation machten. Um eine weitere Route oberhalb von Lager 4 sicherstellen zu können, mussten 12 Mannlasten von Lager 3 nach Lager 4 geschafft werden. Die gute Nachricht war, dass sich noch zwei weitere Sherpas zum Lastentransport anschickten und auch Keelan wieder einsatzfähig war. So setzten sich am 18.5. acht Mann mit ebenso vielen Lasten in Bewegung und stellten in Lager 4 zwei Zelte auf. Die restlichen Lasten würden durch vier Mann einen Tag später erfolgen. Day hatte zwischenzeitlich die weitere Marschroute festgelegt, die wie folgt umgesetzt wurde. Am 19.5. wurde Lager 5 auf 7400 m in Form eines Zeltes errichtet. Day und Owens blieben in Lager 5 und planten am 20.5., falls das Wetter mitspielte, einen Gipfelversuch. Auf dem Weg nach Lager 5 entfaltete die Höhe ihre volle Wirkung auf die Bergsteiger. Anderson hatte physische Probleme, das letzte Lager zu erreichen, und Per Temba meldete Herzbeschwerden. Er war noch nie auf solch eine Höhe angestiegen. Keelan und Anderson kehrten nach Lager 4 zurück und sollten als zweites Gipfelteam am 20.5. nach Lager 5 nachrücken, während Day und Owens am Weg zum Gipfel waren. Auch deshalb, um, falls Not bei Day und Owens vorlag, Erste Hilfe leisten zu können. Die Sherpas sollten bis Lager 3 absteigen, um Sauerstoffflaschen für den Gipfelangriff von Keelan und Anderson sicherzustellen. Doch die Höhenkrankheit, welche Per Temba widerfuhr, machte einen zweiten Gipfelvorstoß zunichte. Denn Per Temba musste mit Hilfe seines Sirdars bis nach Lager 2 gebracht werden, um nicht seiner Krankheit tödlich zu erliegen. Ergo gab es keinen Sauerstoffnachschub. Es musste also alles im Rahmen eines Gipfelversuchs passen. Und den hatten Day und Owens im letzten Lager, in Lager 5, für sich gepachtet. Sie warteten dort auf ihre Chance. In einer Nacht, in welcher starker Wind wehte und die Temperatur unter minus 30 Grad sank. Aber sie hatten den Luxus, die Nacht mit künstlichem Sauerstoff zu verbringen. Nach dem nächtlichen Sturm, als der Morgen am 20.5. dämmerte, war es windstill und die Luft war herrlich klar und die Sonne strahlte vom Himmel. Das Aufstehen aber war schrecklich. Die beiden hatten in Pelzanzügen und Stiefeln geschlafen und kamen nur mit Mühe aus ihren Schlafsäcken. Als das Zelt durch die Sonnenstrahlen leicht aufgewärmt war und auch die umliegenden Felsen nicht mehr so viel Nachtkälte abstrahlten, brachen Day und Owens in Doppelstiefeln und Überstiefeln gegen 08.00 Uhr auf. Erstmals, seit sie am Berg waren, verwendeten sie beim Anstieg künstliche Sauerstoffzufuhr. Sie wollten auf Nummer sicher gehen und unbedingt den Gipfel erreichen. Trotzdem bewegten sie sich langsam und wie in Trance über die 45 Grad geneigten Eis- und Schneehänge Richtung höchsten Punkt. Der Wind war, wie prognostiziert, nur schwach. Dann wurde das Gelände noch einmal steiler, und nachdem sie ein 55 Grad steiles und mit Schnee gefülltes Couloir gemeistert hatten, ragten über ihnen zwei riesige Schneepilze auf einem Felssims auf. Das war der Gipfel, auf dem sie gegen 11.00 Uhr standen. Für die letzten 650 Meter benötigten sie drei Stunden. Die Franzosen hatten 20 Jahre zuvor acht Stunden benötigt.
Allerdings hatten die Franzosen ein Handicap zu tragen. Sie hatten keinen Sauerstoff verwendet und waren von Erfrierungen schwer gehandicapt gewesen. Day und Owens waren nach Herzog und Lachenal im Jahr 1950 erst das zweite Duo, welches am Gipfel stand. Vor dem unglaublichen Panorama des Dhaulagiri und des Machapuchare fotografierte Day Owens mit dem ‚Union Jack‘ und der Flagge Nepals in den Händen. Auch sonst machte er eine Menge Fotos. Summerton hatte vom Basislager aus die Fortschritte mit einem Fernglas verfolgen können und hatte die anderen Lager vom Gipfelsieg in Kenntnis gesetzt. Nachdem die Gipfelsieger noch einige Steine zum Andenken gesammelt hatten, stiegen sie in ihren eigenen Spuren wieder nach Lager 5 ab. Dafür hatten sie lediglich zwei Stunden benötigt. Dort hatte sich das Wetter wieder verschlechtert und sie verbrachten gemeinsam mit Keelan und Anderson eine vor Kälte beißende, bitterkalte Nacht. Es war so kalt gewesen, dass sie sich am Morgen kaum bewegen konnten. Und es dauerte lange, bis Arme und Beine so weit beweglich waren, dass sie wieder einen Aufbruch wagen konnten. Der weitere Abstieg erforderte alle ihre Achtsamkeit, weil das Abstiegsgelände laufend von versteckten Spalten unterbrochen wurde. Wie eine Sonde nutzten sie ihre Eispickel, um die Festigkeit der Schneedecke zu prüfen.
Noch bevor man am 21.5. das ABC-Lager erreichte, stürzte Owens 10 m in eine Gletscherspalte ab (Ein ‚ABC‘-Lager (Advanced Base Camp) oder vorgeschobene Basislager werden dann errichtet, wenn das ‚normale‘ Basislager aus logistischen oder sicherheitsbedingten Gründen weiter entfernt vom Einstieg in den Berg errichtet werden muss.). Mit einem Schock, einer Gehirnerschütterung und schweren Prellungen kam er davon. Ins Basislager musste er begleitet werden. Dort wurden sie von ihren Kameraden jubelnd in Empfang genommen. Ein großer Teil der Ausrüstung und Lasten musste am Berg zurückbleiben, da die Rahmenbedingungen für die Sherpas, um aufzusteigen, zu gefährlich waren. 20 Jahre nach den Erstbesteigern standen wieder Menschen am höchsten Punkt der Annapurna.
Die Grafik zur Route der Briten befindet sich am Ende dieses Kapitels.
Vor weit über 100 Millionen Jahren driftete der indische Subkontinent mit einer Geschwindigkeit von etwa neun Metern pro Jahrhundert als Insel in Richtung Asiens Festland. Dabei legte er eine Entfernung von 6400 km zurück und schob sich vor 50 Millionen Jahren unter die eurasische Platte. Bis heute ganze 2000 km weit. Über Millionen Jahre hinweg erzeugte dieser Drift eine Schubkraft, die eine Masse aus Fels und Stein aus der Erde emporhob. Bis in eine Höhe von weit über acht Kilometern des heutigen Meeresspiegels bauten sich riesige Gesteinsmassen auf, die in ihrer durchschnittlichen Breite 220 km betrugen und sich über eine Länge von über 2400 km erstreckten. Es war die Geburtsstunde eines Gebirgssystems, das wir heute als den Himalaya kennen. In der deutschen Sprache übersetzt bedeutet der Name so viel wie ‚Schneewohnstätte‘. Das Massiv, sich auch heute noch um mehr als einen Zentimeter pro Jahr erhebend, erstreckt sich im Westen von Afghanistan bis nach China im Osten und ist gespickt mit unzähligen Berggipfeln jenseits der 6000 m- und 7000 m-Marke. Diese Riesen werden noch einmal von weit höheren Bergen überragt. Den höchsten Bergen der Erde. Den vierzehn 8000ern. Sie teilen sich geographisch auf drei Länder auf. Fünf von ihnen stehen im nördlichen Pakistan. Einer im südlichen China und acht verteilen sich über das nördliche Staatsgebiet von Nepal. Der Himalaya selbst wird in mehrere Einzelgebirgsketten untergliedert. Eines davon, das Annapurna Himal-Massiv, erstreckt sich über die Distrikte Kaski und Myagdi im zentralen Nepal-Himalaya. Die Bergkette umfasst über 20 Gipfel mit einer Höhe jenseits der 6900 m-Marke. Zu ihnen gehören mit der Annapurna I (8091 m) und der Annapurna II (7937 m) zwei Erhebungen, die zu den 16 höchsten Bergen der Erde zählen. Dem Hauptgipfel, der Annapurna I, ist dieses Buch gewidmet. Sie ist mit ihren 8091 m der zehnthöchste Berg des Planeten. Ihre Bezeichnung stammt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie ‚die Nahrung spendende, fürsorgende göttliche Mutter‘. ‚Anna‘ steht für ‚Nahrung‘ und ‚Purna‘ für ‚erfüllt von‘. In der hinduistischen Mythologie werden ihr Wohlstand und Ernährung zugeschrieben. Sie gilt nicht nur als Göttin des Getreides und der Fülle, sondern ist auch eine der vielen Ehefrauen des Gottes Shiva, einer der drei Hauptgottheiten des Hinduismus. Aufgrund der femininen Namensgebung des Berges stellte sich daher immer wieder die Frage nach dem bestimmten Artikel zum Berg Annapurna. Aufgrund seines hinduistischen göttlichen Hintergrundes lautet sie in diesem Buch auf ‚die Annapurna‘.
Als der Planet Erde mit nicht vorstellbarer Kraft das Annapurna-Massiv auffaltete, ließ die Erdenergie einen langen Rücken/Hauptkamm entstehen, der sich von Westen nach Osten erstreckt. Seine geographischen Koordinaten lauten heute auf: 28° 35′ 45′′ N, 83° 49′ 12′′ O. Der Zeitunterschied zu GMT (Greenwich Mean Time) beträgt 5 Stunden.
Die Masse des Bergrückens besteht aus Eis und Fels und ist oft messerscharf, sodass man bei Besteigungen oft auf die Gratflanken ausweichen muss. Außerdem ist er extrem anfällig für Höhenstürme. Im Osten startet der Kamm bei 7000 m Höhe mit dem Lamjung Himal und führt fast 1000 m höher bis zur Annapurna II. Über die Annapurna IV senkt sich der Grat auf fast 5500 m ab, um dann zur westlich gelegenen Annapurna III steil auf über 7500 m wieder anzusteigen. Fast gleich hoch entpuppt sich die anschließende Erhebung der Gangapurna. Danach fällt der Grat wieder 500 m bis zum Gipfel des Glacier Dome ab. Als nächste Station lässt sich der Khangsar Kang erkennen. An diesem Punkt stellt der Kammverlauf eine Weiche dar. Nach Nordwesten verläuft der Grat mehrere Kilometer lang fast waagrecht in einer Höhe von stetig 7000 m und endet am Tilicho Peak in einer Höhe von 7134 m. Die Franzosen hatten an die senkrechte Mauer, die von diesem Grat nach Westen abfällt, einst den Namen ‚Grand Barriere‘ vergeben. Einst und heute galt/gilt diese Mauer als unüberwindbar. Noch weiter westlich des Tilicho Peak folgen die Gipfel der Nilgiri-Kette mit ihrer höchsten Erhebung von über 7100 m. Der zweite Gratverlauf vom Khangsar Kang erfolgt leicht südwestlich. Im Bergsteigerkreis wird er einfach ‚Ostgrat‘ genannt. Auf seinem Weg erreicht man mit dem Annapurna Ostgipfel, Annapurna Mittelgipfel und dem Annapurna Hauptgipfel drei Erhebungen jenseits der 8000 m-Grenze. Vom Hauptgipfel senkt sich der Kamm etwa um 500 m zum Annapurna Fang. Aufgrund seines westlichen Verlaufs vom Hauptgipfel erhielt er auch den Namen ‚Südwestgrat‘. Danach biegt er nach Süden ab und senkt sich, um dann wieder auf über 7200 m zur Annapurna Süd anzusteigen.
Die wichtigsten Gipfel rund um den Hauptgipfel:
Im Westen ist die Annapurna-Gruppe vom Kali Gandaki-Tal begrenzt, welches die Massive der Annapurna und des leicht nordwestlich gelegenen Dhaulagiri durchschneidet. Die Kali Gandaki bildet in Teilbereichen die tiefste Schlucht der Erde und misst vom Boden bis zu den höchsten Erhebungen 6000 m. Sie verläuft von Norden nach Süden und deckt mehrere Klimazonen, die in kurzen räumlichen Abständen ineinander übergehen, ab. Zu den Hauptorten des Kali Gandaki-Tals zählen Tatopani mit seinen heißen Thermalquellen, Jomsom mit einem Flugplatz, Ghorepani mit dem bekannten ‚Poon Hill‘ und seiner Aussicht auf ein umwerfendes Bergpanorama zu jeder Tageszeit und der Ort Lete/Ghasa, Umschlagplatz aller Expeditionen zur Annapurna und auch zum Dhaulagiri. Die nördliche und östliche Grenze zum Annapurna-Massiv verbindet das Kali Gandaki-Tal mit dem Manang-Tal und seinem Hauptort Manang (3500 m). Östlich davon erhebt sich das nächste Massiv eines 8000ers, jenes des Manaslu, welches durch die Marsyangdi Khola von der Annapurna-Gruppe getrennt wird. Im Norden steigt die Kette des Damodar Himal an und grenzt Nepal von China ab. Zwischen Annapurna-Massiv und Damodar-Massiv liegt mit dem Tilicho-See (4920 m) eines der höchstgelegenen Gewässer der Erde. Die unmittelbare Verbindung zwischen Annapurna Himal und Damodar Himal stellt ausschließlich der Thorang La Pass dar. Weiter nordwestlich liegt das ehemalige Königreich Mustang mit seinem berühmten Wallfahrtsort Muktinath.
1970: Südwand – Durchbruch in neue Zeiten des Alpinismus
Der Brite Chris Bonington liebte die Berge und das Bergsteigen. Bereits 1960 war er im Himalaya und bestieg im Rahmen einer Armee-Expedition unter der Leitung von Jimmy Roberts erstmals die Annapurna II. Im Jahr 1961 war er Teil einer britischen Expedition, die den Nuptse (7861 m) erstbestieg. Schon damals gab er sich mit der klassischen Eroberung eines Himalaya-Gipfels nicht zufrieden – ‚Schnee-Stapfen‘, wie es Bonigton nannte, war nicht unbedingt das, was er wollte. Er wollte klettern. Den Gipfel erreichte er über die technisch schwierige Nuptse-Südwand. 1962 durchstieg er als erster Brite die Eiger-Nordwand (3967 m) und war in Patagonien unterwegs. Er galt als Verfechter des Bergsteigens ohne technische Hilfsmittel. Mitte der 1960er-Jahre widmete er sich dem Abenteuerjournalismus und war als Schriftsteller und Photograph zu Werke. Abenteuer war sein Leben. Im Jahr 1968 kam er mehrere Male knapp mit dem Leben davon, als ihm bei einer Fahrt zum Blauen Nil Eingeborene an den Leib rückten, er mit dem Boot kenterte oder mit einem Flugzeug beinahe abgestürzt wäre. Ein Durchschnittsmensch hätte genug gehabt. Nicht so Bonington. Sein Dasein befriedigte ihn nicht wirklich. Die Berge gingen ihm ab. Er wollte, dass er sich ihnen näher fühlen könnte. Ein Expeditionsprojekt anzudenken, war ihm erstmals 1968 durch den Kopf gegangen. Mit Nick Estcourt verband ihn eine jahrelange Freundschaft. Estcourt war oft in den Bergen gewesen, vor allem mit seinem Vater bereiste er laufend die Alpen. Ansonsten konnte er noch eine Grönland-Expedition vorweisen. Eines Tages saßen die beiden Freunde zusammen und entwickelten eine Idee für ein Himalaya-Projekt. Es war allerdings nicht so einfach, dorthin zu kommen, denn bereits seit Jahren waren die nepalesischen Gebirgsriesen nicht zugänglich, weil Nepal aus politischen Gründen die Grenze gesperrt hatte. Als Alternativziel dachte man über Alaska nach und darüber, welche Leute für ein solches Vorhaben in Frage kommen würden. Martin Boysen war so einer. Er galt als einer der besten britischen Felskletterer und hatte sich in Wales und Schottland bei schwierigsten Erstbesteigungen einen hervorragenden Namen gemacht. Auch in den Alpen hatte er bereits seine Fußabdrücke hinterlassen. Dann dachte man an Dougal Haston. Sowohl Boyson als auch Bonington waren bereits mit ihm unterwegs gewesen. Unter anderem am Eiger und am Cerro Torre in Patagonien. Haston war einer der besten britischen Bergsteiger und hatte sein Leben ganz und gar seiner Leidenschaft verschrieben. Er leitete Kletterschulen und bestieg die schwierigsten Wände. Als man im Oktober 1968 zu viert zusammensaß, wurde man von der Nachricht ereilt, dass die Nepalesen ihre Grenzen wieder öffnen würden. Die Pläne, nach Alaska zu gehen, wurden schnell wieder zur Seite gelegt und man wandte sich dem Dach der Welt zu. Im Himalaya waren im Jahr 1968 alle Gipfel erstbestiegen. Aber keiner dieser Berge, sieht man vom Mount Everest und vom Nanga Parbat ab, hatte eine Erstbesteigung über eine Alternativ-Route vorzuweisen. Um der Angelegenheit auch noch zusätzliche Spannung zu verleihen, widmete man sich dem Ansinnen einer großen Wanddurchsteigung an einem 8000er. Man war nicht alleine. Im Jahr 1970 sollten noch zwei weitere Expeditionen zu gigantischen Wänden des Himalaya stattfinden. Die Deutschen versuchten sich an ihrem Schicksalsberg, dem Nanga Parbat, über die mächtigste Steilwand der Welt – der Rupal-Flanke. Eine japanische Expedition versuchte ihr Glück an der Südwand des Everest. Die Nanga Parbat-Expedition endete sogar in der ersten Überschreitung eines 8000ers, hatte aber einen Todesfall zu beklagen. Die Japaner scheiterten an der Everest-Südwand wegen erhöhter Steinschlaggefahr. Sie standen aber trotzdem auf dem Gipfel, weil sie später die Normalroute nahmen. Auch diese Expedition hatte zwei Todesopfer zu beklagen. Bonington war der Meinung, technische Kletterschwierigkeiten sollten das ‚Tiefschnee-Stampfen‘ ablösen. Er erinnerte sich an seine 1960er-Besteigung der Annapurna II und schlug seinen drei Freunden salopp die Südwand der Annapurna I vor. Einige Tage später reflektierte ein Dia der Annapurna-Südwand von der Wohnzimmerwand. Der Schock des Quartetts war groß.
Die Gewaltigkeit und Steilheit des Massivs waren überwältigend. In die Wand passten vier Alpenwände übereinandergestellt. Sie besaß keine klaren Formen und war auch nicht in irgendeiner Art und Weise gegliedert. Lediglich mit ihren drei Pfeilern erinnerte sie an die Grandes Jorasses im Mont Blanc-Massiv. Was barg diese Wand Unvorhergesehenes für Erstbesteiger? Als die erste Unglaublichkeit der Diaprojektion überwunden war, geschah, was geschehen musste. Es entbrannte eine intensive Diskussion über mögliche Routen, an deren Ende sich Ernüchterung einstellte. Am Foto konnte man zwei gröbere, dem ersten Anschein nach unüberwindliche Hindernisse ausmachen. Einen zerklüfteten Eisgrat, der geradewegs in die Mitte der Südwand lief, und im oberen Teil der Südwand ein Felsband, das wie ein Sperrriegel vor dem Gipfelabschnitt wuchtete. Dort würden alle Kletterkünste gefragt sein. Und das auf über 7000 m. Trotzdem wollte man es versuchen. Kam aber von der Idee, mit vier Mann die Wand anzugehen, rasch ab. Es mussten mindestens acht Mann sein, um solch ein Projekt zu stemmen. Also begann man, weitere Kandidaten ins Kalkül zu ziehen. Und das war nicht einfach. Obwohl England voll gespickt mit ausgezeichnetem Fels- und Eisklettern war, benötigte man aber auch Charaktere, die sich unterordnen konnten und auch gut zusammenpassten. Im Bergsteiger-Genre nicht einfach zu finden, denn es handelt sich oft um ichbezogene Individualisten. Leute mit Himalaya-Erfahrung wären am besten gewesen, waren aber Mangelware, da man ja seit Jahren nicht nach Nepal einreisen durfte. Mit dem verheirateten Familienvater Ian Clough war Bonington Anfang der 1960er Jahre im Mont Blanc-Gebiet und am Eiger aktiv gewesen. Clough selbst leitete zuletzt eine Expedition nach Patagonien und war Berufsbergsteiger. Dann war da noch der aus dem Lake District stammende Mick Burke. Ebenfalls ein ausgezeichneter junger Kletterer, mit dem Bonington am Eiger war. Dort hatte er Burke als zähen Überlebenskünstler unter widrigsten Umständen kennengelernt. Er würde passen. Und natürlich Don Whillans. Für Bonington der beste britische Bergsteiger. Aus dem Norden stammend, spezialisierte er sich auf die mörderischsten Überhänge und balancierte laufend zwischen Leben und Tod. Aber leider war er auch ein Problemfall. Er hatte sich die letzten Jahre mehr dem Trinken als dem Bergsteigen hingegeben. Bonington kannte ihn von einer gemeinsamen Alpenmission, lernte aber dort seinen Charakter und seine Vorgehensweise schätzen. Ende der 1950er Jahre war Whillans dreimal im Himalaya gewesen. Avancierte dort aber zum Pechvogel, weil er aus verschiedensten Umständen nie den Gipfel erreichen konnte. Um Whillans’ Fitness zu prüfen, ging Bonington kurzfristig mit ihm auf Klettertour. Und er entsprach. Nicht unüberraschend. Bonington erzählte ihm von seinen Vorhaben und Whillans nahm an. Als stellvertretender Expeditionsleiter. Er war der beste Ausgleich für die noch unerfahrene Himalayamannschaft.
Und Whillans würde noch eine neue Errungenschaft im Gepäck haben. Ein neuartiges Zelt. Das Whillans-Zelt. Von der Form sah es nicht unmittelbar wie ein Zelt aus, sondern wie eine große Schachtel, deren Material aus Nylon- und Baumwollterrylen über ein Gestänge aus Aluminiumröhren gestülpt wurde. Es maß 1,80 m in der Länge und 1,20 m in der Höhe und Breite. Und es hatte sich bereits auf Whillans’ Reisen nach Patagonien und dem Himalaya bewährt. Mit seinen rund 15 kg Gesamtgewicht würde man sich vor Schnee und Sturm in Sicherheit wiegen können. Vier Stücke würden zu Annapurna mitgenommen werden. Ein weiteres Expeditionsmitglied bot sich aus Amerika an. Wobei finanzielle Überlegungen durchaus eine Rolle gespielt haben. Whillans und Hasting schätzten Tom Frost, der ein überragender Felskletterer war. In den Felswänden von Yosemite hatte er mit seinen Kumpels neue Techniken ausgearbeitet und am Material neue Entwicklungen vorgenommen. Bonington zögerte zuerst, weil Frost ein praktizierender Mormone war. Also eigentlich ein Asket, der mit Alkohol, Zigaretten und dem europäischen Bergsteigerjargon nicht viel am Hut hatte. Es stellte sich allerdings später heraus, dass Frost sehr anpassungsfähig war. Als Bonington ihn kontaktierte, kam er gerade aus Alaska vom Mount McKinley zurück. Vom Gipfel natürlich. Und als er sich anhörte, um was es ging, war er gleich Feuer und Flamme gewesen. Eine weitere Zusage erhielt Bonington von Mike Thompson, einem Freund, den er schon lange kannte und auf den er sich verlassen konnte. Er sollte sich den weniger spektakulären Tätigkeiten am Berg widmen. Die Suche nach Leuten für eine 8000er-Expedition hatte sich bereits überall herumgesprochen. Es fehlte noch der Medizinmann. Der sich allerdings in Person von Dave Lambert, einem Spitalsarzt aus Newcastle, selbst anbot. Der gute Doktor war ein begeisterter Bergsteiger, der es schon oft in den Alpen probiert hatte. Seine offene Art und seine Referenzen gefielen Bonington, und so lud er ihn ein, mitzukommen. Ein guter und erfahrener Mann wurde noch für die Leitung des Basislagers gesucht. Einer, der mit der Themenvielfalt von Organisation, Logistik und Nachschub versiert war. Bonington fragte bei einem ehemaligen Mitglied der 53er-Everest-Expedition nach und erhielt einen Kontakt in Form von Kelvin Kent. Einem Gurkha-Hauptmann, der in Hongkong stationiert war. Der hatte selbst bereits Himalaya-Erfahrung und sprach auch die Sprache der Sherpa. Aufgrund seiner beruflichen Funktion kannte er sich ausgezeichnet mit den Problemen der logistischen Planung aus. Bonington hatte seine Mannschaft zusammen. Dazu hatte er ab Oktober 1968 sieben Monate benötigt. Man war zu elft; Im Durchschnitt knapp über dreißig Jahre alt. Eigentlich im besten Alter, um in den Himalaya zu gehen. Fast alle Bergsteiger kannten sich untereinander, waren unter schwierigen und gefährlichen Umständen schon zusammen geklettert und besaßen weitestgehend auch eine übereinstimmende Einstellung zum Besteigen von Bergen. Bonington musste nun seine Qualitäten der Menschenführung unter Beweis stellen, damit auch alle fest zusammenhielten. Unerwarteterweise wuchs die Mannschaft dann noch um 10 Mitglieder an. Bonington war es im Rahmen der Finanzierung seines Vorhabens gelungen, die Geschichte der Expedition an eine englische Filmgesellschaft zu verkaufen. Und die wollten in voller Stärke mit Reportern, Kameraleuten, Tontechnikern und Regisseuren direkt vor Ort dabei sein. Da waren dann auch noch die Deutschen Hauser und Greissl. Zwei Annapurnaveteranen. Bonington hatte sie im Rahmen seiner Vorbereitungen kontaktiert und wertvolles Fotomaterial erhalten. Die beiden äußerten sich aber nicht optimistisch, was einen Besteigungserfolg der Südwand betraf. Eigentlich war das Vorhaben mit großem Risiko behaftet. Denn die gesamten Pläne stützten sich auf die Fotos einer Steilwand, die nichts anderes als riesenhafte und gefährliche Ausmaße aufwies. Ein bedenklicher Schritt ins Ungewisse. Obwohl man Geld gehabt hätte, im Jahr 1969 einen Voraustrupp zur Erkundung der Südwand in Gang zu setzen, musste man aufgrund von Zeitmangel darauf verzichten. Entschieden hatte man sich für die Vormonsunzeit. Bis Anfang Juni musste man die Wand bezwungen haben. Davor gab es aber noch einiges zu tun. Zwei Monaten Expeditionsbergsteigen im Himalaya ging eine Vorbereitungszeit von 1,5 Jahren voraus. Das Expeditionsvorhaben hatte sich weit herumgesprochen. Und Bonington hatte Glück. Unter Mitwirkung des Literaturagenten George Greenfield konnte er die Everest-Stiftung hinter sich wissen. Die Einnahmen der Stiftung resultierten aus der Everest-Erstbesteigung von 1953. Sie bezahlte immer wieder Zuschüsse an ausländische bergsteigerische Vorhaben. Allerdings hatte sie erst eine Unternehmung zur Gänze unterstützt, nämlich die Kantsch-Expedition aus dem Jahr 1955. Nun wurde Bonington diese Ehre zuteil. Er war erst der Zweite. Für das Annapurna-Vorhaben wurde ein eigenes Komitee zusammengestellt und Sir Charles Evans, der der Erstbesteigung des Kantsch vorstand, übernahm für die Annapurna-Expedition die Schirmherrschaft. Ende 1969 traf die Erlaubnis der nepalesischen Behörde ein. Die Annapurna war für Bonington & Co. reserviert. In einer Lagerhalle hatte man zwischenzeitlich ein Depot für die gesamte Expeditionsausrüstung angelegt und fragte sich, welcher Weg nun der beste wäre, um das gesamte Gut nach Nepal zu transportieren. Luft, Land oder Seeweg? Der Luftweg war zu teuer. Der Landweg war gefährlich und zu lang. Viele Expeditionsteilnehmer konnten gar nicht die Zeit aufbringen, um auch noch mit einem Lastwagenkonvoi nach Asien zu reisen. Also musste es der Seeweg werden. Da der Suezkanal wegen kriegerischer Handlungen nicht in Frage kam, musste das Expeditionsgepäck rund um das Kap der Guten Hoffnung transportiert werden. Eher natürlich, als die Mannschaft mit dem Flugzeug nach Indien abflog. Man ging davon aus, anfangs der dritten Märzwoche von Pokhara aus zur Südwand abzumarschieren. Entsprechend musste sich die Reiseplanung an diesem Datum orientieren. Für Jänner 1970 wäre ein Frachter zu haben gewesen. Der kam aber nicht in Frage, weil man bis zu diesem Zeitpunkt das Gepäck nicht vollständig bereit hatte. Für den 23.1. bot sich ein Schiff an, das Liverpool nach Bombay verlassen sollte. Man hatte zwar immer noch nicht das gesamte Gepäck parat, aber die ‚Army Mountaineering Association‘ entsandte im selben Jahr eine Expedition zur Nordseite der Annapurna. Diese boten sich an, 750 kg auf ihrem Luftweg von Bonington zu übernehmen. Das hörte sich gut an und er buchte das Schiff. Was sich nicht gut anhörte, war, dass das Schiff am 21.1. vermeldete, nicht auslaufen zu können, weil es defekt war. Drei Wochen Verzögerung mussten eingeplant werden. Das kam nicht in Frage, denn dann würde das Schiff, welches für den 28.2. in Bombay erwartet wurde, erst in der dritten Märzwoche dort einlaufen. Definitiv zu spät. Der Plan wäre gewesen, dass Whillans und Lambert das Schiff am 22.2. in Bombay erwartet und mit dem Lastwagen das Gepäck nach Pokhara gebracht hätten. Dort hätte sich Bonnington mit Whillans treffen wollen, um eine Vorerkundung der Südwand vorzunehmen.
Eine Woche bevor der Rest der Mannschaft eingetroffen wäre. Bonington rotierte, hatte aber Glück. Vorerst. Denn es gab noch ein weiteres Schiff, das am 23.1. auslief. Die ‚State of Kerala‘ lief in London aus und steuerte ebenfalls Bombay an. Bonington dachte, das Problem gelöst zu haben. Lambert und Whillans flogen am 27.2. nach Bombay, um das Schiff zu erwarten, und riefen am 28.2. bei Bonington an, um ihm mitzuteilen, dass es doch nicht kam. Es lag mit einem Defekt in Kapstadt auf dem Trockendock. Wahrscheinliche Ankunft am 3.3. Es sollte noch schlimmer kommen, denn das Schiff kam erst am 19.3. Whillans und Lambert wurden nach Katmandu weiterdirigiert. Ian Clough würde in Bombay auf das Gepäck warten, weil Bonington Whillans unbedingt am Berg haben wollte. Bonington improvisierte in der Zwischenzeit in Sachen Ausrüstung und Gepäck von London aus, um planmäßig am 22.3. von Pokhara zur Südwand abrücken zu können. Dabei spielte die Armee-Expedition der Engländer zur Annapurna-Nordseite eine wichtige Rolle, da Ausrüstungsmaterial mit deren Transportmaschine mitkam und die auch Verpflegungsrationen für den Anmarsch zur Verfügung stellte. Er selbst hob am 10.3. Richtung Indien ab, um mit den Zollbehörden in Bombay die rasche Verfügbarkeit des Expeditionsgepäcks sicherstellen zu können, und flog einige Tage später nach Kathmandu weiter. In Nepals Hauptstadt wurde er von Kelvin Kent abgeholt, den er noch nicht kannte und der auf Empfehlung zum Basislagerleiter nominiert worden war. Und Kent hatte schon ganze Arbeit geleistet. Als ehemaliger Fernmeldeoffizier war es ihm gelungen, hochwertige Funkgeräte aufzutreiben, die es der Expedition erlaubten, nicht nur am Berg Funkkontakt zwischen den einzelnen Lagern herstellen zu können, sondern auch zur Basis in Pokhara und zur Armee-Expedition an der Nordseite des Berges. Zukunftsweisend, denn dadurch konnte bei Notfällen sofortiger Kontakt mit den Behörden aufgenommen werden. Ansonsten war er in der nordindischen Stadt Nautanwa gewesen, um die Zollformalitäten des erwarteten Gepäcks für die Überfuhr nach Nepal zu arrangieren, hatte Essvorräte eingekauft, um die Verspätung des Expeditionsgutes zu kompensieren, und hatte Träger organisiert, welche die Lasten ins Basislager zu schaffen hatten. Über Kents Kontakte konnten aus den Bergen rund um Pokhara einhundert Träger rekrutiert werden. Aus Pokhara selbst wurden fünfzig weitere unter Vertrag genommen. Kent war ein Volltreffer, denn er hatte auch sonst noch eine Vielzahl bürokratischer Tätigkeiten im Rahmen der Expeditionslogistik abgearbeitet. Noch bevor Bonington in Kathmandu eingetroffen war, hatten sich Whillans und Thompson am 15.3. zur Erkundung an die Annapurna-Südwand aufgemacht. Am 18.3. traf der Rest der Expeditionsmitglieder in Kathmandu ein. Einen Tag später ging es ebenso per Fluglinie weiter nach Pokhara, wo man von der eigenen Filmgesellschaft mit riesigem Aufgebot empfangen wurde. In der ansässigen Gurkha-Station, welche als Ausgangslager in Pokhara zur Verfügung stand, gönnte man sich eine kurze Ruhepause. Die Gurkha-Station fungierte als Umschlagplatz für Ausrüstung, Post und filmische Werke der mitgereisten Fernsehgesellschaft. Man hatte keine Zeit zu verlieren. Lediglich Ian Clough wartete in Bombay auf das Schiff mit der Expeditionsausrüstung. Jenes Material, welches per Transportmaschine der Army-Expedition direkt aus England kam, war bereits eingetroffen. Am 21.3. trafen 124 Träger ein, um Lasten auszufassen. Sie stammten vorwiegend aus den einheimischen Stämmen der Gurung und der Magar, beides Urvölker in Nepal, und hatten bereits drei Tage Anmarsch aus den Bergen in den Beinen. Angeführt wurden sie von einem Chef-Naik (Mannschaftsdienstgrad der indischen/pakistanischen Armee), dem ehemaligen Gurkha-Leutnant Khagbir Pun, der die Trägerhorde wie Soldaten kommandierte. Am 22.3., nur einen Tag später als ursprünglich geplant, zog die Karawane los. Einen Tag später machte sich die Army-Expedition zur Nordseite der Annapurna auf. Acht Tage würde der Anmarsch dauern, bis man das geplante Basislager vor der Annapurna-Südwand erreichen wollte. Am ersten Tag zog man los gegen Norden. Laufend umringt von Jeeps der Fernsehgesellschaft, die es sich nicht nehmen ließ, den Expeditionswurm zu filmen. Von den vier Sherpas, die man angeworben hatte, waren lediglich zwei beim Anmarsch dabei, die beiden anderen waren mit Whillans auf Erkundung vorausgeeilt. Die Sherpa nahmen als Hochträger schon immer eine Sonderstellung ein. Aus Tibet in den Himalaya gekommen, hatten sich viele von ihnen jenseits des Mount Everest im Solu Khumbu niedergelassen. Dort lebten sie auf einer Höhe von 3500 m. Im Sommer stiegen sie bis auf 5000 m an, um ihre Yakherden auf die Sommerweiden zu bringen. Kein Wunder, dass sie sich als Hochträger am besten eigneten. Sie sind Buddhisten tibetischer Herkunft und ihre soziale Kultur liegt der Tibets näher als jener Nepals. Im Gegensatz dazu gibt es das Volk der Gurkha, das immer an der südlichen Seite des Himalaya ansässig war. Sie sind Hindus, haben sich aber in vielen Dingen dem Buddhismus verschrieben. Nepal ist eine weltweite Ausnahme, was das harmonische Zusammenleben mehrerer Völker unabhängig von ihrer Religion, Rasse und Kultur betrifft. Die Zelte für die erste Nacht schlug man nahe dem Dorf Naudanda auf. Bereits einige Wanderstunden von Pokhara entfernt waren die Straßen so unwegsam geworden, dass kein fahrbarer Untersatz mehr weiterkam. Am nächsten Morgen ging es weiter zum Dorf Lumle, in dessen Nähe man eine Rast einlegte. Die feuchte Hitze drückte auf die Expedition hernieder. Abends erreichte man Chondracot und stieg in die tiefe Schlucht der Modi Kola hinunter, wo man ein Lager für die kommende Nacht aufschlug. Am 25.3. erreichte man Ghandrung, eine größere Siedlung aus zweistöckigen Steinhäusern, die auf terrassierten Hängen hoch über der Modi Kola standen. Dort verbrachte man die dritte Nacht. Bonington traf dort auf Mike Thompson, der mit Don Whillans den Voraustrupp zur Südwand gebildet hatte. Viele Informationen hatte er für Bonington nicht. Obwohl man am Eingang zum ‚Annapurna Sanctuary‘ eingetroffen war, erlaubte das Wetter keinen Blick auf die Südwand.
Die südliche Annapurna-Gruppe stürzt in ein ovales Gletscherbecken ab. Der einzige Zugang besteht von der Südseite über einen schmalen Schluchteingang. Durch diese Schlucht fließt der aus den Gletschern der Südseite entspringende Modi Kola-Fluss. Das Felsportal wird im Osten durch den Machapuchare (6997 m) und im Westen durch den Hiunchuli (6441 m) bewacht. ‚Machapuchare‘ bedeutet ‚Fischschwanz‘. Der Berg erhielt diesen Namen, weil seine Doppelspitze vom Osten betrachtet eben einem Fischschwanz ähnelt. Der Hiunchuli erhielt seinen Namen von Colonel Roberts, einem englischen Expeditionsleiter, der 1957 als erster weißer Mensch in dieses Gletscherbecken gelangte. Die Bezeichnung Hiunchuli, was so viel wie ‚Schneeberg‘ bedeutet, gab es allerdings bereits für einen anderen Berg. Im Rahmen einer deutschen Expedition in den 1960er-Jahren wurde die Vorsilbe ‚Patal‘ hinzugefügt. Es ist der Name des Tals, welches von diesem Berg herunterführt. Das gesamte Becken ist ringsum von steil abfallenden Felswänden eingekesselt. Wie in einer Kathedrale streben kilometerhohe Felspfeiler empor. Das Himmelszelt darüber wirkt winzig. Im Hochsommer lässt das Becken gerade einmal sieben Stunden Sonnenlicht zu. Im Norden zieht der Westgrat vom Hauptgipfel nach Westen Richtung Fang (7647 m), der seinen Namen den Engländern verdankte, die ob seiner Form in ihm den Fangzahn eines Raubtieres sahen. Vom Fang startet der Südgrat in südliche Richtung und begrenzt den Westen des Beckens mit der Annapurna Süd (auch Modi-Peak oder Ganesh, 7219 m). Auch im Norden wird das Gletscherbecken vom Hauptgipfel (8091 m) und dem nach Osten davonziehenden Ostgrat dominiert. Der Ostgrat selbst, durchgehend über 7000 m hoch, besteht aus einer Masse von Fels und Eis und ist oft messerscharf, sodass man bei Besteigungsversuchen seiner Gipfel auf die nördliche oder südliche Gratflanke ausweichen muss. Außerdem ist er bekannt für seine verheerenden Höhenstürme. Der Ostgrat trägt mit dem Roc Noir (7485 m) und im Nordosten mit dem Glacier Dome (7193 m) und der Gangapurna (7455 m) die höchsten Gipfel. Der Roc Noir, oder auch ‚Schwarzer Fels‘, bekam seinen Namen von den französischen Erstbesteigern 1950, die ihn lediglich als schwarzen Fels von der Nordseite her sahen. Der Roc Noir ist eher der markante Eckpunkt des Ostgrates als ein eigener Berg. Auch der Glacier Dome erhielt seinen Namen von den Franzosen. Deshalb, weil auf seinem Gipfel eine Gletscherkuppe aufliegt. Diese bricht nach allen Seiten als Hängegletscher oder in Eisbrüchen ab. Im Osten schließt sich das Becken über die Annapurna 3 (7555 m) und das Gabelhorn (Gandharva Chuli) (6248 m) zum Machapuchare hin. Das Becken selbst ist von Norden nach Süden durch zwei Gebirgskämme dreigeteilt. Zwischen den Kämmen fließen drei Gletscher, der südliche, der westliche und der östliche Annapurna-Gletscher, direkt in die Modi Kola-Schlucht. Das Gletscherbecken selbst erreicht eine ungefähre Höhe von circa 4000 m. Im Laufe der Jahre erhielt das Becken auch den Beinamen ‚Annapurna Sanctuary‘. Deshalb, weil die dort wohnenden Ureinwohner der Gurung glauben, dass in der Umgebung Unmengen von Gold und seltene Schätze der Schlangengottheit Nagas lagern. Der Machapuchare gilt als der Sitz des Gottes Shiva, Gott der Zerstörung. Die Einheimischen sehen in den Schneewehen vom Gipfel seinen göttlichen Weihrauch. Früher durfte die Umgebung aus Aberglaube von Männern und Frauen niederer Kasten gar nicht betreten werden. Heute stehen dieser weiße, von Felsen mit Grautönen untersetzte Schneepalast und dieses heilige Märchenland für ein geschütztes Naturreservat mit einem beeindruckenden und spektakulären Bergpanorama, welches auch ‚Amphitheater der Gletscher‘ genannt wird.
Die Gipfel des Annapurna Himal werden nur sehr selten von der Südseite bestiegen. Neben den objektiven Gefahren und technischen Schwierigkeiten ist ein sehr großer Höhenunterschied von den Talsohlen bis zu den Gipfeln zu überwinden. Dazu kommt, dass die Südwände sehr überraschenden und heftigen Wetterwechseln ausgesetzt sind. Die warme, herantreibende Luft aus dem Tiefland hält an den kilometerhohen Wänden an und wird zum Aufsteigen gezwungen. Dabei kühlt sie ab, es bilden sich Wolken und Schneefall setzt ein. Oft hieß die Devise: Am Morgen Sonne und nachmittags einsetzende Niederschläge. Daher ist die Sicht auf die Bergkette vom Süden aus gesehen oft getrübt, insbesondere während der durch den Monsun entstehenden Regenfälle im Sommer. Besser sind die Verhältnisse im Spätherbst und Winter.