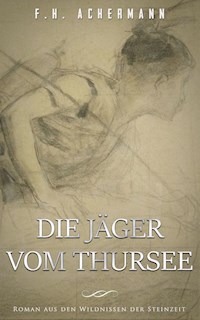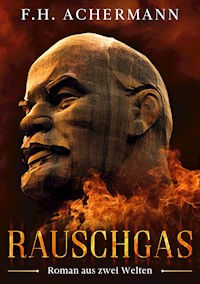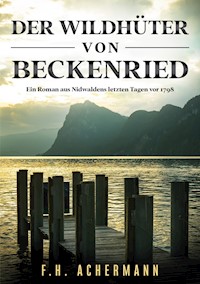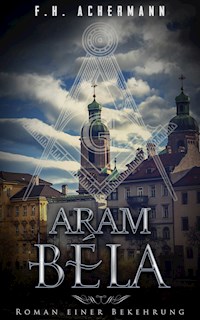Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paris erzittert unter der Schreckensherrschaft des Wohlfahrtsausschusses und unter dessen Führer Maximilien de Robespierre. Das Fallbeil der Guillotine badet das Pflaster der Hauptstadt in Blut. Wer nicht den Vorstellungen der Jakobiner entspricht befindet sich in Lebensgefahr: Adelige und Priester, aber auch Frauen und sogar Kinder fallen dem Mob zum Opfer. Jeden Monat werden hunderte Menschen enthauptet. Korporal Sämi Stucki und Tambour Noldi Kneubühler aus Willisau, beides Überlebende der Schweizergarde, welche zu großen Teilen bei der Verteidigung der Tuilerien und der Königsfamilie ihr Leben ließen, geraten in den Strudel der Geschehnisse. Um Menschen zu retten begeben sie sich in die Höhle des Löwen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Kammerzofe Robespierres
Die Kammerzofe RobespierresVorwort des HerausgebersAuf der FluchtDie verhängnisvolle Nacht Wieder gefangen Zur Guillotine verurteilt Zurück nach Paris!Familie Jobin Die Gräfin von Montfort Judas Jschariot Ein verwegener PlanAls Zofe verkleidet Die erste Nacht bei Robespierre: Eine Märtyrin Die gefälschten Formulare Er selbst!Der erste Tag: Papa Gardier Abenteuerliche Befreiungen Das Grab im Keller Familie de Valmy Ein GeheimbefehlDie Nachtmesse — Ein Priester Der Überfall — EntwischtDer zweite Tag: Böse Augenblicke — Ein WiedersehnDie Zweite Nacht: Das Todesbankett Robespierres — In flagranti ertappt — Robespierres Spaziergang mit der Kammerzofe — Bei Danton — Bei den Verurteilten — Ein Bekenntnis — Hinrichtung der Liste Nr. 27Danton und Robespierre unter dem Fallbeil Der Ring der Gräfin Heimwärts Ankunft in SumiswaldIn Willisau Verschiedene Kneubühler Grüße und SchlussKlappentextImpressumHistorischer Roman aus der französischen Schreckenszeit
von
F. H. Achermann
Herausgegeben von Carl Stoll
Vorwort des Herausgebers
Mit “Die Kammerzofe Robespierres” entführt Franz Heinrich Achermann, der “Schweizerische Karl May”, seine Leser dieses Mal nicht in die prähistorische Zeit, sondern in die Zeit der Pariser Schreckensherrschaft unter Maximilien de Robespierre und Georges Danton. Hier begegnen wir einigen Führern der Jakobiner und erleben eine Situation, in der jeder jederzeit damit rechnen muss, verhaftet zu werden. Jeder weiß, das eine Verhaftung den sicheren Tod bedeutet. Verhöre werden oft gar nicht mehr geführt und allein der Vorwurf, sich nicht vom christlichen Glauben abgewandt zu haben, begründet ebenso ein sicheres Todesurteil wie eine frei erfundene Anklage, weil jemand einem anderen gerade im Weg steht. Menschen wetteifern darum, ihre Familienangehörigen und Freunde zu denunzieren, um damit ihre Loyalität gegenüber dem System zu bezeugen.
Mit gewohnter Präzision und Einfühlungsvermögen schildert Achermann in diesem mit dem Untertitel “Historischer Roman aus der französischen Schreckenszeit” versehenen Roman eines der dunkelsten Kapitel der französischen Geschichte. Ein spannender Hintergrund für die beiden helvetischen Helden, einfache Männer aus dem Volk, die es mit viel Mut und Einsatz schaffen, die “Götter der Revolution” zu überlisten.
Viel Spaß bei der Lektüre dieses spannenden Romans!
Der Herausgeber
Auf der Flucht
Durch die schneebehangenen Wälder der Franche-Comté schweben an rohen Knüppelstöcken zwei mit Bündeln beladene, sehr ungleiche Gestalten.
Voran, mit ruhig-schwerfälligen Bewegungen, als ob er einen schwerbeladenen Karren hinter sich herzöge, ein düster blickender Mensch von wahrhaft herkulischen Körperformen, und hinter ihm, die tiefgedrückten Fußstapfen klug ausnützend, ein frischer, hübscher Bursche mit hellen, fröhlichen Spitzbubenaugen. Wie er so in gemessenen Schritten dem Vordermann folgt, erinnert er fast an einen kleinen Gernegroß, der in den Stiefeln seines Vaters einherstolziert!
Aber schon ihr Aussehen und ihr matter, fast wankender Gang lässt ahnen, dass die beiden nicht zur Erholung in die fast nordische Kälte dieser wilden Regionen des Tafeljuras gewandert sind. Beide sind Flüchtlinge, abgesprengte Trümmer der am 10. August 1792 in Paris so heldenhaft untergegangenen Schweizergarde, und versuchen nun, nach unsäglichen Mühen und Abenteuern dem Schlachthaus von Paris entronnen, auf heimlichen Umwegen die Schweizer Grenze zu gewinnen. Zum Tode verurteilt, ausgeschrieben, von allen Bluthunden gejagt, meist nur nachts marschierend, gelangten sie nach fast zwei Monaten in die wilden Wälder der Franche-Comte, in die Höhen des Lomont, kaum noch zwei Tagreisen von der Berner Grenze getrennt!
Wie von einem inneren Feuer getrieben steigt der starke Mann im tiefen Pulverschnee voran. Er denkt an ein liebes junges Weib und an einen kleinen, herzigen ‘Mutzli‘, die droben im Berner Emmental, in Sumiswald, mit Sehnsucht auf ihn warten.
Samuel Stucki heißt der Mann, ehedem der Schrecken der Jakobiner. Der Jüngere aber schreibt sich Arnold Kneubühler von Willisau, Kanton Luzern. Kaum zwanzig Jahre alt, gesund wie ein Fischotter, kernbrav und schlau wie seine Landsleute, dabei von unsterblichem Humor auch in den schwierigsten Lagen und Gefahren, war er vom Revolutionstribunal in Paris unter drei verschiedenen Namen nicht weniger als dreimal zum Tode verurteilt, hingerichtet und — immer wieder sichtbar geworden, sodass mehrere Jakobiner, die Gott feierlich abgeschafft hatten, bereits wieder an Gespenster glaubten!
Dass sie jetzt, nach diesen entsetzlichen Strapazen, Gefahren und Entbehrungen nicht nur körperlich und seelisch stark mitgenommen, sondern auch nach Kleidung und Haltung heruntergekommen, wie richtige Vagabunden aussehen, ist also durchaus nicht zu verwundern: Stumm, schwitzend, keuchend und ächzend, hin und wieder verschnaufend stampfen sie an den unwirtlichen Höhen des Lomont entlang, bis das blutige Abendrot die unendliche Schneewüste mit leise gehauchtem Kusse zum strahlenden Paradiese wandelt. Hin und wieder bricht der eine von ihnen einen dürren Ast herunter, um ihn sorglich wie ein teures Andenken unter dem Arme zu verwahren.
Plötzlich macht der voranschreitende Stucki vor einer Gruppe schwer behangener und weitausladender Tannen Halt und wischt sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirne:
„Hier kriechen wir unter, Noldi!"
Kneubühler weist ins Tal, wo dicht unter dem Waldrande das Dach eines größeren Bauernhofes sichtbar geworden ist:
„Nicht dort unten? — Sämi, wieder einmal ein bisschen Stallwärme! Vielleicht gar eine warme Mehlsuppe dazu! Sämi! Schließe deine Augen und stelle dir vor: eine warme Mehlsuppe! — Wenn der Bauer eine Tochter hat, so garantiere ich noch wenigstens für geschwellte Erdäpfel!"
Der Berner zieht den hängenden Filzhut noch tiefer in sein unheimliches Stoppelgesicht und tut einen tiefen Atemzug!
„Es geht nicht, Noldi! Um Unterkunft fragen macht verdächtig. Fremde aufnehmen ebenfalls; und erst noch zwei solche Lumpen, wie wir sind!"
„Soll ich dich fordern, Sämi? Noch ein solches Wort, und wir treten auf Knebel an!"
„Ich würde dir's gerne gönnen, Noldi, das bisschen Stalluft, aber du hast ja gesehen, gestern in Clerval, wie die guten Leute erschraken!"
„Die lahme Großmutter im Bette schrie laut auf! Sie meinte, du wolltest sie holen! Sie wird ein entsprechendes Gewissen haben, die Alte!"
„Halten wir noch eine Nacht durch, und dann, dann — oh mein Emmental! Mach Feuer, Noldi!"
Der Berner fährt sich mit der schweren Bärentatze so linkisch über die Augen, dass es dem jungen Luzerner tief ans Herz greift; Stucki leidet infolge der furchtbaren Erlebnisse in Paris und eines nur zu begeiflichen Heimwehs fast an Schwermut. Deshalb sucht ihn Kneubühler bei jeder Gelegenheit aufzuheitern… zwei Strolche, an denen wenigstens noch der — Herrgott seine Freude hat!
„Wird unser Biwakfeuer nicht zu weithin leuchten?", fragt der Kleine jetzt.
„Wir können ja noch etwas tiefer ins Tannwerk hinein. Wird uns wohl niemand nachfragen, sonst bekommt er eine Antwort nach Berner Art!"
„Wie der Maire von Gray, der bei unserer feierlichen Verhaftung einen Fußtritt erhielt, dass er auf drei Meter Entfernung von dir noch den Gartenzaun eindrückte! Weißt, Sämi, so ganz spurlos sind wir denn doch an der Zeit nicht vorübergegangen! Weißt du noch, wie Marat, der berühmte Schreckensmann und Stadtrat von Paris, nach den Septembermorden unter deinem Griff das Kreuz machen musste. Ach, hier unter dieser Bergtanne gibt's ein trockenes Plätzchen, wenn wir ein bisschen scharren! Sämi, hier spielen deine großen Pechschuhe eine wichtige Rolle in der Vorsehung!"
Aus Leibeskräften scharren die zwei den Schnee und auch das Moos aus der windsicheren Mulde, sodass der trockene, gefrorene Erdboden zum Vorschein kommt. Dann suchen sie trockenes Moos, Buchenlaub und dürre Tannenreiserchen, um damit ein Feuer anmachen zu können.
„Wir müssen noch warten, bis es Nacht wird!", sagt der Berner. — „Man würde den Rauch noch gut sehen!"
Eng aneinandergeschmiegt, jeder in eine schwere Pferdedecke gehüllt, starren sie wortlos durch die Waldlücke hinaus ins Tal, in die öden, weiten Fernen der unendlichen Schneewüste.
Was mögen sie wohl sinnen, die beiden Geächteten, fern der Heimat, von Glück und Menschen verlassen?
Sie sehen kaum, dass es finster wird; Grabesstille liegt auf dem faltigen Leichentuche der Franche-Comte, und darunter schläft eine — blutige Tote!
Dort in unendlicher Weite leuchtet ein Sternchen auf, ein Sternchen aus den Gefilden der Seligen, oder ein Lichtlein aus traulicher Stube, wo selige Menschen wohnen!
Kneubühler schaut seinem Kameraden verstohlen ins ehrliche, knochige Gesicht: Wie ein fallendes Sternchen fällt etwas Glitzerndes über dessen Wange, und fast ächzend würgt sich der Atem aus der breiten, wogenden Brust herauf.
„Sämi, morgen Abend sind wir an der Berner Grenze. Den ersten Schweizer küss' ich auf der Straße, und wenn — sie achtzig ist!"
„Mir ist so bang, Noldi — horch, was ist das?"
„Waas?"
„Ein fernes, langgezogenes Heulen!"
„Ein verirrtes Wölflein aus den Vogesen oder vom Berner Jura her. — Stucki, den erledigst du mit einem einzigen Griff."
„Könnte man sein Fleisch gebrauchen?"
„Ausgezeichnet! An einem einzigen Bissen kann man stundenlang essen! — Wollen wir 'anfeuern'?"
„Ja! Das gibt wenigstens ein bisschen Wärme!"
Kneubühler zieht Zunder und Flint (Feuerstein) hervor und nach unzähligen Schlägen und gemeinsamem Blasen beflackert ein lustiges Feuerlein die winterliche Umgebung. Mit wenigen Griffen reißt der Berner noch einen Haufen armdicker Tannäste herunter, und der Luzerner legte sie griffbereit neben das Feuer.
„Was nun?", fragt er dann.
„Zuerst das Hors d'oeuvre!", entgegnet der Hinterländer, zieht aus den Lumpen eine kindskopfgroße, gefrorene Runkelrübe hervor und hält sie zum Auftauen über das rauchende Feuer.
„Woher hast du die?", fragt Stucki.
„Hab' sie heute vormittags in der Gegend von Clerval gefunden, auf freiem Felde, denke dir!"
„Unter dem Schnee?"
„Ein Wildschwein hat sie gerochen und angekerbt — schau her!"
„Hast recht! Zu der müssen wir Sorge tragen! Sie muss reichen bis an die Berner Grenze; wir dürfen nirgends Einkehr halten!"
Beim Worte ‘Berner Grenze‘ hatte der Riese wieder geschluckt, wie um etwas hinabzuwürgen. Dem Kleinen ist es nicht entgangen, und im Flackern des aufrauchenden Feuers sieht er seinen schwermütigen, fast düsteren Blick. Behende wie ein Affe schabt er mit seinem Sackmesser die Runkel sauber und hält dem Älteren ein Stück hin:
„Da, Sämi! — Der Marquise von Pompadour war einst ihr Hund erkrankt, ein herrlicher Affenpinscher mit schmachtenden Augen. Seit mehr als einem halben Tage hatte er Gänseleber und Rindsfilet stehen lassen und schaute nur traurig und verkannt zu seiner Herrin auf. Diese ließ ihn auf einem Seidenkissen dem Regimentsarzte der Schweizergarde bringen, und das muss man sagen: Der Mann verstand sein Handwerk. Er quälte den armen Patienten nicht mit bitteren Mixturen, Pillen und Pulvern zu Tode. Mit so einer rohen Runkel hat er ihn eingesperrt und einfach jeden Tag nachgeschaut, ob die Runkel noch ganz sei. Am fünften Tage wies sie tatsächlich einige verschämte Kerben auf. Da hat er das Hündchen wieder abgeliefert und erhielt dafür am folgenden Tage einen goldenen Ring und den Hosenbandorden, nach dem er so viele Jahre umsonst geschmachtet hatte! — Sämi, wenn dir deine Frau Gänseleber und Filet vorsetzt, berufst du dich einfach auf deine Vergangenheit und lässt das Zeug stehen! Weißt, alles brauchst du dir doch nicht bieten zu lassen!"
„Sprich nicht von daheim, Noldi! Ich darf nicht daran denken — haben wir sonst nichts mehr?"
„Bitte, Sämi, noch zwei Platten: Als Hauptmahlzeit nehmen wir eine Prise Tabak und zum Dessert singe ich dir etwas vor!"
Es gibt für ein düsteres Gemüt neben dem kindlichen Gottvertrauen keine herrlichere Gottesgabe als den goldenen Humor eines treuen Freundes. Kneubühler, dem nur noch Nase und Spitzbubenaugen aus den Lumpen herausgucken, unterhält seinen Kameraden mit Schnurren und Witzen aus dem unerschöpflichen Wahnsinn des Jakobinerregimentes, bis endlich beide vor Schlaf und Müdigkeit in eine einzige Lumpenmasse zusammensinken.
Und unsichtbar über ihnen schreibt die Hand einer unerforschlichen Vorsehung in das Buch der Zukunft ein Schicksal von solcher Furchtbarkeit, wie es kaum je zwei Menschenleben zu verzeichnen haben.
Um Mitternacht schreckt Kneubühler vom Schlafe auf: Dort kommt Stucki mit seinem Prügel hinter einem Busche hervor.
„Was ist los?"
„Zwei Wölfe waren hier! — Schade, dass wir keine Schusswaffe mehr haben; siehst du dort den gelben Schein im Süden?"
„Ja, was soll's?"
„Der Föhn kommt! — Spürst du noch nichts?"
„Doch! Es ist wärmer geworden!"
„Schlafen wir noch einige Stunden!"
Am Morgen sind die beiden Flüchtlinge müder als am Abend. Geschlagen an allen Gliedern, stapfen sie weiter, hundemüde, nüchtern und verfroren. Der Föhn bringt Tauwetter, der Boden wird glitschig, die Kleider sind durchnässt bis über die Knie, und bei Waldpartien, die in der Nähe von Ortschaften unvermeidlich sind, fällt nasser Schnee auf die zwei Wanderer nieder, sodass sie bald unten und oben, innen und außen nass sind wie Pudel auf der Entenjagd.
Gegen Mittag fängt Stucki zu hinken an; seine Füße sind in den schief getretenen, nassen Schuhen wund geworden. Endlich steht er förmlich dampfend still:
„Es geht nicht mehr! Ich muss den Fuß umwickeln — geh du nur, Noldi! Ich folge dann — vielleicht — nach!" Das „vielleicht" erstickt fast in einem erwürgten Schluchzen. Kneubühler schaut ihm ins Gesicht und erschrickt: So elend hat er den Kameraden noch nie gesehen; förmlich am Zusammenbrechen scheint er zu sein! Der sonst so riesenstarke Mann muss sich wohl schon tagelang überwunden, immer und immer aber wieder aufgerafft haben. Solche Riesen sind in der Regel nicht so widerstandsfähig, wie — wie etwa der viel leichtere Kneubühler, der ein flotter Turner, gewandter Fechter, flinker Ringer und gelegentlich zur Abwechslung auch ein Tod und Teufel verachtender Raufbold war, wenn Not oder Ehre es verlangten, dazu ein schlauer Fuchs und zäh wie eine Speckschwarte. Nun aber ist er selber blass, ob vor Angst um seinen Kameraden oder infolge der eigenen, unmenschlichen Überanstrengung und Entbehrung, das weiß er wohl selber nicht:
„Sämi! – So geht's nicht mehr weiter! Wir gehen – wie heißt das miserable Nest dort unten?"
„Pont de Roide!"
„Des Teufels Großmutter mag dort ihren Wallfahrtsort haben, aber wir müssen hin: Du musst etwas Warmes zu dir nehmen, einige Stunden warm ruhen und vor allem den Fuß behandeln. — So ein schwerer Mann geht schlechter auf den Sohlen als ein leichterer, besonders bei diesem nassen, glitschigen Boden", fügt der Kleine in seiner Art zartfühlend hinzu.
„Aber Noldi! Doch nur noch eine Stunde bis zur Schweizer Grenze!" Fast wie ein Schrei klang es von den dürren Lippen des Berners.
„Es geht nicht anders, Sämi! Du würdest mir umfallen."
„Geh weiter, Noldi! — Lass mich hier allein — du hast dein Mütterlein in Willisau!"
„Und in Sumiswald guckt ein armes Fraueli Löcher zum Fenster hinaus, und ein kleiner Mutzli fragt Tag und Nacht —"
„Noldi! Sag nichts! Wenn ich sie nur noch einmal — nur noch einmal sehen könnte! — Dann wollte ich hier gerne den Wölfen mich hinlegen!"
Und da weint auch der Kneubühler wie ein Kind!
„Sämi! Bis hierher sind wir miteinander gewandert, wochenlang haben wir Gefahr und Hunger geteilt. Sämi, wenn ich dich verlasse, dann soll der Totengräber mich einst mit einem Hund begraben, dann sollen die Luzerner Buben auf mein Grab spucken und sagen: Hier liegt ein Schweizergardist, der seinen Freund in der Not verließ, nachdem seine Kameraden für den fremden König in den Tod gegangen waren . Nein, Sämi. Nimm hier meine Hand in deine Bärentatze — so — und nun schwöre ich dir beim heiligen Evangelium, dass ich mit dir leben und sterben will!"
Stucki kann nicht mehr reden, nur ein stoßweises Stöhnen würgt sich aus der breiten Brust herauf, und der Wald ist so still geworden, als horchte ein Unsichtbarer auf die Worte der zwei verlassenen Vagabunden.
Hinter einer verkrüppelten Eiche lauscht ein Reh mit vorgehaltenen Ohren: Was sind das wohl für Wesen dort? Menschen können das nicht sein; denn die kenne ich ganz genau!
Die verhängnisvolle Nacht Wieder gefangen Zur Guillotine verurteilt Zurück nach Paris!
Kneubühler führt den stolpernden und wankenden Riesen über die steilen Hänge zum Dorf Pont de Roide, im Tale des Doubs, der hier den Lomont durchschneidet.
Es geht in den früh dämmernden Abend hinein, wie die zwei verlotterten Vaganten in das stille Dorf und das noch stillere Wirtshaus einkehren. Ein junges, hübsches, dummes Ding fragt sie naserümpfend nach ihren allgemeinen und besonderen Wünschen.
„Zuerst einen Schnaps!", befiehlt der Luzerner.
„Beide zusammen einen oder jeder einen? — Haben die Bürger Geld?"
Da dreht sich Kneubühler nach ihr herum. Sie war an den Rechten gekommen:
„Nach ihrer Geschäftssprache scheint die Bürgerin nicht an die beste Kundschaft gewöhnt zu sein! Verkehrt denn hier wirklich so viel Gesindel, wie man sagt?"
Damit stellt der Kleine seinen Filz auf den Boden und wickelt das zerrissene Halstuch, das ihn bis zur Nase herauf einhüllte, vom Halse, und nun sieht die schnippische Wirtstochter erstaunt auf das hübsche, scharf geschnittene Knabengesicht, das von den lange nicht mehr geschnittenen, blonden Locken pagenhaft umrahmt ist. Und doch erwecken der Schalk und die natürliche Intelligenz in diesem hübschen Gesicht auf den ersten Blick den Eindruck überlegener Männlichkeit und jugendlicher Frische.
Die Wirtstochter kommt einen Schritt näher, halb neugierig, halb schüchtern:
„Ich glaubte, ich meinte nur — weil die Bürger Gäste — so — so…"
„— So lumpig daherkommen, nicht wahr? Hat nicht der Präsident des Wohlfahrtsausschusses, der ‘göttliche' Robespierre, verkündet, dass sich jeder, der sich nicht gebe wie ein richtiger Sanskülotte, im höchsten Grade des Verrates an der Nation verdächtig sei — Bürgerin Wirtin, Sie kommen mir sehr verdächtig vor!"
„Nein, nein — verehrte Herren Bürger, ich meinte nur…"
„Wer jemanden mit 'Herr' anspricht, macht sich verdächtig!"
„Es ist mir so entfahren, von früher her! Ich meinte nur, weil Sie einen…"
„Einen Schnaps bestellen, was? Jeder gute Patriot säuft Schnaps, und wer nicht Schnaps säuft, der macht sich zumindest verdächtig, jene zu verachten, welche die Milch des armen Bürgers trinken; übrigens ist dieser Schnaps für einen kranken Fuß. Wo ist der Fusel? Glaubt die Bürgerin, dass wir kein Geld haben?"
„Bitte, bitte! Sie sollen gewiss alles haben, auch wenn Sie nur in Assignaten bezahlen!"
„Bringen Sie uns einen Wein! Wir sind beide krank!", ruft er ihr nach.
„Alles wie ausgestorben!", bemerkt Stucki, dem es in Ruhe und Wärme etwas besser zu werden scheint.
„Werde sie fragen, was los ist", spricht der Kleine wie sinnend vor sich hin. —
Wenn wir ihn ‘klein‘ nennen, so soll damit nur das körperliche Verhältnis zu seinem riesigen Kameraden ausgedrückt sein; Kneubühler besaß normale Größe und war von Statur und wohl auch infolge militärischer Gymnastik fein proportioniert; er war mit vierzehn Jahren als Trommler in die Schweizergarde eingetreten.
Da kommt das Mädchen mit Schnaps und Wein.
„Können wir eine warme Suppe haben?", fragt der Luzerner.
„Bis in einer Viertelstunde! — Etwas dazu?"
„Was ihr wollt und habt!"
„Es ist halt alles ein bisschen teuer, seit Papiergeld aufgekommen ist."
Das war wohl wieder nichts anderes als ein leiser Zweifel an der Möglichkeit der Bezahlung! Als Antwort darauf greift Kneubühler unter den Brustteil seines Kittels — man hört etwas wie das Krachen einer Naht — und schmettert einen Louisdor auf den Tisch.
„Was tust du?", fragt erschrocken der Berner. — „Ich hätte schon noch Assignaten!"
Die Assignaten waren das in Frankreich im Dezember 1789 ausgegebene staatliche Papiergeld, das in Anweisungen auf die geistlichen, königlichen und Emigrantengüter bestand. Weil diese Güter zum Teil hoch überschätzt, zum Teil gestohlen wurden, und weil niemand in diesen Zeiten Großgrundbesitztum zu kaufen und überhaupt Vermögen zu bekennen wagte, dazu die Staatsfinanzen total zerrüttet waren, sanken diese Assignaten immer mehr im Kurs.
„Für Assignaten, für diese Lumpenwische, kriegen wir doch nichts Rechtes. So viel bist du mir denn schon noch wert, Stucki!"
„Aber, ich hätte ja selber noch einige…"
„Schluss! Du hast Frau und Kind! – Bürgerin Wirtschaft! Bringen Sie uns etwas Herzhaftes!"
Während die Wirtstochter verschwindet, um etwas Herzhaftes zuzubereiten, reibt Kneubühler dem Stucki seinen bös angelaufenen Fuß mit Obstbranntwein tüchtig ein und verbindet ihn mit einem trockenen Tuche. Dazwischen nehmen sie hin und wieder einen Schluck in den — nüchternen Magen! Die Wirkung zeigt sich sofort: Stucki wird erfrischt, aufgeräumt und Kneubühler mutwillig. Er stimmt einen Jodler an, dass die Fenster klirren und der Berner begleitet ihn wie mit einer auf das tiefe C gestimmten Posaune von Jericho, unter deren Stößen bekanntlich die Stadtmauern zusammenstürzten.
Mit der zweiten Flasche kommt ein heißes Stück Wildsau! Da fallen dem riesigen Berner die Tränen über die Wangen, und auch dem Kneubühler wird es so rührselig ums Herz, als ob er an der Bahre einer lieben Verwandten stünde. Mit wonnevollem Gesichte schneidet er seine Portion herunter und stellt den Rest, an dem sich die ganze Familie Wolf hätte sättigen können, dem Stucki hin. Mit schweigender Andacht nimmt der Berner die Gabe Gottes und zollt ihr alle Ehre, so
dass die dritte Träne schon auf den Knochen fällt.
Die Wirtstochter hat indessen dem Kneubühler mit regem Interesse zugeschaut, ihm auch hin und wieder eingeschenkt, ohne dass es dem Hinterländer eingefallen wäre, dieses Interesse auch nur durch ein Wort oder durch einen Blick zu fördern. — Der Berner aber hat bereits den Röhrenknochen mit gewaltigem Biss und Krach geöffnet und lutscht mit tiefen Schlürftönen das leckere Mark heraus.
Endlich kann sich die neugierige Französin nicht mehr halten.
„Woher sind die — Bürger?", fragt sie mit zuckersüßer Verschämtheit.
„Aus Amerika!", sagt Kneubühler und nimmt einen Schluck.
„Aber — das vorige Lied habe ich einmal im Berner Jura gehört, in der Nähe von Boncourt!"
„Wir haben dort auch schon Geschäfte gemacht. Wir sind nämlich Schweinehändler!"
Als Antwort auf diese mehr als kühne Behauptung fixiert sie die beiden von oben bis unten. Dieser freche Blick geht dem Luzerner auf die Nerven.
„Was sind wir schuldig?", fragt er kurz und bündig.
„Ach Gott, ja — ein Livre zwölf Sous!"
Und damit springt sie auf und holt Kleingeld — Assignaten, und zählt die Herausgabe neben den Louisdor, der immer noch auf dem Tische liegt.
„Könnten wir nicht altes Geld, Silbergeld, bekommen?", erkundigt sich Kneubühler wie so nebenbei; denn die Assignaten hatten schon mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, trotz staatlichem Zwangskurs.
„Tut mir leid!", entgegnet die holde Fee mit einem schnippischen Lächeln des Bedauerns. — „Wir haben jetzt eben nur Papiergeld und das hat ja gesetzlichen Kurs — man muss es annehmen!"
„Gut!", sagt der Hinterländer, indem er mit unnachahmlicher Gleichgültigkeit den Louisdor wieder einsteckt und einen Wisch Papiere auf den Tisch legt.
„Wir können das ja viel einfacher machen: hier bat die Bürgerin Wirtin ein Livre zwölf!"
„Ja, aber dann macht es mehr!", keucht die Enttäuschte mit gepressten Lippen.
„Dummes Zeug! Sie bekommen ja auch wieder gleich viel dafür! Es hat ja gesetzlichen Kurs — man muss es nehmen!"
„Gut! — Sehr gut!", sagt sie scheinbar gleichgültig, aber mit einem eigentümlichen Glühen in den schönen Katzenaugen.
„Für Ihre besondere Mühe und Freundlichkeit haben Sie hier noch zehn Sous!"
„Oh, bitte, bitte! — Von solch freundlichen Schweinehändlern nehme ich nichts an!" Und mit der Geste einer Königin weist sie das Geld zurück. Kneubühler steckt es ein.
„Können wir hier die Nacht über bleiben, Fräulein — Bürgerin?"
„Nein — tut mir außerordentlich leid! Alle Betten sind besetzt vom eigenen Personal!"
Damit verneigt sie sich hoheitsvoll zum Zeichen, dass ihre Audienz vorüber sei, und schmilzt hinweg.
„Gehen wir, Noldi?", fragt Stucki.
„Ja!", stimmt dieser zu und leert sein Glas in einem Zuge.
Wären sie jetzt gegangen, so wäre ihnen das Furchtbarste des Lebens erspart geblieben. — Aber auch manch herrliche Tat wäre ungetan geblieben, und — unsere Geschichte wäre nun fertig!
Da kommt aber die hübsche Französin wieder herein — ganz Freundlichkeit und Huld!
Und der Adam hat noch immer angebissen!
„Dass man so vergesslich sein kann!" — seufzt sie mit holder Entrüstung und bitterer Selbstanklage — „Papa und Bruder Louis kommen ja erst morgen heim, ein Zimmer mit zwei Betten ist frei!"
Da will sich Stucki erheben:
„Wir gehen! In drei Stunden sind wir in Damvant."
Aber beim ersten Versuche, aufzustehen, fällt er wieder zurück; seine Glieder sind von den unmenschlichen Strapazen steif und wie gelähmt, seine Füße wund und geschwollen. Kneubühler erfasst seinen Zustand mit einem einzigen Blick und gibt die endgültige Entscheidung:
„Wir bleiben! — Du musst eine Nacht Ruhe haben! Was kostet das Zimmer?"
Das fragt der Hinterländer nicht aus Knauserei, sondern nur, um sich am Morgen von der unergründlichen Evastochter nicht übers Ohr hauen zu lassen.
„Sagen wir zehn Sous für beide, samt Morgenessen weil's für euch ist!", lockt sie mit schmeichelndem Unterton in der süßen Stimme.
„Gut!", erklärt der sonst so witzige Kneubühler ahnungslos. — „Hier sind sie! Und wenn wir mit Ihnen zufrieden sind, Fräulein Bürgerin, so kriegen Sie den Louisdor doch vielleicht noch!"
„Ich werde ihn mir erringen!", haucht sie nun mit geheimnisvollem Lächeln, das der mit allen Wassern gewaschene Kneubühler wieder für holde Verschämtheit nimmt.
„Können wir früh zu Bett?", erkundigt er sich.
„Wann die Bürger wollen! Es ist alles gerüstet!"
Auch den Unterton in diesem „gerüstet" hört keiner von ihnen heraus; sie sind eben zu sehr mitgenommen, eigentlich abgehundet.
„Wir nehmen noch eine Flasche Wein aus der Kammer, Fräulein Bürgerin!", befiehlt der Luzerner.
„Gern — soll's gleich sein?"
„Wir bitten darum!"
Die Schöne hüpft weg und die zwei Vaganten nehmen ihr zweifelhaftes Gepäck auf, um die herrliche Lagerstätte sobald als möglich auszunützen, obwohl es erst gegen sechs Uhr abends geht.
Da bringt die Wirtstochter eine Flasche Burgunder. Kneubühler zahlt und fragt sie in aller Gleichgültigkeit:
„Sind sie verreist, die zwei — die Bürger Papa und Bruder?"
„Ja, nach Montbeliard."
„Zum Markt?"
„Nein, zum Patriotenfest!"
„Heute? — Was ist denn los?"
„Ein Gottesdienst zu Ehren der Göttin der Vernunft; achtzehn Verräter werden dabei hingerichtet, durch die wandernde Guillotine!"
„Ach! — In Montbeliard? Die Stadt gehört ja erst seit einem Jahre zu Frankreich!"
„Aber die Bürger von Montbeliard haben bewiesen, dass sie gute Patrioten sind!"
„Wie? — Durch dieses Fest?"
„Und die Hinrichtung der Verräter!"
„Könnten Sie dabei sein, Bürgerin Wirtstochter, wenn einer guillotiniert wird?"
„Wenn ein Verräter unter das Fallbeil geschoben wird? — Mit Vergnügen! — Ich könnte dabei stricken!"
„Wenn Sie sehen müssten, wie er hingeführt wird, wie seine Knie schlottern, wie seine Gesichtszüge bleich und schlaff, seine Lippen schneeweiß werden, wie das Haar sich aufrichtet, die Augen in wahnsinniger Angst hervorquellen, wie er anfängt zu schlucken, zu wimmern, zu heulen, zu rasen, oder wie er schlaff und schlotternd zusammenbricht. — Könnten Sie sehen, wie die Blutmenschen seine von Todesangst gelockerten Glieder förmlich zusammenlesen und zusammenhalten müssen, wie sie ihn aufs Brett binden, unter das triefende Beil schieben, wie das knirschende Beil fällt, das Blut spritzt, der Kopf mit verzerrten Augen herunterpoltert und von einem Henkersknecht an den klebrigen Haaren erfasst und dem Volke gezeigt wird?"
„Das muss ja äußerst interessant sein! Das will ich mir nächstens unbedingt einmal ansehen!"
Die zwei sagen nichts mehr — hören auch den blutigen Hohn der Patriotin nicht heraus — fassen ihre Lumpen und die Flasche und gehen ihr voran in den ersten Stock, wohin sie mit einer Repslampe nachkommt und die beiden in ein Zimmer des zweiten Stockes emporführt. Dort stellt sie die Lampe auf eine Stabelle, wünscht mit eindringlich süßer Stimme "Geruhsame Nacht" und schwebt hinweg wie eine Königin durch den Thronsaal.
Stucki löscht die Lampe sofort aus; denn der helle Vollmond scheint durch die zwei Kammerfenster und sehnsüchtig weist der weichherzige Riese in die strahlende Winterlandschaft hinaus:
„Dort — dort drüben!"
„Was?"
„Die Schweizer Grenze!"
„Wir trinken eins darauf — prosit, Sämi, es lebe das Emmental! — Morgen, Sämi, morgen sind wir auf Schweizer Boden."
„Und übermorgen in Sumiswald, und wenn ich nur noch Fetzen nachschleppe."
„Ich komme mit dir, Sämi, und werde deinem Fraueli erzählen, was der Korporal Stucki in Paris alles geleistet hat. Wenn sie nur die Hälfte glaubt, muss sie vor dir Angst bekommen. Von Sumiswald bin ich in einigen Stunden in Willisau, — das Müetti wird schauen, wenn der Tote heimkommt!"
„Ja, beim Donner", meint der Berner halb fröhlich, „der Zimmermann von der zweiten Kompagnie muss dich ja daheim bereits totgesagt haben!"
„Beim Teufel von Willisau!", kichert der Kleine behaglich, „totgemeldet und von der Liste der Lebenden gestrichen bin ich sicher, aber wo des berühmten Mannes sterbliche Überreste ruhen, darüber sind die Gelehrten noch geteilter Meinung!"
Diese letztere Redensart von der ‘geteilten Meinung der Gelehrten‘ ist überhaupt ein Lieblingsspruch des fröhlichen Hinterländers.
Sie schmettern ihr Reisegepäck in die Ecken und steigen — seit sechzehn Tagen das erstemal der nassen Kleider ledig — vor Behagen stöhnend und ächzend in die trockenen Betten. Stucki bricht beinahe durch und der Fußboden bebt und ächzt wie ein überlasteter Tanzboden.
Nach großen Anstrengungen schläft man gewöhnlich bald und ruhig; nach übergroßen Strapazen aber befindet sich der Körper in einer Art Fieber und der Geist taumelt zwischen Bewusstsein und Phantasien. So auch hier! Mit köstlichem Behagen recken sie die halblahmen Glieder, stöhnen und seufzen vor Wonne, wickeln sich ein, drehen sich, kommen in Hitze, werfen einen oberen Zipfel des Deckbettes zurück und fahren sich ächzend über die heiße Stirn. Schließlich springt Kneubühler aus dem Bett, sucht anscheinend etwas, findet es nicht, trinkt noch den Rest der Flasche und steigt wieder ins Elysium, bleibt aber sitzen und schaut zum andern hinüber:
„Sämi!", ruft er ganz leise, um ihn gegebenenfalls nicht zu wecken. Da regt sich was im Odenwald:
„Hm?"
„Kannst du schlafen?"
„Das nicht, aber es isch notti gäng schön im Bett; ich phantasier' mich heim!"
„Donnerwetter, Sämi! Morgen, morgen sind wir im Berner Jura. Ich kann's fast nicht glauben!"
„Wenn man sich auf etwas recht freut, so gibt's gäng neuis! Ans beste Fleisch gehen die Katzen am liebsten!"
„Es müsste doch mit dem Teufel zugehen!"
„Wenn ich morgen vom Weißenstein aus die Berner Oberländer Alpen sehe, Noldi, dann knie ich in den Schnee und bete drei 'Vater Unser'."
„Wie bist du denn eigentlich als Verheirateter unter die Garde gekommen? Ich will aber nicht fragen!"
„Frage nur! — Es hat so sein müssen! Mit vierzehn Jahren kam ich nach Paris und als Trommler zur Schweizergarde. Ich hatte damals schon das Maß und die normale Größe. Meine zwanzig Jahre waren bis auf drei Monate fertig, als ich wegen Todesfall heim musste; der Vater war gestorben, und die Mutter krank. In dieser Zeit verheiratete ich mich, damit die Mutter jemand hatte und ging dann nach Paris zurück, um die drei Monate noch fertig zu machen, meine Sachen in Ordnung zu bringen und — geriet in die blutige Brunst der Revolution, in den Tuileriensturm und die Septembermorde. Das übrige weißt du! — Horch! Ging da nicht jemand von der Türe weg?"
„Wohl möglich! Wir sind unvorsichtig. — Die Hauptsache ist, dass die Galgenvögel von Paris ihre Schnäbel umsonst gewetzt haben und dass wir morgen im hinteren Weißenstein einen Enzian bekommen — schlafen wir!"
Und es ging!
Kneubühler duselt allmählich ein und hört bald nicht mehr das Schnarchen des Berners, der wie eine Saugpumpe mit falschem Atem nach Luft ringt.
Mitternacht mochte längst vorüber sein, als Stucki durch eine leise Berührung erwachte. Diese „leise Berührung" hatte darin bestanden, dass Kneubühler ihm einen Stoß versetzt hatte, welcher einem englischen Berufsboxer den Atem abgeschlagen hätte. Wie im Rausche fährt der Riese empor:
„Gib mir den Bub!"
Der arme Teufel hatte wieder von daheim geträumt!
„Sämi!"
„Was isch?"
„Hörst du nichts?"
Die Frage war überflüssig; denn von der Wirtsstube herauf tönt ein Lärmen und Gröhlen, ein Singen und Schnabulieren, wie es eben nur angefeuchteten — französischen Zungen möglich ist; dazwischen hört man abgerissene Töne der Marseillaise und verstümmelte Strophen des schrecklichen "Ca ira".
„Wer ist das?", fragt der Berner.
„Das werden die Patrioten von Montbeliard sein!"
„Ah, richtig! — Werden auch noch genug bekommen von diesem besoffenen Freiheitsteufel! Schlafen wir weiter!"
„Nein, Stucki, das dürfen wir nicht!"
„Und — warum nicht?"