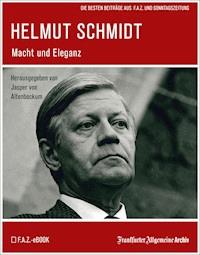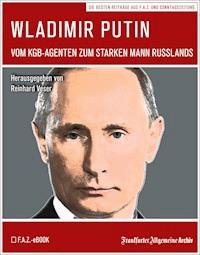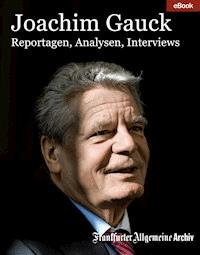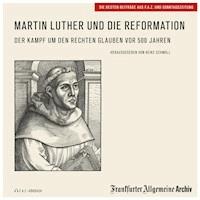Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Betrachtungen namhafter Hirnforscher und Neurobiologen über Denken, Lernen und Kreativität sind die Schwerpunkte des von F.A.Z.-Ressortleiter Joachim Müller-Jung herausgegebenen zweiten eBooks der F.A.Z. über Aspekte der Hirnforschung. Die Denkleistungen des menschlichen Gehirns sind Grundlage und Voraussetzung für Lernfähigkeit und für Kreativität. Ausgehend von Beiträgen über Denkprozesse sowie Potentiale und Grenzen des Denkens geht das eBook über zum Thema Lernen und vertieft neurowissenschaftliche Gedächtnistheorien und Ansätze der Neuropädagogik. Der dritte Abschnitt widmet sich der Kreativität. Die Autoren verfolgen die Frage, welche Hirnfunktionen schöpferische Kräfte beeinflussen und wie Kreativität funktioniert. Sie werfen auch ein Auge auf die neurowissenschaftliche Betrachtung von Kunst und entdecken die erschreckende Nähe von Genie und Wahnsinn. Kommentierte Buchempfehlungen für die weiterführende Lektüre schließen das eBook.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Kraft des Geistes
Wie das Gehirn uns denken, lernen und kreativ sein lässt
F.A.Z.-eBook 41
Frankfurter Allgemeine Archiv
Herausgeber: Joachim Müller-JungRedaktion und Gestaltung: Birgitta Fella
Projektleitung: Franz-Josef GastericheBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb und Vermarktung: [email protected]© 2015 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am MainTitelfoto: © agsandrew / Fotolia.de. Bildbearbeitung: Hans Peter Trötscher.
ISBN: 978-3-89843-388-4
Vorwort
Gehirn, was kannst du?
Von Joachim Müller-Jung
Die Geschichte zum Verständnis unseres Gehirns ist weit davon entfernt, zu Ende geschrieben zu sein. Dennoch wird diese Illusion weiter genährt. Die Ratgeber- und Sachbuchtitel, aber auch die forschungspolitische Agenda, sind voll mit Verheißungen. Eine »Neuro«-Manie hat die Erziehung unserer Kinder im Gewand der Neuropädagogik erfasst, dem Wirtschaften werden kognitive Prozesse zugeordnet, und Kultur wird als soziales Unterfangen beschrieben, dessen kreative Urkräfte und psychologischen Befindlichkeiten mit neurologischen Techniken leicht auf den Grund zu gehen ist.
Was also ist dran am Neurohype? Als Emil du Bois-Reymond im Jahr 1848 die Faszination seiner jüngsten neurophysiologischen Erkenntnisse über die elektrische Natur der Nervenleitung öffentlich mitteilte, klang das in den Ohren seiner Zeitgenossen, von denen viele noch der cartesianischen Teilung von Leib und Seele anhingen, wie die Erfüllung eines Menschheitstraums: »Es ist mir, wenn mich nicht alles täuscht, gelungen, jenen hundertjährigen Traum der Physiker und Physiologen von der Einerleiheit des Nervenwachstums und Elektrizität, wenn auch in abgeänderter Gestalt, zu lebensvoller Wirklichkeit zu erwecken.«
Dass er die philosophische Bedeutung und die Folgen für das Menschenbild der kommenden Jahrhunderte nicht zu sehen vermochte, mag man angesichts dieser Euphorie kaum glauben. Von da an jedenfalls kann man endgültig vom modernen Gehirn sprechen, das von den Naturwissenschaften und ihren Techniken nach Strich und Faden auseinandergenommen wird. Mit der Verknüpfung von Molekularbiologie, Bildgebung und Informationstheorie ist die Hirnforschung endgültig in die Beletage der »Big Sciences« aufgestiegen. Ihr Interpretationsbedürfnis ist entsprechend gewachsen. Viele Milliarden Euro fließen in die Erstellung von Hirn-Atlanten und Hirn-Simulationen, der Aufwand kennt – auch um des medizinischen Fortschritts willen – keine Grenzen.
Wie sehr die Hirnforschung inzwischen aber nicht nur medizinisch Boden gutgemacht hat, sondern auch zu einem politisch-kulturellen Faktor zu werden verspricht, hat das im Jahr 2004 in der Zeitschrift »Gehirn und Geist« populär aufbereitete »Manifest« zur Lage der Hirnforschung von elf deutschen Hirnforschern gezeigt. Es ist nicht ohne Widerspruch geblieben.
Mit den Versprechungen der Hirnforschung jedenfalls sind auch die Erwartungen an die Hirnforschung gestiegen. Aber was kann sie wirklich, angesichts von über 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Gehirn, die durch eine Billiarde Synapsen miteinander verbunden sind und pro Sekunde zehn Billiarden synaptische Informationseinheiten erzeugen. Wie kann hier die Ordnung unseres Denkens entstehen, und warum ist diese oft gestört? Welche Voraussetzungen machen uns kreativ und was hemmt unsere schöpferischen Kräfte? Wie lernt der Mensch am besten und warum ist etwas dran, wenn man sagt, man könne etwas »im Schlaf«?
Im vorliegenden eBook erklären herausragende Hirnforscher und Wissenschaftsjournalisten die Erkenntnisse der Neurowissenschaften zu diesen Fragen und zeigen auf, welche Konsequenzen sich daraus für unser tägliches Leben ergeben können.
Dem Konzept der Lokalisation von Hirnfunktionen zufolge sind für unsere verschiedenen Sinne und Wahrnehmungen Nervennetze an präzise bestimmbaren Orten für komplexe Operationen verantwortlich. Illustration: © Matthew Cole / Fotolia.com
Die Freiheit des Denkens
Die Gedanken sind frei – aber werden sie das auch bleiben?
Wie entsteht die Ordnung unseres Denkens, und was stört sie? Möglich, dass wir bald die Prinzipien des Denkens verstehen und kranken Menschen helfen können. Aber können wir dann auch Gedanken lesen?
Von Onur Güntürkün
Immerzu denke ich. Schon oft habe ich versucht, mein Denken zu stoppen; eine Leere in mir zu erzeugen, um dann durch den Vergleich dieser Leere mit meinem alltäglichen Denken mehr über das Gefüge meiner Gedanken zu erfahren. Nie ist es mir gelungen. In der Meditation, so heißt es, gelänge dies nach langem Üben. Ich werde wohl eines Tages das Training des Meditierens auf mich nehmen müssen, um in innerer Leere meinem Denken auf den Grund zu gehen.
Ich beobachte an mir, dass mein Denken ständig seinen Charakter wechselt. Manchmal ist es verwaschen bis zur Unkenntlichkeit; ein dumpfes Chaos von Gedankensplittern und wortlosen Bildern, die sich aneinanderreihen und überlagern. Manchmal, für kurze Momente, bin ich nur Sehen, Fühlen oder Hören. Manchmal springt mein Denken plötzlich auf etwas Neues und ich weiß nicht warum. Und zuweilen ist mein Denken kristallklar. Ein luzider Gedanke trägt mich dann für Stunden durch das komplexe Geflecht einer Argumentation und ich erkenne mit Leichtigkeit die innere Struktur des Gegenstandes, an dem ich geistig arbeite. In solchen Zeiten ist Denken ein rauschhaftes Vergnügen. Als Psychologe und Hirnforscher versuche ich, die neuronalen Grundlagen des Denkens zu verstehen. Für diese Forschung brauchen wir die ganze methodische Bandbreite der kognitiven Neurowissenschaften. In Zellkulturen werden zum Beispiel hybride Kompositionen aus Nervenzellen und Mikrochips gebastelt, um einen momentan noch primitiven biologisch-technischen Dialog mit kleinen Gruppen von Nervenzellen zu führen. In Tierexperimenten lernen verschiedenste Tierarten, von Forschern ertüftelte Aufgaben zu lösen, während man gleichzeitig die Aktivität von Dutzenden ihrer Nervenzellen aufnimmt und versucht, die Teilaufgaben zu entschlüsseln, die die einzelnen Neuronen ausführen.
Diese Experimente offenbaren, dass Neuronen wie kleine Zahnräder einer gewaltigen Maschine funktionieren, indem sie Teilaufgaben eines großen Funktionsgefüges übernehmen. In anderen Versuchen rekonstruieren Wissenschaftler die komplexen Vorgänge im menschlichen Gehirn und schaffen es, einzelne Bausteine des Denkens sowie ihre zugehörigen neuralen Signaturen zu isolieren. In klinischen Studien werden gelähmte Menschen mit Elektroden in oder an ihrem Gehirn ausgestattet, um sie zu befähigen, allein durch die Kraft ihrer Gedanken Rollstühle und Roboterarme zu steuern oder über Schrift mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. All diese Erkenntnisse helfen uns immer besser zu verstehen, wie Denken, Lernen, Erinnern, Entscheiden und Handeln funktioniert und warum diese Prozesse zuweilen versagen. Die von Neugier getriebene Grundlagenforschung macht dabei die spätere klinische Anwendung erst möglich. Wenn wir die psychologischen und neuralen Signaturen des Denkens entschlüsselt haben, können wir vielen Menschen mit Krankheiten und Behinderungen helfen. Aber können wir dann auch Gedanken lesen? Könnten all diese Erkenntnisse eventuell dazu führen, dass das berührende Volkslied »Die Gedanken sind frei« nur noch mit bitterem Beigeschmack gesungen werden kann, weil wir in unserem Denken gläsern geworden sind?
Nichts ist für die Forschung so wichtig wie eine Theorie, die das Experimentieren leitet und dem Forscher hilft, gewonnene Daten in echte Erkenntnisse umzuwandeln. Die wahrscheinlich fundamentalste Theorie der kognitiven Neurowissenschaft wurde 1949 von dem kanadischen Psychologen Donald Hebb in seinem Buch »The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory« ausformuliert. Hebb spezifiziert hierbei drei Postulate, die immer noch als Grundmuster der heutigen neurowissenschaftlichen Forschung dienen.
Das erste Postulat besagt, dass Neuronen, die gemeinsam aktiv sind (und somit im Jargon der Neurowissenschaften gemeinsam »feuern«), untereinander effektivere Synapsen entwickeln. Ich will dies an einem Beispiel erläutern. Stellen wir uns vor, dass Sie in eine andere Wohnung umgezogen sind und dort das erste Mal in Ihrer neuen Küche kochen. Während es in der Pfanne brutzelt, beugen Sie sich geschwind nach vorne, um ein Gewürz zu greifen. Ein Teil der Nervenzellen in Ihrem Gehirn verarbeitet gerade die Situation: »ich stehe vor dem Herd«, »Gewürze sind im Bord vor mir«, »ich greife in Richtung der Gewürzdosen« und so weiter. In dem Moment kollidieren Sie schmerzhaft mit der Dunstabzugshaube. Sofort melden sich andere Nervenzellen: »Schmerz an der Stirn«, »Dunstabzugshaube hängt tiefer als in der alten Küche« und so fort. Alle in dieser fiktiven Szene aufgeführten Nervenzellen feuern nun für einen kurzen Moment gemeinsam. Dadurch wird die synaptische Bindung zwischen ihnen stärker. Eine stärkere synaptische Bindung führt dazu, dass wenn Sie das nächste Mal an Ihrem neuen Herd kochen, wieder die Nervenzellen aktiv sind, die ihre jetzige Situation verarbeiten (etwa »ich stehe vor dem Herd«). Die Aktivierung dieser Neuronen ist aber nun durch die starken synaptischen Kontakte in der Lage, diejenigen Nervenzellen zu aktivieren, die damals die schmerzhafte Kollision verarbeitet haben. Dadurch erinnern Sie sich während des Kochens, wie weh es damals tat und dass Sie ein neues Bewegungsmuster brauchen, um ohne Blessuren Ihr Pfannengut zu würzen.
Das erste Postulat von Donald Hebb (neurons that fire together, wire together) hat sich neurobiologisch als absolut zutreffend erwiesen. So simpel dieses Postulat klingt, so genial ist die vorgeschlagene Lösung für ein grundlegendes Problem der Hirnforschung: wie organisiert sich das Gehirn selbst und wie integriert es die im Leben gemachten Erfahrungen ohne die Existenz eines übergeordneten Kontrollsystems, das dem Gehirn sagt, wie es das tun soll? Heute wissen wir, dass entsprechend der Hebbʼschen Regel Synapsen, durch die Korrelation der Aktivität gleichzeitig feuernder Neurone gestärkt werden. Dadurch organisiert sich die Gedächtnisbildung unseres Gehirns durch das gemeinsame Auftreten von Ereignissen, die dann neuronal assoziiert werden.
Für Sie als Leser dieses Artikels bedeutet das, dass ich gerade dabei bin, Ihr Gehirn zu verändern. Millionen Neuronen Ihres Nervensystems verarbeiten gerade die Inhalte dieser Seite. Die Synapsen an denen erfolgreich beide beteiligten Nervenzellen gleichzeitig aktiv sind, durchlaufen daher in diesem Moment eine komplexe Kette molekularer Prozesse, an deren Ende die Stärkung dieser Synapsen steht. Wenn Sie sich morgen noch an diesen Artikel erinnern, habe ich Ihr Gehirn erfolgreich modifiziert.
Das zweite Hebbʼsche Postulat lautet, dass Nervenzellen sich zu flexiblen, kurzfristig gemeinsam feuernden Koalitionen (sogenannte Assemblys) formen, die dann ein Objekt, eine Handlungsintention oder einen Gedanken repräsentieren. Es ist an dieser Stelle wichtig, genau zu definieren, was mit einer neuronalen Koalition gemeint ist. Ein Neuron A kann beispielsweise Teil des Assemblys »Herd« sein, wenige Minuten später im Assembly »Schreibtisch« ebenfalls feuern und kurz danach schweigen, wenn Sie an Ihr Auto denken. Dagegen könnte ein Neuron B eventuell bei »Herd« inaktiv bleiben, aber bei »Schreibtisch« und »Auto« feuern. Sollten Sie aber etwas Neues über Ihren Schreibtisch lernen, können sich die Zusammensetzungen ändern, so dass zum Beispiel Neuron A aufhört, Mitglied dieses Assemblys zu sein. Sollten Sie den Begriff Assembly noch nie in diesem Zusammenhang gehört haben, formt sich eventuell in diesem Augenblick eine neue Konstellation von Nervenzellen in ihrer Hirnrinde, die durch Ihre gemeinsame Aktivität die synaptische Effizienz innerhalb dieser Gruppe erhöht (erstes Hebbʼsches Postulat) sowie Assoziationen mit anderen ähnlichen Begriffen etabliert (das heißt mit Assemblys, die schon früher in Ihrem Gehirn entstanden waren).
Jedes Mal, wenn Sie in Zukunft das Wort Assembly hören oder lesen oder wenn Sie über die neuralen Korrelate des Denkens nachdenken, werden Sie genau diese neue Konstellation von Nervenzellen aktivieren. Und wenn Sie bei diesem Nachdenken zu neuen Einsichten kommen, wird auch Ihr Assembly für den Begriff »Assembly« sich in der Zusammensetzung seiner neuronalen Mitglieder verändern.
Es ist wichtig festzuhalten, dass die Neuronen, die ein Assembly bilden, nicht zwangsläufig räumlich benachbart sein müssen. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich, dass sie über verschiedene Bereiche Ihrer Hirnrinde verteilt sind. Nehmen wir das Assembly für den Herd in Ihrer Küche. »Herd« ist ein Wort in der deutschen Sprache und so wird eine Reihe von Neuronen im Sprachareal der linken Hirnhälfte Teil des Assemblys »Herd« sein. Ihr Herd hat aber auch ein bestimmtes Aussehen und somit werden Nervenzellen im Bereich Ihres visuellen Systems an diesem Assembly teilhaben. Da Sie häufig die Knöpfe Ihres Herdes bedienen, werden ebenfalls Nervenzellen in der Nähe der motorischen Zentren Ihrer Hände Teil des Assemblys »Herd« sein.
Wahrscheinlich hatte Donald Hebb auch mit seinem zweiten Postulat weitestgehend recht, wobei ein endgültiger Beweis für Hebbʼsche Assemblys noch aussteht. Selbst wenn über das Konzept von Assemblys momentan noch teilweise kontrovers diskutiert wird, sind Neurowissenschaftler sich jedoch einig, dass beim Denken große Gruppen von Neuronen in wechselnden Kombinationen aktiv sind. Diese Aktivitätsmuster wandern schnell über die Oberfläche der Großhirnrinde, wobei gleiche Denkinhalte in der Regel mit ähnlichen Aktivitätsmustern verbunden sind. Dadurch sind Hirnforscher bis zu einem gewissen Grad in der Lage nachzuvollziehen, woran eine Person gerade denkt.
Da aber jedes Gehirn noch viel einzigartiger ist als ein Fingerabdruck, muss ein Computer erst einmal die Aktivitätsmuster des Gehirns einer bestimmten Person erlernen. Dazu wird die Person in einen Scanner gelegt und bekommt vom Experimentator mehrfach entweder ein A oder ein B auf einem Monitor gezeigt. Jeder dieser Buchstaben führt zu einem spezifischen Aktivierungsmuster im Gehirn, welches von einem Computer erlernt wird. Jetzt kann die Versuchsanordnung geändert werden: Zwar wird immer noch der Versuchsperson manchmal ein A oder ein B gezeigt, aber der Experimentator weiß nun nicht mehr, welcher Buchstabe gerade auf dem Monitor erscheint. Das muss er jetzt anhand der Aktivierungsmuster des Gehirns erraten.
Auf diesem einfachen Niveau funktioniert Gedankenlesen bereits ganz gut. Man kann diese Experimente so weit treiben, dass man extrem grob nachvollziehen kann, an was eine Person gerade denkt, während sie beginnt zu träumen, oder für welche von zwei Alternativen sie sich in wenigen Sekunden entscheiden wird. Für das Gelingen all dieser Studien muss aber immer die Versuchsperson vorher mit einem Set von Stimuli konfrontiert werden, damit der Computer die individuellen Aktivierungsmuster des Gehirns jeder Person für jeden Stimulus erlernen kann.
Das dritte Hebbʼsche Postulat besagt, dass Assemblys so in Sequenzen geordnet sind, dass das Ende der Aktivität eines Assemblys den Beginn der Aktivität des nächsten markiert. Dies könnte eventuell die neuronale Grundlage für den ununterbrochenen Strom von Gedanken repräsentieren, den wir alle erleben. Die Überprüfung der Richtigkeit dieses Postulats ist eine schwierige Aufgabe. Tatsächlich beobachtet man, dass Nervenzellen in Arealen wie zum Beispiel dem für Gedächtnisbildung wichtigen Hippocampus in zeitlich angeordneten Staffeln organisiert sind und wie Taktgeber für Assemblys in anderen Bereichen des Gehirns fungieren könnten. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass Neuronen in kleinen Schaltkreisen in immer wiederkehrenden Sequenzmustern aktiv sind. Das Problem der jetzigen Hirnforschung sind aber nicht so sehr die kleinen repetitiven Schaltkreise. Die Frage ist eher, mit welchem Mechanismus Assemblys sich auf flexible Art und Weise immer wieder zu neuartigen Sequenzen organisieren. Sehr wahrscheinlich konkurrieren viele Assemblys darum, das nächste in der Kette zu sein. Wie die Auswahl des nächsten Assemblys gelingt und wie die ständige Überlagerung verschiedener Assembly-Ketten verhindert werden kann, gehört zu einem Teil der momentan noch nicht befriedigend geklärten Rätsel.
Die Erforschung der neuronalen Grundlagen des Denkens ist die wahrscheinlich fundamentalste Herausforderung der Neurowissenschaft. Unsere Fähigkeit zu komplexem Denken hat uns zum Menschen gemacht, und Störungen des Denkens sind ein zentrales Merkmal vieler Erkrankungen des Gehirns. Noch sehr viel grundlagenwissenschaftliche Forschung ist notwendig, um die neuronalen Prinzipien des Denkens so weit zu verstehen, dass die kausalen Kernproblematiken der verschiedenen Erkrankungen des Gehirns geklärt werden können.
Bis dahin müssen die meisten therapeutischen Verfahren der Neurologie und Psychiatrie die Symptome lindern, statt die Ursachen der Erkrankung zu beseitigen. Doch die neurowissenschaftliche Erforschung des Denkens hat neben vielen Erkenntnissen für die klinische Anwendung ganz nebenbei auch ein Beiprodukt geschaffen, das für viele Patienten eine dramatische Qualitätssteigerung ihres Lebens bedeuten kann. Menschen mit vollständiger oder weitestgehender Lähmung sind momentan für ihre Versorgung und für die Erfüllung einfachster Wünsche auf ihre Umwelt angewiesen. Wie weiter oben ausgeführt, lassen sich aber Signaturen von Handlungsintentionen in jedem Gehirn identifizieren. Hierbei braucht man noch nicht mal einen großen Scanner zu verwenden, sondern kann mit einfachen Elektroden, die auf die Kopfhaut geklebt werden, die neuralen Korrelate von Handlungsintentionen ableiten. Durch systematisches Trainieren von Musterdetektoren sind später technische Systeme in der Lage, zum Beispiel Rollstühle zu manövrieren. Für komplexere Handlungen, die beispielsweise von Roboterhänden durchgeführt werden, müssen kleine Elektroden entweder auf oder in den Cortex des Patienten implantiert werden. Die Patienten bekommen dadurch eine technische dritte Hand, mit der sie viele alltägliche Dinge erledigen können.
Wenn wir heute bereits in der Lage sind, einfache Bilder, Worte und Entscheidungen aus dem Gehirn von Versuchspersonen zu lesen, müssen wir dann fürchten, dass wir bald geistig gläsern werden? Wo sind die Grenzen der technisch-wissenschaftlichen Entwicklung des Gedankenlesens? Sollte in naher Zukunft die Auflösung von Scannern oder elektrophysiologischen Methoden besser werden, steigt natürlich auch die Güte des ausgelesenen neuralen Signals. Derzeitige Scanner mit sehr hohen Magnetfeldstärken sind allerdings bereits nahe der physikalisch sinnvollen Oberkante der Auflösung. Die elektrophysiologischen Verfahren werden diese Auflösung sehr wahrscheinlich nie erreichen. Das heißt, wir haben zwar noch nicht die Grenze erreicht, nähern uns aber den technischen Limits, die diese Technologien mit sich bringen. Mit der gleichzeitig ständig steigenden Rechenkapazität von Computern könnte es eventuell innerhalb der nächsten ein bis zwei Dekaden möglich sein, nicht nur grobe Kategorien des Denkens (»Mann«, »Straße«, »Auto«), sondern auch differenziertere Gedanken, wie die an eine bestimmte Szene, eine konkrete Person oder ein Wort zu erfassen. Komplexe Gedankengänge wären immer noch nicht erfassbar. Zudem muss man bei diesen Überlegungen eine Randbedingung erwähnen.
Alle bisherigen Untersuchungen klappen nur durch hochgradig kooperative Versuchspersonen, die sich stundenlang bewegungslos Stimulusmaterial anschauen, damit der Scanner ihre entsprechenden Hirnaktivitäten lernen kann. Später, in der eigentlichen Testphase, halten sich diese Versuchspersonen auch brav an das Testprotokoll und denken zum Beispiel genau an das Bild oder das Wort, das der Computer in ihrem Gehirn erfassen soll. Sobald diese Systeme zur Überführung von potentiellen Verbrechern genutzt werden sollen, wird wahrscheinlich klar werden, welche geistigen Gegenstrategien Menschen entwickeln können, die nicht ihr Denken offenbaren wollen.
Doch was wäre, wenn uns morgen eine technische Revolution ein vollkommen neues Werkzeug in die Hand geben würde, mit dem wir die Aktivität praktisch aller Neuronen erfassen könnten? Ein solches fiktives Szenario ist kaum vernünftig zu beantworten. Aber ich vermute, dass selbst ein derartig hochauflösendes System das Problem des vollständigen Gedankenlesens nicht lösen kann. Dieses Problem liegt in der Korrelation des geistigen und des neuronalen Signals. Den theoretisch unendlich vielen geistigen Vorgängen eines Menschen stehen in einem solchen Szenario auch nahezu unendlich viele Kombinationen neuronaler Signale gegenüber. Diese müssen erst einmal aufeinander abgebildet werden. Dazu müsste die Versuchsperson eine extrem große Anzahl unterschiedlicher Gedanken denken und diese präzise mitteilen, damit die Musterdetektoren die dazugehörigen neuronalen Signale lernen. Wie lange braucht es wohl, bis man so viel Unterschiedliches gedacht und das Gedachte erzählt hat, bis der Musterdetektor aus mir herauslesen kann, was ich für mich behalten möchte? Und dann gibt es noch ein weiteres großes Problem, es wurde ganz zu Anfang skizziert: Mein Denken ist bei weitem nicht so klar, dass ich es immer präzise mitteilen kann. Nur ein Teil meines Denkens wird mir bewusst und nur ein Teil des mir bewussten Denkens kann ich in Worten wiedergeben. Der Rest meines Denkens ist selbst mir nicht zugänglich, trägt aber zu den neuronalen Signalen bei, die zukünftige Systeme erfassen könnten.
Ich glaube, es bleibt dabei: Die Gedanken sind frei.
Der Autor
Prof. Dr. Dr. h.c. Onur Güntürkün ist Biopsychologe an der Ruhr-Universität Bochum. Nach dem Abitur in der Türkei studierte und promovierte er in der Psychologie in Bochum und war dann Postdoc in Paris, San Diego und Konstanz. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie Leopoldina und erhielt viele Auszeichnungen wie den Alfried Krupp-Preis, die Wilhelm Wundt-Medaille, die Verdienstauszeichnung des Türkischen Parlaments, den Leibniz- sowie den Communicator-Preis. In seiner Forschung versucht er zu verstehen, wie das Denken entsteht.
Dieser Beitrag erschien im Rahmen einer Vortragsreihe der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung als größtem privaten Förderer der Hirnforschung.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.10.2014
Die Illusion von Einsicht
Neurologen wollen beobachtet haben, wo Gott, die Liebe oder die Politik im Hirn wohnen. Ist das exakte Wissenschaft oder Humbug?
Von Georg Rüschemeyer
Spätestens seit seiner Wahl zum amerikanischen Präsidenten hat sich Barack Obama mit sympathischem Grinsen und sonorer Stimme in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Doch dieses Image ist neu: »Barack Obama hat noch Arbeit vor sich. Hirnscans von Probanden zeigten ein auffälliges Fehlen starker Reaktionen beim Betrachten von Mr. Obama«, schrieben Forscher Ende 2007 in einem Gastbeitrag für die New York Times. Das Team um den Neuropsychologen Marco Iacoboni von der Universität in Los Angeles, UCLA, hatte zwanzig noch unentschlossene Wähler mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) getestet. Ihnen wurden Bilder und Videos der damals sieben aussichtsreichen Bewerber um das Präsidentenamt gezeigt; die gemessenen Aktivierungsmuster in ihren Gehirnen wurden anschließend von den Forschern interpretiert.
Während Obama im Gehirnscan vor allem durch Funkstille auffiel, konnten andere Kandidaten offenbar die Empathiezentren des superioren Temporal-Sulkus und den inferioren Frontalkortex erregen. Hillary Clinton dagegen brachte die Angstzentrale in der Region der Amygdala zum Leuchten, gleichzeitig aber auch den cingulaten Kortex – ein Anzeichen, so die Autoren, für einen Kampf gegen »unterbewusste Impulse, Mrs. Clinton zu mögen«, der sich in den Wählerhirnen abgespielt habe. In Wallung versetzt wurden diese schon durch das Lesen der Worte »Republikaner«, »Demokrat« und »unabhängig«: Neben der Amygdala sprangen dabei das Ekel-Areal Insula, aber auch die Belohnungszentren des ventralen Striatum und andere Hirnareale an, deren Aktivität mit »Zuneigung und Verbundenheitsgefühl verbunden sind«.
Was kann man aus diesem Feuerwerk der Hirnregionen lernen? Vor allem, dass manche Forscher auch vor grobem Unfug nicht zurückschrecken, um in die New York Times zu kommen. Drei Tage später druckte die Zeitung eine von prominenten Neurowissenschaftlern unterschriebene, gepfefferte Gegendarstellung ab. Das Kolportieren einer nicht von Fachkollegen gegengelesenen Studie, welche unwissenschaftliche und unbegründete Schlussfolgerungen über ein so wichtiges Thema wie die Präsidentenwahl enthalte, sei besorgniserregend, schrieben die Kritiker um Iacobonis UCLA-Kollegen Russ Poldrack. »Ob ein Mensch Angst oder Verbundenheit empfindet, lässt sich nicht aus der Aktivität eines bestimmten Hirnareals schließen.« Schließlich seien die meisten Areale an einer ganzen Reihe mentaler Zustände beteiligt. So wird etwa die Amygdala auch bei positiven Emotionen aktiv, ebenso wie beim Betrachten sexuell anregender Bilder oder wohlgeformter Renaissance-Skulpturen.
Erinnert stark an die Schale einer Kokosnuss: das 1937 auf der Insel Java entdeckte Schädelfossil »Sangiran II«. Das Schädeldach des Homo erectus ist rund 1,5 Millionen Jahre alt. Gefäßabdrücke und Innenohr der Schädelkalotte sind noch immer Gegenstand wichtiger Forschung, denn dem Urmenschen konnte niemand mit Hirnscans hinter die Schädeldecke schauen. F.A.Z.-Foto: Frank Röth.
Auch wenn man die zitierte Studie als besonders misslungen ansieht: Der Versuch, die menschliche Psyche und so komplexe Phänomene wie Angst, Trauer, Liebe oder Frömmigkeit mit beobachteten Aktivierungsmustern im Gehirn gleichzusetzen, wird häufig unternommen. Das Gros der rund 20 000 in Fachzeitschriften publizierten Studien, die seit 1992 mit Hilfe der fMRT-Technik die neuronalen Grundlagen von Wahrnehmung und Denken ergründen wollten, versucht es.
Während in frühen Experimenten noch einfache Zusammenhänge erforscht wurden, wie etwa die Aktivierung des visuellen Kortex durch blinkende Lichter, ging es ab Ende der neunziger Jahre mehr und mehr um den menschlichen Geist schlechthin. Was Wissenschaftler meist vorsichtig als »neuronale Korrelate« der untersuchten kognitiven Funktionen bezeichnen, wird in den Medien dann schnell zum »Angstzentrum« oder dem »Sitz Gottes« im Gehirn. »Eigentlich liefert die fMRT nur Informationen über die Neuroanatomie«, sagt der Züricher Neuropsychologe Lutz Jäncke. »Aussagen über höhere kognitive Fähigkeiten sind damit nur sehr eingeschränkt möglich.« Das liegt einerseits an der geringen zeitlichen Auflösung der Methode – nicht einmal ansatzweise kann die sich im Bereich von Millisekunden abspielende Kommunikation zwischen Nervenzellen abgebildet werden. Ein weiteres Problem sind die abgeleiteten, bunten Aktivierungskarten des Gehirns: »Was man da sieht, sind eben immer nur Korrelationen psychischer Aktivität«, sagt Jäncke.
Was diese Korrelationen wirklich bedeuten, ist eine philosophische Frage, aber nicht nur. Denn die Grundannahme bei der fMRT-Interpretation, dass die tatsächlich gemessene erhöhte Durchblutung eines Hirnareals dem Feuern der dort sitzenden Nervenzellen entspricht (siehe unten: »Alles eine Frage des Sauerstoffverbrauchs«), ist durchaus nicht trivial. »Das funktioniert nur so ungefähr«, meint Nikos Logothetis, Direktor am Max-Planck-Institut für kybernetische Biologie in Tübingen. Er hatte im Jahr 2001 in einer der meistzitierten Studien des Fachs nachwiesen, dass die Durchblutungsänderungen tatsächlich mit dem Feuern ganzer Gruppen von Nervenzellen einhergehen.
Dass das nicht immer der Fall sein muss, zeigte eine in Nature (Januar 2009) veröffentlichte Arbeit. Forscher der New Yorker Columbia-University hatten die Sehregion im Kortex von Rhesusaffen freigelegt und mit empfindlichen Videokameras und Elektroden parallel dessen Durchblutung sowie die fMRT-Aktivität gemessen, während die Tiere sich Lichtreize auf einem Bildschirm ansahen. Durchblutung und Nervenfeuern waren zunächst, wie erwartet, synchron. Wenn aber auf den winzigen Lichtpunkt, der sonst das Folgen eines größeren Reizes ankündigte, nur Dunkelheit folgte, blieben die Nervenzellen weitgehend stumm. Die Blutgefäße erweiterten sich trotzdem wie gewohnt – und das würde in einem fMRT-Bild Nervenaktivität vorgaukeln, wo keine ist.
Inwieweit solche vorsorglichen Durchblutungsänderungen die Aussagekraft von fMRT-Studien in Frage stellen, ist nun Thema eines Expertenstreits. Für den Mathematiker und Neurobiologen Nikos Logothetis steckt dahinter die viel größere Frage, was die Stärke eines Neuronengewitters überhaupt über kognitive Prozesse aussagt: »Es kann zum Beispiel sein, dass das Signal zum Großteil von neuromodulatorischen Nervenzellen generiert wird, die lediglich die Aktivität übergeordneter Hauptneuronen verstärken oder hemmen. Die Aktivität der eigentlich relevanten Zellen, geht dabei aber weitgehend unter.« Das sei besonders gravierend bei der Untersuchung komplexer Denkprozesse, da diese vermutlich auf der Aktivität von sehr viel weniger Zellen beruhten, als etwa die Wahrnehmung eines Lichtreizes im visuellen Kortex. »fMRT verpasst einfach sehr viel relevante Aktivität«, sagt Logothetis.
Das alles schmälert seiner Ansicht nach nicht die Verdienste einer »phantastischen« Methode, die in Kombination mit anderen Messverfahren tatsächlich helfen könnte, die neuronalen Grundlagen des menschlichen Geistes zu verstehen. Bei der richtigen Fragestellung liefere die fMRT überaus wertvolle Antworten. Doch den meisten Studien fehle es eben an einer sinnvollen Fragestellung und testbaren Hypothesen, sagt sein Kollege Lutz Jäncke. »Da werden einfach Probanden mit irgendwelchen Stimuli traktiert, und nachher guckt man mal, wo es aufleuchtet«, beschreibt Jäncke das weitverbreitete Verfahren der Post-hoc-Analyse, also des kausalen Verknüpfens zweier gleichzeitig auftretender Beobachtungen. Mit dem richtigen statistischen Verfahren lasse sich auch fast immer etwas finden. Trotzdem sieht auch Jäncke das Problem nicht so sehr in der Methodik, die, richtig angewandt und durch andere Methoden ergänzt, wichtige Ergebnisse liefern könne, sondern in den oft hochspekulativen Interpretationen vieler Studien.