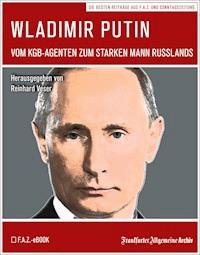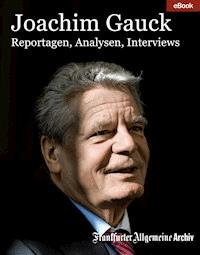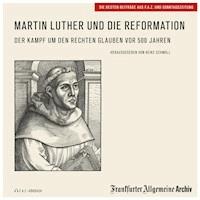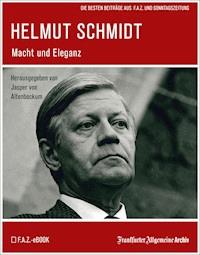
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
An die politische Lebensleistung Konrad Adenauers und Helmut Kohls kam er nie heran, er war auch nicht so umschwärmt wie Willy Brandt, nicht so kumpelhaft wie Gerhard Schröder, nicht so kontrolliert wie Angela Merkel. Doch Helmut Schmidt übertrumpfte sie alle, weil er Eleganz und Macht verband. "Macht und Eleganz" taufte er die Skulptur Henry Moores vor dem Bonner Kanzleramt, in das er 1976 aus dem Palais Schaumburg umzog und das er in eine Galerie verwandelte. Auch das zeigte, bei aller Bärbeißigkeit, die Schmidt oft und gerne zur Schau stellte, seinen ästhetischen Zugang zur Politik, der ihm schon den Weg in die Sozialdemokratie gewiesen hatte. Er entschied sich nach dem Krieg auch deshalb für die SPD, weil es eleganter, "schöner" und dramatischer war, für eine Partei zu arbeiten, die planen, steuern und lenken, nicht beharren, reagieren und bewahren wollte. Seine erste politische Bewährungsprobe, das Krisenmanagement rund um die Sturmflut des Jahres 1962, meisterte er, damals noch Hamburger Innensenator, bravourös. Das Image des "Machers", das er sich seinerzeit erwarb, blieb ihm Zeit seines Lebens erhalten. Bestätigt wurde es ein weiteres Mal im sogenannten "deutschen Herbst", als er mit aller Härte auf den Terror reagierte und erfolgreich war. In den Diskussionen rund um den "NATO-Doppelbeschluss", der letztlich dazu beitrug, den Warschauer Pakt in die Knie zu zwingen, ließ ihn schließlich seine Partei im Stich. Kanzler war er da schon nicht mehr, weil sein Koalitionspartner die Wirtschaftspolitik der SPD nicht mehr mittragen wollte. Als Publizist und weitgehend überparteilicher Experte für vieles blieb Schmidt im Gedächtnis der Deutschen ein unverzichtbarer Bestandteil des politischen und kulturellen Geisteslebens. In dieser Sammlung der besten Porträts, Reportagen und Interviews aus 53 Jahren blickt dieses F.A.Z.-eBook zurück auf eine einmalige Karriere des vielleicht beliebtesten Politikers, den die Bundesrepublik hatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Schmidt
Macht und Eleganz
F.A.Z.-eBook 44
Frankfurter Allgemeine Archiv
Herausgeber: Jasper von AltenbockumRedaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher und Birgitta Fella
Projektleitung: Franz-Josef GastericheBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb und Vermarktung: [email protected]© 2015 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am MainTitelfoto: © F.A.Z.-Foto / Barbara Klemm.
ISBN: 978-3-89843-419-5
Vorwort
Macht und Eleganz
Von Jasper von Altenbockum
An die politische Lebensleistung Konrad Adenauers und Helmut Kohls kam er nie heran, er war auch nicht so umschwärmt wie Willy Brandt, nicht so kumpelhaft wie Gerhard Schröder, nicht so kontrolliert wie Angela Merkel. Doch Helmut Schmidt übertrumpfte sie alle, weil er Eleganz und Macht verband. »Macht und Eleganz« taufte er die Skulptur Henry Moores vor dem Bonner Kanzleramt, in das er 1976 aus dem Palais Schaumburg umzog und das er in eine Galerie verwandelte. Auch das zeigte, bei aller Bärbeißigkeit, die Schmidt oft und gerne zur Schau stellte, seinen ästhetischen Zugang zur Politik, der ihm schon den Weg in die Sozialdemokratie gewiesen hatte. Er entschied sich nach dem Krieg auch deshalb für die SPD, weil es eleganter, »schöner« und dramatischer war, für eine Partei zu arbeiten, die planen, steuern und lenken, nicht beharren, reagieren und bewahren wollte.
Dabei ist es die Ironie seiner Kanzlerschaft, dass er meist reagieren musste, vieles bewahren wollte und durchaus kräftig auf seiner stoischen Weltsicht beharren konnte. Sein Reaktionsvermögen machte ihn zum »Weltökonom« und zum »Krisenkanzler« – von der Flut bis zum Terrorismus, von der Ölkrise über die Währungskrisen (ja, die gab es in Europa auch mit der D-Mark!) bis zum Nato-Doppelbeschluss, dessen Erfinder er war. Bewahren wollte Schmidt in all diesen kleinen, großen und durchaus existentiellen Krisen der westdeutschen Demokratie das bundesrepublikanische Vertrauen in Institutionen und Werte, die sein Vorgänger Willy Brandt noch reformieren, ja revolutionieren, er selbst aber wie ein zartes Pflänzchen »nur« verteidigen wollte. Im Rückblick seiner politischen Karriere ist diese Bundesrepublik alles andere als die idyllische und harmonische Gartenlaube, zu der sie neuerdings so gerne gemacht wird.
Der Altkanzler mit typischer Geste: Helmut Schmidt erklärt die Welt anlässlich seiner Ehrenpromotion an der Universität Marburg 2007. F.A.Z.-Foto / Wolfgang Eilmes.
Schmidt wurde deshalb auch zum tragischen Helden einer Zeit, in der die Ruhe der Nachkriegszeit aufgebrochen, der Konsens der Wohlstandsgesellschaft verlorengegangen war und sich die SPD von einer linksradikalen bis romantischen Gesellschaftskritik zermürben ließ. Das Ergebnis, die Entstehung der Grünen und deren Philosophie einer ökologischen und multikulturellen Gesellschaft, ist Schmidt bis in seine alten Tage, und hier kommt sein Beharrungsvermögen ins Spiel, fremd geblieben. Dagegen stand sein Staatsverständnis, das er gegen Extreme, Hysterie und fehlendes Augenmaß verteidigte, durchaus mit der Leidenschaft, wie sie Max Weber forderte.
Noch während seiner Kanzlerschaft sollte es deshalb heißen, Schmidt sei doch eigentlich in der falschen Partei gewesen. Doch dieser Eindruck kam nur deshalb zustande, weil Schmidt seine Partei wie kaum ein anderer an der Wirklichkeit maß – und deshalb wie kaum ein anderer SPD-Kanzler sich von der eigenen Partei entfernte, die bei ihren Visionen blieb und stets mit dem Risiko haderte, neue zu verpassen. Vielleicht war das der Grund, warum er auf das Wort »Vision« so allergisch reagieren konnte. Ganz abgeneigt war er Visionen nämlich insgeheim gar nicht so sehr: in Deutschland, in Europa und erst recht in der Welt, wo er sich als Planer, Stratege und Lenker zu Hause fühlte, wo er deshalb für die moderne Generation der »Weltinnenpolitiker« Pate stand. Diese Rolle füllte und kostete Helmut Schmidt in seinem »zweiten Leben« nach der Kanzlerschaft wie kein anderer Politiker vor ihm aus; sie machte ihn zum Idol weit über die SPD hinaus. Er übertrumpfte sie alle.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2015
Charakterbilder
Ein Ästhet der Macht
Zum Tode Helmut Schmidts
Von Jasper von Altenbockum
Es wurde gerne von den zwei Leben des Helmut Schmidt gesprochen, vom Leben als Politiker und vom anschließenden, viel längeren Leben als Publizist, Denker und Deuter. Doch wenn man es recht besieht, waren es nicht zwei Leben. Schmidt kehrte im Alter zu dem Leben zurück, das ihn in die Politik gebracht hatte und das er wohl auch dort nie aufgegeben hatte. Schmidt wollte Architekt und Städteplaner werden, bewegte sich in seiner Jugend schon in Künstlerkreisen, fühlte und bewegte sich auch später wie ein Ästhet unter den Banausen der Macht. Das brachte ihm gerne den Ruf der Hochnäsigkeit ein, war aber einer in der deutschen Politik seltenen Mischung aus Schöngeist, Politik und Macht geschuldet. Unter den Kanzlern der Bundesrepublik war er der einzige, der auf den Gedanken kam, ein Buch über »Kunst und Politik« zu schreiben, ohne damit eine Handlungsanleitung für staatliche Kulturförderung zu verstehen. Es hatte mehr mit dem Anspruch zu tun, den er in die Skulptur Henry Moores legte, die er 1976 vor dem Kanzlerbungalow in Bonn aufstellen ließ und auf den Namen taufte: »Macht und Eleganz«. Den funktionalen Kanzlerbungalow verwandelte er in eine Galerie, als entstehe gute Politik nicht zuletzt aus dem Wahren, Schönen und Guten.
Auch sein Weg in die SPD hatte damit zu tun. Der 1918 im »Vorort der geistigen Freiheit«, in Hamburg geborene Schmidt machte die Verachtung der Nazis für »entartete Kunst« und seine Kontakte in der Kriegsgefangenschaft dafür verantwortlich, dass er Sozialdemokrat wurde. Das Erlebnis, wie im Volksgerichtshof Widerständler des 20. Juli behandelt wurden, für ihn eine Pflichtveranstaltung, wozu er abkommandiert worden war, der er sich dann aber entziehen konnte, mag ebenfalls dazu beigetragen haben. Dass der Vater der uneheliche Sohn eines jüdischen Bankiers war, konnte die Familie während der Nazi-Diktatur verheimlichen. Den Plan, Architekt und Städteplaner zu werden, gab Schmidt in der Nachkriegszeit auf, der Ästhet wurde Volkswirtschaftler, statt Städteplaner wurde er schließlich ein Staatsplaner.
Eines Tages sollte es angesichts dieser doch sehr bürgerlichen Vorgeschichte seiner politischen Laufbahn heißen, Schmidt sei an die falsche Partei geraten. Doch das ist nicht wahr. Die Partei war nur an einen Planer, einen Macher, einen Lenker geraten, der ihre klassenkämpferischen Visionen mit Marc Aurel, Max Weber und Karl Popper korrigierte. Schmidt sah sich als Mann der Tat, der sich in der Krise bewährte, und litt unter nichts so sehr, als dass seine Taten nicht groß genug sein könnten. Die Rettung vieler Hamburger vor der Flutkatastrophe im Februar 1962 mit Hilfe der eigenmächtig herbeigerufenen Bundeswehr als Hamburger Innensenator war Schmidts frühe große Tat, die seinen Ruf als Krisenmanager begründete, ihn auf diesen Ruf aber auch bis über das Ende seiner politischen Laufbahn hinaus festlegte.
Durchaus machtbewusst präsentierte sich Helmut Schmidt auf diesem in den 70er Jahren entstandenen Porträt. F.A.Z.-Foto / Barbara Klemm.
Fünfzehn Jahre nach der Hamburger Katastrophe wollte es das politische Schicksal, dass Schmidt gar nicht krisenerprobt genug hätte sein können, um das Richtige zu tun. Generalbundesanwalt Siegfried Buback und der Bankier Jürgen Ponto wurden ermordet. Die RAF hatte Schmidts zweite Kanzlerschaft in eine Zeit der Krise, in den »deutschen Herbst« verwandelt. Die Befreiung der Passagiere der »Landshut« in Mogadischu am 18. Oktober 1977 aus den Händen von palästinensischen Terroristen, die damit die Gründergeneration der RAF freipressen wollten, gehört zu den mutigsten Leistungen, die ein Kanzler zu verantworten hatte. Aber die sich anschließende Ermordung des entführten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer durch RAF-Terroristen gehörte gleichzeitig zu den größten Demütigungen, die ein Kanzler der Bundesrepublik hinnehmen musste.
Schmidt empfand sich damals schon lange als Lotse, als »Krisenkanzler«, als Ethiker der Verantwortung, der den Staat durch allerlei Stürme zu führen hatte. Die SPD hingegen, diese Partei der permanenten Krise, deren Vorsitzender er nie wurde und wohl auch nie werden wollte, kam nicht in den Genuss seiner staatsmännischen Navigation.
Schmidts Kanzlerschaft begann nach dem Sturz Willy Brandts durch die Guillaume-Affäre 1974 zu einer Zeit, als sich die westdeutsche Linke in immer mehr Fraktionen spaltete und sich die SPD von einer linksradikalen bis romantischen Gesellschaftskritik zermürben ließ. Am Ende der Ära Schmidt/Brandt/Wehner standen die Gründung und der Aufstieg der Grünen, und Schmidts Anteil daran war, dass er deren Erfolgsrezept nicht anders als mit Realitätsflucht erklären wollte. Schon als Fraktionsvorsitzender in der Zeit der Großen Koalition – nach dem Tod Fritz Erlers und an der Seite des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Rainer Barzel – und später, im ersten Kabinett Willy Brandts, zunächst als Verteidigungsminister, gehörte er zum »pragmatischen« Flügel der SPD. Als Verteidigungspolitiker verfolgte Schmidt gegenüber Franz Josef Strauß aber ein durchaus »linkes« Programm, indem er gegen die atomare Aufrüstung der Bundeswehr kämpfte und, dann als Minister, die alte Garde der Generäle entließ. Als Nachfolger Karl Schillers im Amt des Finanzministers, erst recht als Nachfolger Brandts als Bundeskanzler seit 1974, folgte dann die Zeit des nüchternen Dompteurs einer weltweiten Rezession und einer Außenpolitik im Ost-West-Konflikt, die einer Konfrontation mit der Sowjetunion unter Leonid Breschnew nicht aus dem Wege ging.
Die Prinz-Heinrich-Mütze kennzeichnet den Lotsen. Schmidt macht 1976 in Neustadt an der Weinstraße Wahlkampf. F.A.Z.-Foto / Wolfgang Haut.
Das trug Schmidt am Ende seiner Amtszeit das Attribut des Antipoden Willy Brandts, des Konservativen und Rückschrittlichen ein. Das täuschte darüber hinweg, dass in seine Zeit der endgültige Bruch zur Wirtschafts- und Finanzpolitik der Ära Ludwig Erhards fällt. Massenarbeitslosigkeit und Inflation waren neue, unbekannte Erscheinungen in einer damals schon nicht mehr ganz so jungen Bundesrepublik, die schon in der Großen Koalition unter Kiesinger und Brandt den Pfad staatlicher Zurückhaltung verlassen hatte. Schmidt ergänzte die Vorstellung von der politischen Planbarkeit der Marktwirtschaft um eine internationale Dimension – in seine Zeit fallen die ersten Weltwirtschaftsgipfel, ständige europäische Währungsreparaturen und – unterstützt durch den befreundeten französischen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing – die Anfänge einer gemeinschaftlichen europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik. Wie weit sich Deutschland vom Liberalismus der Nachkriegszeit entfernt hatte, wurde erst in den letzten Jahren der Kanzlerschaft Schmidts klar. Da übernahm Margaret Thatcher in Großbritannien das Ruder.
Damals wie heute fand jedoch eine andere Entscheidung Schmidts innerhalb und außerhalb der SPD weit größere Beachtung. Die Ölkrisen von 1973 und 1979 bewirkten, dass Schmidt die SPD auf die Atomenergie festzulegen suchte. Damals passte das durchaus zum Fortschrittsoptimismus der Partei. Die Energiepolitik, die Skepsis gegenüber einer blauäugigen Entspannungs- und Friedenspolitik sowie seine manchmal ätzende Abneigung gegen eine »alternative« Weltwirtschaftsordnung trugen ihm aber bald die Gegnerschaft nicht nur des linken Parteiflügels ein, sondern auch der westdeutschen linken Intellektuellen überhaupt. Anders gesagt: die Freundschaft Schmidts zu Siegfried Lenz war eine der wenigen Freundschaften im Künstler- und Intellektuellenmilieu, die diese Zeit unbeschadet überlebte. Dabei hatte Schmidt in vielerlei Hinsicht fortgesetzt, was Willy Brandt nicht anders gemacht hätte. Auch die KSZE-Schlussakte von Helsinki und mehrere Begegnungen mit Erich Honecker im Sinne der deutsch-deutschen Entspannungspolitik zählten dazu, treten in der Erinnerung aber hinter Schmidts vermeintlichen Konservatismus zurück.
Grund dafür war, dass sich seine Kanzlerjahre unter dem Schlagwort charakterisieren lassen, das 1972 der Club of Rome geprägt hatte: die Grenzen des Wachstums. Das äußerte sich damals in einer angsterfüllten Kultur- und Gesellschaftskritik, die Schmidt bei allem Hang zu Kunst, Kultur und Literatur fremd blieb. Dazu war er zu sehr der Kriegsgeneration verhaftet. Und es war diese Generation, von der sich die westdeutsche Jugend »emanzipieren« wollte. Die ersten gesellschaftspolitischen Konsequenzen der Achtundsechziger-Revolution, die großen, auch damals manchmal schon bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in Brokdorf und in Gorleben, die Friedensdemonstrationen mit ihrem Höhepunkt 1981 im Bonner Hofgarten (die zweite, noch größere Kundgebung gegen den Nato-Doppelbeschluss fand dann 1983 unter Helmut Kohl statt) fielen in Schmidts Amtszeit.
Schmidts Laufbahn verlief als Verteidigungs- und Finanzminister, vor allem aber als »Schmidt-Schnauze« lange Zeit wie die eines hanseatischen und sozialdemokratischen Pendants zu Franz Josef Strauß – bei allem Unterschied in der Ästhetik. Zum Showdown der beiden Politiker kam es in der Bundestagswahl von 1980, die Schmidt mit Hilfe einer starken FDP gegen Strauß gewann. Wie sich herausstellen sollte, war das ein Pyrrhussieg, denn die Rechnung des damaligen CDU-Vorsitzenden, Helmut Kohl, war aufgegangen, sich die Niederlage von Strauß zunutze zu machen und alsbald auch als Sieger über Schmidt hervorzugehen – zwei Jahre später, mit dem konstruktiven Misstrauensvotum am 1. Oktober 1982, war es so weit.
Darüber, ob Schmidt damals an der FDP oder an der SPD gescheitert ist, wird immer wieder gerne diskutiert. Schmidt hatte, nachdem er schon 1981 seine eigene Partei durch Rücktrittsdrohungen und, als erster Bundeskanzler überhaupt, durch die Vertrauensfrage im Bundestag diszipliniert hatte, die FDP-Minister entlassen, bevor sie die Koalition im Streit über die Haushaltspolitik verlassen konnten. Die FDP, mit Hans-Dietrich Genscher und Otto Graf Lambsdorff an der Spitze, fürchtete, die Wähler wieder zu verlieren, die sie gewonnen hatte, weil sich bürgerliche Wähler von Strauß abgeschreckt fühlten. Allerdings waren diese Wähler in großen Teilen auch einem Bündnis mit einer unzuverlässigen SPD abgeneigt. Auf die FDP war Schmidt – und nicht nur er in der SPD – seither nicht mehr gut zu sprechen.
Mit Brandt, dem Parteipatriarchen, den er auf Betreiben Herbert Wehners abgelöst hatte, und mit großen Teilen der Partei lag Schmidt aber ohnedies und schon lange überquer: wegen des Aufstiegs der Friedensbewegung und der Grünen, wegen Schmidts Amerika-Freundlichkeit und wegen seiner Zuchtmeisterei. Sein Nimbus als Weltwirtschaftspolitiker, der zu Hause in Hamburg mit seiner Frau »Loki« die Staatsmänner aus Ost und West an der hauseigenen Bar empfing, der mit Giscard d’Estaing den G-7-Gipfel erfand und der in Europa wiederkehrende Währungskrisen meisterte, dieser Nimbus des Pragmatikers half ihm in der SPD nichts.
Zum Zerwürfnis kam es über der Entspannungspolitik. Schmidt setzte 1979 in Washington, London und Paris den sogenannten Nato-Doppelbeschluss durch, der Moskau zu Verhandlungen und zum Rückzug seiner Mittelstreckenraketen zwingen und später unter Ronald Reagan zu einer »Nulllösung« führen sollte: keine atomaren Mittelstreckenraketen der Nato in Europa, dafür aber auch keine SS-20-Raketen des Warschauer Pakts, die Deutschland in eine atomare Wüste verwandelt hätten. Nach Schmidts Sturz ließ die SPD in der Opposition diese Linie fallen wie eine heiße Kartoffel. So ähnlich muss sich auch Schmidt vorgekommen sein.
Erst Jahre nach dem Scheitern Schmidts, als die ersten »Enkel Brandts« Karriere machten, merkte die SPD (und auch die FDP), was sie an ihm hatte. Den Erfolg der »Nulllösung« fuhr Helmut Kohl 1987 ein – zwei Jahre später wurde offenbar, dass sich die Sowjetunion in den Ruin gerüstet hatte. Da hatte Schmidt seinen politischen aber schon lange gegen einen publizistischen Tatendrang eingetauscht. Als Herausgeber der Hamburger Wochenzeitung »Die Zeit« widmete er sich nur noch selten der Innenpolitik, kommentierte vielmehr umso lieber die Europa-, die Sicherheits- und die Weltwirtschaftspolitik. So – und in zahlreichen Büchern – konnte er an die globalen Facetten seiner Kanzlerschaft erinnern, die ihm wichtiger waren als die innenpolitischen Tragödien und Ränkespiele. Macht und Eleganz ließen sich so noch einmal versöhnen, und auch die Partei versöhnte sich mit ihrem innerparteilichen Herausforderer, der ihr ähnliche Zumutungen abverlangt hatte wie später Gerhard Schröder. Im Dezember 2011, kurz vor seinem 93. Geburtstag am 23. Dezember, war er der Star des Berliner Parteitags der SPD, gefeiert als visionärer Europäer und sozialdemokratische Vaterfigur. Am Dienstag ist Helmut Schmidt im Alter von 96 Jahren in Hamburg gestorben.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.11.2015
Der ewige Kanzler
Seit 1982 Jahren ist Helmut Schmidt nicht mehr im Amt, doch die Deutschen können einfach nicht von ihm lassen. Wenn dieser Mann uns die Welt erklärt, werden Erinnerungen wach an eine Zeit, in der scheinbar alles einfacher und übersichtlicher war als heute. Dabei war der Regierungschef auch damals schon vor allem eines: Krisenmanager.
Von Oliver Hoischen
Sie sehen ihn gern, noch immer. Wenn er auftritt, sind die Eintrittskarten Wochen vorher ausverkauft, es gibt ein Gedränge und Geschiebe. So wie kürzlich, als er im Berliner Ensemble auf der Bühne saß und man im Foyer eine Leinwand aufstellen musste, weil nicht alle in den Theatersaal passten. Deutsche Großväter, Eltern und Kinder kamen herbeigeströmt, um ihren Übervater zu bestaunen.
Neben ihm, auf einem Tischchen, stand ein Glas Cola, als Requisite. Natürlich zog er bald kräftig an einer Zigarette. »Ich bin ein alter Mann ohne Einfluss«, kokettierte der frühere Bundeskanzler. Seine Stimme war voller Schärfe – hamburgisch-kühl, sie kam von oben und schwebte über den Dingen. Da konnte jeder verstehen, was seinerzeit der CDU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Zeitel gemeint haben mochte, als er Helmut Schmidt einen Staatsschauspieler nannte. Doch Schmidt fühlte sich geschmeichelt: »Ich kann daran nichts Ehrenrühriges erkennen. Warum soll ich nicht von meiner Begabung Gebrauch machen?«, meinte er. Überliefert ist von ihm auch diese Sentenz: »Unser Gewerbe ist doch wie das der Schauspieler. Ohne Zustimmung von draußen gehen wir ein.« Jeder Auftritt des Kanzlers sei eine Mischung aus Leistung und Show gewesen, schreibt sein Biograph Mainhardt Graf von Nayhauß. So ist es geblieben.
Dabei ist Helmut Schmidt seit 26 Jahren nicht mehr der »Leitende Angestellte der Bundesrepublik«, wie er sich selber nennt. Sein aktuelles Buch, vielleicht sein letztes, sein Vermächtnis, heißt schlicht: »Außer Dienst«. Und verkauft sich blendend. Längst ist alles über ihn gesagt und geschrieben, in unzähligen Büchern von ihm und über ihn – die Leute finden ihn faszinierend. Sie mögen, dass ihnen einer deutlich sagt, wo es langgeht. Und das mit – jawohl – Kodderschnauze. Raubtierkapitalismus? Der frühere Bundeskanzler ist stolz darauf, diesen Begriff erfunden zu haben. Liechtenstein? »Die steuerfreien Inseln sind ein Krebsschaden für die ganze Welt.« Georgien? Dass der Nato-Rat eine Sitzung in Tiflis abgehalten habe, das sei, so Schmidt, in etwa so gewesen, als ob sich zu Breschnews Zeiten der Ministerrat des Warschauer Pakts in Havanna getroffen hätte. Afghanistan? »Was militärische Operationen angeht, da bin ich vorsichtiger als heutige Politiker. Ich habe den Zweiten Weltkrieg erlebt.« Es sei leicht, meint Schmidt, in ein Land »militärisch reinzugehen, aber schwer, ohne ein Chaos zu hinterlassen, mit Anstand wieder rauszugehen«. Finanzkrise? »Den Sozialstaat kann nur der Staat selber aufrechterhalten, nicht der Markt.« Jubel im Saal.
Der frühere Bundeskanzler sucht noch immer nach Bestätigung. Die bekommt er leicht. Denn wenn Schmidt spricht, erinnern sich die Leute. An die Zeit, als Amerikaner auf der einen und Russen auf der anderen Seite der Mauer standen, ganz übersichtlich. Als Deutschland bequem im Windschatten der Großen segelte und der Bundestag nicht darüber nachdenken musste, ob deutsche Soldaten dabei helfen sollen, das Morden im Kosovo zu beenden, oder gar am Hindukusch Terroristen dingfest zu machen. Als samstags noch die ganze Familie nacheinander in die Badewanne stieg und pünktlich zur »Tagesschau« wieder heraus war, weil anschließend »Dalli Dalli« kam. Regelmäßig bekam damals ein Bundeskanzler noch bis zu hundert Sekunden Sendezeit am Stück, um den Deutschen die nicht globalisierte Welt zu erklären. Schmidt, Typ Oberlehrer, kam das entgegen.
Er glänzte bei der KSZE-Konferenz 1975 in Helsinki. Er hob vor dem Kamin in Schloss Rambouillet den »Weltwirtschaftsgipfel« mit aus der Taufe. Er hatte die Idee, ein »Europäisches Währungssystem« zu schaffen – ohne ihn, seinen großen wirtschaftlichen Sachverstand, gäbe es vielleicht den Euro nicht. Seine Freunde waren Valéry Giscard d’Estaing und Henry Kissinger. Sogar Leonid Breschnew nötigte er Respekt ab – auch deshalb, weil er im Gespräch mit dem Sowjetherrscher offenbar Tacheles redete. Für eine Oppositionsbewegung wie die polnische Solidarnosc konnte er sich dagegen kaum begeistern. Umso mehr für den Nato-Doppelbeschluss, der fest mit Schmidts Namen verbunden bleibt: Wenn die Sowjets ihre SS-20-Raketen nicht binnen vier Jahren abschafften, so wurde 1979 beschlossen, dann würde der Westen mit Pershing-2-Raketen und Marschflugkörpern nachrüsten. So kam es. Die Geschichte gab Schmidt recht: 1987 vereinbarten Amerika und die Sowjetunion, diese Waffen wieder zu verschrotten.
Wenn da nur die Sozialdemokraten nicht gewesen wären. Manche von ihnen zweifeln noch heute, ob die Nachrüstung nötig war. Der Doppelbeschluss passte nicht in ihr Selbstverständnis: Sie wollten verhandeln, ohne bei einem Scheitern eigene Raketen stationieren zu müssen. Mit ihrer Gesinnungsethik, ihrem Gerede vom Sozialismus und einer besseren Welt konnte Schmidt nichts anfangen. Er hielt ihnen seine Verantwortungsethik entgegen, sprach von »pragmatischem Handeln zu ethischen Zwecken« und las Mark Aurel, den römischen Kaiser und stoischen Philosophen. »Er war überzeugt, dass er der Klügste ist«, sagt einer. Und er war es vielleicht auch.
Visionen? Ab zum Arzt! Als die Sozialdemokraten über den »Orientierungsrahmen ’85« diskutierten, eine Fortschreibung des Godesberger Programms, schüttelte Schmidt verständnislos den Kopf. Als Hunderttausende durch Bonn zogen und Gorleben, Brokdorf, »Schneller Brüter« oder Mutlangen in aller Munde waren, machte er Augen und Ohren zu. Wo er Öko- und Friedensbewegung in die SPD hätte integrieren können, rief er: Umweltidioten! Die Grünen, so sagen heute viele, seien durch ihn erst möglich geworden. Trotzdem hat er geklagt, sein »größter Fehler« sei es gewesen, nicht nach dem SPD-Vorsitz gegriffen zu haben. Könnte sein, dass er irrt: Willy Brandt hielt ihm stets den Rücken frei, er selbst hätte die Partei kaum zusammenhalten können. Rein instrumentell war sein Verhältnis zu ihr. Erst 1983, auf dem Kölner »Raketenparteitag«, wandten sich die Genossen ganz von Schmidt ab, von 400 Delegierten stimmten nur noch 14 für den Vollzug des Nato-Doppelbeschlusses. Da war er gedemütigt, aber eben auch nur noch Kanzler a. D.
Das kam, weil Helmut Schmidt stets die Mitte verkörperte. Wer ihn wählte, meinte nicht unbedingt die SPD. Bis heute haben viele Deutsche offenbar den Eindruck, Schmidt sei eigentlich in der falschen Partei und habe für seinen Machtverlust selbst nicht viel gekonnt. Gab es da nicht die Wendehälse von der FDP? Sind Genscher und Lambsdorff nicht unfair mit ihm umgegangen? Aufregende Regierungszeiten waren das damals: Im Februar 1982 stellt Schmidt die Vertrauensfrage, da war seine Wiederwahl erst gut ein Jahr her. Im Herbst wird dann Helmut Kohl Bundeskanzler. Den Pfälzer hatte er lange unterschätzt, er schien ihm zu sentimental und gefühlig.
Genau das erlaubt sich Schmidt nicht zu sein. Er will Autorität ausstrahlen – die Leute sehnen sich ja danach. Bei ihm suchen sie Orientierung, bis heute, da es schon wieder eine Krise gibt, eine Wirtschaftskrise. Schmidt scheint dafür der kompetente Mann, mit beidem kennt er sich aus: mit Wirtschaft und mit Krisen. Auch wenn in seiner Zeit der Schuldenberg immer weiter wuchs, die Arbeitslosenzahl stieg. Der Mainzer Historiker Andreas Rödder schreibt, Schmidts achteinhalb Regierungsjahre seien Zeiten des Krisenmanagements gewesen, der inneren, äußeren und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. »Dies waren per se nicht die Voraussetzungen für vorwärtstreibend Neues und große Aktivposten in der Bilanz, sondern für eine reaktive und kleinerschrittige Politik nicht der Reform, sondern der Bestandssicherung«, schreibt Rödder. Ob sich die ängstlichen Deutschen darum bis heute so gut mit Schmidt identifizieren können? Mit dem Mann, der auch höchste Staatsgäste in seinen kleinbürgerlichen vier Wänden in Hamburg-Langenhorn empfing, im Reihenhaus der »Neuen Heimat«. Dem Lehrersohn, der gleich um die Ecke, in einer Hütte am Brahmsee, Urlaub machte. Der sich nie eine dicke Zigarre oder Klamotten von Brioni gönnte und ein Leben lang an der Seite seiner Frau blieb: bei Loki. Und der vor allem die »ganze Scheiße des Krieges« mitgemacht hatte.
Wie teuer Schmidt sich seine Rauhbeinigkeit erkauft hat, können die Deutschen nur ahnen. »Tragödie des Pflichtbewusstseins« hat Schmidt den Zweiten Weltkrieg einmal genannt, keine Gnade der späten Geburt kam ihm zu Hilfe. Hans-Joachim Noack, sein Biograph, erlaubt sich deshalb die Frage, ob Schmidt den Nationalsozialismus tatsächlich »ohne Schaden an Geist und Seele überstanden« habe, wie er einmal selbst behauptete. Was andere eine »Analyse der politischen Situation« genannt hätten, hieß bei Bundeskanzler Schmidt später jedenfalls einfach »Lagebeurteilung«. Für die Franzosen blieb Schmidt »Le Feldwebel«. So aß er an seinem Schreibtisch im Palais Schaumburg manchmal Suppe aus der Dose, um keine Zeit zu verlieren. Noack, der Biograph, berichtet sogar, der Bundeskanzler habe morgens auf der Trillerpfeife geblasen, um die Beamten an ihre Schreibtische zu jagen. »Sein Verständnis von Führung war, dass man keine Zweifel zeigen darf, dass man nach außen hart ist«, sagt einer von damals. Und: »Er hatte etwas Männerbündlerisches: Das größte Zeichen an Zuneigung war, wenn man von ihm mit einem Faustschlag auf die Brust begrüßt wurde.«
So hat er sich inszeniert: als Mann der Exekutive, als »Macher«, der schon 1962, als Hamburger Innensenator, während einer gewaltigen Sturmflut, ins Polizeipräsidium stürmte und dort einen »gackernden Hühnerhaufen« vorfand. Da, so will es die Legende, hörte alles auf sein Kommando. Als Kanzler bekam es der Pragmatiker als Erstes mit der Ölkrise zu tun. Seine größte Bewährungsprobe aber wurde der Terror der »Rote Armee Fraktion« im Herbst 1977. Nach der erfolgreichen Stürmung der »Landshut« in Mogadischu sahen die Deutschen in Helmut Schmidt ihren Helden. Die Bilder vom Staatsakt für den ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer gruben sich ins kollektive Gedächtnis – der in sich versunkene Schmidt neben der Witwe des Ermordeten. Der Kanzler sah sich »in Schuld verstrickt«. Wie sollten sich die Deutschen von dieser Tragik nicht rühren lassen? Kino- und Fernsehfilme über diese Zeit fesseln sie bis heute.
So halten sie Helmut Schmidt also für den »coolsten Kerl« des Landes – laut Umfrage finden sie ihn cooler als den Schauspieler Til Schweiger. Und am 23. Dezember wird er auch noch 90, ein richtiger Methusalem. Ohne Schmidt und seine Weisheiten würde das »Zeit«-Magazin jeden Donnerstag ungelesen auf Deutschlands Couchtischen gestapelt. Die »Bild«-Zeitung nennt ihn schon »Helmut den Großen«, weil alle anderen Superlative längst vergeben sind. Die Bürger finden ihn viel besser als unsere täglichen Pofallas, Heils und Niebels – charismatischer, standfester. Dabei sitzt er auf dem Balkon und muss das Staatsschiff gar nicht mehr lenken. »Heutzutage haben wir weniger starke Führungspersonen, und es gibt infolgedessen mehr Leute, die sich einbilden, sie seien selber auch eine ganz gute Führungsperson, und eine Splitterpartei aufmachen«, hat Schmidt vor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Die neuen Politiker-Modelle erscheinen ihm wohl zu stromlinienförmig.
Und Helmut Schmidt? Der ist wie ein liebenswerter Oldtimer mit Ecken, Kanten und Marotten – und lebenslanger Richtlinienkompetenz.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 21.12.2008
Ein widersprüchlicher Kanzler
Gedanken über Helmut Schmidt
Von Volker Zastrow
Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte, von der Parteien Gunst und Hass verwirrt? Nicht im geringsten. Helmut Schmidt verdiente und fand Anerkennung, sogar Bewunderung selbst bei politischen Gegnern wie etwa Franz Josef Strauß. Auch Widersacher wie Erhard Eppler konnten ihm den gebührenden Respekt nicht versagen. Der fünfte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erntete Ruhm in Ost und West; seine Integrität und sein Format sind unbestritten. Noch heute schätzt man seinen Rat und seine Urteilskraft auf der ganzen Welt. Er stand und steht für eine Politik des Augenmaßes, der Stetigkeit, Berechenbarkeit und Kompetenz.
Rätsel scheint Helmut Schmidt niemandem aufzugeben. Er hat sie alle schon selbst gelöst. Bei keinem anderen Kanzler gehen Einschätzung durch andere und eigene Stilisierung so bruchlos ineinander über. Sein Charakterbild ist längst zum Klischee gefroren. Der Mann wirkt eisklar, kantig konturiert: Macher, Mütze, Mogadischu. Der Historisierung, kritischen Einordnung und Bewertung ist Schmidt bisher weitgehend entkommen.
Dabei ist dieser Politiker keineswegs so eindeutig, wie es den Anschein hat. An welchem Punkt auch immer man sein Bild näher ins Auge fassen möchte, beginnt es zu verschwimmen, irritierend zu changieren. Für einen Rationalisten ist er sonderbar emotional, als Sozialdemokrat erstaunlich konservativ. Hinter dem Entschlossenen verbirgt sich der Kunktator. Ein Tatmensch, der sich in Aktenberge hineinwühlt, souveräner Kettenraucher, Kraftprotz mit Herzschrittmacher. Gaullistischer Atlantiker, treu im Bündnis und doch Mittler zwischen Ost und West; kühler Interessenpolitiker, in Moskau zu gutgläubig, in Washington wutentbrannt. Bedrängt in Bonn, doch heimlicher Führer der westlichen Welt. Das Verblüffendste an diesen Widersprüchen ist, dass sie niemanden verblüffen. Es scheint fast so, als herrsche rundum stilles Einvernehmen, sie seien für die Politik des Kanzlers ohne Belang gewesen. Das kann nicht stimmen.
Staatsmann zwischen den Parteien
Als Kanzler sah Schmidt sich von Anfang an mit der paradoxen Aufgabe konfrontiert, den Schein der Klarheit auszustrahlen. Er war durch Brandts Rücktritt 1974 in einer unvorhersehbaren Ausnahmesituation an die Spitze gelangt. Die SPD hatte zu diesem Zeitpunkt in der Wählergunst erschreckend abgebaut, nicht zuletzt weil die Linke 1973 auf dem Parteitag in Hannover überraschende Erfolge erzielt hatte. Die Gemeinsamkeiten in der Koalition waren erschöpft, das Hauptgeschäft der Ostpolitik beendet, Geld für Reformen gab es nach der ersten Ölkrise nicht mehr. In dieser Lage bildete Schmidt die Ultima ratio der SPD. Freilich waren nur wenige bereit, darauf zu setzen, dass Kanzler und Koalition die Legislaturperiode überleben würden. Schmidt jedoch blieb achteinhalb Jahre im Amt, ein Beweis für außerordentliches politisches Geschick. Denn um sich zu behaupten, musste er Kräfte zusammenhalten, die auseinanderstrebten: Die FDP wollte am liebsten weg, und die SPD war von ihrer Notlösung keineswegs begeistert.