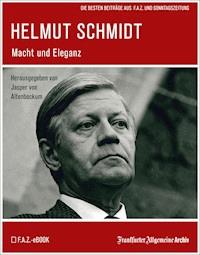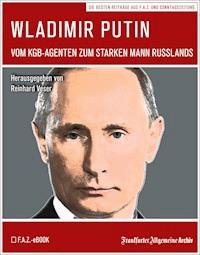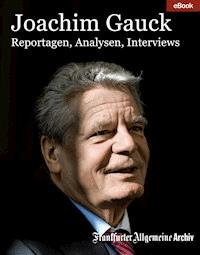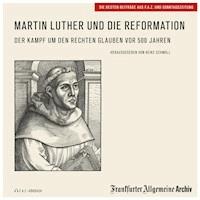Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was hat man sich unter der Investitur eines "Yeoman Bed Goer" vorzustellen? Hat ihre Majestät tatsächlich einmal Ukulelestunden genommen? Was geschieht bei einem königlichen "Swan Upping"? Und was verbindet die britische Monarchie eigentlich mit Deutschland? Die F.A.Z.-Korrespondenten haben seit der Krönung Elisabeths II. vor über sechzig Jahren informative, unterhaltsame und kuriose Geschichten rund um die Königin und ihre Familie zusammengetragen, die nun erstmals gesammelt in Form eines eBooks vorliegen. Abgerundet wird diese Sammlung durch eine Chronik der Regentschaft Elisabeths II. und Literaturhinweise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Königin Elisabeth II.
Sechzig Jahre Hofbericht in F.A.Z. und Sonntagszeitung
F.A.Z.-eBook 20
Frankfurter Allgemeine Archiv
Projektleitung: Franz-Josef Gasterich
Produktionssteuerung: Christine Pfeiffer-Piechotta
Redaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher
eBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2013 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main.
Titelgestaltung: Hans Peter Trötscher. Foto: F.A.Z.-Foto / Frank Röth
(Königin Elisabeth II. besucht den Reichstag anlässlich ihres Staatsbesuchs in Deutschland am 18. Juli 2000)
ISBN: 978-3-89843-233-7
Vorwort
Von Hans Peter Trötscher
Als Elisabeth II. im April 1926 als älteste Tochter des Herzogs von York das Licht der Welt erblickte, war es eher unwahrscheinlich, dass sie jemals auf dem Thron des Vereinigten Königreichs sitzen würde. Allein die Vorliebe ihres Onkels Eduard VIII. für die geschiedene Bürgerliche Wallis Simpson, die zum erzwungenen Thronverzicht führte, brachte Georg VI. in Amt und Würden, denn das Oberhaupt der Kirche von England durfte zu jener Zeit keinen geschiedenen Ehepartner haben. Damit war Elisabeth Thronfolgerin. Georg VI. wurde nur 57 Jahre alt und damit musste Elisabeth mit 26 Jahren seine Nachfolge antreten. In Großbritannien wurden 1952 noch Lebensmittelkarten ausgegeben.
Schon mit 21 Jahren hatte Elisabeth Philip Mountbatten geheiratet und war bei ihrer Thronbesteigung bereits zweifache Mutter. Elisabeth ist ein wichtiger Teil der britischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg und symbolisiert wie keine andere Person die Kontinuität des Vereinigten Königreichs auch in schwierigen und wechselhaften Zeiten. Über das Privatleben der Königin weiß man nicht viel. Wahrscheinlich gibt es auch gar nicht viel zu wissen, denn Elisabeth verstand es schon immer, wie kaum ein anderer Monarch, die eigene Person mit dem Amt eins werden zu lassen.
Wie der Hof selbst verlautbart, mag sie Tiere, konkret sind das wohl vor allem ihre Corgy-Hunde und ihre Pferde. Zu ihren Kindern hat sie ein eher distanziertes Verhältnis. Dass im zwischenmenschlichen Bereich einiges nicht zum Besten bestellt ist, trat beim tragischen Tod von Elisabeths Schwiegertochter Diana im Jahre 1997 zutage. Diana, die vor allem von der englischen Presse als Lichtgestalt und Alternative zur formal erstarrten restlichen Royal Family ins Spiel gebracht worden war, hatte das Volk hinter sich gehabt. Implizit gaben viele Briten der Königin die Schuld am schlimmen Schicksal Dianas. Geschickt überhöhte die Labour-Partei die von Tony Blair so bezeichnete »Volks-Prinzessin« und brachte die Monarchie ernsthaft ins Wanken.
Aber letztlich meisterte Elisabeth auch diese Situation. Sie gestand eigene Fehler ein und zeigte mehr Menschlichkeit. Wie weit das aus Überzeugung geschah oder einfach aus dem Antrieb, die Monarchie zu bewahren, ist unklar.
So sitzt Elisabeth seit nunmehr über sechzig Jahren auf Britanniens Thron und ist für die meisten ihrer Untertanen einfach nicht mehr wegzudenken.
Die Idee der Monarchie im 21. Jahrhundert
Sie ist die Krönung
So patriotisch gestimmt waren die Briten seit dem Sieg im Zweiten Weltkrieg nicht mehr: Das diamantene Thronjubiläum Königin Elisabeths II. lässt das Volk und die Geschäftemacher jubeln. Gefeiert wird nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland eine Frau mit großer Disziplin und mit kleinen Schwächen.
Von Johannes Leithäuser
Es nimmt kein Ende – und hat dabei noch gar nicht richtig angefangen: Die Zeitungsköchinnen des »Daily Telegraph« kochen der Nation seit Wochen »Coronation Chicken« vor, jenes Curry-Huhn, das einst zur Krönung Elisabeths II. erfunden wurde, und backen »Saxe-Coburg-Cake«, einen Schichtkuchen, der an die deutschen Vorfahren des Hauses Windsor erinnern soll. Der renommierteste britische Rosenzüchter stellte selbstverständlich zur Blumenschau in Chelsea seine »Royal Jubilee Rose« vor, eine pinkfarbene Strauchrose, und hatte doch das Nachsehen gegenüber einem Konkurrenten, dessen champagnerfarbene »The Queen’s Jubilee«-Rose es immerhin in den Wettbewerb um die Pflanze des Jahres schaffte – während die Rose mit dem korrekten Namen »Diamond Jubilee«, die in Britannien momentan von der Kaufhauskette Marks & Spencer vertrieben wird, eine cremeweiße Floribunda, gar aus der deutschen Rosenzüchterei Tantau stammt.
High Five für die Monarchie. Das frisch vermählte Herzogspaar von Cambridge hat den Umsatz mit königlichem Kitsch in Höhen getrieben, die seit Prinzessin Dianas Zeiten nicht mehr vorstellbar waren. F.A.Z.-Foto / Daniel Pilar.
Und dann die Fahnen: Zwar ist der Union Jack seit je eines der populärsten britischen Design-Motive, das den Kult-Status von Mini-Cooper-Autos, von Pop-Gruppen, von Taschen, Mützen und allerlei anderen Accessoires beförderte, aber so viel blauweißrotes Kreuzgeflagge wie gegenwärtig hat das Vereinigte Königreich seit der siegreichen Beendigung des Zweiten Weltkrieges nicht wieder gesehen. Der Patriotismus, der in der Person der zierlichen 86 Jahre alten Königin ankert, wirkt als Kaufanreiz für alles, was in das britische Nationalmuster eingewickelt ist: von den Digestive-Keksen über Teedosen, Küchentücher, Serviettenringe, Liegestühle bis hin zu Damenhandtaschen. Das Londoner Warenhaus Harrods hat seine grünen Sonnenblenden mit den Farben des Vereinigten Königreiches vertauscht, und einige britische Brauereien haben ihren Bierflaschen vorübergehend verkaufsfördernde Union Jacks übergezogen.
Schon vor einem Jahr, zur Hochzeit des Thronfolge-Enkels William, buchten die Party-Ausstatter Rekordumsätze mit dem Absatz von Wimpeln, Fähnchen, Servietten, Papiertischtüchern, nationaler Tischdekoration. Damals war noch aufmerksam darauf geachtet worden, dass die Familienfirma der Braut Catherine, ein Online-Vertrieb von Partyartikeln aller Art, nicht allzu offensichtlich in den Hochzeitsjubel einstieg und aus der Vermählung einer Betriebsangehörigen einen unlauteren Geschäftsvorteil zog. Dieses Mal sind Carol und Michael Middleton nicht weniger eifrig im Geschäft als ihre Mitbewerber. Ihr »ultimatives britisches Straßenparty-Set« bietet Pappbecher, Teller und Servietten für 24 Gäste – das Dekor zeigt wechselweise Pferde, königliche Gardesoldaten, Nationalfahnen und Königswappen – sowie zwei Fähnchengirlanden, 40 Luftballons und zwei Papiertischtücher für umgerechnet etwa 60 Euro. Plastikbesteck muss extra zugekauft werden.
Elisabeth II. auf dem Weg zur Hochzeit ihres Enkels. Statt wie früher hoch zu Ross oder zumindest in einer Kutsche nimmt die Königin neuerdings den Bentley. Der Jubel in Wolfsburg soll ob dieser Entscheidung nicht unerheblich gewesen sein. F.A.Z.-Foto / Daniel Pilar.
Wem das Pappbecher-Ambiente der Schwiegereltern von Prinz William (dessen Vater Charles immerhin eine Schirmherren-Rolle beim feierlichen Jubiläumszug seiner Mutter auf der Themse innehatte) zu bieder oder zu billig erscheint, der ist beim Hoflieferanten Fortnum & Mason besser aufgehoben. Der gediegenste Londoner Lebensmittelhändler, der in diesen Tagen häufig darauf hinweist, er beliefere die Monarchie seit zwölf Generationen, hat sich zwei Jahre lang auf diese Feier vorbereitet und liefert alles: Jubiläumsporzellan, Jubiläumsmarmeladen, Jubiläumspicknickkörbe samt Jubiläumschampagner, Jubiläumsteekannenwärmer und, besonders hübsch, die Jubiläumskeksdose aus Goldblech, in deren Boden eine Spieluhr mit Handaufzug steckt. Die spielt, ein bisschen hastig, die Nationalhymne: God save the Queen.
Fortnum ist womöglich der älteste, sicher aber der bekannteste Einzelhändler, der sich als Hoflieferant mit dem königlichen Wappen schmücken kann; eine Sonderstellung bescherte der Firma im März des Jubiläumsjahres den ehrenvollen Besuch der Monarchin mit ihrer Schwiegertochter Camilla und ihrer Schwiegerenkelin Catherine. Die drei Damen steckten während ihres Aufenthalts im Stammgeschäft in der Londoner Straße Piccadilly ihre Nase auch in eigens bereitgehaltene Präsentkoffer aus Weidengeflecht und zeigten sich vom Inhalt entzückt, angeblich vor allem, als sie darin neben den üblichen Picknick-Utensilien auch abgepackten feinen Hundekuchen entdeckten.
Es gibt mehr als 700 weitere offizielle Lieferanten des königlichen Haushalts, von denen viele gleichfalls den Glanz des diamantenen Thronjubiläums auf ihre Produkte lenken wollen. Der Schokoladenhersteller Prestat hat eine Jubiläums-Pralinenschachtel ins Programm genommen, simpel kalkuliert: Inhalt 15 Trüffel, Preis 15 Pfund. Andere Ausstatter des Königshofes geben sich zurückhaltender in ihren Geschäftsaussichten: Bei Swaine Adeney Brigg, dem königlichen Handschuh- und Reitpeitschenmacher, heißt es, der größte Auftrag sei wahrscheinlich schon im vergangenen Jahr abgearbeitet worden – damals hatte der Palast sechs neue lange Postillon-Peitschen für die Kutscher bestellt, die auch jetzt wieder die Karossen lenken, in welchen die Königin und ihr Gefolge am nächsten Dienstag vom Danksagungsgottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale durch die Stadt rollen werden.
Pünktlich zur diamantenen Jubiläumsfeier haben auch Berechnungen stattgefunden, welchen Markenwert die »Firma« (wie die Königin ihr familiäres Repräsentationsunternehmen angeblich nennt) repräsentieren würde, wenn man Schlösser, Grundbesitz, Kronjuwelen, aber auch die wirtschaftlichen Werbeeffekte in Tourismus, Export und Souvenirhandel zusammenzählte. Die Kalkulation der Beratungsfirma Brand Finance ergibt eine Summe von 44 Milliarden Pfund – das ist mehr, als die größten britischen Einzelhändler (Tesco) und die bekanntesten (Marks & Spencer) zusammen auf die Waage brächten.
Doch trotz des atemberaubenden Pomps, der sich an diesem Sonntag beim Festumzug auf der Themse zu entfalten entspricht, fällt die Anmutung der meisten Jubiläumsdevotionalien eher ein wenig bieder aus. Viele der Keksdosen, Keramikbecher, Kissen, Tücher und Porzellantassen zitieren in ihrem Design jene glückliche Nachkriegszeit, in denen die Herrschaft Elisabeths II. einst begann. Darin steckt eine doppelte Botschaft: Einerseits ist die britische Gesellschaft im vierten Jahr der Wirtschafts- und Finanzkrise doch durchaus empfindlich gegenüber verschwenderisch üppigem Bling, glitzernden Demonstrationen eigenen Wohlergehens, andererseits glänzen eben dadurch die schlichten fünfziger Jahre wieder wie neu mit ihren nostalgisch einfachen Vergnügen und Zeitvertreiben, zu denen eben auch Straßenfeste mit Wimpelketten gehörten.
Die jüngsten Meinungsumfragen sehen die Zustimmung der Untertanen Ihrer Majestät zur Institution der Monarchie auf Rekordwerten; jedenfalls so hoch, wie sie seit dem Unfalltod Dianas, Princess of Wales, nicht mehr gewesen sind. Die 86 Jahre alte Monarchin symbolisiert Beständigkeit in den aktuellen unsicheren Zeiten, und sie lebt ihrer Nation eine beispielhafte Pflichterfüllung vor. In der offiziellen Jubiläumsansprache an die politische Elite des Landes, zu der die Königin im Mai in der mittelalterlichen Westminster Hall erschien, dem düsteren Zentrum des Parlamentspalastes an der Themse, versprach sie ausdrücklich, ihr Leben weiterhin dem Dienst an ihren Völkern widmen zu wollen.
Also rüsten sich an diesem Sonntag, aus Dankbarkeit und einer Art familiären Zuneigung, noch weit mehr Briten als zu Williams Trauung vor einem Jahr für Grillfeste und Nachbarschaftsfeten, dekorieren ihre Wohnzimmerfenster weißrotblau und prosten ihrer Herrscherin zu. Wenn alles vorbei und verdaut ist, bleibt am Ende der patriotische Griff zu den Papierrollen der Marke Andrex, als deren Markenzeichen auf der Verpackung seit je ein flauschiger Retriever-Welpe schlummert; auch sie aber tragen in diesen Tagen, wie so vieles, den Union Jack auf der Plastikhülle.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 3.6.2012
Das Staunen der Welt
Von Königin Elisabeth lässt sich lernen, was Monarchie in einer aufgeklärten Gesellschaft überhaupt noch bedeuten kann
Von Dirk Schümer
Wozu taugt die Monarchie? Die Frage, die sich beim gigantischen Aufwand für Königin Elisabeths goldenes Thronjubiläum ja durchaus stellt, führt uns auf die falsche Spur. Eine Monarchie taugt nicht zu irgendetwas, eine Monarchie ist einfach da. Genau wie diese Monarchin, die sich für ihren Job weder qualifiziert hat noch sich 1952 gegen Konkurrenz durchsetzen musste, die ihr Geld nicht erarbeitet und die klangvollen Titel, die sie vergibt, nicht besitzt. Elisabeth sitzt einfach auf dem Thron und übernimmt dabei die merkwürdigste Aufgabe, die jemand in unserer kapitalistischen Mediendemokratie erben kann: Sie verkörpert.
Denn zur bloßen Idee ist längst das verkommen, was in grauen Vorzeiten einmal von den Menschen als Macht akzeptiert wurde: die magische Fähigkeit, sich vor anderen zum Anführer zu machen und diese Aura auch noch äonenlang an die eigene Brut weiterzugeben. So wurden einst Kämpfer zu Häuptlingen, indem sie – wie die Karolinger – mit grölenden Horden ganze Landstriche eroberten und plünderten. Indem sie, wie die italienischen Gonzaga oder Scaliger, im richtigen Moment einem Rivalen den Kopf abhackten. Oder indem sie, wie Wilhelm der Eroberer, der Ur-Urahn Elisabeths, wagemutig auf eine regnerische Insel übersetzten, um im Kampf Mann gegen Mann einen strategischen Brückenkopf zu besetzen, der nun immerhin 936 Jahre hält und zwischenzeitlich die halbe Welt umfasste.
Auf den heute wurmstichigen Thronen der Reiche des Mittelalters saßen Priesterkönige, die den Bresthaften die Skrofeln durch Handauflegen heilten und dann ihre balsamierten Leiber den Grabkammern anvertrauten, während der unsterbliche Körper des Königtums aus den fiesesten Wirren immer wieder neu erstand, weil die Menschen eines leiblichen Gefäßes für ihre Vorstellung von Macht bedurften. Vom britischen Empire, dem frühesten und aggressivsten all dieser Reiche, ist nach vielem Auf und steilem Ab einiges an Kronjuwelen übriggeblieben. Aber das ist es mitnichten, was Elisabeth in der raren Milliardärsinnung der fixen Berlusconis, Murdochs und Bloombergs zur Herrscherin macht. Alles könnte man ihr wegnehmen, aber sie bliebe – wie im Märchen – allzeit Königin.
Die modernen Klippschulmeister, die Medienleute, suchen daher am verkehrten Ende, wenn sie im Geheimnis von Elisabeths Persönlichkeit den Daseinsgrund der britischen Monarchie vermuten. Elisabeth wurden zum Jubiläum dutzendweise Publikationen jeden Volumens und jeden Seichtheitsgrads gewidmet, ohne dass man damit ihrem Wesen, ihrem Charakter auch nur einen Schritt nähergekommen wäre. In Wahrheit hat Elisabeth gar keine Persönlichkeit, und das macht sie – mehr noch als den abgeschotteten Tenno – zur letzten großen Monarchenfigur. Sie spielt nicht die Königin, sie ist die Königin. Sie jongliert nicht mit Macht, sie inkarniert sie. Von ihr lässt sich lernen, was die Monarchie in einer aufgeklärten Gesellschaftsordnung überhaupt noch bedeuten kann.
Das süße Geheimnis der Krone. Elisabeth verkörpert Idee, Person und Amt der modernen Monarchie. Niemals ist sie auf modischen Firlefanz hereingefallen. F.A.Z.-Foto / Felix Schmitt.
Griechenlands Exkönig Konstantin, obgleich einer vergleichsweise minderbürtigen Dynastie als der Windsorschen angehörig, hat Elisabeth einmal als die letzte Überlebende der alteuropäischen Herrscher bezeichnet, die mit einem Blick einen Menschen durchschauen und in seine Schranken zu weisen vermögen. Bei einer biederen, bald achtzigjährigen Hausfrau, die sich seit einem Halbjahrhundert jeden Morgen von Dudelsackmusik wecken lässt, meist von stark behaarten Hunden umgeben ist und bekennendermaßen als einzige intellektuelle Beschäftigung den Pferdesport gelten lässt, scheint diese telepathische Gabe wie ein Wunder. Aber wahrscheinlich sind die totale Menschenkenntnis und die Gabe, auf keine Mode, keinen zeittypischen Firlefanz hereinzufallen, gar nicht so schwer zu erwerben, wenn man sich nur ganz fest auf diese Aufgabe konzentriert: das zu sein, was alle anderen nicht sind.
Das hat Elisabeth getan, seit sie als kleines Mädchen begriff, dass sie einmal Königin der Briten und Herrscherin des Commonwealth sein würde. Sie hat brav alle Formeln geübt und seither Tag für Tag ihren Dienst angetreten. Sie hat sich an den herrschaftlichen Code der Kleider und der Sprache gehalten und es ihrer Umgebung, ihrer Familie damit wahrlich nicht leicht gemacht. Der Umsturz dessen, was dies vor 50 Jahren einmal alles bedeutete, hat ihr indessen nicht das geringste anhaben können, weil sie nicht an die Erscheinungsformen und Territorien ihrer Macht geglaubt hat, sondern nur an die Idee. Ob ein Irrer plötzlich nachts an ihrem Bett steht, ob ein nackter Maorihäuptling ihr etwas vortanzt, ob Margaret Thatcher in ihrem Namen die Armen berauben oder Tony Blair ebenso in ihrem Namen die Menschen mit Medientricks ruhigstellen will – die Queen bleibt stets die Queen. Sie hat auch keine Wahl.
Was ist nun die Idee, an die Elisabeth so fest glaubt, dass ein ganzes Volk, dass die halbe Welt ihr dies ohne jeden Zweifel abnimmt? Es ist die durch und durch religiöse Vorstellung, dass sich vage Erscheinungsformen des menschlichen Beisammenseins, dass sich abstrakte Ideale in einzelnen Personen manifestieren können. Dass eine einzelne eine Nation repräsentiert. Dass eine Sippe das Fortleben dieser Nation befördert. Dass ein Mensch für Werte und Überzeugungen einer Gemeinschaft sterben und leben kann, die für alle erstrebenswert wären, aber nicht einmal bestenfalls von einer Minderheit erreicht werden. Auf solchem – wie auch immer korrumpierten – Glauben an Zusammenhalt, Nächstenliebe, Aufopferung, Auserwähltheit, Stellvertretung basieren alle Religionen. Und nicht zufällig kann neben der Queen als amtlicher Instanz von sakraler Herrschaft allerhöchstens der Papst gelten. Wohlverstanden: nicht wegen ihrer persönlichen Fähigkeiten, die bei einer desinteressierten Greisin und einem paralytischen Pflegefall nicht ins Gewicht fallen, sondern wegen ihrer historisch gewachsenen und von der alten Welt übriggebliebenen Ämter.
Sollten nun eine Werbeagentur oder ein hybrider Denktank an Symbolfiguren für die fröhliche Konsumzukunft der befriedeten Menschheit basteln, wir könnten sicher sein, auf zwei Gestalten nicht zu stoßen: einen von einem Männerclub gewählten, autoritären, gegen Sex, Pop und Konsum wetternden Alten in irgendeinem Palast. Oder eine stets etwas desinteressierte Oma, die auf Milliarden sitzt, sich nicht berühren lässt und eine kaputte Familie hinter sich weiß. Nichts an diesem Regiment ist gerecht, ist transparent, ist revidierbar. Nichts an diesem Regiment ist human. Darum ist es so abwegig, wenn falsche Berater der Queen soufflieren dürfen, sie sorge sich um den kranken Mittelfuß des englischen Fußballers Beckham, sie surfe dann und wann im Netz oder habe eine Vorliebe für hüpfende Boygroups. Nein, die Queen der Briten hat ohne emotionale Erschütterungen sogar mindestens eine naive Schwiegertochter ausgesessen, die als verwöhnte Göre das Amt nicht von der persönlichen Befriedigung trennen konnte und dadurch für kurzzeitige Wallungen sorgte. Die Queen hingegen muss das Amt von keinen Privatinteressen trennen; sie hat keine.
Darum auch überragt Elisabeth sogar hochbegabte Monarchenkolleginnen und Mutterfiguren wie die Niederländerin Beatrix oder die Dänin Margarethe, weil die staunenswerte Britin sich im Amt nicht einmal mit modernen Bühnenbildern oder abstrakt gekneteten Tonfiguren, nicht mit politischen Prärogativen oder familiärem Geltungsdrang hervortun will. Elisabeth ist – und das ist seit ihrer zähen Ur-Uroma Viktoria und den fast 60 Regierungsjahren des unglücklichen Endzeithabsburgers Franz-Joseph in der Welt nicht wieder vorgekommen – nichts als eine Monarchin, Tag und Nacht, mit Hut und Krone, im Bett wie auf dem Thron. Indem sie ihr persönliches Leben und Empfinden auf das absolute, jederzeit mit dem Amt der Gesalbten kompatible Minimum reduziert und ganz mit ihrer Funktion verschmilzt, bleibt sie der Welt der faulen Kompromisse und des psychosozialen Ehrgeizes, der politischen Betrügereien und der lächerlichen Mode himmelweit entrückt. So akkumuliert sie wahre Macht, von der noch Generationen zehren können, wenn sie es nicht gar zu dumm anstellen.
Die Deutschen, die Elisabeth als Symbolfigur des ehemaligen Alliierten und Besatzers mehr noch als andere Monarchenfiguren vergöttern, können dagegen nur mit würdigen Honoratioren-Präsidenten und glanzlosem Republikanertum aufwarten. Nostalgie für eigene Gekrönte dürfte da nicht im Spiele sein, denn die letzten deutschen Monarchen, die hohenzollerschen Emporkömmlinge, ritten ihr Reich und ihr Volk operettenhaft ins Verderben, weil sie sich damals schon an den beneideten, unerreichbaren Windsors abarbeiteten. Die Hybris, im heutigen Preußen auch nur anspielungsweise als Farce die damalige Tragödie imitieren zu wollen, Hohenzollernschlösser wiederzuerrichten oder vor preußischen Adelssprösslingen Bücklinge zu machen, die doch schon im kruppsch befeuerten Original neben den Windsors wie Witzfiguren gewirkt hatten, würde die Republik Deutschland auf ewig zur Nippeskultur machen. So wie Deutschland seine verkorkste Tyrannengeschichte nicht retouchieren kann, so bleibt es nolens volens dem besten, was die eigene Tradition hergibt, verhaftet: biedermeierlicher Bürgermeister- und Pastorenkultur, wie sie Herzog oder Rau und all die wackeren Landesfürsten recht ordentlich inszenieren.
Wir Deutschen müssen angesichts der zweiten Elisabeth lernen, was unsere Geschichte erheblich unblutiger hätte verlaufen lassen: unsere Grenzen zu erkennen und uns angesichts wahrer Größe, die alle historischen Verbrechen irgendwann überwölbt, zu bescheiden. Und wir können die auch noch so dubios auf ihre Throne gerückten Monarchen glücklicherer Nationen wie der Spanier, der Schweden, der Luxemburger, der Niederländer, der Dänen (die im Haudraufkult der Wikinger wurzeln und als einzige die britische Monarchie an Anciennität noch übertreffen) nur neugierig bestaunen.
Die deutsche Adelsberichterstattung gehört nicht ohne jeden Grund zur dichtesten und gleichzeitig bestinformierten der Welt. Alle diese Monarchenfiguren, die wir nicht verdient haben, verkörpern, so gut sie können, die sakrale Gestalt der Macht. Selbst noch in einem Zufallsstaat wie dem letzten Territorium des Heiligen Römischen Reiches, dem winzigen Großfürstentum Liechtenstein, das aus böhmischer Wurzel ans klippenreiche Tal des Hochrheins verschlagen wurde, überlebt die krause und doch so überaus erfolgreiche Idee vom unschändbaren Körper des Königs, in dem unsere partikularen Interessen zusammenfallen.
Wer die Erfolgsgeschichte junger Monarchien wie Norwegens oder Spaniens verfolgt, wer die nicht mit großen Gaben gesegneten belgischen Coburg-Gothas im Zerfall ihres kleinen Landes bemitleidet, wer die liberale Identität vieler Skandinavier in ihren Monarchien gespiegelt findet, der wird sich um die Zukunft dieser Anachronismen nicht sorgen. Könige und Königinnen lassen sich erfinden, aber dann existieren sie außerhalb von Kausalität und Gegenwart. Genau diese Eigenschaft macht sie so stark.
Gefangen im eisernen Gehäuse profaner Zwänge, konfrontiert mit dem täglichen Abnutzungsgefecht des Meinungsstreits, geblendet von einer piependen und quäkenden Welt aus Daten, Pop und Silikon, können wir angesichts dieser größten lebenden Monarchin, die einige ihrer Tugenden, wenn schon nicht an die Kinder, so doch hoffentlich an ihre Enkel weitergeben kann, nur innehalten und staunen.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 9.6.2002
Das Mysterium der Monarchie
Königin Elisabeth II. – der ruhende Pol in einer ständig wechselnden Welt
Von Gina Thomas
Als Königin Elisabeth II. vor Jahren an einer jubelnden Menge vorbei in den Buckingham-Palast zurückkehrte, bemerkte ihr Begleiter untertänigst: »Die Menschen lieben Sie wirklich, Ma’am.« Die Schmeichelei verfehlte ihr Ziel. Kühl erwiderte die Königin, der Beifall gelte nicht ihr, sondern der Monarchie.
In dieser Antwort ist ihre Auffassung über die Rolle enthalten, die sie mit eiserner Disziplin erfüllt. Sie hat die eigene Person der Institution völlig untergeordnet. Legte man ihr wie einigen ihrer Vorfahren, etwa Alfred dem Großen oder Edward dem Bekenner, einen Beinamen zu, ginge sie als Elisabeth die Pflichtbewusste in die Geschichte ein. Sie bleibt an die Gelöbnisse gebunden, die sie bei ihrer Thronbesteigung ablegte, sie nimmt sie wörtlich. Schon deswegen wird sie nicht einfach abdanken. Der Historiker David Starkey hat darauf hingewiesen, dass die Krönungszeremonie dies vorgebe: »Wenn man siebenfach gesalbt wird, wenn einem zwei Kronen auf das Haupt gesetzt werden, wenn man drei Zepter bekommt und ein Schwert, wenn man ungefähr fünfundvierzig mal gesegnet wird und die Großen und Mächtigen des Landes vor einem knien und einem Treue schwören und das Ganze fünfeinhalb Stunden dauert, vergisst man es nicht.«
So unzeitgemäß dieses Ritual und das vermeintlich mittelalterliche Schaugepränge des britischen Herrscherhauses erscheinen mögen, zeugen die Trauer um die Königinmutter und die Jubelfeste zum goldenen Thronjubiläum in diesen Tagen von dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verehrung, das die Monarchie erfüllt. Nicht zufällig gibt es keine politische Form, die so weit zurückgeht und die so lange überlebt hat wie das Königtum. Zu den dynastischen, kirchlichen und verfassungsrechtlichen Grundlagen der Monarchie kommt eine mystische Komponente hinzu, die sich so wenig erklären lässt wie religiöser Glaube.
Die Monarchie lebe von dem Mysterium, schrieb Walter Bagehot 1867 in seinem Klassiker über die englische Verfassung und warnte davor, das Tageslicht in diese Magie eindringen zu lassen. Inzwischen sind die persönlichen Schwächen und die Entgleisungen der Windsors von grellen Schweinwerfern erfasst worden. Sie haben der Institution etwas von dem Zauber genommen, ihn aber nicht vollends zerstört. Bagehots Behauptung, dass »eine prinzliche Hochzeit die brillante Ausgabe einer universalen Tatsache« sei und »als solche die Menschheit fasziniert«, lässt sich nicht nur auf die märchenhaften Brautpaare anwenden, die sich vor den feuchten Augen der Welt trauen ließen. Sie gilt auch für die Affären und gescheiterten Ehen. Schon zu Zeiten Königin Viktorias versuchte sich das Königshaus als die vorbildliche Familie darzustellen. Die Bemühungen gipfelten 1967 in dem Film »Royal Family«, in dem die Windsors die perfekte Häuslichkeit und Geselligkeit mimten. Mittlerweile verkörpern sie geradezu die zerrütteten Verhältnisse, die überall in der Gesellschaft anzutreffen sind. Und gebannt verfolgen weite Teile der Menschheit jede neue Episode der Seifenoper als eine überlebensgroße Variante des Vertrauten.
Auch das ist Ausdruck der mit dem Verstand nicht fassbaren Emotionen und Instinkte, die sich mit der Monarchie verbinden. So ist es denn auch fast ein Widerspruch in sich, wenn sich Tony Blair mit seinem siebten Sinn für den Zeitgeist als »rationalen Monarchisten« bezeichnet. Ein volksnahes, allen Pomps entkleidetes Herrscherhaus, das sich der unklaren Vorstellung einer verjüngten, vom Ballast der Geschichte befreiten Nation anpasst, fände gewiss nicht den gleichen Zuspruch. Nirgends war die Kluft zwischen der Blairschen Vision und dem traditionellen Bild so deutlich zu vernehmen wie bei der leutseligen Silvester-Feier im Millennium Dome, als die Königin mit grimmiger Miene die Arme verschränken und »Auld Lang Syne« mitsingen musste.
Eine Zeitlang schien es, als verspiele sich Elisabeth II. mit ihrer konservativen Starrheit die Gunst der Bevölkerung. Jetzt aber deutet vieles darauf hin, dass dem Königshaus wieder mehr Sympathien zufließen, gerade weil es sich dem New-Labour-Bild von »Cool Britannia« nicht gefügt hat. Ungeachtet der Zugeständnisse, die sie in den letzten fünfzig Jahren machen musste, von dem Abbau der »großen imperialen Familie« bis hin zu der verspäteten Bereitschaft, Einkommensteuer zu zahlen, ist die Krone der ruhende Pol geblieben in einer ständig wechselnden Welt, ein Symbol der Kontinuität in aufgewühlten Zeiten.
Das liegt ebenso an der in der Verfassung verankerten Rolle des Monarchen wie an der gewissenhaften Person der Königin selbst. Das britische Staatsoberhaupt hat auf dem Papier viele Befugnisse: Es ernennt den Premierminister und als Oberhaupt der anglikanischen Kirche auch die Bischöfe, es löst das Parlament auf und bewilligt Gesetze. Aber diese Funktionen sind Formalitäten. Die extremen Umstände, unter denen, wie Kritiker der Institution warnen, ein skrupelloser Herrscher seine Rechte missbrauchen könnte, sind kaum vorstellbar. Allerdings kann die Krone in Ausnahmesituationen schlichtend eingreifen oder, wie in den letzten fünfzig Jahren immerhin dreimal geschehen, tatsächlich den Premierminister bestimmen, wenn keine Partei die Mehrheit im Parlament erringt.
Im Wesentlichen beschränkt sich die politische Rolle des Monarchen, so Bagehot, auf das Recht, »zu Rate gezogen zu werden, zu ermuntern und zu warnen«. Wie weit Elisabeth II. davon Gebrauch macht, ist ein gut gewahrtes Geheimnis. Denn keiner ihrer zehn Premierminister hat bislang etwas preisgegeben über den Inhalt der Gespräche, die jeden Dienstag im Buckingham-Palast stattfinden. Gleich welcher politischen Couleur, haben sie jedoch einmütig die Erfahrung und die Weisheit der Königin gerühmt. Auch hat keiner von ihnen die Vorzüge der Verfassungsmonarchie in Frage gestellt, die über der Politik steht und eine gewisse Stabilität garantiert – Vorzüge, die den Briten jetzt wieder bewusst werden, da sie sich ihrer nationalen Identität nicht mehr sicher sind. Einiges wird sich wohl noch ändern. Selbst die von der Königin einberufene Reformgruppe überlegt sich, wie angemessen die Rolle des Monarchen als Oberhaupt einer Staatskirche ist, der höchstens dreißig Prozent der Bevölkerung angehören. Aber seit langem war es um die Republikaner nicht mehr so still wie in diesen Tagen.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 5.6.2002
Einmal Buckingham Palace
Das zweite elisabethanische Zeitalter
Von Bernhard Heimrich
Wer eine Königin besucht, kann etwas erzählen. Also fangen wir an. »Zum Palast bitte«, sagt der Fahrgast. »Buckingham?« fragt der Taxifahrer. »Zum Buckingham-Palast«, bestätigt der Fahrgast ergriffen. Der Fahrer nickt, stellt den Zähler an und macht sich auf den Weg. Der Passagier hinten lauert. Der Fahrer vorne schweigt. Das kann doch nicht alles gewesen sein?
In Paris war das ganz anders gewesen. Als der Taxifahrer hörte, er möge zu »Notre Dame« fahren, hat er den Gast zuerst einmal geduldig gefragt, ob er eine Ahnung habe, wie viele Kirchen es in Paris gebe, die Notre Dame heißen. Dürfe es vielleicht Notre Dame de Lorette sein, schlug er vor, oder lieber Notre Dame de la sowieso? Oder wieder eine andere? »Notre Dame!« wiederholt der Fremde kläglich. »Kein Problem«, sagt der Fahrer munter. Es war ihm überhaupt nur um seinen Stolz auf sein Wissen und die vielen Kirchen seiner Hauptstadt gegangen. Oder war da nicht auch noch eine Ahnung von Nation, von großer Geschichte im Schatten dieser Kirchen? Ist nicht Paris einmal eine Messe wert gewesen? War sein König nicht der allerchristlichste? Gehört zur Nationalliteratur nicht auch ein Glöckner von, pardon, Notre Dame? Was für Paris die vielen leeren Kirchen sind, sind für London die vielen bewohnten Paläste. Dort leben die, die schon immer in Palästen gelebt haben. Unser Taxifahrer zählt nicht dazu, und deshalb hatte die Fahrt eigentlich auch ein kleiner Test zum Pegelstand einer englischen Seele sein sollen.
Das Ergebnis ist ebenso enttäuschend wie, ein wenig früher, die Suche im Telefonbuch. Da steht »Buckingham Palace« eingestreut irgendwo zwischen »Buckingham Balti House«, offenbar einer indischen Speisegaststätte, »Buckingham Arms«, was schon wieder auf eine Kneipe schließen lässt, oder »Buckingham Dry Cleaners«; und auch die Telefonnummer macht mit ihrem kleinbürgerlichen Durcheinander beliebiger Ziffern nichts von sich her.
»Wo soll ich Sie denn rauslassen?« fragt der Taxifahrer am Ziel der unergiebigen Expedition. »Die Wachablösung sehen Sie am besten von da drüben.« Es ist kurz nach zehn; um elf ist der wöchentliche Auftritt der zackigsten Ballett-Truppe dieser Erde, der königlichen Garde. »Hören Sie, ich will in den Palast hinein, nicht zum Palast!« Das gibt dem Fahrer dann doch einen Ruck. Sogar das Taxi ruckt ein bisschen, denn eben hat der Fahrer die Zentralverriegelung wieder eingeschaltet. Der Fahrer dreht sich herum, um den Gast besser studieren zu können. Aber noch immer scheint ihm der Sinn nicht nach einer Aussprache über die Monarchie zu stehen. Stattdessen steuert er den nächsten Polizisten an. »Hier ist einer, der sagt, er will in den Palast«, klagt er. Der Fahrgast fingert in den Manteltaschen nach diesem elenden Brief, vergebens natürlich. Wahrscheinlich liegt er zu Hause auf dem Schreibtisch. Der Polizist wirft einen Blick auf den Fahrgast. Wie ein Taliban sieht der heute aber nicht aus. »Wenn Sie in den Palast wollen, nehmen Sie am besten den übernächsten Eingang«, sagt er milde. Und das soll alles gewesen sein?
Gott und ihr Recht. Bei aller »Britishness« haben die Royals einen erstaunlichen und doch historisch klar nachweisbaren Hang zu ausländischen Motti. Beim Prince of Wales ist es sogar deutsch: »Ich dien«. F.A.Z.-Foto / Felix Schmitt.
Eine Einbestellung
Jetzt ist auch der Brief wieder da. Es ist eine Einbestellung zur Königin. Eine »Einladung« darf man so etwas nicht nennen, das wäre ungehörig; denn die Königin lädt niemanden ein, höchstens vielleicht andere Königinnen. Alle übrigen Menschen lädt sie vor. Denn Höflichkeit ist in Wahrheit gar nicht die Tugend der Gekrönten. Die Königin also hält heute in ihrem Palast eine »Investitur«. Das heißt, sie verleiht die Ehrentitel der Saison; und wer eine Einbestellung hat, darf dabei zuschauen. Manchmal wird sogar der eine oder andere Ausländer bestellt, denn man hat keine Vorurteile. Auch die Abwägung der Schicklichkeit der Person nimmt bei Fremden und Untertanen gleichermaßen einige Wochen in Anspruch, bei den Untertanen womöglich sogar noch ein bisschen länger. Mit der Vorladung kommt die Regieanweisung. Für den Zuschauer genügt dunkler Anzug; andere müssen zum Kostümverleih. Ferner flattert eine rote Karte aus dem Umschlag, die am Außentor »abgegeben werden muss«. Das ist doppelt unterstrichen. Dann tritt eine weiße Karte für drinnen in Aktion, die dem Posten »gezeigt, aber keinesfalls ausgehändigt wird!« Diese Anweisung steht in Großbuchstaben.
Am Tor des Buckingham-Palastes ist immer Ferientag. Touristen posieren abwechselnd für ein Foto. Kinder werden hochgehoben, damit sie besser durch das Gitter schauen können. Die Polizisten sind von väterlicher Freundlichkeit und aufgelegt zu den ausführlichsten Auskünften. Zaungäste fixieren mit mörderischer Geduld die Posten in den Bärenfellmützen, um sie bei einer winzigen Bewegung zu ertappen. Andere stehen in unternehmungsvollem Nichtstun herum, wie es nur Ausflügler können. Für sie alle ist die Welt an diesem Tor zu Ende, heute, immer. Doch das ist diesmal nicht die Welt des Fahrgastes.
Mit weichen Knien, aber dennoch festen Schrittes geht er durch das Volk hindurch zum Durchlass neben dem großen Tor mit den güldenen Zinnen. Hier wickelt er seine vielfarbigen Papiere aus, und dann ist es auch schon geschehen. Ein Schritt, und er ist auf der erdabgewandten Seite des Schilderhäuschens. Die Zuschauer schauen ihm durch den Zaun nach, wie ihm noch nie jemand nachgeschaut hat. Bei einem echten Palast ist nicht das Drinsein das Erbauende, sondern das Hineingehen. Der Königin geht das sicher jeden Tag so. Hie und da blitzt ein rasch hochgerissener Fotoapparat. Zu Hause wird es einen fruchtlosen Streit geben, wer der Unbekannte sei.
Die Beziehungen zwischen drinnen und draußen sind rätselhafter, als man denkt. Im Jahr des vierzigsten Thronjubiläums der Königin 1992 wurde eine Übersicht veröffentlicht, ein Drittel der Bevölkerung des Königreichs habe angegeben, Elisabeth II. erscheine ihnen gelegentlich im Traum. Wenn es Nacht wird in ihrem Reich, besucht sie wie Harun al Raschid das Unterbewusstsein ihres Volkes in den seltsamsten Verkleidungen. In manchen Träumen tritt sie auf als ein älteres Fräulein mit einem »möblierten Zimmer« in London; als Bäuerin von einem Hof in Yorkshire; als Landfahrerin, die in einem Wohnwagen lebt. Wieder anderen erscheint sie als Tischtennis-Spielerin, als Liftboy oder als Lastwagenfahrerin, und mitunter steht sie wie Theodor im Fußballtor. Und da es britische Träume sind, gipfelt der Auftritt meistens darin, dass man das Teewasser aufsetzt.
Das ist die wunderliche Ungereimtheit dieses zweiten elisabethanischen Zeitalters der Insel, das an diesem Mittwoch 50 Jahre alt wird. Am 6. Februar 1952 war Elisabeth II. ihrem Vater auf den Thron gefolgt. Im Unterschied zu allen anderen europäischen Monarchien sieht die britische ihren Sinn, ja ihre verfassungsgemäße Aufgabe immer noch im Ritual der Entrückung. Das ist ihr Schein, und das ist der Wunschtraum im Schloss, drinnen. Doch die wahren Träumer im Volk sehen die Königin offenbar nicht so weit entfernt, sondern geradezu alarmierend nahe.