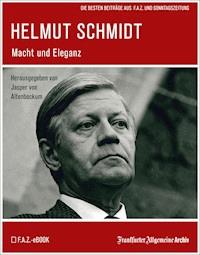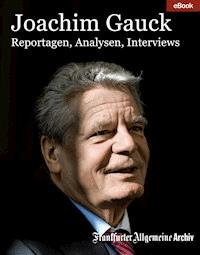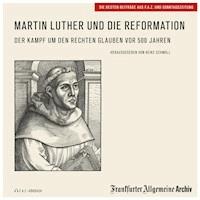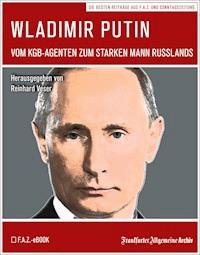
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Aus dem blassen, steif wirkenden Unbekannten, der 1999 Ministerpräsident wurde, ist ein vertrautes Gesicht geworden. So auffällig wie kaum ein anderer Politiker von Weltrang inszeniert sich Putin selbst. Die Fotos, die ihn mit nacktem Oberkörper zeigen, sind in die Ikonographie der Macht eingegangen. Und trotzdem ist vieles an ihm noch immer rätselhaft. Teile seines frühen Lebenslaufs liegen berufsbedingt im Dunkeln, sein Privatleben hält er geheim - und vor allem: Außerhalb seines engsten Kreises weiß vermutlich niemand, was er mit dem Krieg in der Ukraine wirklich erreichen will und zu welchen weiteren Schritten er in der Konfrontation mit dem Westen bereit ist. Der Mann, von dem man sich einst Stabilität erhoffte, ist zum großen Unberechenbaren der internationalen Politik geworden. In diesem E-Book sind F.A.Z.-Beiträge über Putin aus den fast sechzehn Jahren seiner Herrschaft versammelt, die diesen Weg nachzeichnen. Daraus wird deutlich, wie sich das Bild des russischen Präsidenten mit den Jahren verändert hat - und welche Konstanten es gibt. Der Blick zurück hilft dabei, die Gegenwart besser zu verstehen. Putins Russland wird uns in den kommenden Jahren womöglich noch mehr beschäftigen, als es das bisher schon getan hat. Der Herausgeber: Reinhard Veser wurde am 17. Oktober 1968 in Stuttgart geboren. Nach dem Zivildienst studierte er von 1990 bis 1997 an den Universitäten Heidelberg, Vilnius und Mainz Slawistik, Osteuropäische Geschichte und Politikwissenschaft. Erste journalistische Erfahrungen sammelte er seit 1986 bei der "Filder-Zeitung", einer Lokalzeitung im Südwesten von Stuttgart. Seit dem Studienjahr in Vilnius 1993/94 schrieb er für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften Berichte über Litauen und Weißrussland. Im Oktober 1998 wurde er Volontär bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ihn nach dem Volontariat zum 1. Januar 2000 als Redakteur in die politische Redaktion übernommen hat. Dort befasst er sich mit osteuropäischen Themen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wladimir Putin
Vom KGB-Agenten zum starken Mann Russlands
F.A.Z.-eBook 40
Frankfurter Allgemeine Archiv
Herausgeber: Reinhard VeserRedaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher
Projektleitung: Franz-Josef GastericheBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb und Vermarktung: [email protected]© 2015 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am MainTitelfoto: © Kremlin.ru. Bildbearbeitung: Hans Peter Trötscher
ISBN: 978-3-89843-390-7
Vorwort
Der Populäre
Von Reinhard Veser
Wladimir Putin polarisiert. In seinem eigenen Land erreicht der russische Präsident Popularitätswerte, von denen Regierungschefs und Staatsoberhäupter demokratischer Staaten nicht einmal zu träumen wagen. In den meisten anderen Ländern Europas hält ihn eine große Mehrheit für den Schuldigen am gefährlichsten Konflikt auf dem Kontinent seit dem Ende des Kalten Kriegs – dem Krieg in der Ukraine. Aber das Meinungsbild in den westlichen Gesellschaften ist nicht so eindeutig wie das in Russland: In Deutschland und Frankreich etwa findet Putin zahlreiche und lautstarke Verteidiger und Verehrer bei der extremen Rechten wie bei der extremen Linken. Die einen sehen in ihm einen Verteidiger traditioneller Vorstellungen von Vaterland und Familie gegen einen kosmopolitischen Liberalismus, bei den anderen wirken alte Reflexe aus der Zeit nach, in denen Moskau noch die Welthauptstadt des Kommunismus war. Beiden gemeinsam ist ein Antiamerikanismus (und oft eine damit einhergehende EU-Feindlichkeit), für den Putin sich als Bannerträger und Vorkämpfer anbietet.
Der Mann, dessen Politik heute Europa zu zerreißen droht, war ein Unbekannter, als er im Sommer 1999 zuerst russischer Ministerpräsident und nur wenige Monate später russischer Präsident wurde. Nach seinem von Alkohol und Krankheit gezeichneten Vorgänger Boris Jelzin, in dessen Amtszeit Russland immer unberechenbarer und chaotischer zu werden schien, verbanden viele innerhalb wie außerhalb Russlands mit dem überaus nüchtern auftretenden Putin die Hoffnung auf eine neue Stabilität. Mit einer auf Deutsch gehaltenen Rede im Bundestag gewann er die Sympathien der Deutschen. Der amerikanische Präsident George W. Bush meinte nach einem Blick in die Augen des russischen Präsidenten, darin die Seele eines anständigen Menschen erkannt zu haben. Als Putin den Amerikanern nach den Anschlägen vom 11. September 2001 seine Solidarität versicherte, hatten viele den Eindruck, zwischen Russland und dem Westen beginne eine Annäherung ganz neuer Qualität.
Doch das war schon damals nicht das ganze Bild. Putin hat von Anfang an polarisiert, denn ebenso stark wie die Hoffnungen, die sich mit ihm verbanden, war auch das Misstrauen ihm gegenüber. Er hatte seine Laufbahn als Agent des sowjetischen Geheimdienstes KGB begonnen, figurierte Anfang der neunziger Jahre als Mitarbeiter des Petersburger Bürgermeisters Anatolij Sobtschak in einer Reihe von Korruptionsskandalen, war als Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB auf vollkommen undurchsichtige Weise an den schmutzigen Machtkämpfen der letzten Jahre von Jelzins Präsidentschaft beteiligt. Putins Aufstieg vom Überraschungskandidaten für die Regierungsspitze zum populärsten Politiker Russlands vollzog sich vor dem Hintergrund einer Serie von Bombenanschlägen in russischen Städten mit hunderten von Toten, die die Sicherheitskräfte tschetschenischen Terroristen zuschrieben und zum Anlass für ein rabiates militärisches Vorgehen im Kaukasus nahmen. Wer die tatsächlichen Urheber dieser Anschläge waren, ist indes bis heute unklar – die sonst bekennerfreudigen kaukasischen Islamisten verneinen ihre Täterschaft, zugleich gibt es Indizien, die zum FSB hinführen.
Diese Doppelköpfigkeit blieb lange bezeichnend für das Bild Putins: Während er wie ein liberaler Reformer sprach, begann er schon in den ersten Jahren seiner Amtszeit damit, die Medienfreiheit einzuschränken, Weggefährten aus dem KGB gezielt an Schlüsselstellen in Staat und Wirtschaft zu plazieren, Kritiker wie den Ölmagnaten Michail Chodorkowskij mit den Mitteln der Justiz auszuschalten und Wahlen zu manipulieren. Dass zu seinem offen formulierten Ziel, Russland wieder auf Augenhöhe zu den Vereinigten Staaten zu bringen, auch die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion gehörte, zeigte sich erstmals während der orangen Revolution in der Ukraine Ende 2004.
Seinem Ansehen in der russischen Bevölkerung schadete das nicht – als er im Frühjahr 2008 das Präsidentenamt an den von ihm ausgesuchten Nachfolger Dmitrij Medwedjew übergab und Ministerpräsident wurde, war er so populär, dass er auch als formal zweiter Mann im Staat unbestritten der „Führer der Nation“ (wie ihn seine Verehrer titulierten) war. In den Augen einer großen Mehrheit der Russen hatte er das Versprechen gehalten, nach den Wirren der neunziger Jahre wieder Stabilität herzustellen – und zugleich ging es dank des über Jahre hohen Ölpreises vielen Russen deutlich besser als zu Beginn von Putins Herrschaft. Der Anfang des Niedergangs schien gekommen, als er vier Jahre später seine Rückkehr in das Präsidentenamt ankündigte und den Russen nicht einmal den ernsthaften Anschein einer Wahl ließ. Das nicht so sehr, weil die Opposition in Moskau nach der Parlamentswahl Ende 2011 plötzlich – für Regimegegner wie Regierung unerwartet – Massen mobilisieren konnte, sondern vor allem weil aus Umfragen ein wachsender Überdruss am immer gleichen Präsidenten sprach. Selbst unter seinen Anhängern wuchs die Zahl derer, die sich gegen eine weitere Amtszeit aussprachen. Zugleich zeigten sich immer deutlicher Anzeichen einer wirtschaftlichen Krise. Sie ist mittlerweile für die Russen deutlich spürbar – auch, aber nicht nur wegen der Sanktionen, die der Westen wegen der Annexion der Krim und des Kriegs in der Ostukraine gegen Russland verhängt hat. Putin aber reitet auf einer Welle des Patriotismus und scheint so unanfechtbar zu sein wie nie zuvor.
Aus dem blassen, steif wirkenden Unbekannten, der 1999 Ministerpräsident wurde, ist ein vertrautes Gesicht geworden. So auffällig wie kaum ein anderer Politiker von Weltrang inszeniert sich Putin selbst. Die Fotos, die ihn mit nacktem Oberkörper zeigen, sind in die Ikonographie der Macht eingegangen. Und trotzdem ist vieles an ihm noch immer rätselhaft. Teile seines frühen Lebenslaufs liegen berufsbedingt im Dunkeln, sein Privatleben hält er geheim – und vor allem: Außerhalb seines engsten Kreises weiß vermutlich niemand, was er mit dem Krieg in der Ukraine wirklich erreichen will und zu welchen weiteren Schritten er in der Konfrontation mit dem Westen bereit ist. Der Mann, von dem man sich einst Stabilität erhoffte, ist zum großen Unberechenbaren der internationalen Politik geworden.
In diesem eBook sind F.A.Z.-Beiträge über Putin aus den fast sechzehn Jahren seiner Herrschaft versammelt, die diesen Weg nachzeichnen. Daraus wird deutlich, wie sich das Bild des russischen Präsidenten mit den Jahren verändert hat – und welche Konstanten es gibt. Der Blick zurück hilft dabei, die Gegenwart besser zu verstehen. Putins Russland wird uns in den kommenden Jahren womöglich noch mehr beschäftigen, als es das bisher schon getan hat.
Machtantritt: Wie Putin zum starken Mann Russlands wurde
Das große Spiel
Wie der Kreml eine fast verlorene Schlacht doch noch gewann · Präsidenten-Wahl in Russland
Von Markus Wehner
Die Lage schien hoffnungslos, das Spiel schon vor der Zeit verloren. Im Sommer 1999, ein Jahr vor den russischen Präsidentenwahlen, dachten die Mächtigen im Kreml ans Kofferpacken. Der sieche Präsident, seit Jahren vom Alkohol betäubt, erwies sich immer mehr als eine unberechenbare Belastung, wenn es sich auch bisher mit ihm hatte leidlich angenehm regieren lassen, solange er den Einflüsterungen seiner Umgebung gefolgt war. Doch seine Zeit war abgelaufen, und ein Nachfolger war nicht in Sicht. Stattdessen formierten sich die Gegner der Macht im Kreml, um ihr den Todesstoß zu geben. Das Heer des Zaren war vor der entscheidenden Schlacht in alle Winde zerstreut, die Weltpresse sprach ihr höhnendes Urteil über den korrupten Clan des Boris Jelzin, über seine Hofschranzen und Günstlinge. Deren Macht schien wie Staub zwischen den Fingern zu zerrinnen.
Die Lage im Lande war so schlecht wie lange nicht zuvor, die Armut groß, die Arbeitslosigkeit hoch. Die Verkündung des Staatsbankrotts, verschuldet durch die Finanzspekulationen der Mächtigen, hatte man im vergangenen Jahr einem jungen Demokraten übertragen und ihn danach in die Wüste geschickt. Um die im Volk ungeliebten Dinge zu tun, waren die Liberalen immer nützlich gewesen: So war es bei der Preisfreigabe, so auch bei der Privatisierung. Man holte die machthungrigen jungen Politiker in die Mannschaft des Kremls, um ihnen hinterher die Schuld zu geben und sie bis auf weiteres auszuwechseln. Nach der Entlassung des jungen Sergej Kirijenko und einer Parlamentskrise sah sich der Kreml gezwungen, den ehemaligen KGB-Mann Jewgenij Primakow ins Regierungsamt zu bitten, einen alten Fuchs und sowjetischen Großmachtpolitiker, der die Lage im Lande retten sollte. Es gelang ihm, den freien Fall der russischen Wirtschaft zu bremsen und die innenpolitische Lage zu beruhigen, unter anderem, indem er die Kommunisten in die Regierung aufnahm. Der Kreml war bereit, mit dem fast siebzig Jahre alten Politprofi zu verhandeln, ein Übereinkommen zu finden. Doch Primakow wollte sein eigenes Spiel. Er zerstritt sich mit dem Paten der Macht, dem reichen Unternehmer Boris Beresowskij, und verkündete, er werde gegen Korruption und unrechtmäßige Bereicherung vorgehen. Als man ihm die Nachfolge Jelzins unter der Bedingung anbot, dass er der Kreml-Familie bleibenden Einfluss und Immunität garantieren würde, lehnte Primakow ab. Seine Tage waren gezählt, die Familie entließ den Spielverderber im Mai.
Doch der Rauswurf aus dem Kreml machte Primakow zum Helden des Volkes, das mit ihm die Hoffnung verband, die Lage werde wenigstens nicht noch schlechter werden. Primakow, gedemütigt von der Kreml-Kamarilla, machte sich gemeinsam mit dem einflussreichen Moskauer Oberbürgermeister Jurij Luschkow daran, die Macht am Roten Platz zu übernehmen. Ein Bündnis mit den mächtigsten der Provinzfürsten wurde geschmiedet, der Kreml konnte es nicht verhindern. Als der Präsident die reichen Gouverneure in den Kreml lud, um sie in letzter Minute von ihrem frevelhaften Treiben abzubringen, lachte man ihm ins Gesicht. Deine Zeit ist abgelaufen, alter Mann, gab man dem kranken Staatsoberhaupt zu verstehen.
Die Familie im Kreml – an deren Spitze Jelzin-Tochter Tatjana Djatschenko, Präsidentenberater Valentin Jumaschew und Stabschef Alexander Woloschin – war nicht bereit, das Feld schon vor der Schlacht zu räumen. Man sammelte die Mannschaft der besten Polittechnologen und steckte die Ziele ab, die man in den kommenden Monaten erreichen musste: Um den Kreml zu verteidigen, musste man seine Gegner, Primakow und Luschkow, vernichtend schlagen. Man musste einen Nachfolger finden, der treu zur Familie stehen würde. Man musste die Stimmung in der Gesellschaft, die gegen den Kreml gerichtet war, um hundert Grad umdrehen. Für alles das brauchte man viel Geld und – einen siegreichen Krieg.
Putin, der letzte Kandidat
Als Nachfolger des unbotmäßigen Primakow hatte der Kreml Sergej Stepaschin ins Amt des Regierungschefs berufen, einen gebildeten Petersburger, der als Geheimdienstchef und Innenminister unter Jelzin gedient hatte. Stepaschin war in den Augen der Familie eine Figur, die sich leicht lenken lassen würde. Er versprach, loyal zu sein, man gab ihm eine Chance. Dass die Paten des Kremls, Beresowskij und der junge Öl-Magnat Roman Abramowitsch, ihm ihre Strohmänner als Minister ins Kabinett schickten, nahm Stepaschin hin. Doch seine Arbeit als Regierungschef tat er in unauffälliger Art, ohne sich des Wohlwollens der Familie zu versichern. Vor allem sträubte er sich dagegen, das zu tun, was für die Pläne des Kremls entscheidend war: Krieg in Tschetschenien zu führen, der kleinen Republik im Nordkaukasus. Stepaschin war als Geheimdienstchef einer der entschiedensten Befürworter des ersten Moskauer Feldzugs in Tschetschenien Mitte der neunziger Jahre gewesen, bei dem binnen einundzwanzig Monaten mindestens achtzigtausend Menschen starben. Doch er hatte eingesehen, dass sich das Problem auf diese Weise nicht lösen ließ, und hatte sich schließlich für die Friedensverhandlungen mit den Tschetschenen eingesetzt.
Deren Führer und späterer Präsident Maschadow hatte ihm zweimal das Leben gerettet.
Schon im März vorigen Jahres hatte man beschlossen, in die abtrünnige Kaukasus-Republik Tschetschenien einzumarschieren, die ein Herd der Unruhe und Kriminalität in der Region war. Man wollte jedoch nur die Grenzen Tschetscheniens besetzen und eine Pufferzone für die Sicherheit Russlands bilden. Im Juli wurde beschlossen, die Aktion auf das nördliche Drittel Tschetscheniens auszudehnen. Gegen Geiselnehmer wollte man Geheimdienstoperationen nach israelischem Vorbild starten. Stepaschin war nach eigenen Aussagen mit diesem Plan einverstanden, einen großen Krieg wollte er aber nicht. Auch an der geplanten Kampagne gegen Luschkow und Primakow wollte er sich nicht beteiligen. Damit erwies er sich in den Augen Jelzins und seiner Umgebung als zu schwach. Ihm konnte man das Amt des Regierungschefs, das als Sprungbrett für das Präsidentenamt galt, nicht länger anvertrauen. Anfang August musste er gehen.
In den Augen der Öffentlichkeit hatte der Kreml keinen Kandidaten mehr in der Hinterhand, der es mit Primakow und Luschkow hätte aufnehmen können. Die Verwunderung war groß, als Boris Jelzin den bis dahin nur wenig bekannten, farblosen Geheimdienstchef Wladimir Putin nicht nur als neuen Regierungschef vorschlug, sondern ihn auch zugleich zu seinem Wunschnachfolger kürte. Putin galt als ein politischer Niemand. Dass der im Volk ungeliebte Jelzin ihn nun zu seinem Kronprinzen ernannte, versetzte ihm aus der Sicht der politischen Kommentatoren schon zu Beginn seiner Amtszeit den politischen Todesstoß. Viele zeigten sich sicher, dass Jelzin an diesem Augusttag noch nicht den letzten Wunschkandidaten für seine Nachfolge präsentiert hatte.
Doch der Kreml hatte seine Wahl mit gutem Grund getroffen. Putin war ein Kandidat wie Stepaschin, ein gebildeter Petersburger, zugleich ein erfahrener Geheimdienstmann. Er hatte zehn Jahre in der Auslandsspionage in Deutschland gearbeitet, weshalb er als Petersburger Kommunalpolitiker noch Anfang der neunziger Jahre den Spitznamen Stasi trug. Putin war unerfahrener als Stepaschin, naiver, aber auch härter. Er gehörte keiner der üblichen Machtgruppierungen an, war nicht – wie etwa der Favorit Beresowskijs, General Lebed – der Mann eines bestimmten Oligarchen, und er versprach deshalb, ein ebenso treuer wie leicht zu beeinflussender Regierungschef und Nachfolger im Präsidentenamt zu werden. »Er ist unfähig zum Verrat«, sagte über ihn sein politischer Ziehvater, der kürzlich verstorbene ehemalige Petersburger Bürgermeister Anatolij Sobtschak, der Putin als seinen Stellvertreter in die Politik geholt hatte.
Putin, der pedantische Ordnungsfanatiker, der die Deutschen liebt und viele ihrer Eigenschaften verinnerlicht hat, war der Mann, der bereit war, Krieg in Tschetschenien zu führen und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Sein Wille, Ordnung zu schaffen, hätte kein geeigneteres Objekt finden können. In der Kaukasus-Republik hatte sich seit Jahren eine Willkürherrschaft breit gemacht, die Clans der verschiedenen Militärführer terrorisierten das Land und die angrenzenden Republiken. Der Regierung des Anfang 1997 gewählten, vergleichsweise gemäßigten Präsidenten Maschadow war es nicht gelungen, die radikalen Führer der Islamisten zu entmachten oder zu integrieren. Stattdessen verbreiteten bewaffnete Banden Angst und Schrecken in Tschetschenien, Hunderte von Russen, Tschetschenen und Ausländern wurden von professionell arbeitenden Greiftrupps entführt, weiterverschachert, oft gegen Millionenbeträge freigekauft oder aber umgebracht. Moskau hatte nach den Zerstörungen des Feldzuges wenig getan, um die kranke tschetschenische Gesellschaft heilen zu helfen. Die Wunde im Kaukasus blutete weiter. Nun konnte man sie im Kreml nutzen, um das Problem des Machterhalts zu lösen.
Doch galt es, die Bevölkerung für diesen Krieg zu gewinnen und damit für den Kandidaten, der sein Schicksal mit diesem Krieg verband. Den ersten Feldzug in Tschetschenien hatte Russland verloren, weil die Medien offen über den grausamen Krieg berichtet hatten, über die hohen Verluste der russischen Armee, über das Leid der Zivilbevölkerung, oft mit Sympathie für den Freiheitsdrang des tschetschenischen Volkes. Die russische Gesellschaft stellte sich gegen den Krieg. Zwar hatten sich die Tschetschenen mit Geiselnahmen, Raub und Drogenhandel mittlerweile die Sympathien bei den Medien und in der russischen Bevölkerung verscherzt, doch war kaum damit zu rechnen, dass ein neuer Waffengang beliebt sein würde. Russland würde seine Söhne aus Sibirien und dem russischen Norden nicht noch einmal für ein Abenteuer des Kremls im fernen Kaukasus fallen sehen wollen. Der Westen würde gegen einen Angriff auf Tschetschenien protestieren.
Der bestellte Krieg
Wenn Russland allerdings selbst angegriffen würde, wenn die tschetschenischen Islamisten ihre Revolution über die Grenzen ihrer Republik ausdehnen sollten, dann wäre eine Notwehrsituation entstanden, die einen Krieg rechtfertigen und die Unterstützung der Bevölkerung sichern würde. Auch dem Westen würde man den Krieg als Aktion gegen den internationalen Terrorismus erklären können. Schon Anfang Juli hatten Moskauer Zeitungen davor gewarnt, dass die Gotteskrieger des tschetschenischen radikalen Führers Schamil Bassajew an der Grenze zu Dagestan Gewehr bei Fuß stünden, um in die Nachbarrepublik einzumarschieren. Doch von Moskau erfolgte keine Reaktion auf diese Bedrohung. Im Gegenteil, russische Truppeneinheiten wurden von der Grenze abgezogen und durch einfache Milizionäre ersetzt, die keinen entschiedenen Widerstand gegen die Kämpfer leisten konnten.
Am 1. August drangen die Einheiten Bassajews nach Dagestan ein. Eine Woche später wurde Stepaschin als Regierungschef entlassen, Putin zu seinem Nachfolger ernannt. Die Operation zur Rettung des Kremls hatte begonnen.
Der tschetschenische Präsident Maschadow behauptet, dass der Kreml-Magnat Beresowskij, der Stabschef des Kremls, Woloschin, und auch der damalige Geheimdienstchef Putin über den Angriff auf Dagestan informiert gewesen seien.
Russische Zeitungen berichteten, Woloschin, der als Mann Beresowskijs gilt, habe sich im Sommer mit Tschetschenen-Führer Bassajew in Frankreich heimlich getroffen. Bassajew stand in Opposition zu Maschadow, ein kleiner Krieg konnte ihm im innertschetschenischen Machtkampf von Nutzen sein. Dass Moskau seine Verbindungen zu Bassajew benutzte, um den Angriff auf Dagestan zu bestellen und für den Beginn des Krieges gegen Tschetschenien zu nutzen, ist allerdings nicht nur die Meinung der Kreml-Gegner. Der Chefredakteur der »Unabhängigen Zeitung«, die Beresowskij gehört, hat die Ansicht vertreten, der Inlandsgeheimdienst FSB habe den Angriff auf Dagestan provoziert. Und auch der religiöse Führer Tschetscheniens, Mufti Achmed Kadyrow, ein Gegner Maschadows und Bassajews und darum nun ein Freund Putins, sagt, Bassajew sei von Moskauer Kreisen bezahlt worden, damit man einen Anlass habe, um den Krieg gegen Tschetschenien zu beginnen. Aus Dagestan sei Bassajew mit russischen Hubschraubern zurück nach Tschetschenien begleitet worden, damit ihm ja nichts passiere, denn man habe ihn noch dafür gebraucht, um die »antiterroristische Operation« in Tschetschenien zu beginnen.
Das Abenteuer Bassajews in Dagestan, das fast zweihundert russische Soldaten das Leben kostete und die guten Beziehungen Tschetscheniens zu Dagestan zerstörte, war freilich kaum geeignet, in Russland ein allgemeines Gefühl der Bedrohung entstehen zu lassen und einen großen Krieg zu rechtfertigen. Doch schon wenige Wochen später begannen dramatische Ereignisse, die das politische Leben in Russland auf den Kopf stellten. Am 31. August explodierte eine Bombe in einem Einkaufszentrum unter dem Manegeplatz in unmittelbarer Nähe des Kremls.
Eine Person wurde getötet, vierzig verletzt. Das schien zunächst das Werk von Verrückten zu sein. Doch die nächste Sprengladung detonierte nur zwei Tage später in dem Ort Bujnaksk in Dagestan in einer Militärsiedlung. Sie kostete 64 Menschen das Leben. Am 8. September flog ein Wohnhaus in der Gurjanow-Straße in einem gewöhnlichen Wohnbezirk Moskaus in die Luft – 94 Menschen starben. Die Bombenserie fand ihren Höhepunkt fünf Tage später in der Karschisker Chaussee im Süden Moskaus: 119 Moskauer – Männer, Frauen, Kinder – wurden aus dem Schlaf in den Tod gerissen. Eine letzte Bombe explodierte am 16. September in der südrussischen Stadt Wolgodonsk; siebzehn Menschen wurden getötet und mehrere hundert verletzt. Alle Anschläge wurden mit dem Sprengstoff Hexagen ausgeführt, der in Zuckersäcken in die Keller gebracht worden war.
Bis heute ist unklar, wer für die Bombenserie verantwortlich ist. Der Geheimdienst FSB verfolgte jedoch sofort die tschetschenische Spur, eine andere Urheberschaft schien von Anfang an ausgeschlossen. Die Ansicht, dass der Bombenterror das Werk der tschetschenischen Terroristen sei, fand in der Bevölkerung leicht Glauben. Die Russen packte angesichts der zynischen Terrorakte die kalte Wut. Moskau ließ seine Truppen nach Tschetschenien einmarschieren. Proteste in der Bevölkerung dagegen gab es nicht. Im Gegenteil, die Popularität Putins stieg mit jeder Woche des Krieges. Er erschien als der Retter der Nation, bereit, sie in der Todesgefahr zu beschützen. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich die Nation wieder einig in der Abwehr eines äußeren Feindes, war bereit, sich hinter einem starken Führer zu scharen. Die Gesellschaft zeigte sich begeistert von einem Politiker, der endlich Ordnung zu schaffen, sie von den Demütigungen und Traumata der vergangenen Jahre zu befreien versprach.
Der Geheimdienst und die Bombenanschläge
Der liberale Politiker Anatolij Tschubajs jubelte, in Tschetschenien finde die Wiedergeburt der russischen Armee statt. Kritik an dem Krieg, wie sie der demokratische Oppositionelle Grigorij Jawlinskij übte, wurde als Vaterlandsverrat gewertet. Seitdem erlebt Russland eine Remilitarisierung seiner Gesellschaft: In den Schulen wird der Wehrkundeunterricht, bekannt aus Sowjetzeiten, wieder eingeführt, Reservisten werden in die Armee eingezogen, Studenten sollen keinen Aufschub mehr von der Dienstpflicht bekommen.
Der ursprünglich geplante kleine Krieg nahm jedoch bald seinen eigenen Lauf. Zunächst war nur von einem Sicherheitskorridor die Rede gewesen, den die russische Armee in Tschetschenien schaffen solle, um die Bevölkerung vor Anschlägen und Geiselnahmen zu schützen. Doch die Armeeführung, die die Schmach des verlorenen ersten Tschetschenien-Krieges nie verwunden hatte, drang darauf, die antiterroristische Operation auszuweiten. Sie wollte Rache üben, verlangte Genugtuung für die Demütigungen der vergangenen Jahre, für den vermeintlichen Dolchstoß im ersten Tschetschenien-Feldzug, für die Schmach der Nato-Erweiterung und des Jugoslawien-Krieges, für die Missachtung der grundlegendsten Bedürfnisse einer Armee, die einst stolz auf ihre Schlagkraft gewesen war. Die Bomben in Moskau waren das beste Argument für die Militärs, dass nur ein Kampf bis zum siegreichen Ende Russland von der aus Tschetschenien drohenden terroristischen Gefahr würde befreien können.
Putin entschied sich für den harten Kurs. Am 22. September begann die Bombardierung der Hauptstadt Grosnyj und anderer tschetschenischer Städte. Mitleid mit dem tschetschenischen Volk war von russischen Politikern nicht zu hören. Stattdessen forderten die radikalen Nationalisten der Partei Schirinowskijs, eine Atombombe auf Grosnyj zu werfen, um das Leben der russischen Soldaten zu schonen. Dazu ist es nicht gekommen. Die Stadt sieht heute dennoch so aus, als hätte sie eine Atombombe getroffen. Mit den Anschlägen in Moskau habe das tschetschenische Regime sein wahres Gesicht gezeigt, verkündete Putin. Verhandlungen mit dem tschetschenischen Präsidenten Maschadow lehnte er von Anfang an ab. Zweifel daran, dass die Bomben von tschetschenischen Terroristen gelegt worden seien, sind nach den Worten Putins »zynisch und amoralisch«.
Vermutungen, der russische Inlandsgeheimdienst FSB oder der Militärgeheimdienst GRU selbst seien mit den Bombenanschlägen verbunden, tauchten allerdings schon bald in der russischen Presse auf. Der FSB spricht heute von neun Hauptverdächtigen, die alle in Tschetschenien in einem Lager des aus Jordanien stammenden Rebellenführers Chattab ausgebildet worden seien. Beweise und Namen legte der Geheimdienst allerdings bisher nicht vor, sondern lobte sich selbst, allein in Moskau sechs weitere Bombenanschläge verhindert zu haben. Die Vermutung, russische Geheimdienste könnten selbst in den Bombenterror verwickelt sein, wurde von den Ereignissen in Rjasan, einer Stadt zweihundert Kilometer südlich von Moskau, genährt. Dort hatte ein Mann im September zur Zeit der Bombenanschläge ein verdächtiges Auto vor seinem dreizehnstöckigen Haus bemerkt und die Polizei alarmiert.
Die fand im Keller des Hauses drei Säcke mit Sprengmaterial. Das gesamte Haus wurde evakuiert, die 250 Bewohner verbrachten die Nacht in einem Kinosaal. Erst vierundzwanzig Stunden später teilte der Geheimdienst mit, das Ganze sei nur eine Übung gewesen und in den Säcken habe sich nicht der Sprengstoff Hexagen, sondern nichts als Zucker befunden. Doch an dieser Version bestehen Zweifel: Die örtliche Polizei in Rjasan besteht darauf, dass der Sprengstoff zweifelsfrei ebenso echt gewesen sei wie der Zünder; von einer Übung sei dort nichts bekannt gewesen. Auch in anderen Städten wurden keine solchen Übungen durchgeführt. Die Bewohner des Hauses in Rjasan gehen deshalb davon aus, dass sie nur mit Glück dem Bombentod entgangen sind.
Die Zeitung »Nowaja Gaseta« berichtete dieser Tage, Säcke mit Hexagen seien zu jener Zeit in einer Militärbasis bei Rjasan aufbewahrt worden; sie hätten die Aufschrift »Zucker« getragen. Die Säcke seien von Soldaten untersucht worden, denen die aus Moskau angereisten Geheimdienstleute dann empfohlen hätten, ihren Fund ganz schnell zu vergessen. Die Tschetschenen haben stets bestritten, dass sie die Häuser in die Luft gesprengt haben. Sie behaupteten, ein von ihnen gefangener Offizier der GRU, Alexej Galtin, habe zugegeben, dass der Militärgeheimdienst an den Anschlägen beteiligt gewesen sei. Der wies diese Behauptungen sogleich zurück, dementierte aber nicht die Existenz des Offiziers und seine Gefangennahme.
Mit dem Beginn des Krieges begann der Kreml zugleich seine Kampagne gegen seine Gegner Primakow und Luschkow. Es ging darum, die Politiker schon im Zuge der Parlamentswahlen im Dezember zu schlagen, die als Vorentscheidung für die Präsidentenwahl galten. Die treibende Kraft der Kampagne war der Magnat Beresowskij, der über ein riesiges Medienimperium verfügt und mit Primakow verfeindet ist. Der Kreml bewirkte, dass Ermittlungen gegen Beresowskij wegen Veruntreuung riesiger Summen eingestellt wurden, der Magnat stellte dafür seine Finanzkraft und sein politisches Geschick wieder dem Kreml zur Verfügung. Im halbstaatlichen Fernsehkanal ORT, bei dem Beresowskij 49 Prozent der Aktien kontrolliert, begann eine beispiellose Hetzkampagne gegen Primakow und Luschkow.
Angeführt wurde sie von Sergej Dorenko, einem persönlichen Vertrauten Beresowskijs, der jeden Sonntagabend neue Kübel Schmutz über die Feinde des Kremls auskippte. Deren Umfragewerte sanken von Woche zu Woche, während Putins Werte gleichzeitig ebenso deutlich stiegen. Eine entsprechende Gegenwehr war den Angegriffenen unmöglich, nicht nur, weil der Kreml die landesweit ausstrahlenden Fernsehsender beherrscht. Im nationalen Taumel des Tschetschenien-Krieges wäre offene Kritik an Putin und am Krieg einem politischen Selbstmord gleichgekommen. Das Wahlbündnis von Primakow und Luschkow zerfiel in Wirklichkeit schon vor der Wahl, als die Provinzfürsten merkten, dass sie auf das falsche Pferd gesetzt hatten. Sie gingen auf Distanz zu Primakow und suchten die Nähe des neuen starken Mannes.
Vor wenigen Monaten noch als die neue Partei der Macht gehandelt, zerbröselte das von Primakow und Luschkow geführte Bündnis »Vaterland – Das ganze Russland«. Es landete weit abgeschlagen auf dem dritten Platz. Die Wahl gewann dagegen eine virtuelle Partei, die Boris Beresowskij sich ausgedacht und finanziert hatte: »Einheit«, angetreten als die Putin-Partei, erreichte ohne jedes Programm und ohne einflussreiche Politiker auf Anhieb fast ein Viertel der Stimmen, fast so viele wie die Kommunisten, die der Kreml diesmal hatte ungeschoren davonkommen lassen und mit denen die Beresowskij-Partei nun in der Duma gemeinsame Sache macht.
Der Ausgang der Duma-Wahl war ein Triumph für den Kreml. Ihn zu vollenden blieb Boris Jelzin vorbehalten. Sein vorzeitiger Rücktritt war von den Politikberatern des Kremls schon seit Monaten diskutiert worden, es galt nur noch, das Ansinnen dem Präsidenten, der die Macht so liebte, einsichtig zu machen.
Mit seinem pompösen Rücktritt am Silvestertag verabschiedete sich Jelzin auf die Weise, mit der er regiert hatte – unberechenbar, launisch, nicht ohne sentimentalen Charme und groben Witz. Seine Abschiedsrede, in der er die Russen um Verzeihung bat, hatte ihm sein Berater Jumaschew zu fünfundneunzig Prozent geschrieben.
Nach der russischen Verfassung muss nach dem Rücktritt eines Präsidenten binnen dreier Monate ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden, die Vollmachten des Präsidenten gehen so lange auf den Ministerpräsidenten über. Als eine seiner ersten Amtshandlungen unterschrieb Putin ein Gesetz, das die Immunität für Jelzin festschreibt und ihm ein gutes Auskommen sichert.
Dank des Rücktritts von Jelzin regiert Wladimir Putin seit drei Monaten in Personalunion als amtierender Präsident und als Regierungschef. Auf eine Wahlkampagne für die Präsidentenwahl hat er verzichtet, ebenso auf Wahlplakate und auf Werbespots im Fernsehen. Er wolle nicht wie Süßigkeitsriegel oder Tampons angepriesen werden, sagte er zur Begründung. Putin kann sich das erlauben, er ist ohnehin jeden Tag im Fernsehen zu sehen. Als Regierungschef und Staatsoberhaupt bereist er seit Wochen ganz Russland in einem kaum verdeckten Wahlkampf.