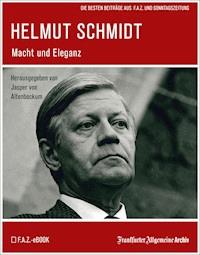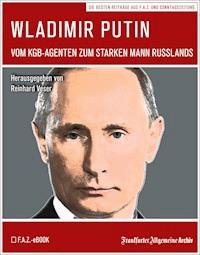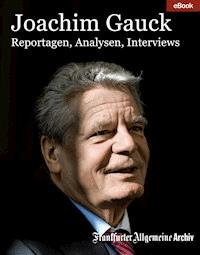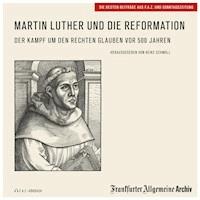Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
»Alles ist Zahl«, soll Pythagoras gesagt und damit zum Ausdruck gebracht haben, dass das Wesen aller Dinge auf dieser Welt Zahl und Harmonie ist. Auch heute noch glauben viele Menschen, dass sich alles auf der Welt in irgendeiner Weise berechnen lässt, dass Maß und Zahl und ihre Gesetzmäßigkeiten gegebene Realitäten sind, die der Mensch nur entdecken muss. Wir aber wollen uns auch der Frage widmen, ob Zahlen überhaupt existieren. Gibt es sie wirklich, oder erfinden wir sie in dem Moment, da wir sie für die Darstellung eines Sachverhaltes brauchen? Von Pythagoras über Euklid bis Euler und Fermat führt die Reise in die Welt der Zahlen durch eine Landschaft voll formaler Schönheit, kühner Gedanken und außergewöhnlicher Menschen. Die Autoren: Ulf von Rauchhaupt, Albrecht Beutelspacher, Heinrich Hemme, Benedikt Fehr, Marc Dressler, Helmut Schwan
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Schönheit der Zahlen
Die Ordnung der Welt durch den menschlichen Geist
F.A.Z.-eBook 33
Frankfurter Allgemeine Archiv
Redaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher
Key Account Management Archivpublikationen: Christine Pfeiffer-Piechotta [email protected]
Projektleitung: Franz-Josef Gasterich
eBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2014 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main.
Titelgrafik: © iStockfoto.com
ISBN: 978-3-89843-376-1
Die Welt ist Zahl
Die Unbegreiflichen
Manche Völker kommen gut ohne Zahlen aus
Von Ulf von Rauchhaupt
Den Zahlen geht es heutzutage ein bisschen wie Gott: Es wird zuweilen daran gezweifelt, ob es sie überhaupt gibt. Wenn es in manchen Zirkeln nicht gar üblich geworden ist, es für ausgemacht zu halten, dass es sie nicht gibt. Eine seltsame Ansicht, möchte man meinen. Zumindest die ganzen Zahlen – also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter – sollte es doch geben. Wird denn nicht überall gezählt: ob Rinder oder Kinder, Bronzebarren oder Dax-Punkte? Hat der Mensch denn nicht immer schon gezählt?
Nicht unbedingt. Natürlich, die Anfänge der menschlichen Beschäftigung mit den Zahlen liegen im Dunkeln, wie fast alle Anfänge. Spätestens in der jüngeren Altsteinzeit, als Homo sapiens nach Mitteleuropa vordrang, muss er auch mit dem Zählen begonnen haben. Denn einigermaßen unstrittig ist, dass ein in Mähren ausgegrabener 20.000 bis 30.000 Jahre alter Knochen etwas mit Zahlen zu tun hat. Denn darauf sind 55 Kerben eingeritzt, die ersten 25 in Fünfergruppen. Zwar wurde in Afrika ein Knochen gefunden, in den jemand vor gut 35.000 Jahren 29 Kerben geritzt hat. Ob er damit aber etwas gezählt hat – die Tage zwischen zwei Vollmonden etwa – oder ob es ihm eher auf das Muster ankam, ist kaum zu beweisen. Zweifel sind auch deswegen angebracht, weil es noch heute Naturvölker gibt, die ganz gut ohne Zahlen auskommen. Die Awetí in Brasilien etwa haben nur für Eins bis Vier einfache Zahlwörter, größere Zahlen werden mit komplexen Kunstworten dargestellt, und auch das nur ungern. Und die Pirahã im Amazonastiefland zählen sogar überhaupt nicht und sind laut ethnologischen Untersuchungen auch nicht in der Lage, zu begreifen, was Zahlen jenseits der Drei überhaupt sein sollen. Sie haben nur ein Wort für »eine kleine Anzahl«, eins für »eine irgendwie größere Anzahl« und eins für »viele«. Mit mangelnder Intelligenz hat das gewiss nichts zu tun, eher – so glaubt der Ethnologe, der die Pirahã studiert hat – mit mangelndem Interesse an Dingen, die sich der unmittelbaren Erfahrung entziehen.
Es muss daher nicht an fehlender schriftlicher Überlieferung liegen, wenn der uns geläufige Umgang mit Zahlen erst bei urbanen Hochkulturen belegt ist. Mathematik als theoretische Wissenschaft war da aber noch lange nicht daraus geworden. Die Sumerer und Ägypter – und völlig unabhängig von ihnen auch die Maya – zählten und rechneten zu praktischen Zwecken, zur Verwaltung, Landvermessung und für das Kalenderwesen. Und auch als in der griechischen Antike das theoretische Interesse schon lange erwacht war und mit Werken wie denen des Euklid schon die ersten mathematischen Großtaten vollbracht waren, fehlten noch immer so entscheidende Konzepte wie etwa die Null. In der Alten Welt tauchte sie erst im 5. Jahrhundert in Indien auf. Was den sonst so schlauen Griechen nicht gelang, war der uns heute trivial anmutende Schritt von den natürlichen Zahlen zu den »ganzen Zahlen«, zu denen man heute neben der Null auch die negativen zählt.
Das erscheint sehr seltsam. Denn andere, uns heute sehr viel schwieriger anmutende Zahlentypen kannten die Griechen schon: die sogenannten »rationalen Zahlen«, also Brüche, sowie die »irrationalen Zahlen«, zu denen die Wurzeln gehören und (wahrscheinlich) die Kreiszahl π. Doch historisch ist das durchaus einleuchtend. Die antike Mathematik war vor allem Geometrie. Rationale Zahlen waren Seitenverhältnisse, irrationale Zahlen waren Diagonalen wie die des Quadrats. Und die Kreiszahl trägt ihre Herkunft ja schon im Namen. Unser heutiger, von Körpern abgelöster, rein algebraischer Zahlbegriff dagegen fehlte den Griechen etwa so, wie den Pirahã die Vorstellung davon fehlt, was eine ganze Zahl sein soll.
Heißt das aber nun, dass die Menschen die Zahlen erst machen, wenn sie mit ihnen umgehen? Verhält es sich mit ihnen also etwa so wie mit dem Gott der Feuerbachschen Religionskritik, sind sie nur ein Spiegel des Menschen, wenn er zählt – oder eben Seitenverhältnisse, Diagonalen oder Kreisumfänge bestimmt? Einige Mathematiker – und noch mehr Philosophen – glauben das tatsächlich. »Es gibt keine Zahlen«, verkündete etwa Reuben Hersh von der University of New Mexico einmal. »Es gibt nur Gezähltes.«
Diese These klingt sehr tolerant. Denn wer sie vertritt, bekundet damit, keine höhere Weisheit zu beanspruchen als die Zahllosen Pirahã oder die Griechen ohne Null. Er behauptet nicht, etwas Absolutes zu kennen, auf das irgendwelche Außerirdischen auf fernen Planeten auch erst mal kommen müssten. Die These, Zahlen seien nur Menschenwerk, wendet sich gegen Dogmatismus und Metaphysik. Sie ist modern, aufgeklärt, liberal. Nur: das alles sagt gar nichts darüber aus, ob sie auch stimmt.
Dabei geht es letztlich auch um die Frage, um was für ein Unternehmen es sich bei der Mathematik eigentlich handelt. Ist sie eher eine Geisteswissenschaft in dem Sinne, dass sich eben alles ordnen und zusammenhängend darstellen lässt, worauf der menschliche Geist so kommt, unabhängig davon, ob es nur mit ihm oder auch etwas mit der »Welt da draußen« zu tun hat? Oder werden Zahlen eher zu bestimmten Zwecken konstruiert, was die Lehre von ihnen eher als eine Art Ingenieurwissenschaft erscheinen ließe? Ist gar die Kreativität, die man bei solchen Konstruktionen walten lassen kann, ein so zentrales Element, dass man bei der Mathematik am ehesten von einer Kunst sprechen muss? Oder ist es schließlich nicht doch eher so, dass der Mathematiker etwas entdeckt wie ein empirischer Forscher, es also mit Sachverhalten zu tun hat, die es auch ohne ihn gibt?
Dabei ist es natürlich ein Missverständnis zu meinen, in der Mathematik ginge es nur um Zahlen. Man kennt heute mathematische Objekte mit völlig anderen Eigenschaften, von denen einige – etwa die sogenannten Gruppen – in bestimmten Bereichen wie der Physik fast so zentral geworden sind wie anderswo die Zahlen. Die Unterscheidung von quantitativ und qualitativ, die auch deswegen so beliebt ist, weil sich damit herrlich polemisieren lässt, indem man etwas als »bloß qualitativ« oder »nur quantitativ« abtut, diese Unterscheidung wird umso unbrauchbarer, je tiefer man in die höhere Mathematik eindringt. Eigentlich gibt es auch dort nur die eine wertende Grundunterscheidung, die für alle Wissenschaft gilt und die da heißt: folgerichtig oder nicht folgerichtig.
Aber auch dieser Hinweis hilft nicht weiter bei der Frage, ob es Zahlen – oder was sonst alles folgerichtig diskutiert werden kann – wirklich gibt; ob die Mathematiker dergleichen entdecken oder erfinden. Tatsächlich ist die Behauptung, hier würde nur konstruiert oder erfunden, theoretisch ebenso wenig zu beweisen wie die Leugnung Gottes. Und selbst wenn man auf Außerirdische stieße, die den Satz des Pythagoras nicht kennen, könnte ja es immer noch sein, dass sie ihn einfach noch nicht entdeckt haben. Praktisch betrachtet, haben sehr viele Mathematiker und fast alle mathematisch aktiven Naturwissenschaftler bei ihrer Arbeit den starken Eindruck, eine von ihnen unabhängige Wirklichkeit zu entdecken und zu erkunden. Mit dem Dogmatismusvorwurf können sie dabei leben. Sie behaupten ja nicht, schon die ganze Wahrheit über die Zahlen und all die anderen mathematischen Objekte und Strukturen zu kennen. Aber etwas davon, würden sie sagen, haben sie schon gesehen.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 06.01.2008
Schöne Mathematik
Der Spaßmacher
Er wollte zeigen, wie vergnüglich die Welt der Zahlen ist. Seit zehn Jahren kommen die Ungläubigen, staunen und begreifen. Albrecht Beutelspacher, Direktor des Mathematikums in Gießen.
Von Helmut Schwan
Vielleicht lag es daran, dass seine Zunft ständig etwas beweisen muss. Für Albrecht Beutelspacher war es die These, Mathematik könne richtig Spaß machen. Eigentlich müsste er sich längst die Frage stellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass ihm das gelingen würde. Denn Mathematik, übersetzt die Kunst des Lernens, durchdringt dem Gießener Professor zufolge nahezu das gesamte Leben. Von der Anordnung der Blütenblätter bis zu Milliardentransaktionen auf den Finanzmärkten.
Wenn heute Mitsiebziger Metallkugeln staunend schiefe Ebenen herunterrollen lassen, der Familienvater sein Geburtsdatum in den Touchscreen tippt und strahlt, weil sich tatsächlich auch diese Zahlen einreihen in die unendlichen Stellen hinter dem Komma von π, wenn ein Stockwerk höher seine vier Jahre alte Tochter die Geometrie eines Tetraeders studiert, das sie in Seifenlauge getaucht hat – dann bewahrheitet sich, was Albrecht Beutelspacher eigentlich immer ahnte. Man muss Mathematik nur im Wortsinne begreifbar machen, dann versteht man sie auch. Und dann, ja selbst das behauptet der Einundsechzigjährige, kann sie sogar glücklich machen.
So wie den Initiator des Ganzen, wenn er die Zahlen des Museums rekapituliert. Seit der Eröffnung im November 1992 kamen pro Jahr rund 150.000 Besucher aus insgesamt mehr als 50 Nationen, das Interesse hat über die Dekade nicht nachgelassen – im Gegenteil.
Vielleicht waren es tatsächlich die Bauklötze, mit denen alles begann. Seine Mutter hat ihm erzählt, er habe diese als kleines Kind immer sehr symmetrisch gestapelt. Er sei ein guter Schüler, aber kein Überflieger gewesen, erinnert sich Beutelspacher – zur Eins in Mathe reichte es manchmal nicht, weil er sich zu oft verrechnete.
Sein Vater hatte ein kleines Geschäft mitten in Tübingen, Albrecht war das älteste von sechs Kindern. Er ging auf das humanistische Gymnasium. Die Studenten und Professoren waren in der engen Stadt allgegenwärtig, das Akademische hatte nichts Respekteinflößendes an sich. Albrecht Beutelspacher war in der Unterprima, als er seinem Lehrer den Wunsch mitteilte, er wolle Mathematik studieren. Der sei erschrocken und habe ihm geraten, sich erst einige Vorlesungen anzuhören, ehe er sich tatsächlich dafür entscheide. Und so saß der Gymnasiast im Hörsaal, blickte auf eine Tafel, vollgeschrieben mit Formeln, »und ich verstand nichts«. Was ihn aber nicht weiter beunruhigte, weil es seinen Banknachbarn, den Herren Studenten, offenbar ebenso ging.
Nach dem Abitur schrieb er sich an der Hochschule seiner Heimatstadt ein und geriet Ende der sechziger Jahre in eine Zeit, in der auch an der mathematischen Fakultät in Tübingen alles in Frage gestellt wurde. Die Überzeugung, »wir können das besser«, habe alles Tradierte über den Haufen geworfen. Die Studienordnung sowieso, aber sogar das »Wohlordnungsaxiom«, den ehernen Grundsatz über die Abfolge der Zahlen.
Albrecht Beutelspacher weiß noch, dass es ein Dienstagnachmittag war, »14.13 Uhr«. Da begegnete er vor dem Hörsaal zum ersten Mal der Dozentin, einer unscheinbaren Frau aus Serbien, die seine Begeisterung für die Kombinatorik wecken sollte. Das ist, vereinfacht ausgedrückt, die Lehre davon, wie Zahlen oder Objekte angeordnet werden können. In seiner Diplomarbeit, die ihm seine Mentorin später gab, beschäftigte er sich mit der »Parallelität in höherdimensionierten Räumen«. Die Professorin hatte ihm verschwiegen, dass sich schon einige vergeblich daran versucht hatten. Beutelspacher biss sich durch, »es wurde das Beste, was ich je geschrieben habe«.
Er und seine Kommilitonen hätten sich damals keine Gedanken darüber gemacht, wie sie mit dem Wissen einmal ihr Geld verdienen sollten. »Im Notfall werden wir Lehrer«, lautete das Motto. Er selbst ging nach Abschluss des Studiums nach Mainz, zunächst als Assistent, später als Professor auf Zeit. Er entdeckte für sich die Kryptographie, jenen Zweig, der vor allem für die Datenverschlüsselung praktische Anwendung findet. Als Mitte der achtziger Jahre die Aussichten, dauerhaft eine Stelle als Hochschullehrer zu finden, ziemlich schlecht waren, erhielt der Mathematiker von Siemens das Angebot, für den Konzern in diesem zukunftsträchtigen Fach zu forschen. Im Nachhinein ist er froh, damals nicht seinem rebellischen Reflex aus bewegten Studententagen: »Industrie? Das sind doch die Bösen!«, gefolgt zu sein. Die Bedingungen und die Atmosphäre in München empfand er als nahezu ideal. Das Projekt, die Programmierung von Geld- und Simkarten zu entwickeln, wirkte damals noch wie eine Zukunftsvision.
Dennoch blieb der pädagogische Geist unruhig. Als er 1988 den Ruf an die Universität in Gießen erhielt, nahm er an. Wie man die auch für seine Studenten schwer fassbare Wissenschaft anschaulicher machen könne, ließ ihn seinen Worten nach nie los. Die Chance, auf größerer Bühne zeigen zu können, wie nützlich und alltagstauglich, wie faszinierend und mysteriös, ja wie »schön« Mathematik sein könne, ergab sich 1993 allerdings eher per Zufall. In einem Seminar für Lehramtsstudenten hatte der Professor diesmal nicht einen dieser schwerverständlichen Texte verteilt, sondern die Aufgabe gestellt, geometrische Modelle wie Würfel oder Tetraeder zu basteln und sie dann mathematisch zu erklären.
Weil die Modelle so eindrucksvoll gerieten, organisierten acht Studentinnen eine Ausstellung in einem Universitätsraum. Die Resonanz fiel begeistert aus. Damit kam ein Stein ins Rollen, der, wie es sein »Erfinder« heute sieht, das Mitmach-Museum als logische Folge hatte. Beutelspacher kam auf die Idee, Schulklassen in die Ausstellung einzuladen. Schließlich traten die Exponate eine Rundreise durch die Republik an, sie wurden in Schulen, Sparkassen oder Einkaufszentren gezeigt. Die ersten Pappmodelle aus dem Seminar, zum Teil künstlerisch gestaltet, erwiesen sich als überaus haltbar. Obwohl sie vermutlich mehr als zehntausendmal berührt wurden, war ihnen nichts passiert.
Ob tatsächlich dieser Moment den Ausschlag gab, dem Projekt der »Mathematik zum Anfassen« einen festen Platz, gar ein Museum zu widmen, weiß Beutelspacher nicht mehr so genau. Aber es sei ihm schon nahegegangen, als er gesehen habe, wie ein Kind geweint habe, weil es am letzten Tag der Ausstellung vom Tisch mit den Knobelteilen wegmusste. Er gründete einen Förderverein, warb mit schwäbischer Beharrlichkeit erfolgreich um Zuschüsse von Stadt und Land und um Sponsoren und suchte nach einem Gebäude. Das alte Zollamt, rustikale Gründerzeitarchitektur, erwies sich schließlich wie geschaffen für den Zweck. Nicht nur, weil es unmittelbar neben dem Museum liegt, das Leben und Wirken von Justus Liebig zeigt, Gießens immer noch bedeutendsten Wissenschaftler. Es ist zudem in drei Minuten vom Bahnhof zu Fuß zu erreichen, als Ziel für Schulprojekttage nicht unwichtig.
Auch wenn am Anfang womöglich einige Klassen das Mathematikum als das kleinere Übel zum zweiten Vorschlag des Lehrers gewählt hatten, dann eben ins Museum für Bestattungskulturen nach Kassel zu reisen, sprach sich schon bald herum, wie »g... das denn« sei. An der Installation, mit der man sich in eine Riesenseifenblase hüllen kann, an dem Tisch, wo man nach einer Anleitung von Leonardo da Vinci aus dem 15. Jahrhundert ohne Klebstoff und Nägel mit Latten eine Brücke bauen kann, vor dem Selbstversuch des »goldenen Schnittes«, der am eigenen Abbild die Faszination großer Gemälde spüren lässt, überall stehen die Schüler nach wie vor Schlange.
Albrecht Beutelspacher ist Vater zweier Kinder. Sie sind der Faszination der Zahlen zumindest nicht in dem Maß erlegen, dass sie Mathematik studieren. Und der Professor maßt sich nicht an, von einem Kontrastprogramm zu sprechen, das das Museum zur Schule liefere. Er formuliert eher vorsichtig, der Unterricht bewege sich allmählich durchaus auch in Richtung »richtige Mathematik«. Die eigentlich fast in allen Lebenslagen die Chance bietet, Probleme zu analysieren, sie kreativ zu lösen. So wie Schüler im Deutschunterricht von Hesses Steppenwolf gepackt würden, brauche auch das von so vielen als anstrengend empfundene Pflichtfach Mathematik »emotionale Berührungspunkte«. Die ließen sich aber, wenn man die Augen offen halte, eigentlich überall finden: in der Form der Verkehrsschilder, in der Bauweise der Häuser und tausendfach in der Natur. Lernen, logisches Denken, müsse gerade in Deutschland, das gute Autos nicht nur bauen, sondern auch weiterentwickeln wolle, kreativ bleiben. Dafür brauche es Freiräume, lautet sein Credo. G 8 und Zentralabitur, den damit verbundenen Leistungsdruck, sieht Professor Beutelspacher daher eher kritisch.
2008, im Jahr der Mathematik, fuhr Beutelspacher fast jeden Tag zu einem anderen Vortrag. Er ist Botschafter der Stiftung Rechnen, Ehrendoktor der Universität Siegen, er hat den hessischen Kultur- und als Erster den deutschen IQ-Preis erhalten. Die Zeitschrift »Cicero« zählte ihn 2007 zu »Deutschlands wichtigsten Vordenkern«. Er schreibt hochgelobte Bücher und Zeitungskolumnen, verfasst Beiträge für den Rundfunk, wird von den Medien immer wieder gerne gefragt, wenn Entwicklungen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft womöglich auch mathematisch zu erklären sind. Die renommierte Deutsche Forschungsgesellschaft ehrte ihn als Kommunikator des Jahres. Das Preisgeld von 100.000 Mark steckte er in sein Projekt, weil er, wie er sagt, die Auszeichnung ohne das Mathematikum gar nicht bekommen hätte. Auf den Titel ist er auch deswegen stolz, weil er sich seither nicht mehr sorgen müsse, sein Mitmach-Museum könnte als die Idee eines »durchgeknallten Professors aus der Provinz« belächelt werden. So unprätentiös und uneitel er wirkt, so bescheiden der Museumsdirektor auftritt, er hat sein Projekt in einer Mischung aus buddhistischer Gelassenheit und Überzeugungskraft verwirklicht. Zornig habe man ihn nie erlebt, sagen seine Mitarbeiter. Aber er lasse eben nicht locker.
Beim Blick zurück auf das Gebäude, das ganz früher ein Gefängnis war, sieht man Albrecht Beutelspacher im hell erleuchteten Foyer stehen. Vor ihm ein älteres Ehepaar, das mit freudig geröteten Gesichtern, mit Händen, die Figuren in die Luft malen, auf ihn einredet. So, als erklärten sie ihm, wie Mathematik funktioniert. Der Professor schweigt und lächelt.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung , 25.03.2012
Pasta Mathematica
Nudel ist nicht gleich Nudel. Aber ihre Form lässt sich stets in eine Formel fassen, behauptet der Londoner Designer George Legendre und bringt endlich einmal Ordnung in die Welt der italienischen Teigwaren.
Von Ulf von Rauchhaupt
Chinesische Archäologen stießen im Sommer 2002 bei Ausgrabungen in der jungsteinzeitlichen Siedlung Lajia am Oberlauf des Gelben Flusses auf eine umgedrehte Schüssel. Vor etwa 4.000 Jahren war sie bei einem Erdbeben zu Boden gefallen und durch die anschließende Überschwemmung des Dorfes luftdicht mit Schlamm bedeckt worden. Als die Forscher die Schüssel umdrehten, fanden sie darin Nudeln.
Die Teigware aus Lajia ist nicht nur die älteste, die auf uns gekommen ist, sondern auch das bei weitem früheste Zeugnis dieses Lebensmitteltyps überhaupt, weit älter als alle bildlichen und schriftlichen Erwähnungen, aus denen sich bis dato nicht hatte klären lassen, ob man nun im Abendoder im Morgenland zuerst auf die Idee gekommen war, Getreideteig zu kochen, statt zu backen. Umso erstaunlicher, wie vertraut der Inhalt jener Schüssel erscheint. Zwar war er nicht aus Hartweizen zubereitet, sondern, wie spätere Analysen ergaben, aus Hirse. Doch mit einer annähernd konstanten Dicke von weniger als drei Millimetern und bis zu 50 Zentimetern Länge erinnerten sie die chinesischen Ausgräber sofort an ihre La-Mian-Nudeln – und unsereinen an Spaghetti.
Damit sind die »Schnürchen« (so die wörtliche Bedeutung des italienischen Wortes Spaghetti) nicht nur die weltweit beliebteste Pastaform, sondern offenbar auch die ursprünglichste. Praktisch veranlagte Nudelliebhaber werden sich das vor allem fertigungstechnisch erklären. Man erhält diese Form, wenn man den Teig durch ein einfaches Lochmuster drückt oder ihn – wie bei den La-Mian und wahrscheinlich auch bei den Steinzeitnudeln aus Lajia – wiederholt mit der Hand auszieht. Doch eine besondere Stellung der Spaghetti ergibt sich auch aus der mathematischen Theorie der Nudel.
Das Fundament zu einer solchen hat nun der Londoner Architekt George Legendre vorgelegt. Der Titel »Pasta by Design« seines 2011 erschienenen Buches verrät bereits, dass es ihm dabei ausschließlich um die Geometrie italienischer Teigwaren geht, was aber der Allgemeinheit seines Ansatzes kaum Abbruch tut. Schließlich werden nirgendwo auf der Welt so viel Nudeln gegessen wie zwischen Mailand und Palermo: Der Durchschnittsitaliener verbraucht 26 Kilo Trockenmasse pro Jahr, verputzt also ungefähr jeden zweiten Tag einen Teller voll. Auch bei der Herstellung ist das Land Spitzenreiter. Von den 13,1 Millionen Tonnen Hartweizenteig, die im Jahr 2010 weltweit produziert wurden, kamen nach Auskunft der International Pasta Organization 3,2 Millionen Tonnen aus Italien.
Dabei hat die italienische Pasta im Laufe der Jahrhunderte einen Formenreichtum entwickelt, vor dem auch Kenner schnell den Überblick verlieren, zumal identische oder sehr ähnliche Formen zuweilen regional unterschiedliche Namen tragen können. So erhebt auch George Legendre nicht den Anspruch, jede jemals irgendwo servierte Nudelsorte katalogisiert zu haben. Allerdings sind in den 92 Pastaformen, die sein Buch erfasst, alle gängigen Grundformen enthalten – und etliche exotische dazu. Sie alle werden nicht nur nebst Hinweisen zu Herkunft und wichtigster kulinarischer Einsatzmöglichkeit präsentiert, sondern vor allem mathematisch repräsentiert: als ein Satz von Gleichungen, mindestens eine für jede der drei Raumdimensionen (siehe »Die Fusilli-Formel«). Das Ergebnis ist ein Riesenspaß für alle, die Mathematik und Sinnlichkeit nicht als Gegensatz betrachten. Vor allem aber für den Autor selbst, der hier eine Methode, mit deren Hilfe er sonst Gebäude oder Brücken gestaltet, gewissermaßen rückwärts anwendet. Das Verfahren nennt sich »parametrisches Design« und stellt Formen durch Gleichungssysteme dar, die veränderliche Größen, die Parameter, enthalten. Der Gestaltungsprozess wird damit in zwei Schritte zerlegt, die grundsätzliche Formentscheidung besteht im Aufstellen der Gleichungen, die Feinarbeit im Variieren der Parameter. Das Auffinden der drei Gleichungen zum Rückwärts-Design eines Spaghetto ist nun ganz besonders einfach: ein konstanter Wert entlang der Achse, und in den Raumrichtungen senkrecht dazu Sinus und Cosinus, die zusammen den kreisrunden Querschnitt der Nudel beschreiben.
Vielen anderen Pastaformen sieht man ihre mathematische Struktur nicht so einfach an. »Dafür haben wir an mehreren Kilogramm Probenmaterial gearbeitet, das wir auf der ganzen Welt gekauft hatten«, erinnert sich Legendre. »Die haben wir dann einer sorgfältigen formalen Analyse unterworfen.« Dabei kam ihm die Erfahrung seines Architekturbüros mit Sinus- und Cosinus-Funktionen zugute. »Wir sind Experten in der Anwendung solcher periodischer Funktionen im Raum«, sagt er und verweist auf »Henderson Waves«, eine 274 Meter lange Fußgängerbrücke in Singapur, die er und seine Kollegen mittels einer einzigen Gleichung entworfen hatten. Und irgendwie periodisch im Raum, das sind ja auch viele Nudelformen, ob es nun die Schrauben der Fusilli sind oder die Riffelungen der Rigatoni.
»Letztlich gibt es keine Form, die sich nicht durch sinusartige Funktionen darstellen ließe«, sagt Legendre. Komplexere Pastasorten, etwa die links unten auf dieser Seite gezeigten Conchiglie, verlangen allerdings auch kompliziertere Operationen, vor allem das Potenzieren von Sinus- und Cosinus-Ausdrücken. Und bei solchen Sorten, deren Form sich dem Fließpressen des Teiges durch eine komplex geformte Düse verdankt (wie die rechts gezeigten Rotelle), reicht eine Formel pro Raumdimension in der Regel nicht mehr aus.
Neben der Parametrisierung der Nudelwelt verfolgt »Pasta by Design« aber noch ein zweites Ziel: ein System zu finden, in das sich jede erdenkliche Nudelform einordnen lässt. Möglicherweise kann man eine solche Klassifikation auch aus den grundlegenden mathematischen Eigenschaften der von Legendre ermittelten Gleichungssysteme gewinnen. Doch so weit treibt der Londoner Architekt die Sache dann doch nicht, was theoretisch interessierte Leser vielleicht etwas enttäuschen wird. Stattdessen teilt er die Pastaformen zunächst in offensichtliche Grundklassen ein: gerade, gebogen, gekantet, verdrillt, helixförmig, eingekniffen und gestaucht – und unterteilt diese weiter nach Längsprofil, Querschnitt, Oberflächenstruktur und Form der Ränder.
Daraus ergibt sich der unten gezeigte Baum von Formenkombinationen, dessen Verzweigungen die Nudeln in Gruppen und Untergruppen gliedert. Auch wenn Legendre dieses Resultat seiner Klassifikation an einen phylogenetischen Stammbaum aus der Biologie erinnert, ist es genau das nicht. Schließlich gibt es keine Nudel, die zum Beispiel einfach nur gerade ist, ohne gleichzeitig auch entweder hohl oder massiv zu sein. Und die Spaghetti, die historisch eine Basisform gewesen sein mögen, erscheinen hier nicht als Urahn an der Baumwurzel, sondern sind nur ein Zweig unter vielen anderen.
Trotzdem ist das Schema aufschlussreich. So kann man einmal bei einer Portion Fettuccine »Alfredo« und einem guten Chianti darüber sinnieren, warum keineswegs alle möglichen Kombinationen von Strukturelementen verwirklicht sind. Der Raum aller möglichen Formen, der »Morphospace«, wie Evolutionsbiologen das nennen, ist keineswegs ausgefüllt. So gibt es offenbar keine Pasta mit massivem (also weder halboffenem noch hohlem) Querschnitt, die zugleich eine geriffelte Oberfläche besitzt. Gewiss, ganz mit Nudelmasse ausgefüllte Rigatoni wären kulinarisch kaum überlebensfähig. Aber Linguine mit Mikro-Riffelung wären denkbar und könnten dank vergrößerter Oberfläche eine verbesserte Pesto-Adhäsion aufweisen. Doch wer sagt, dass die Evolution der Nudel nach 4.000 Jahren schon an ein Ende gelangt ist?
George L. Legendre: «Pasta by Design”, Thames & Hudson, London 2011
Die Fusilli-Formel
Eine Pastaform (zum Beispiel eine Spiralnudel oder Fusillo) ist bei George Legendre beschrieben als eine Wolke diskreter Punkte im Raum (A). Jeder Punkt ist durch ein Indexpaar i und j identifiziert, wobei i und j ganze Zahlen sind, im Fall der Fusilli zwischen 0 und 200 beziehungsweise 0 und 25.
Gemelli (»Zwillinge«) werden in Süditalien mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum serviert, im Norden eher mit Pesto oder Bohnen. Ihre mathematische Struktur ähnelt erwartungsgemäß sehr der von Fusilli.
Rigatoni (»große Gestreifte«) empfehlen sich für Saucen mit größeren Stücken, Wildragout etwa oder Pilze. Ihre Geometrie ist sehr elegant.
Rotelle (»Rädchen«) sind ein vergleichsweise modernes Pasta-Design, das offenbar zuerst in Ohio verkauft wurde. Ihre Mathematik ist eine Zumutung.
Fettuccine (»Bändchen«) sind relativ breite Eiernudeln aus Latium und ein Grundnahrungsmittel in der Stadt Rom. Dort erfand Alfredo Di Lelio im Jahr 1914 die nach ihm benannte Fettuccine- Version mit Butter und Parmesan.
Tagliatelle (»breit Geschnittene«) sind schmaler als Fettuccine und kommen aus der Gegend um Bologna. Mathematisch lassen sie sich als komplettes Knäuel beschreiben. Die Gleichung dafür ist überraschend einfach.
Radiatori (»Heizkörper«) sind hierzulande Exoten, eignen sich aber sehr gut zur Begleitung von Fleischragouts. Mathematisch sind sie deutlich simpler, als sie aussehen.
Conchiglie rigate (»gestreifte Muscheln«) schmecken am besten mit Tomatensauce oder Pesto Genovese. Ihre geometrische Gestalt auszurechnen ist allerdings fast so aufwendig wie bei den Farfalle.
Tortelloni sind die Großform der Tortellini (»kleine Gedrehte«) und wie diese eine pasta ripiena (»gefüllte Pasta«). Auch mathematisch sind sie sehr komplex.
Farfalle (»Schmetterlinge«) passen gut zu Carbonara. Ihr Gleichungssystem ist das komplizierteste aller auf dieser Seite gezeigten Nudeln.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 13.05.2012
Bloß nicht an diese Medaille denken!
In einem ungewöhnlichen Buch berichtet der Franzose Cédric Villani aus seinem Leben als Spitzenmathematiker. Eine Begegnung.
Von Ulf von Rauchhaupt
Ich mag meinen Namen«, sagt der schlaksige Mann im Dreiteiler. Wie immer trägt er eine Lavallière, eine weiche Schleifenkrawatte, heute in Grün, und eine Brosche in Form einer Spinne, diesmal ein eher einfaches Modell aus Messingdraht und Glasperlen. »Es ist diese Zusammenstellung, Cédric ist ein angelsächsischer Königsname, und Villani verweist auf eine sehr bescheidene Herkunft, es ist das italienische Wort für Landarbeiter.« Aus Italien stammt ein Teil seiner Familie, der Großvater wurde in Neapel geboren. Jetzt steht der Franzose bei einem Treffen in Frankfurt am Main Rede und Antwort.
Aussagen wollen ebenso begründet sein, wie Theoreme bewiesen werden müssen. Cédric Villani hat sichtlich Spaß an der romantisch-künstlerhaften Erscheinung, die er pflegt, aber er ist eben Mathematiker – und nicht irgendeiner. Mit 28 wurde er Professor an der École normale supérieure de Lyon und mit 37 zudem Direktor des Institut Henri Poincaré in Paris. Und seit 2010 ist er Träger der Fields-Medaille, die auch als Nobelpreis der Mathematik bezeichnet wird, obwohl sie deutlich schwerer zu bekommen ist, da sie nur alle vier Jahre und nur an Personen unter 40 verliehen wird.
Über sein Arbeitsleben der Jahre 2008 bis 2010, dessen wissenschaftlicher Ertrag ihm diese Ehrung einbrachte, hat Villani im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben, das in Frankreich ein Hit wurde und das dieser Tage unter dem Titel »Das lebendige Theorem« auf Deutsch erschienen ist. Es ist ein literarisches Projekt; das Thema ist archaisch. Es gibt den Helden und seinen Gehilfen – Villanis ehemaliger Schüler Clément Mouhot, der heute in Cambridge lehrt. Sie ziehen aus, um den Drachen zu besiegen, der hier die Gestalt eines vertrackten mathematischen Problems hat. Statt einer Prinzessin winkt die Fields-Medaille, an die der Held aber im Angesicht des Ungetüms keinesfalls denken darf – Mathematiker verhalten sich in solchen Dingen abergläubischer als die Ritter des Mittelalters. Die Form der Saga ist allerdings modern: eine Collage aus tagebuchartigen Notizen, wissenschaftlichen Textauszügen inklusive seitenlanger Formelfolgen und E-Mails, die zum Teil ebenfalls voller Formeln sind, und zwar in Gestalt von Befehlen der Computersatz-Software LaTeX. Denn seit Anbruch des E-Mail-Zeitalters nutzen Wissenschaftler, die sich quantitative Argumente mitzuteilen haben, LaTeX-Code auch dazu, dies allein mit Zeichen der Tastatur zu tun. Emoticons finden sich bei Villani keine, sieht man von der Zeichenfolge »@!*#« ab, von der jeder Comicleser weiß, wie trefflich sie ein wertendes Adjektiv ersetzen kann.
Erklärt wird in alledem so gut wie gar nichts. Die wenigen mathematischen Erläuterungen, die Villani gibt, erfordern Vorkenntnisse und haben nicht näher mit dem Theorem zu tun, mit denen der Held und sein Knappe ringen. »Ich wollte nicht, dass der Leser durch Bemühung, die Mathematik zu verstehen, von der Geschichte abgelenkt wird«, sagt Cédric Villani. Die Geschichte, das ist die seines Arbeitsalltags, und wenn sie auch nichts erklärt, wird doch viel gezeigt. Insofern handelt es sich beim »Lebendigen Theorem« eben doch um ein Sachbuch. Villani, der seiner Disziplin in Frankreich ein Gesicht gegeben hat, lässt die Leser einfach einmal dabei zugucken, wie es so zugeht unter den Spitzenmathematikern unserer Zeit. Wie es ist, Tage und Nächte mit Termen und Indices zu hadern, wie es sich anfühlt, nach großen Mühen einen 180-Seiten-Beweis bei einer Fachzeitschrift eingereicht zu haben und dann zu erfahren, dass die Veröffentlichung abgelehnt wird. Oder Villani zeigt, wie angenehm sein Aufenthalt am Institute for Advances Studies in Princeton war – und wie viel besser er hätte sein können, wenn man in New Jersey vernünftigen Käse bekäme. Und schließlich lässt Villani seine Leser auch an seiner Freude teilhaben, als er die Fields-Medaille, das Objekt der verbotenen Sehnsucht, am Ende dann doch bekommt.
»Das lebendige Theorem« ist also mehr ein sinnliches Erlebnis als ein intellektuelles. Dabei ist Villanis Forschungsgegenstand gar nicht so außerweltlich wie manch anderer, mit dem sich Mathematiker befassen. Die Objekte, die er untersucht, sind sogenannte partielle Differentialgleichungen. Wie Gleichungen der Schulmathematik, also etwa »x2-4=0«, sind das Aussagen, die nur für bestimmte Lösungen richtig sind. Statt Zahlen (im obigem Fall x=+2 und x=-2) sind die Lösungen von Differentialgleichungen nun ganze Funktionen f(x), und partielle Differentialgleichungen haben als Lösungen Funktionen mit mehreren Variablen, also etwa f(x, v). In den Naturwissenschaften, vor allem in der Physik, geht es sehr oft darum, Lösungen partieller Differentialgleichungen zu finden oder zumindest etwas über ihre Eigenschaften herauszufinden. Mathematik geht hier stufenlos in mathematische Physik über.