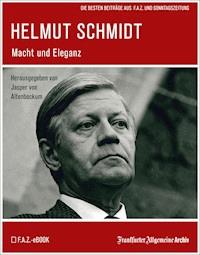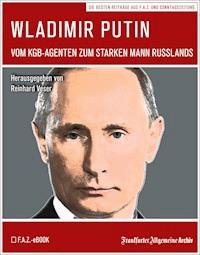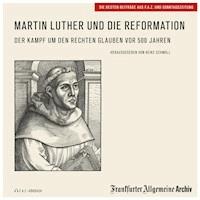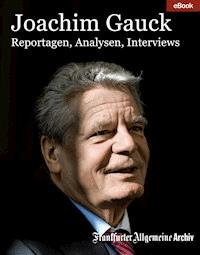
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: F.A.Z.-Köpfe
- Sprache: Deutsch
Joachim Gauck hat einen langen Weg zurückgelegt, vom oppositionellen Pastor in der DDR über den oftmals angefeindeten, aber auch hochgelobten Beauftragten für die Stasi-Akten bis schließlich zum von breiten Bevölkerungsschichten getragenen Bundespräsidenten. Wie Gauck trotz aller Anfeindungen und Widerstände bei seiner Linie blieb und zu guter Letzt den Weg zum Amt des Bundespräsidenten beschritt, zeichnet dieses eBook des F.A.Z.-Archivs anhand zeitgenössischer Texte nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joachim Gauck
Reportagen – Analysen – Interviews
F.A.Z.-eBook 1
Herausgegeben vom Frankfurter Allgemeine Archiv
Projektleitung Franz-Josef Gasterich
Produktionssteuerung Christine Pfeiffer-Piechotta
Redaktion Hans Peter Trötscher
E-Book-Produktion Rombach Druck- und Verlagshaus
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2012 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main.
Titelbild: F.A.Z.-Foto / Frank Röth.
ISBN: 978-3-89843-166-8
Seelsorger der Nation
Gauck begleiten gewaltige Erwartungen. Deutschland sehnt sich nach einem Havel.
Von Berthold Kohler
Es schien alles endgültig entschieden zu sein, vor zwei Jahren, als Joachim Gauck sich für die Kluge-Köpfe-Serie der F.A.Z. fotografieren ließ als Bürger Gauck, mit dem Rücken zum Schloss Bellevue. Er hatte damals die Wahl zum Bundespräsidenten erwartungsgemäß, wenn auch zu allgemeinem und wohl persönlichem Bedauern verloren, die Freiheit des Pensionärs aber behalten. Fortan konnte er tun, was er am liebsten und am besten tat: als Wanderprediger der Demokratie und der Freiheit durchs Land ziehen, mit einem Ruf wie Donnerhall, jedenfalls im Westen. Er genoss das Ansehen eines »elder statesman« der Helmut-Schmidt-Klasse, ohne – die Leitung einer Behörde erhebt noch nicht in diesen Stand – jemals ein Staatsmann gewesen zu sein.
Seit gestern verlangt das Schicksal diesen Vorschuss von ihm zurück. Den elften Bundespräsidenten begleiten Erwartungen, wie sie größer kaum sein könnten. Selbst einem Selbstbewusstsein wie dem seinen müssen sie Respekt abnötigen. Gauck zieht nicht nur mit einer überwältigenden Mehrheit, sondern auch mit einem umfassenden Sanierungsauftrag ins Schloss: Er soll ein Amt, dessen Würde und Ansehen gelitten haben, wieder zu alter Höhe aufrichten. Volk und politische Klasse erwarten von ihm, dass er nach einer hingeworfenen und nach einer gescheiterten Präsidentschaft dem Verfassungsorgan, das er verkörpert, so viel Glanz verleiht, dass der alte Satz, (West-)Deutschland habe Glück mit seinen Staatsoberhäuptern gehabt, in Summe wieder stimmt.
Denn die Deutschen hängen an ihrem Paradoxon im Verfassungsgefüge, das Einfluss auf sie ausüben soll, ohne im herkömmlichen politischen Sinne Macht über sie zu haben. Man erwartet vom Bundespräsidenten, dass er im Fürsorgestaat – für alles hat die moderne Gesellschaft einen Dienstleister – die Versorgung mit Geist und Moral sicherstellt. Mehr als den anderen Staatsorganen wird ihm die Aufgabe politischer Sinnstiftung zugeschrieben. Er soll Hefe in die gesellschaftlichen Debatten rühren und zugleich den Kitt liefern, der die Gesellschaft zusammenhält. Ihm gibt man auf, den Stoff zu weben, aus dem die Träume von einem gerechten und friedlichen Gemeinwesen sind, in Deutschland und der ganzen Welt.
Diese Jobbeschreibung hat selbst Gauck einmal eine »mission impossible« genannt. Doch wer sollte sich nach der unglücklichen Vorgeschichte noch an sie heranwagen, wenn nicht der freischaffende »Demokratielehrer«, der seit zwei Jahren auf Tournee war mit dem Stück »Wie man es besser machen könnte«? Der Pastor, der zum Bürgerrechtler wurde, ist den in ihn gesetzten Hoffnungen zufolge der deutsche Havel, nach dem sich besonders die linken Intellektuellen im Westen so sehnten – so sehr, dass sie bereitwillig übersahen, wie fern er ihnen auf manchen Feldern steht. Und dass der Ostdeutsche im Osten nicht ganz so durchgängig verehrt wird wie im Westen.
Endlich den Solitär gefunden zu haben, der dem Land der Dichter und Denker gut zu Gesicht steht, hinderte die Finder freilich nicht daran, ihn noch vor der Wahl in die Schablonen pressen zu wollen, die man angeblich loswerden wollte. Denkt er auch genug ans Soziale? Hat er nicht nur ein einziges Thema, die Freiheit?
Ein solcher Vorwurf kann wohl nur in Deutschland erhoben werden. Er zeigt, wie wenig Wertschätzung die liberale Idee, die es in deutschen Landen immer schon schwer hatte, in dieser Republik noch erfährt. Und wie sehr ein Bundespräsident nottut, dessen Lebensthema die Freiheit des Bürgers ist: Freiheit im klassischen Verständnis als Freiheit vom Staat, aber auch Freiheit zum Engagement, zur Verantwortung, zur »Bezogenheit«, wie Gauck sagt. Als die Wulffs ins Bellevue kamen, war von den deutschen Kennedys die Rede. Ihnen folgt jetzt ein Hausherr mit weit geringerem Glamour-Faktor, der aber den vielzitierten (und wenig beherzigten) Satz des amerikanischen Präsidenten nicht nur in eigenen Worten, sondern auch mit eigener Glaubwürdigkeit vortragen kann und wird: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern, was du für dein Land tun kannst.
Es ist damit zu rechnen, dass Gauck bei der Auslegung des Kennedyschen Imperativs für das höchste Staatsamt für manche Überraschung sorgen wird. Das mag zu den Gründen der Kanzlerin gehört haben, ihn abzulehnen, bevor er ihr aufgezwungen wurde. Gauck ist ihr nicht verpflichtet, was aber auch für sie von Vorteil sein kann. In jedem Fall belegen die beiden ostdeutschen Protestanten an der Spitze des deutschen Staates, dass die Wiedervereinigung nicht nur nach dem Prinzip der Einbahnstraße verlief. Sie führen auch vor, wie bis zur Unsinnigkeit oberflächlich die Einteilung in »Ossis« und »Wessis« war und ist. Frau Merkel, die Integrierte, und Gauck, der Integrierer, könnten nicht viel unterschiedlicher sein, was Temperament, Rollenverständnis und Zugang zur Politik angeht.
Das gilt auch für die Bedeutung, die sie dem Wort im politischen Prozess geben können. Das Pathos, mit dem Gauck seine Reden grundiert, mag manchem in Berlin bald als überreichlich erscheinen. Doch klagt das Volk seit Frau Merkels Amtsantritt über eine Unterversorgung mit rhetorischer Wärme und historischer Verortung. Der Deutsche lebt gerade in Zeiten der Verunsicherung nicht vom Pragmatismus allein. Der neue Seelsorger der Nation wird auch diese Lücke füllen.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 19.03.2012
Das Ende der Kür
Von Günter Bannas
Joachim Gauck konnte bisher tun und lassen, was er wollte. Diese unbeschwerte Zeit, in der er sich, ohne Rücksichten nehmen zu müssen, in der Kunst der freien Rede über die Freiheit üben konnte, ist vorbei. Seit auch die Kanzlerin sich bereitfand, ihn als ihren Kandidaten für das höchste Staatsamt zu betrachten, wird jedes seiner Worte auf die Goldwaage gelegt. Bislang schlägt er sich gut.
Es wäre untertrieben, diese Räumlichkeiten schmucklos zu nennen. Es wäre sogar falsch, diese Zimmer als geschmacklos zu bezeichnen. Das schiere Nichts bestimmt das Ambiente. Keine Regale, keine Bilder, keine Teppiche. Ein paar Tische verlieren sich hier, Telefon, Internetzugang, Zeitungen, Papierkorb. Minimalausstattung eines Büros. Es ist eine Wohnung am katholischen Hof in Berlins Mitte, drei Zimmer, in denen der Stab des mehr als mutmaßlich künftigen Bundespräsidenten wirkt – wobei schon der Ausdruck Stab übertrieben scheint. Ein Pressesprecher, der schon im Juni vor zwei Jahren dabei war. Ein Referent mit nämlicher Erfahrung, eine Sekretariatskraft und schließlich, sozusagen als koordinierender Chef, David Gill, stellvertretender Bevollmächtigter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland am Regierungssitz in Berlin.
Weil Gill den Hausherrn und Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe, den Prälaten Karl Jüsten, kennt, kam die Gruppe Gauck für vier Wochen im Katholischen Büro unter – für jene vier Wochen, die zwischen der Nominierung des Kandidaten und seiner Wahl zum Nachfolger des unglücklichen Christian Wulff liegen. Die Kosten teilen sich, ist in dieser Zeit hinzuzufügen, die Parteien, die die Kandidatur Joachim Gaucks unterstützen.
Viel spricht dafür, dass die Gruppe dann hinüberziehen wird in das Verwaltungsgebäude am Schloss Bellevue. Alles spricht dafür, dass Gauck, der frühere Pfarrer und nachmalige Vortragsreisende, dann im Schloss arbeiten wird. Schon jetzt wird er (fast) wie ein Bundespräsident behandelt. Beamte des Bundeskriminalamtes achten auf die Sicherheit. Die Limousinen sind groß und schwarz. Freundlichst wird er – auch und gerade – von denen begrüßt, die ihn vor zwei Jahren partout nicht haben wählen wollen. »Willkommen, Herr Gauck. Wir freuen uns sehr auf Sie.« Er nimmt es freundlich zur Kenntnis.
Joachim Gauck hatte ein schönes Leben. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Vorträge wurden zu Büchern. Er war ein gefragter Mann. Er reiste durch die Lande und hielt Lesungen, Reden. An Hochschulen und in Talkshows, in Wirtschaftsunternehmen und Kirchengemeinden und sogar einmal bei der CSU in Wildbad Kreuth trat er auf. Er hat es wohl genossen. »Das ist eine sehr angenehme Art zu leben«, pflegt er sich zu erinnern. Ganz früher, als die DDR noch existierte und er Jugendpfarrer in Rostock war, galt er als herausragender Prediger. Er scheint die Kunst des Redens und des rhetorischen Beeindruckens nicht verloren zu haben. Und die Wirkungen hat er wohl genossen – von unglaublichen Sympathiewellen kann er sprechen.
Es mag an der Redeweise seines Vorgängers und der Mehrheit des politischen Personals liegen, dass im Falle Gaucks (sogar, ausschließlich?) die professionellen Zuhörer geneigt sind, Kleinigkeiten wie Großtaten zu beschreiben. Letzter Akt seines alten Lebens in Fürth. Eine Rede, eigentlich wie immer. Doch seine erste Rede als künftiger Bundespräsident. Freiheit und Verantwortung. Äußerlichkeiten werden wichtig genommen, wie das von nun an immer sein wird. Er trug keine Krawatte. Er habe keine Krawatte getragen, wurde berichtet. Er begrüßte seine Tochter, weil die nun, da des Vaters Dasein als freischaffender Redner ende, ihren Vater einmal erleben wolle. Sogar die Tochter habe seiner Rede gelauscht, wurde übermittelt.
Gauck weiß, dass es mit der Freiheit der Rede vorbei ist. Einen Auftritt in Polen, in Lodz, hatte es noch gegeben. Ansonsten ist, wie das im Deutsch der Bürokraten wohl heißt, der Kalender »leer geräumt worden«. Es ist vorbei mit der Kür. Von nun an ist die Pflicht das Maß aller Dinge. Schon spricht der freigeistige Redner, die Verantwortung vor Augen, von einem Verlust an Lebensqualität. Er tut es halb im Scherz und halb im Ernst. Er genießt die Öffentlichkeit, hat aber die Kehrseite – erstmals seit langem – erfahren. Alte Wegbegleiter aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung werfen ihm vor, sich erst dann der Bewegung angeschlossen zu haben, als es mit der DDR schon fast vorbei gewesen sei. Er sei schon damals ein Konservativer gewesen. »Linkes Denken war Gauck schon immer suspekt, die DDR hasste er«, hat Hans-Joachim Tschiche, oppositioneller Pfarrer aus Magdeburg, jetzt – vorwurfsvoll – über Gauck geschrieben. Differenzen über den Weg zur Vereinigung Deutschlands scheinen der Hintergrund zu sein.
Dass Gauck in der »Tageszeitung« (taz) als »reaktionärer Stinkstiefel« tituliert worden war, scheint ihn getroffen zu haben. Dass Jürgen Trittin, Vorsitzender der Grünen-Fraktion, dann ebenso deftig von »Schweinejournalismus« sprach, hat Gauck in seinem positiven Urteil über Trittin bestärkt. Die Verteidigung gegen die Vorwürfe habe ihm gutgetan, sagte Gauck bei seinem Besuch in der Grünen-Fraktion. Viele seiner Vorgänger waren empfindlich gegenüber öffentlicher Kritik. Uralte Zeitungskommentare konnten sie sich merken. Auch Gauck wirkt nicht abgebrüht, wie es die Kämpfer aus den parlamentarischen Schlachten geworden sind.
Von nun an wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, was möglicherweise Gaucks Naturell der Unbefangenheit zuwiderläuft. Veränderungen an sich nimmt er vorweg. »So werdet ihr mich lange nicht mehr hören«, wurde er bei den Grünen vernommen, die – was glaubhaft wirkt – für sich in Anspruch nehmen, bei ihnen habe sich Gauck am wohlsten, weil heimisch gefühlt. Mit manchen seiner politischen Aussagen ist das nicht zu erklären. Sie widersprechen geradezu grünem Gründungsmythos. Beispiel: Friedensbewegung der frühen achtziger Jahre. »Zu jener Zeit war die Begeisterung für den Frieden groß und ohne Einschränkung. Und so dachten viele meiner protestantischen Freunde im Westen, wenn man sich entfeinde, wäre das eine wirksame Aktion gegen Feindschaft und Krieg. Unsere Evangelischen Akademien und Studentengemeinden waren eben nicht immer der besondere Hort des Heiligen Geistes, sie waren und sind manchmal auch Spielwiesen des Zeitgeistes«, hat er geschrieben. Es sagt viel über die Entwicklung der Grünen aus, dass sie nun zum zweiten Male Gauck zum Bundespräsidenten wählen wollen.
F.A.Z.-Foto / Helmut Fricke
Wir sind jetzt in unerwarteter Weise auf der Erfolgsstraße«, sagte Gauck den Grünen – die Kampagne von 2010 im Blick, die trotz aller medialen Erfolge in einer Wahlniederlage gegen Christian Wulff geendet hatte. Zurückliegende Bemerkungen über Thilo Sarrazin (»mutig«) oder die Occupy-Bewegung (»albern«) aber hatten für Wirbel in der links-alternativen Szene und mithin auch bei den Grünen gesorgt. Gauck also hatte sich bei seinen eigentlichen »Entdeckern« auch zu rechtfertigen. Er distanzierte sich und suchte sich zu entschuldigen. Statt »mutig« hätte er eher »frech« sagen müssen, sagte er über Sarrazin. Er teile dessen Thesen ganz und gar nicht. Er sei wohl auch zu unbefangen in die Debatte über die Integrationspolitik gegangen, führte er aus. Die Fachleute der Grünen auf vielerlei Gebieten sollen nicht einen Vorwurf ausgelassen haben – bis hin zum Datenschutz. Zwei Ankündigungen des Kandidaten wurden vernommen. »Debatten müssen geführt werden.« Und: »Ich bin bereit zu lernen.«
Die Umstände seiner neuerlichen Kandidatur haben die Notwendigkeit des Lernens mit sich gebracht. »Ich hatte mich nicht vorbereitet«, lautet Gaucks Schilderung. Wie denn auch? Wozu denn auch? Mit Glanz und Gloria hatte er in der Bundesversammlung die Wahl 2010 verloren. Seine Vorträge galten den Begriffen der Freiheit, der Verantwortung und der Toleranz. Diese Inhalte hatten den vormaligen Schwerpunkt – das »Zusammenwachsen« des Westens und des Ostens Deutschlands – abgelöst. Die Leute erwarteten von ihm keine Reden über den Euro, die Finanzmärkte, die Atompolitik, den Nahen Osten und die innere Sicherheit. Sie wollten Grundsätzliches hören, nicht das Alltägliche.
Bei Gauck scheint es so, als wende sich ein Ostdeutscher an die Ostdeutschen. Die Erfahrungen der DDR-Vergangenheit schwingen mit, wenn er die Menschen zum Mittun in Staat und Gesellschaft auffordert. Manche Formulierungen würde ein westdeutsch Sozialisierter nicht verwenden. Manche Erklärungen zur Freiheit klingen pastoral. Gauck glaubt, das urtümliche Ansinnen von Freiheit werde sich durchsetzen. Er scheint verstanden zu haben, dass es im Westen der Republik eine wachsende Distanz zum Osten gibt – auch wegen der Herkunft der politischen Repräsentanten. »Der alte Westen darf sich nicht abwenden«, erscheint für Gauck als eines seiner Interessengebiete.
Gerne wurde er in diesen Tagen als »Demokratielehrer« bezeichnet, auch von Angela Merkel, als sie im Januar vor zwei Jahren eine Laudatio zu seinem 70. Geburtstag hielt. Über die Maßen hatte sie ihn gewürdigt, durch ihr Erscheinen an sich, durch ihre Rede und, wie Gauck das fand, ihr langes Bleiben bei dem Fest. Einen doppelten Boden allerdings hatte die Bundeskanzlerin in ihre Rede gezogen: »Eigentlich könnte Joachim Gauck die Laudatio auf sich am allerbesten halten.«
Angela Merkel also schien den früheren DDR-Bürgerrechtler zu schätzen – einerseits. Sie schien ihn aber nicht im Amt des Bundespräsidenten haben zu wollen, bis zuletzt – andererseits. Gauck sei »monothematisch«, führte Frau Merkel in ihren Parteigremien und beim Koalitionspartner aus. Wahrscheinlich würde er die Charakterisierung nicht einmal bestreiten, allenfalls einwenden, sein Thema sei umfassend genug. Die Ursachen und Hintergründe der Vehemenz des Widerspruchs Frau Merkels gegen Gauck an jenem Sonntag, selbst nachdem sich die FDP auf Gaucks Seite geschlagen hatte, liegt auch für Führungsmitglieder der Union im Dunkeln. Furcht um die eigene Autorität? Sorge, einen Fehler von 2010 zugeben zu müssen? Angst, es könne ein Bundespräsident erwachsen, der sie an Beliebtheit übertrifft? Vielleicht spielte es auch eine Rolle, die Kanzlerin halte zwei Ostdeutsche an der Spitze des Staates für zu viel des Ostdeutschen. Vielleicht sorgte sie sich, Gauck habe keine politisch-administrative Erfahrung. Es mag sein, dass die unterschiedlichen Biographien der beiden hinzukommen. Gauck durfte in der DDR nichts als Theologie studieren, weil er nicht Mitglied der FDJ gewesen war. Frau Merkel durfte immerhin Physik studieren und wurde promoviert. Wahrscheinlich wird sich das ursprüngliche Motivbündel Frau Merkels nie entwirren lassen.
Es ist keine Kampagne wie im Juni 2010, die Gauck und seine Freunde zu führen haben. Damals war es eine Großgruppe, Medienleute und Künstler vor allem. Im Internet wurde gekämpft. Gauck wurde als der Präsident der Herzen präsentiert. Es ging um jede Stimme der Bundesversammlung, und immerhin fiel die Entscheidung erst im dritten Wahlgang. Alles anders heute. Der Kandidat ist so gut wie gewählt. Nur in den Landtagen zuletzt von Mecklenburg-Vorpommern und in der kommenden Woche von Baden-Württemberg und Bayern tritt er auf. 45 Minuten hat, beispielsweise, sein Termin in Schwerin gedauert. Auftritte zudem bei den Bundestagsfraktionen und eigens zudem bei der CSU-Landesgruppe. Gepflegt wurden die vor allem, die vor zwei Jahren für Wulff votiert hatten. Pflichttermine, wie sie künftig zum Alltag Gaucks gehören werden. Schon in diesen Tagen ist er nur noch überaus beschränkt der Herr seiner Termine.
Wichtig also seine Vorstellung bei der nordrhein-westfälischen CDU. Marienthal bei Hamminkeln am Niederrhein. Immerhin 20 Stimmen der Bundesversammlung hat die Landtagsfraktion in Düsseldorf zu vergeben – von Alice Schwarzer bis Friedrich Merz reicht das Spektrum der Delegierten. Ob Gauck es so machen wolle wie einst Richard von Weizsäcker, wollte jemand wissen, und gemeint war damit, ob Gauck sich im künftigen Amt als oberster Kritiker der Parteien präsentieren wolle. Nein, wurde er vernommen, dazu eigne er sich nicht. Gauck scheint der Parteien nicht überdrüssig zu sein. Dermaßen einfühlsam hat er sich im Linksrheinischen präsentiert, dass einer der Anwesenden dem evangelischen Theologen zurief, eigentlich könnte er auch ein katholischer Christ sein – was er gesagt habe und wie. »Wir wählen ihn nicht, weil die Umstände nun so sind, sondern weil wir ihn wollen«, hat Karl-Josef Laumann, der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, hernach versichert.
Brückenbauen bei den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP. »Die CDU hat die Idee der Freiheit nie dem Zeitgeist geopfert.« Das hörten die Abgeordneten der Union gerne. »Es gibt also keine größere Distanz zwischen dem Kandidaten und Ihren Wertvorstellungen.« Und: »Gott schuf uns, damit wir Verantwortung übernehmen.« Er wolle ein Bürgerpräsident sein, nicht aber als Gegenspieler zur parlamentarischen Demokratie und den Parteien auftreten. Fragen zu Finanzmärkten und zur Außenpolitik beschied er mit einer Entschuldigung. Er wolle jetzt nichts aus dem hohlen Bauch sagen. Er wisse, es sei ein Problem. Aber er habe sich einzuarbeiten. »Ich war von dieser Vorstellung beeindruckt«, wurde dann von offizieller Seite gesagt.
Gute Worte erhielt die FDP. Ein »flammendes Plädoyer für die Freiheit« habe Gauck gehalten, erzählten später die Zuhörer. Zitate wurden abgestimmt. »Freiheit ist immer Freiheit für etwas und zu etwas. Die Freiheit der Erwachsenen bedeutet Verantwortung.« Nur in der Pubertät des Menschen sei es schwierig damit, was Gauck noch mit dem Bonmot anreicherte: »Manche kommen nie aus der Pubertät.« Ein Abgeordneter lobte die Äußerungen des zurückgetretenen Bundespräsidenten Wulff zur Integrationspolitik. »Die Politik von Wulff werde ich fortsetzen, mit meinen Worten«, lautete die Antwort. Zur Freude der Abgeordneten wünschte Gauck der krisengeschüttelten FDP alles Gute – in dem Sinne, dass es schade wäre, wenn eine einst so starke Partei aus dem Bundestag herausfiele.
Von nun an reden Joachim Gauck und Angela Merkel, als Verfassungsorgane, gut übereinander. Am Abend der Nominierung wiederholte die Bundeskanzlerin das Wort vom »wahren Demokratielehrer«. Vier Stunden nachdem sie das »Gauck – niemals« ausgerufen hatte, sagte sie: »Ich bin sicher, dieser Mann kann uns wichtige Impulse geben für die Herausforderung unserer Zeit und der Zukunft, die Globalisierung, die europäische und internationale Staatsschuldenkrise, die Energiewende, die innere und äußere Sicherheit und nicht zuletzt das immer wieder neu zu schaffende Vertrauen in die Demokratie und unsere freiheitliche Grundordnung.« Der Auserkorene kokettierte mit Aufgewühltsein und Nervosität. Eines vergaß er nicht: »Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben mir auch versichert, dass Sie auch in anderen Zeiten beständig Hochachtung und Zuneigung zu mir empfunden haben. Und das Wichtige daran ist, dass Sie mir Vertrauen entgegengebracht haben.«
Gauck scheint nicht zu jener Sorte Theologen zu gehören, die Macht und Einfluss per se für etwas aus dem Reich des Bösen halten. Er mag es für überaus angebracht gehalten haben, dass er – im Laufe der Zuspitzungen der Wulff-Krise – von SPD und Grünen gefragt wurde, wie schon vor knapp zwei Jahren ihr Kandidat in der Bundesversammlung zu sein. Seine Zusage war knapp. »Klar.« Er hatte genannt werden wollen, war die Botschaft. Innerlich rechnete er wohl damit, es werde der Koalition ja doch wohl gelingen, einen Kandidaten zu finden, der einem ausreichend großen Teil von SPD und Grünen ebenfalls genehm sei.
Sich selbst mag er nur als Konsens-Kandidat eines übergroßen Teils der Bundesversammlung gesehen haben. Auftritt in Wien, Beratungen in Berlin, Festlegung der FDP auf Gauck. Eine SMS an die Donau. »Ich wurde blass.« Rasch verblasste seine Konsens-Idee, und Tage später, als er sich der CDU in Nordrhein-Westfalen vorstellte, schilderte er, nach dem Umschwenken der FDP wäre er auch in eine Kampfkandidatur gezogen. Das habe er, rief er seinen neuen Anhängern zu, sehen wollen, wie CDU, CSU und Linkspartei Seite an Seite gegen ihn aufträten. Ähnlich hat auch Angela Merkel kalkuliert. Ihr liebreizendes Lächeln setzte sie auf, als sie Gauck im Kanzleramt präsentierte. Seither arbeiten ihre Helfer daran, die Geschichte umzuschreiben. Ziel: Angela Merkel selbst ist es gewesen, die Joachim Gauck vorgeschlagen und durchgesetzt habe. »Angela Merkel hat mit ihrer Ankündigung, einen parteiübergreifenden Kandidaten zu finden, Gauck erst möglich gemacht«, sagen die Helfer der Kanzlerin. Einen ersten Erfolg haben sie verbucht. Der Beitrag der FDP zu Gaucks Nominierung hat sich in den Umfragen nicht zugunsten der FDP ausgewirkt. In der Unionsfraktion sprach Gauck nun von »meiner Bundeskanzlerin«. Beifall.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 10.03.2012
Linker Konservativer
Von Timo Frasch
Lange bevor Joachim Gauck von gemäßigten Linken, Liberalen und Konservativen als Präsidentschaftskandidat präsentiert wurde, hat er sich selbst schon als »linken, liberalen Konservativen« präsentiert. Dieses nun oft wiederholte Wort, das alles meint, alles vereint und alles verneint, dürfte Gaucks künftigem Vorgänger gut gefallen – zumal es ähnlich bunt ist wie dessen eigener Begriff von bunt. Will uns Gauck etwa sagen, dass er unter den Konservativen als ein Linksliberaler zu gelten habe statt unter den Linksliberalen als ein Konservativer? Oder will er als Protestant, der er ja auch noch ist, darauf hinaus, dass er links, liberal und konservativ – zugleich oder gar in dieser Reihenfolge – sei und damit eine complexio oppositorum, wie sie nach Carl Schmitt eigentlich nur Katholiken für sich beanspruchen können? Wenn das so ist, warum sagt es der sonst so beredte Gauck dann nicht so, sondern anders? Und warum beschreibt er, der seine Wahl zum Bundespräsidenten letztlich der FDP zu verdanken haben wird, sich nicht als »linken, konservativen Liberalen«? Oder – den rot-grünen Gaucklern zuliebe – als »konservativen, liberalen Linken«?
Beschränken wir uns der Einfachheit halber auf die verkürzte Wendung »linker Konservativer«. In diesem vermeintlichen Oxymoron (von griechisch oxys für »scharfsinnig« und moros für »dumm«) ist »Konservativer« das Hauptwort, dem »linker« als adjektivisches Attribut beigeordnet ist. Dieses hängt nicht nur mit dem Hauptwort ab, sondern auch von ihm, in Fall, Zahl und Geschlecht. Die Kräfteverhältnisse scheinen also klar. Offenbar kommt es Gauck darauf an, das Konservative stärker zu gewichten als das Linke. Doch so einfach ist es nicht, nicht immer gilt rechts vor links, nicht immer sticht der Ober den Unter. Als künftiger erster Mann im Staate wird Gauck das noch merken.
Nehmen wir das Beispiel »schwarzer Schimmel« – oder »weißer Schwarzer«. In diesen Fällen ist das jeweilige Attribut semantisch so dominant, dass es das Hauptwort unter sich begräbt: Wenn ein Schimmel schwarz ist, ist er kein Schimmel, wenn ein Schwarzer weiß ist, ist er kein Schwarzer. Ergo ist ein Schwarzer auch dann kein Schwarzer, wenn er rot-grün oder gelb ist. In dunklen Zeiten gab es sogar mal Zweifel, ob ein Schwarzer, wenn er reich ist, ein Schwarzer sein könne. Jedenfalls hat der schwarze frühere Boxer Larry Holmes einst gesagt, ihm sei es erst gelungen, nicht mehr schwarz zu sein, als er genug Geld beisammenhatte. Wulff und Gauck hingegen wollen farbig sein. Zumindest Wulff hat dafür aber immer das Geld gefehlt. Deshalb hat er es ja so bunt getrieben, dass es dem Bürger (Lars Dietrich, Gauck et al.) irgendwann zu bunt wurde.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 03.03.2012
»Er war für uns selten der Vater«
Von Stefan Locke
Wie ist Joachim Gauck wirklich? Sein Sohn Christian gibt Auskunft. Ein Gespräch über die Unbedingtheit des Pfarrers, die Nöte einer Familie, gehässige Kritik und wilde Ehe – und darüber, wann ihm der Vater peinlich war.
Herr Gauck, wie haben Sie von der Nominierung Ihres Vaters erfahren?
Ziemlich früh. Ich bekam an dem Sonntag einen Anruf, dass die FDP sich für ihn ausgesprochen hat, und daraufhin habe ich meinen Vater informiert. Er hatte nur wenig Zeit, er war ja in Wien zu einem Vortrag, und sagte nur, das hätte er auch gehört. Aber uns war klar, dass er nicht noch einmal ohne eine realistische Chance antreten würde. Und wir wussten, dass Frau Merkel keinen Seiteneinsteiger mehr wollte.
Haben Sie darüber mit ihm geredet?
Wir reden nicht ständig miteinander, er ist ja viel unterwegs. Aber eine zweite Kandidatur war nie Thema, unsere ganze Familie hat das stets weit von sich gewiesen. Mich haben sehr oft meine Patienten angesprochen, dass sie gern meinen Vater im Amt sähen, das hat mich auch gefreut. Aber wir haben nicht geglaubt, dass er nach dem Wulff-Rücktritt noch einmal gefragt wird. Wir haben alle gedacht: Sie wird nicht über ihren Schatten springen.
Hat er sich mit Frau Merkel darüber unterhalten, beide kennen sich doch?
Zu DDR-Zeiten kannten sie sich nicht, aber seit dem Mauerfall kennen und schätzen sie sich; sie war auch bei seinem sechzigsten Geburtstag da und hat bei seinem siebzigsten vor zwei Jahren die Laudatio gehalten, aber seitdem haben sie sich, glaube ich, nur einmal gesehen. Und ich weiß ganz sicher, dass sie dabei nicht über seine Kandidatur gesprochen haben.
Trotzdem hat sich Angela Merkel heftig gegen Ihren Vater als Kandidaten gewehrt. Tragen Sie ihr und trägt er ihr das nach?
Wir wissen nicht, welche tatsächlichen Gründe sie hatte. Es wird manchmal gesagt, sie sei nicht berechenbar, und so kommt das auch bei mir an. Mein Vater meinte, wenn sie ihn fragt, kann er das nicht ablehnen, denn er hat 2010 unter ungünstigeren Bedingungen ja gesagt. Nur wir alle haben bis zum Schluss nicht damit gerechnet. Er selbst hat immer gesagt: »Ich habe ein wunderbares Leben, bin jeden Tag unterwegs und treffe viele Menschen.« Er war so oft weg, dass wir ihn als Familie schon ermahnt haben, nicht auch noch an Wochenenden irgendwo aufzutreten und sich mal freizunehmen. Seine typische Antwort lautete dann: »Jaja, mach’ ich mal.« Und dann kam der Anruf im Taxi.
Er soll mit dem Satz »Wir ändern die Route, Sie fahren den künftigen Bundespräsidenten« das Taxi zum Kanzleramt gelotst haben.
Ich weiß nicht, ob er das so gesagt hat. Wenn, dann war es sicher nicht seine Eitelkeit, die ihm immer noch vorgehalten wird und die er längst abgelegt hat, sondern das Erlebnis dieses wirklich einmaligen Moments. Dass er dann so etwas sagt, passt zu ihm, da sehe ich ihn vor mir.
Bei der anschließenden Pressekonferenz wirkte er überwältigt.