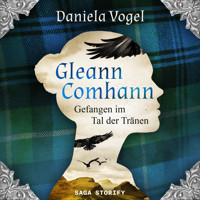3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Simon de Luca, seines Zeichens Manager und Besitzer von Lugano Industries, eines milliardenschweren Unternehmens, hat eine ungewöhnlich Passion: Er ist geradezu besessen von der Geschichte Schottlands. Als sein Freund Benedikt Peters, ein Archäologieprofessor, das intakte Grab einer keltischen Hohepriesterin entdeckt, die noch dazu vollständig erhalten ist, ist er hin und her gerissen. Irgendwie kommt sie ihm bekannt vor, doch noch weiß er nicht, warum. Schließlich aber bringt ihr Anblick ihm seine verlorenen Erinnerungen wieder. Die Erinnerungen an sein längst vergangenes Leben, in Britannien, als dieses noch von den Römern besetzt war und an Caitlin, seiner wahren Liebe, nach der er sich seit Ewigkeiten sehnt. Um sie beide vor einem Schicksal, schlimmer als der Tod, zu retten, muss er sich auf eine Reise in eben diese Zeit begeben, um seinem ärgsten Feind gegenüberzutreten. Denn nur, wenn er dort den Lauf des Dinge ändert, können sie auf ewig zusammen sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Kristallgrotte
Daniela Vogel
Buchbeschreibung:
Simon de Luca, seines Zeichens Manager und Besitzer von Lugano Industries, eines milliardenschweren Unternehmens, hat eine ungewöhnlich Passion: Er ist geradezu besessen von der Geschichte Schottlands. Als sein Freund Benedikt Peters, ein Archäologieprofessor, das intakte Grab einer keltischen Hohepriesterin entdeckt, die noch dazu vollständig erhalten ist, ist er hin und her gerissen. Irgendwie kommt sie ihm bekannt vor, doch noch weiß er nicht, warum. Schließlich aber bringt ihr Anblick ihm seine verlorenen Erinnerungen wieder. Die Erinnerungen an sein längst vergangenes Leben, in Britannien, als dieses noch von den Römern besetzt war und an Caitlin, seiner wahren Liebe, nach der er sich seit Ewigkeiten sehnt. Um sie beide vor einem Schicksal, schlimmer als der Tod, zu retten, muss er sich auf eine Reise in eben diese Zeit begeben, um seinem ärgsten Feind gegenüberzutreten. Denn nur, wenn er dort den Lauf des Dinge ändert, können sie auf ewig zusammen sein.
Über den Autor:
Daniela Vogel, Jahrgang 1967, lebt im Ruhrgebiet, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Bereits seit ihrer Jugend schreibt sie Liedertexte, Kurzgeschichten und Gedichte. Schon früh entwickelte sie ein besonderes Interesse für Geschichte und die meist damit zusammenhängenden Sagen und Legenden. In ihren neuen Erzählungen verbindet sie diese beiden Dinge miteinander und paart sie mit einer Liebesgeschichte.
Sie studierte Mathematik und Informatik und war einige Jahre in einer Computerschule als Dozentin tätig. Erst als ihre Kinder, wie es so schön heißt, aus dem Gröbsten heraus waren, begann sie erneut mit dem Schreiben. Zunächst mit den Texten für ein Kindermusical, das lokal ein Mal aufgeführt wurde. Damals entstand auch ihre Idee für ihren ersten Fantasy Roman, den sie 2015 im Selbstverlag veröffentlicht.
Sie ist begeisterte Hobbyschneiderin für historische Gewandungen, musiziert in einem Gitarrenchor und trainierte jahrelang eine Tanzgruppe.
Bereits erschienen:
Die Kristallgrotte
Die Chroniken Aranadias II - Die Herrin der Seelen
Gleann Comhann - Gefangen im Tal der Tränen
Verloren im Abbild des Kriegers
Schwanenfeder, Ginster & Gold
Im Bann der Melodie des Schicksals
Weitere Information über Daniela Vogel und ihre Bücher finden Sie unter:
www.fantasy-by-daniela-vogel.de
Hinweise zum Urheberrecht
Das gesamte Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Reproduktion, Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder andere Verfahren) sowie die Einspeicherung, Vervielfältigung und Verarbeitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt und auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Autorin untersagt.
Impressum
Texte : © Copyright by Daniela Vogel
Grafik: © Copyright by Jessica Mohring, www.bookster-marketing.de
Verlag: Daniela Vogel
Norstraße 52
47169 Duisburg
Die Kristallgrotte
Daniela Vogel
Prolog
Beißender, fauliger Gestank nahm ihm fast die Luft zum Atmen. Er lag auf modrigem, feuchtem Stroh. Es war so kalt, dass die nach Verwesung und Schimmel riechenden Dämpfe seiner mehr als kargen Bettstatt als weiße Nebelschwaden, die langsam emporstiegen und schließlich im Nirgendwo verpufften, um ihn herum waberten. Sein Magen drehte sich und er musste all seine Beherrschung zusammennehmen, um sich nicht zu übergeben. Er schlang seinen Mantel fester um seinen Körper, dabei richtete er sich auf und sah sich um. Wo war er hier nur wieder herein geraten? Und wo war hier eigentlich? Er konnte sich nicht einmal daran erinnern, überhaupt eingeschlafen zu sein.
Er befand sich in einer Art Grotte, deren Wände von seltsamen Kristallen durchzogen waren. Sie warfen das Licht der wenigen Fackeln, die rings um sein provisorisches Lager postiert waren, in allen Farben des Regenbogens auf sein Gesicht und ließen seine Umgebung merkwürdig durchsichtig erscheinen.
Bei Jupiter! Wo war er? Wie war er hierher gekommen? Obwohl die ungewöhnliche Kulisse, vor der er sich befand, geradezu bizarr wirkte, fühlte er kaum Angst. Doch sein Puls raste und sein Körper zitterte. Verdammt! Wieso suchte Fortuna immer nach ihm, wenn sie Schabernack treiben wollte? Gab es nicht genug andere, die sie hätte narren können? Warum war immer er derjenige, der in derartige Situationen geriet? Dabei hatte er doch nur, … Fortuna schien ihn wirklich zu hassen, … jedenfalls in letzter Zeit. Er zog das Unglück ja geradezu magisch an! Wodurch hatte er nur diesmal ihr Interesse an ihm geweckt und anschließend ihren Zorn auf sich gezogen? Caitlin, schoss es ihm durch den Kopf. Sie war bei ihm gewesen, bevor ... Ja, bevor was eigentlich? Und, wo, bei Jupiter, war sie jetzt?
»Caitlin?«, seine Stimme klang rau und hallte unheimlich in einem nicht endenwollenden Echo von den Wänden. Das war allerdings beängstigend und bei jeder Woge seiner eigenen Stimme zuckte er unwillkürlich zusammen.
»Caitlin? Wenn du hier irgendwo in meiner Nähe bist, dann antworte mir«, versuchte er es noch einmal etwas leiser, nachdem der mörderische Widerhall endlich verebbt war. Doch eine Antwort blieb aus. Resignierend ließ er sich auf sein Lager zurückfallen. Es hatte keinen Sinn! Sie war nicht hier! Er war allein! Allein in einem anscheinend unterirdischen, malerisch schönen Gefängnis, von dem er nicht einmal wusste, wo es lag, auf welche Weise er hineingelangt war und warum er sich überhaupt darin befand.
Ein leises Schlurfen riss ihn aus seinen Gedanken. Er schloss die Augen und lauschte. Das Schlurfen wurde langsam lauter und verstummte schließlich in seiner unmittelbaren Nähe. Die Stille, die daraufhin herrschte, war ihm unerträglich. Letztendlich hielt er es nicht länger aus. Er öffnete seine Augen und sah direkt in das zerfurchte, verwitterte Gesicht des Mannes, der vor geraumer Zeit zu seinem unsichtbaren Schatten geworden war und ihn seitdem unablässig verfolgte und beobachtete. Gwydion! Der Erzdruide und oberste Magier!
»Ihr seid also endlich erwacht! Zu schade! Ich dachte schon, mein kleines Problem hätte sich von selbst erledigt! Doch, wie ich leider feststellen muss, ist dem nicht so!« Die schnarrende, eisige Stimme des Alten fuhr ihm durch Mark und Bein. Gwydion fixierte ihn aus wässrigen, eisblauen Augen, die keinerlei Gefühlsregung erkennen ließen. Er musterte ihn von oben bis unten, während ein diabolisches Grinsen seine ansonsten teilnahmslosen Gesichtszüge zu einer dämonischen Fratze verzerrte. »So lernen wir uns am Ende also doch noch kennen.«
»Als ob wir uns nicht schon längst kennen würden! Schließlich konnte ich keinen Schritt mehr ohne Eure aller Orts gepriesene Anwesenheit tun«, entgegnete er dem Alten, nachdem er seine Sprache wider gefunden hatte.
»Ah, wie ich höre, habt Ihr also meine bescheidene Gegenwart gespürt. Das spricht für Euch. Dennoch, soweit ich mich erinnern kann, hatten wir beide noch nicht das Vergnügen von Angesicht zu Angesicht miteinander zu reden.«
»Ein Umstand, den ich auch weiterhin liebend gern herausgezögert hätte.«
»Junger Mann, Ihr nehmt den Mund reichlich voll für einen in eurer Lage!« Der Blick des Alten wurde noch ein wenig durchdringender, doch er hielt ihm mit aller Macht stand. Dabei richtete er sich vollends auf.
»Was soll das heißen? In meiner Lage? Bin ich euer Gefangener? Doch, wo sind dann die Ketten?«
»Ich würde euch eher einen Gast nennen und Ketten bedarf es nicht.«
»Dann verratet mir eines. Wo ist sie? Wo habt Ihr sie hingebracht? Ist sie auch hier unten? Haltet Ihr sie irgendwo in meiner Nähe versteckt? Ich weiß, dass ich das hier Euch zu verdanken habe, kein anderer hätte die Dreistigkeit, mich hierher zu verschleppen und das vor den Augen der Besatzer. Also leugnet nicht! Es ist mir egal, was mit mir geschieht, aber, bei allen Göttern, sagt mir, was Ihr mit Caitlin gemacht habt!« Während seiner kurzen Rede erstarrten die Gesichtszüge des Alten zu Eis. Langsam kehrte dieser ihm den Rücken zu.
»Ich leugne ja gar nicht! Aber glaubt Ihr wirklich, ich würde Euch ihren Aufenthaltsort verraten, jetzt, da ich es endlich geschafft habe, euch beide zu trennen?« Der hämische Tonfall des Alten trieb ihn zur Weißglut und er musste seine Hände hinter dem Rücken zu Fäusten ballen, um ihm nicht unverzüglich an die faltige Gurgel zu springen. »Wie anmaßend von Euch!«, fuhr dieser unbeirrt fort. »Aber typisch für euer Volk! Ihr haltet euch noch immer für das Maß aller Dinge, obwohl ihr es doch mittlerweile eigentlich besser wissen müsstet.« Gwydion wandte sich ihm erneut zu. Seine Augen blitzten gefährlich auf und schienen blutunterlaufen.
»Wer glaubt Ihr, dass Ihr seid? Ihr fallt wie die Heuschrecken über uns herein. Ihr macht vor nichts und niemandem halt. Weder respektiert ihr unsere Götter, noch akzeptiert ihr unsere Kultur oder toleriert unser Sein. Ihr erobert und mordet und das nur, weil ihr euch für die auserwählte Rasse haltet. Ich muss euch enttäuschen! Dem ist nicht so! Weder seid ihr auserwählt, noch die Rasse, deren Bestimmung es ist, über die Völker dieser Welt zu herrschen. Ihr manövriert euch nur Schritt für Schritt auf euren eigenen Untergang zu. Darin seid ihr nicht die Ersten und ihr werdet auch nicht die Letzten sein. Eines muss ich jedoch zugeben. Anfangs habe ich euch ob eurer Hartnäckigkeit doch wirklich und wahrhaftig geschätzt. Aber, das ist nun endgültig vorbei! Ihr seid zu weit gegangen! Ihr habt uns zwar erobert, oder, wie ihr es zu nennen pflegt, dem Reich angeschlossen, um uns Barbaren zu kultivieren, aber, so einfach machen wir es euch nicht! Ihr könnt unser Land verwüsten, unsere Frauen schänden und uns versklaven, aber eines werdet ihr niemals können, …, ihr könnt uns weder unseren Stolz noch unsere Seele nehmen. Ja, junger Eroberer, damit habt Ihr nicht gerechnet. Es gibt Völker, die sich nicht bereitwillig wie Lämmer zur Schlachtbank führen lassen. Die nicht vor der Standarte des Adlers in den Staub sinken und sich niemals mehr erheben, und wir gehören ihnen an. Dieses Mal habt ihr einen Fehler begangen! Ihr habt uns unterschätzt! Gewaltig unterschätzt! Ihr hättet diese Insel meiden sollen, wie euer Gott Vulcanus das Meer, oder Pluto das Licht.«
»Wieso erzählt Ihr mir das alles? Was habe ich mit all dem zu schaffen? Glaubt Ihr, ich wäre freiwillig hierher, in diese Einöde, in dieses barbarische, unwegsame Land gekommen? Wendet euch mit euren Anklagen an den Kaiser oder an den Statthalter dieser Provinz. Ich bin ein einfacher Soldat. Was schert mich die Politik!«
»So, so, ein einfacher Soldat! Ich würde den Sohn des Gaius Lucius Maximus nicht als einen einfachen Soldaten bezeichnen. Aber, genau das meinte ich! Ihr biegt euch die Wahrheit so zu Recht, wie es euch gerade am günstigsten erscheint. Sagt mir, Sohn des Lucius, habt Ihr ein Gewissen? Oder ist es Euch durch all Eure Lügen und Halbwahrheiten abhandengekommen? Fühlt Ihr die Schreie all derer, die Ihr unter Euer Banner zwingt und die dann ihr letztes Bisschen Leben in der Arena aushauchen, um euch Zerstreuung zu verschaffen? Oder lassen sie Euch kalt? Könnt Ihr noch ruhig schlafen? Oder quälen sie Euch in euren Träumen?« Wieder trafen sich ihre Blicke. Während der Alte ihn eindringlich musterte, kaute er verlegen auf seiner Unterlippe. »Ah, habe ich Euren wunden Punkt getroffen? Sollte da doch so etwas wie ein Herz in Eurer Brust schlagen? Für wahr, Ihr scheint allmählich zu begreifen, welch großer Unterschied darin besteht, von den glorreichen Heldentaten Eurer ruhmreichen Armeen am heimischen Herdfeuer zu hören, oder mitzuerleben, mit wie viel Blut Eure, ach so gepriesenen, Siege erkauft wurden.«
»Ich ...«
»Sagt nichts!«
»Aber, ich wollte nicht ...!«
»Nein! Ihr wollt nie! Aber ihr tut es trotzdem und vergesst darob zu denken! Dies ist unser Land! Wir sind hier seit Anbeginn aller Zeit! Nicht Ihr! Uns wurde dieses Land von den Göttern gegeben, um ihnen zu dienen und sie zu ehren! Nicht Euch! Wir sind diejenigen, die so fest mit dieser, …, wie nanntet ihr sie noch gleich? ... Ach, ja, unwegsame Einöde verwurzelt sind, wie die alten Eichen in unseren Wäldern. Habt Ihr einmal versucht, einen alten Baum zu verpflanzen? Wisst Ihr, was dann mit ihm geschieht? Sicher wisst Ihr das, doch was schert es Euch? Euch kümmert weder die Tatsache, dass Ihr dadurch ein Geschöpf der Götter zerstört, noch die weitreichenden Konsequenzen Eures Tuns. Wer, so frage ich Euch, spendet euch dann Schatten, wenn Ihr erschöpft von der Arbeit ein ruhiges Plätzchen sucht? Wer schützt Euch vor Wind und Regen? Wer gibt den Tieren des Waldes dann ein Obdach? Ja, das alles wollt Ihr nicht bedenken und Ihr tut auch so, als ginge es Euch nicht im Geringsten etwas an. So seid Ihr nun einmal: Elende Ignoranten! Nichts als elende Ignoranten!« Gwydions Stimme wurde bei seinen letzten Worten gefährlich leise.
»Ihr tut mir Unrecht! Ich wollte nicht zerstören. Ich wollte ein Bündnis schaffen, das ...«
»Ein Bündnis? Welcher Art? Besteht in Euren Augen ein Bündnis darin, dass ihr die Hohepriesterin entehrt und versucht sie auf Eure Seite zu ziehen? Muss sie diejenige sein, die Euch und Eurer Sache bedingungslos folgt und alles für Euch aufgibt, oder seid Ihr bereit das Gleiche auch für sie zu tun?« Er schwieg. «Das habe ich mir gedacht! Dennoch hätte ich Euch nicht für so töricht gehalten.«
»Ja, aber ...«
»Aber! Immer aber!« Gwydions Stimme wurde noch eine Spur eisiger. »Ihr habt nicht die geringste Ahnung, auf was und auf wen Ihr Euch eingelassen habt! Habe ich recht?« Wieder schwieg er. «Gut, dann versuche ich es Euch zu erklären. Ihr, ahnungsloser Sohn des Lucius, habt Euch erdreistet, unseren größten Schatz für Euch zu beanspruchen. Caitlin ist seit ihrer Geburt unsere Hohepriesterin. Die Auserwählte! Unser Bindeglied zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und unserer Zukunft. Ihr, törichter, junger Eroberer, habt versucht, sie uns zu nehmen. Gleichsam einer Seele, die den Körper verlässt und ziellos umher irrt. Zurück bleibt nichts als Leere. Ohne sie sind wir nichts! Und ohne uns ist sie verloren! Fast hättet Ihr erreicht, was weder euer Kaiser noch seine ruhmreichen Legionen bewirken konnten, aber, den Göttern sei Dank, ich konnte euch trennen und so das Schlimmste verhindern. Das Schicksalsrad dreht sich endlich wieder in seine vorherbestimmte Richtung. Und nun, Sohn des Lucius, werdet ihr die Früchte eures Tuns ernten! Ihr werdet büßen, wie noch keiner vor euch!«
»Gwydion, ich hatte keine Ahnung ...«
»Nein, das hattet Ihr wohl wirklich nicht, denn sonst ...«
»Gwydion, bitte sagt mir, wo Ihr sie hingebracht habt! Geht es ihr gut? Lebt sie?«
»Was erdreistet Ihr Euch, mich so etwas zu fragen? Sagte ich nicht gerade eben, sie wäre unser größter Schatz!«
»Dann lasst mich sie sehen! Lasst mich noch ein letztes Mal mit ihr reden!« Gwydion hielt inne.
»Habt ihr nicht schon genug angerichtet?«
»Bitte, Gwydion, nur das eine Mal noch! Dann könnt Ihr mit mir machen, was Ihr wollt. Ich werde mich nicht einmal wehren. Aber, ich flehe Euch an, sagt mir wenigstens, was mit ihr geschehen ist.« Der Alte musterte ihn erneut.
»Sie ist endlich ihrer Bestimmung gefolgt.«
»Was soll das heißen?« Er war am Ende seiner Geduld. Gwydion hatte ihn, bei den Göttern, wahrhaftig genug gereizt und beleidigt. Diese Antwort war eindeutig zu viel des Guten. Was hatte er sich denn schon Großes zuschulden kommen lassen? Nichts weiter, als sich in die falsche Frau zu verlieben. Das hämische Grinsen des Alten brachte das Fass zum Überlaufen. Er stürmte auf ihn zu, doch noch, bevor er ihn erreichen konnte, spürte er eine eisige, unsichtbare Hand, die sich um seine Kehle schloss und bedächtig immer fester zudrückte. Er rang verzweifelt nach Luft, doch das Atmen fiel ihm immer schwerer. Kurz bevor er jedoch das Bewusstsein verlor, ließ die Hand von ihm ab und er stürzte fast ohnmächtig zu Boden.
»Wage es nie wieder! Meine Macht reicht aus, dich wie eine Wanze zu zertreten, elendes Menschlein!« Aus Gwydions Stimme war jedwedes Schnarren verschwunden. Sie donnerte ihm entgegen, wie eine tosende Naturgewalt und das Echo der Wände schien sie noch zu verstärken. »Vergiss sie!«
»Das kann ich nicht! Gwydion, bitte, tut mit mir, was immer Ihr wollt, aber gebt sie frei. Sie trifft keine Schuld.« In seiner Verzweiflung, die nach und nach seine Wut verdrängte, fiel er sogar vor dem Alten auf die Knie.
»Sie freigeben? Ich kann sie nicht freigeben. Sie gehört mir nicht! Sie gehört einzig und allein den Göttern und unserem Land. Sie ist unsere Seele, unsere Hoffnung, unser Schutz und unsere Zukunft. Sie wird niemals frei sein.«
»Und, was sagt sie dazu?«
»Sie hat es verstanden und ist ihrer Bestimmung gefolgt.«
»Bei allen Göttern, das sagtet Ihr bereits. Aber, ich verstehe es nicht. Lasst mich mit ihr reden, bitte, ich ...«
»Lass das Wimmern und Winseln. Genug ist genug! Trage es mit Fassung, wie ein Mann! Du wirst sie nie wieder sehen! Niemals! Du wirst vergessen! Vergessen müssen!«
»Ich sie vergessen? Ihr verlangt Unmögliches von mir. Ich werde sie suchen und finden. Ich schwöre euch, ich werde sie mitnehmen. Sie wird vergessen! Vergessen, dass Ihr sie für Eure Zwecke missbrauchen und ihr ein Leben ohne Freude und Glück auferlegen wolltet.«
»Du wirst was? Ha! Du unterschätzt schon wieder meine Macht!« Die Farbe von Gwydions Augen wechselte von eisig blau zu flammend rot. Starr vor Entsetzen, hielt er den Atem an. Das war nicht möglich. Seine Augen spielten ihm wahrscheinlich nur einen Streich. Doch je mehr er den Alten anstarrte, desto offensichtlicher wurde die Tatsache, dass Gwydion sich vor seinen Augen veränderte. Was geschah hier? War er nicht mehr Herr seiner Sinne?
»Ja, mein, ach so eifriger, kleiner Eroberer, jetzt beginnst du, zu begreifen. Doch jetzt ist es zu spät! Zu spät zum davon rennen, oder mir zu trotzen. Du bist mir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Welch erhebendes Gefühl!« Nicht nur Gwydions Augen schienen plötzlich zu glühen. Das unheimliche rote Funkeln breitete sich zunehmend über seinen gesamten Körper aus und hüllte ihn förmlich ein. »... Ach ja, ich vergaß, du wirst nicht einmal in der Lage sein, deinen kleinen Finger zu rühren, wenn ich erst einmal mit dir fertig bin.« Wider spürte er die eisige Hand, die sich um seine Kehle legte, und langsam zudrückte. Gwydions Blick bohrte sich bis tief in seine Seele und er hörte sein diabolisches Lachen, das seinen Schädel beinahe zerspringen ließ.
»Wenn du meinst, dass dies hier das Ende wäre, dann hast du dich getäuscht.« Er japste und versuchte mit aller Gewalt der eisigen Umklammerung zu entkommen. »Ich bin noch lange nicht mit dir fertig. Ich werde dir viel Zeit geben. Viel Zeit zu vergessen. Aber du wirst nicht vergessen und genau das wird dein Untergang sein. Wie lange, glaubst du, dauert die Ewigkeit? Wie groß, meinst du, ist ein Schmerz, der nie vergeht? Oh ja, junger Eroberer, du wirst es bald wissen! Sehr bald sogar! Du wirst lernen durch die Zeit zu irren, ohne dir bewusst zu sein, dass du überhaupt etwas lernst. Du wolltest, was nicht für dich bestimmt war. Du nahmst, ohne zu fragen und es geschah, was niemals hätte geschehen dürfen. Dafür wirst du jetzt büßen. Du wirst das Gefühl haben, etwas verloren zu haben. Du wirst danach suchen, aber du wirst es nicht finden. Glaub mir, du wirst so weit vergessen, dass du noch nicht einmal weißt, was dich so ruhelos macht, selbst, wenn ich es dir auf einem silbernen Tablett servieren würde. Erst am Ende deiner Suche wirst du erkennen, doch dann ...« Gwydion brach in schallendes Gelächter aus. »Das wird meine Rache sein. Mein Fluch!« Er versuchte weiterhin sich aus der eisigen Umklammerung des Alten zu befreien, doch er war mit seinen Kräften am Ende. »Winde dich nur, wie ein Wurm, Menschlein, doch es wird dir nichts nützen. Vor mir gibt es kein Entkommen!« Selbst als er bereits in eine tiefe Bewusstlosigkeit hinüber glitt, hörte er noch von Ferne die Stimme des Alten. Schließlich aber umfing ihn nichts als Schwärze und er ließ sich dankbar hineingleiten.
Kapitel 1
Ein durchdringendes, monotones Fiepen riss ihn aus dem Tiefschlaf. Er fluchte laut, während sich seine Augen in der Dunkelheit auf die hellgrün erleuchteten Ziffern seines Digitalweckers richteten und er verzweifelt versuchte in dem leuchtenden Mischmasch etwas Sinnvolles zu erkennen. Verdammt! Halb drei Uhr nachts! Das bedeutete, dass er noch nicht einmal zwei Stunden geschlafen hatte. Das war eindeutig zu wenig. Dass er momentan nicht ganz bei der Sache war und sich Fehler leistete, die ihm unter normalen Umständen niemals unterlaufen wären, war ihm schon vor Tagen aufgefallen. Wie er aber, in drei Teufel Namen, auf die hirnrissige Idee gekommen war, den Wecker auf diese nachtschlafende Zeit zu stellen, war ihm dennoch ein Rätsel. So dämlich konnte selbst er nicht sein. Und schon gar nicht, wenn der nächste Tag mit allen möglichen Terminen nur so vollgestopft war. Er drückte im Halbschlaf auf sämtliche Knöpfe und atmete erleichtert auf, als das Fiepen endlich verstummte. Dann ließ er sich zurück in die Kissen fallen und war wenig später auch schon wieder eingeschlafen.
Kaum eine viertel Stunde später riss ihn erneut ein lautes Piepsen aus dem Schlaf. Er wollte schon nach dem Wecker greifen, um ihn mit aller Gewalt gegen die Wand zu schleudern, als er begriff, dass es nicht der Wecker war, der ihn zum wiederholten Male aus dem Schlaf riss, sondern das Telefon. Er richtete sich langsam auf, griff mit einer Hand nach dem Apparat neben seinem Bett, während er mit der anderen nach dem Lichtschalter suchte und dabei die Nacht insgeheim zum Teufel schickte.
»Ja!«
»Simon? Bist du das?« Die Stimme am anderen Ende klang aufgeregt.
»Wer sonst? Benedikt? ... Bist du von allen guten Geistern verlassen? Weißt du, wie spät es hier ist? Viertel vor drei! Nachts! Wenn ich es noch einmal betonen darf. Ich schwöre dir, wenn du mir nichts Wichtiges zu sagen hast, dann dreh ich dir deinen dürren Hals um.« Sein rüder Ton ließ die Stimme am anderen Ende der Leitung abrupt verstummen.
»Gütiger Himmel, Junge«, kam nach einer Weile zögernd eine Antwort. »Ich habe im Eifer des Gefechts doch tatsächlich nicht an die Zeitverschiebung gedacht. Aber, du wolltest ja, dass ich mich sofort bei dir melde, wenn wir etwas finden.«
»Ja, sicher! Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass du es gleich so wörtlich nimmst.« Das hätte er sehr wohl, wenn er ehrlich mit sich selbst gewesen wäre, denn am anderen Ende der Leitung befand sich niemand anderes als Professor Benedikt Peters, berühmter Archäologe und sein bester Freund, wenn er überhaupt jemanden als solchen bezeichnen wollte. Sie hatten sich vor Jahren auf einem Symposium über keltische Geschichte kennengelernt, bei dem der Professor mit seinen verrückten Thesen nicht gerade Begeisterungsstürme unter seinen Kollegen auslöste. Er jedoch war von dem gerade einmal 1,60 m großen, spindeldürren Mann mit der riesigen Hornbrille, die ihm das Aussehen der Stubenfliege Puck aus der Zeichentrickserie „Biene Maya“ verlieh, geradezu fasziniert gewesen. Die Vehemenz, mit der dieser kleine Mann seine Meinung gegen alle anderen verteidigte und seine nahezu unerschöpfliche Energie hatten ihn davon überzeugt, dass eben dieser Mann genau der Richtige wäre, um ihn bei seiner ganz persönlichen Passion zu unterstützen. Ein äußerst kostspieliges Privatvergnügen, aber er konnte es sich ja leisten. So bestand nun schon seit einigen Jahren ein überaus gewinnbringendes Verhältnis zwischen ihnen beiden, das sowohl ihm als auch dem Professor bisher nichts als Vorteile verschafft hatte. Dass daraus eine so tiefe Freundschaft entstehen könnte, damit hätte er im Traum nicht gerechnet, aber auch das hatte sich für beide Seiten nur als positiv herausgestellt. Gut, wenn Benedikt mit Ausgrabungen beschäftigt war, dann vergaß er Zeit und Raum, aber das war ein Übel, das er nur allzu gerne in Kauf nahm, denn die Ergebnisse sprachen jedes Mal für sich. Heute war eben er derjenige, der diese Schrulle seines Freundes ausbaden musste, doch, so dachte er sich, was soll’s! Es gab weitaus Schlimmeres.
Er rieb sich den Schlaf aus den Augen und griff instinktiv nach der Flasche sündhaft teuren, schottischen Whiskey, die halb voll, vom Vorabend übrig geblieben, auf seinem Nachtisch neben dem Wecker stand. Kein Wunder, dass er das vermaledeite Ding falsch gestellt hatte. Erst die Feier in seiner Firma und dann auch noch seine private mit sich selbst, das hätte vermutlich sogar einen Bären aus dem Konzept gebracht.
»Scheiße!« entfuhr es ihm, während er die Flasche an seine Lippen setzte und den Inhalt gierig trank.
»Hörst du mir überhaupt zu? Simon? Was ist nur los mit dir?« Er brummte etwas in den Hörer, was die andere Seite mit einem tiefen Seufzer quittierte.
»Schmeckt dir der Whiskey?« Simon de Luca, der gerade den letzten Rest seines Whiskeys verschluckte, prustete los und starrte entgeistert in den Hörer.
»Woher, in drei Teufel Namen, weißt du ...?«
»Weil ich dich mittlerweile viel zu gut kenne. Du bringst dich mit dem Zeug noch einmal selbst um, mein Freund. Hör auf einen alten Mann. Mach nicht den gleichen Fehler. Das Zeug vernebelt nur deine Sinne. Es erlöst dich nicht von deinen Problemen. Du brauchst einen klaren Kopf, wenn du deine Aufgabe erledigen willst! Und außerdem habe ich keine Lust, meinen besten Freund und Mäzen auf diese Weise zu verlieren. Reiß dich gefälligst zusammen!«
»Ach, Benedikt! Werde doch nicht gleich immer so melodramatisch! Du hast ja keine Ahnung, was hier los ist. Hinter mir liegt eine Scheißwoche und diese Nacht setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Ich werde mich schon nicht umbringen!« Jedenfalls nicht auf diese Weise fügte er in Gedanken hinzu.
»Das will ich dir aber auch geraten haben!« Es entstand eine Pause.
»So, nachdem du mir nun den Kopf gehörig gewaschen und mich aus meinen Träumen, wenn auch Albträumen, gerissen hast und an Schlaf sowieso nicht mehr zu denken ist, würdest du jetzt bitte so freundlich sein, zum eigentlichen Grund deines Anrufs zu kommen. Du weißt, ich plaudere gerne mit dir, aber du hast mich bestimmt nicht angerufen, nur um mit mir Small Talk zu treiben. Also, schieß schon los. Was ist passiert?« Kaum waren seine Worte verklungen, da bemerkte er auch schon, wie eine innere Unruhe von ihm Besitz ergriff. Er griff erneut nach der Whiskey Flasche, ließ sie aber sofort wieder sinken, als er feststellte, dass er sie bereits geleert hatte. Außerdem hatte Benedikt recht. Ein noch größerer Brummschädel wäre keinesfalls förderlich für seine morgigen Verhandlungen.
»Sitzt du?«, tönte es in diesem Moment vom anderen Ende.
»Wieso?«
«Simon, du hattest recht!«
»Womit hatte ich recht?«
»Mensch, Junge, wir haben ein Grab gefunden. Hier in dieser gottverlassenen Gegend! Vollkommen intakt! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es keltischen oder piktischen Ursprungs ist. Etwas daran ist merkwürdig. Aber, auf jeden Fall ist es eine Sensation! Die Reporter werden uns in Scharen belagern, wenn sie erst einmal Wind von der Sache bekommen. Was hältst du davon, dich auf den Weg zu machen, um dabei zu sein? Ich möchte dich bei mir haben, wenn wir es näher untersuchen. Simon, du weißt, ich bin nicht gerade der euphorische Typ ...«, er musste unwillkürlich Grinsen, denn Professor Peters war die Euphorie in Person. »..., aber«, fuhr dieser unbeirrt fort, »ich sage dir, so etwas hast du noch nie gesehen! Ich kann mir gut vorstellen, welchen Wirbel alle darum machen werden. Herr Gott noch mal, Simon, ich fühle mich wie Carter bei der Entdeckung von Tut Anch Ammons Grab.« Simon de Luca starrte ungläubig auf den Hörer in seiner Hand. Wenn nur die Hälfte von dem stimmte, was Benedikt ...
»Du sagst ja gar nichts, Junge!«
»Ihr habt wirklich etwas gefunden?«
»Nicht nur etwas, mein Junge! Etwas ganz Großes! Etwas Einmaliges! Etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat und das genau an der von dir beschriebenen Stelle. Es ist einfach unfassbar!«
»Wirklich?«
»Junge, du hörst dich an, als könntest du es selbst nicht fassen. Wer hat mir denn die ganze Zeit in den Ohren gelegen und das mit einer Überzeugungskraft, die selbst den ungläubigen Thomas nicht weiter hätte zweifeln lassen? Und nun ist der Erfolg dein Werk! Du hattest recht! Gegen jede Vernunft hattest du recht! Es existiert und ich glaube, wir haben es gefunden.«
Simons Knie wurden weich. Seine Hand, die den Telefonhörer dermaßen umklammerte, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten, zitterte mit einem Mal und seine Kehle wurde staubtrocken. Er hievte seine Beine ungelenk aus dem Bett, kam wackelig auf seinen Füßen zum Stehen und zwang sich dabei ruhig ein und aus zu atmen, um seinen Pulsschlag wieder auf ein normales Maß zu senken.
»He, Junge, hast du nicht gehört, was ich dir eben gesagt habe? Ich sagte ...«
»Verdammt, ich habe es gehört!«, seine Stimme klang so belegt, dass er sich selbst kaum verstehen konnte. Er schluckte ein paar Mal, hustete, dann fuhr er fort. «Ich kann es nicht fassen! Benedikt, dass ist ...«
»Dann beweg dein knackiges Hinterteil endlich in Richtung Flughafen und überzeuge dich selbst davon.«
»Du hast gut reden! Für dich ist es dein Beruf, für mich hingegen ein Hobby. Ich glaube, mein Aufsichtsrat wäre nicht gerade begeistert, wenn ich die Sitzung morgen aufgrund irgendwelcher persönlichen Belange einfach so platzen ließe. Wir stehen gerade vor einem richtig fetten Deal und da kann ich hier nicht so einfach verschwinden.«
»Du meinst, du steckst in einem richtig fetten Deal und traust keinem deiner Leute zu, ihn nach deiner Vorstellung abzuschließen. Du bist unverbesserlich! Wie lange, glaubst du, wird es noch dauern?«
»Ich hoffe, dass ich Ende nächster Woche alles unter Dach und Fach habe. Danach stehe ich dir voll und ganz zur Verfügung. … Eine Frage hätte ich jedoch noch. Was ist eigentlich so ungewöhnlich an unserem Fund?« Er konnte das Grinsen seines Freundes am anderen Ende der Leitung geradezu hören.
»Das, mein Lieber, wirst du schon selbst herausfinden müssen.«
»Das ist nicht fair! Schließlich bezahle ich dafür!«
»Das Leben ist nie fair!«
»OK, .... OK! Ich lass dir deinen Spaß, aber wehe dir, wenn es mich nicht vollkommen aus den Socken haut ...!«
»Das wird es!«
»Gut zu wissen! ... Ich melde mich dann bei dir, wenn ich den Flug gebucht habe. Sag mal, muss ich mir einen Mietwagen nehmen, oder kannst du einen deiner Leute entbehren, damit er mich abholen kommt?«
»Sicher kann ich das. Wie du schon bemerktest, zahlst du ja auch schließlich dafür ... Ach und noch etwas! Lass dich von deinen Firmenfuzzies nicht fertigmachen. Denk an deine Gesundheit!«
»Das tue ich doch immer, mein Freund. Also dann bis später!«
»Bis später! Wir sehen uns!« Das Knacken am anderen Ende der Leitung zeigte ihm, dass Benedikt aufgelegt hatte. Er starrte noch lange auf den stummen Hörer, dann ließ er ihn geistesabwesend auf sein Bett fallen.
Simon de Luca, seines Zeichens Chef von Lucano Industries, einige Milliarden Dollar schwer und sonst kaum aus der Fassung zu bringen, rang nach Luft und ließ sich auf die Bettkante fallen. Seine große, breitschultrige Gestalt, die eher der eines gut trainierten Athleten, denn eines Managers glich, mit dem dunkelbraunen, schulterlangen Haar und den faszinierenden, wasserblauen Augen, die ihm vor nicht allzu langer Zeit den Titel „Sexiest Manager alive“ bei der Boulevardpresse eingebracht hatte, sackte auf der Bettkante zusammen und schlug die Hände vor sein Gesicht.
»Oh, mein Gott!«, flüsterte er vor sich hin. Er befand sich in einem Stadium zwischen Melancholie und Aufregung und er wusste auch nur zu gut, warum er gerade auf diese Weise auf den Anruf seines Freundes reagierte.
»Wenn es doch nur wahr wäre! Wenn Benedikt doch nur recht hätte!« War er seinem Ziel wirklich so nah? Ein letzter Funke Hoffnung, den er bereits in der hintersten Ecke seines Selbst vergraben hatte, keimte langsam in ihm auf. Er fingerte geistesabwesend nach seiner seidenen Bettdecke, erhob sich zögernd und wickelte sich dabei, in seiner betont lässigen Art, die kühle Stoffbahn um seine bloßen Hüften. Dann trat er vor die Balkontür und öffnete sie. Ein eisiger Windzug erfasste ihn und ließ seine Haare wie eine seidige Fahne nach hinten wehen.
Zu seinen Füßen lag Manhattan. Ein winterliches Manhattan, denn, so kurz vor Weihnachten, lag es unter einer dichten Schneedecke, aus der die Wolkenkratzer wie gepuderte Riesen hervorragten. Er sog die kalte Winterluft tief in seine Lungen, dabei starrte er von seinem Penthouse auf die menschenleeren, verschneiten Straßen. Die Lichter des riesigen Baumes vor dem Rockefeller Center waren selbst von hier oben aus noch gut zu erkennen. Alles wirkte so friedlich. Friede! Welch schönes Wort! Aber eben nur ein Wort, nicht mehr! Er beobachtete eine Kehrmaschine, die den Platz um die Tanne vom Schnee befreite, während eine zweite über die künstlich angelegte Eisfläche fuhr, um sie für den nächsten Tag wieder befahrbar zu machen. Weihnachten! Hatte es jemals Bedeutung für ihn gehabt? Er konnte sich nicht daran erinnern, auch nur einen Gedanken daran verschwendet zu haben. Wieso dann gerade jetzt? Vielleicht, weil du alt wirst!, beantwortete er sich selbst die Frage. Seine Belegschaft hätte vermutlich gelacht, denn äußerlich wirkte er noch immer, wie ein Mitte-zwanzig-Jähriger. Er aber wusste es besser. Die alljährlichen Feiern in seiner Firma, anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes, waren für ihn zu einer permanenten Herausforderung geworden. So auch gestern! Er verstand die Hochstimmung, die dieses Fest jedes Jahr bei seiner Belegschaft hervorrief, ohne sie jedoch teilen zu können. Denn, im Gegensatz zu einem Großteil seiner Mitarbeiter, die im Anschluss an die Firmenfeier die Festtage im Kreis ihrer Freunde und Familien verbrachten, wartete auf ihn nur die Einsamkeit und Leere seines viel zu teuren, eigens für ihn designten Penthouses, das ihm im Grunde genommen nur dazu diente, sich selbst vor der restlichen Welt abzuschotten. Ein Zufluchtsort, den neben ihm nur seine Haushälterin Mathilda betreten durfte. Er warf seinen Blick zurück in den nun hell erleuchteten Raum. Die marmornen Statuen von Jupiter, Juno, Diana und Apoll schienen ihn demonstrativ anzugrinsen. Ja, sie alle hatten ihn verlassen und das schon vor so langer Zeit. Sie traf genauso viel Schuld an seiner Einsamkeit, wie ihn selbst. Und dadurch, dass er jeden Tag mit ihren kalten, leblosen Statuen verbrachte, wollte er sich selbst beweisen, dass er in der Lage war, ihnen zu trotzen und sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Er hatte sich geirrt. Das war ihm heute Nacht klar geworden. Er würde niemals in der Lage sein, dem Schicksal zu trotzen. Was also war ihm noch geblieben? Nur sein Stolz und den würde er sich von keinem nehmen lassen. Nicht einmal von diesen eiskalten, marmornen Geschöpfen. Er seufzte, dabei wanderte sein Blick auf die Spitze des „Empire State Buildings“. Noch immer übte das alte Gebäude eine große Faszination auf ihn aus, denn es übertraf all die anderen Gebäude bei Weitem an Schönheit.
»Was sagst du dazu, mein Freund?« richtete er sein Wort an das alte Gebäude. »Liegt es an Weihnachten oder an Benedikts Anruf, dass ich hier stehe, wie ein kompletter Narr und auf die leeren Straßen starre?« Weihnachten! Das Fest des Erlösers! Erlösung, das Wort, das zwar in seinem Wortschatz existierte, von dem er aber weder die wirkliche Bedeutung kannte, noch eine Ahnung hatte, wie sie sich anfühlen würde. Konnte man überhaupt an dessen Existenz glauben? Das Telefonat eben hatte ihn bis auf die Grundmauern erschüttert. Er war all die Jahre einem Hirngespinst nachgejagt, so hatte er wenigstens geglaubt. Und nun war dieses Hirngespinst zum Leben erwacht und er, töricht, wie er war, klammerte sich an den kleinen Funken Hoffnung, der tief in seinem Innern zu glimmen begonnen hatte. Verdammt! Nicht schon wieder! Er war schon zu oft enttäuscht worden. Viel zu oft! Er wollte sich nicht mehr in jene Euphorie steigern, die nur dazu führte, letztendlich in ein noch viel tieferes und schwärzeres Loch zu fallen. Diesmal könnte er sich nicht noch einmal daraus befreien, so viel war sicher. Diesmal wäre es sein Untergang! Doch, was nutze es, dass sein Verstand sich verzweifelt zu wehren begann, während sein verräterisches Herz der Hoffnung bereits Tür und Tor geöffnet hatte? Konnte er sie zulassen? Wollte er sie zulassen? War es möglich, dass ...? Gab es für ihn tatsächlich eine Zukunft ohne Einsamkeit und Leere? Konnte er nach all den Jahren wirklich erlöst werden? Fragen, die er sich nicht beantworten konnte, die er aber nur zu gerne beantwortet hätte und die er sich beantworten musste, bevor es zu spät war.
Dieses Grab war seine erste Spur! Die Spur seiner Träume, die ihm endlich die Stelle gezeigt hatte, an der er suchen musste. Nach all den Jahren der Verzweiflung. Eine Spur zu seiner Bestimmung, seiner Zukunft, zum Leben allgemein. Das war so sicher, wie das „Amen“ in den Kirchen. Ja, er wollte endlich mit dem Leben beginnen und nicht nur so dahinvegetieren. Dieses Grab war seine Chance, endlich den Weg zu finden. Sein rettender Anker, ein Strohhalm, an den er sich klammern wollte, und wäre es auch sein Ende. Was, so fragte er sich, hatte er denn schon Großartiges zu verlieren? Reichtum? Macht? Dinge, auf die er liebend gerne verzichten würde. Und wenn dieser Weg wieder eine Sackgasse sein sollte, dann gab es immer noch die Möglichkeit, sich ... Nein, er musste einfach die Hoffnung zulassen, das war er sich nach all den Jahren einfach schuldig.
Kapitel 2
Die darauffolgenden Tage waren die schlimmsten seines Lebens, wenn man einmal davon absah, dass in seinen Augen sein bisheriges Dasein kaum eine Steigerung zuließ. Die Verhandlungen, die er schon für abgeschlossen gehalten hatte, zogen sich wie Kaugummi in die Länge. Doch, Gott sei Dank, rückten die Weihnachtsfeiertage unaufhaltsam näher, sodass seine Verhandlungspartner schließlich doch noch einlenkten. Zusätzlich hatte ihm sein Aufsichtsrat, der ebenfalls mit einem schnellen Abschluss gerechnet hatte und dem Dollarzeichen schon in den Augen gestanden hatte, die Hölle heißgemacht. Er hatte sich von diesen geldgierigen Schwachköpfen doch tatsächlich anhören müssen, er hätte nicht mehr den nötigen Biss, ein Projekt dieser Größenordnung zu aller Zufriedenheit durchzuziehen. Er und nicht den nötigen Biss? Was bildeten sich diese hirnlosen Affen eigentlich ein? Wer hatte denn aus der einstmals maroden Firma das gemacht, was sie heute war? Und wer finanzierte jedes noch so aussichtslose und schwachsinnige Projekt, nur um sie bei Laune zu halten? Dankbar hätten sie sein sollen, doch Geld verdarb nun einmal den Charakter.
Wenn er geglaubt hatte, dass damit sein Soll an Unannehmlichkeiten für diese Woche erfüllt gewesen wäre, dann hatte er sich jedoch gewaltig getäuscht. Denn, zu allem Überfluss war dann auch noch diese penetrante Presseziege, Valeria Bishop, vom „Morning Star“ bei ihm aufgekreuzt. Sie hatte mit ihren Hüften gewackelt, mit ihren Augen geklimpert und sich dann, wie ein Bluthund an seine Fersen geheftet, nur um exklusiv über die Verhandlungen berichten zu können. Das hatte sie ihm jedenfalls gesagt! Er aber war der Ansicht, dass diese junge Dame weitaus mehr im Sinn gehabt hatte, als seine schnöden Geschäfte. Ihre Artikel waren äußerst informativ gewesen. Nicht in Bezug auf seine Verhandlungen, sondern auf sein Privatleben. Sie hatte jedwede Information, die sie über seine Person erhaschen konnte, an die Öffentlichkeit gezerrt und ihn wie eine kostbare Rarität der Weiblichkeit dargeboten mit dem Ergebnis, dass er wie ein Rockstar von dem schönen Geschlecht überall, wo er auftauchte, nur so belagert wurde. Als wenn es in dieser verdammt großen Stadt nicht genug andere, interessantere Leute geben würde, die sich nur darum rissen, jeden Morgen neue, Seiten füllende Artikel über sich selbst in den Auslagen der Zeitungskioske bewundern zu können. Zu seinem Glück hatte sie aber irgendwann im Laufe der Woche ihr Interesse an ihm verloren. Wahrscheinlich musste sich jetzt ein, aus ihrer Sicht, reizvolleres Opfer, mit ihr herumschlagen. Fortuna sei Dank!
Als sich dann auch noch seine anderen Probleme weitestgehend in Luft aufgelöst hatten, hatte er endlich wieder frei atmen und sich den wirklich wichtigen Dingen in seinem Leben zuwenden können, wie zum Beispiel seinem Besuch bei Benedikt.
Jetzt saß er, zwar einige Tage später als ursprünglich geplant, aber dennoch weitgehend gut gelaunt, in einem äußerst komfortablen Flieger nach Glasgow.
Nach einem turbulenten Start lag New York momentan direkt unter ihm. Die dicke Wolkendecke, die sich, wie eine weißgrau schimmernde Berglandschaft unter der Maschine auftürmte, zeugte von dem heftigen Schneetreiben, das dort unten noch immer herrschte. Es grenzte schon beinahe an ein Wunder, dass man ihnen bei diesem Sauwetter überhaupt die Starterlaubnis erteilt hatte, wenn auch nur zögernd und mit Verspätung. Er hatte schon fast damit gerechnet, dass Fortuna wieder einmal seine Pläne durchkreuzen würde und er unverrichteter Dinge in sein Penthouse zurückkehren müsste, als die Verantwortlichen doch noch ihr OK gaben. Vermutlich lag es an den bevorstehenden Weihnachtstagen. Tausende von wartenden Fluggästen in einem kalten, total überfüllten Flughafen, keine gute Publicity! Welch weise Entscheidung sie doch getroffen hatten. Der Geburt des Erlösers sei Dank!, schoss es ihm durch den Kopf, dabei lehnte er sich relaxed in seinem geräumigen erste Klasse-Sitz zurück.
Eine blond gelockte Stewardess oder Flugbegleiterin, wie sie sich seit geraumer Zeit nannten, sah jedoch in dieser einfachen Geste eine Aufforderung, sich ihm zügig zu nähern. Dementsprechend steuerte sie nun mit kreisenden Hüften geradewegs auf ihn zu.
»Mister de Luca? Ist bei Ihnen alles in Ordnung?« Er starrte sie verwirrt an. Während sie sich tiefer zu ihm hinunter beugte, als es notwendig gewesen wäre. Dabei wippte das Schiffchen, das keck auf ihren dichten Locken thronte, aufreizend hin und her. »Darf ich Ihnen noch etwas bringen?« Ihre veilchenblauen Augen fixierten seine, solange bis er verstohlen zur Seite blickte, während sie ihn verzückt anlächelte,
»Nein, danke!«, erwiderte er deshalb schnell. »Ich habe alles, was ich brauche!« Jedenfalls alles, was du mir geben könntest, fügte er in Gedanken hinzu.
»Sind Sie sicher?«, wieder lächelte sie vielsagend. »Soll ich Ihnen nicht doch noch etwas bringen? Ein Glas Champagner oder ein Journal?« Sie war hartnäckig, das musste er ihr lassen. Hartnäckiger als die meisten anderen. Ihr Oberkörper streifte scheinbar zufällig sein Gesicht, während sie die Jalousie vor das Fenster zu seiner Linken zog und damit die Sonnenstrahlen, die die dichte Wolkendecke mittlerweile in ein weißes Wattemeer verwandelt hatten, nach außen verbannte. Verdammt! Warum musste sie das jetzt tun? Und dabei dieser Duft! Veilchen! Wie ihre Augen! Er stöhnte leise, gleichzeitig drückte er sich tiefer in seinen Sitz. Es war ja nicht so, dass er sich seiner Wirkung auf das andere Geschlecht nicht bewusst gewesen wäre, doch, mussten sie es immer gleich übertreiben? Nicht einmal hier oben, hoch über den Wolken hatte er seine Ruhe vor ihnen. Er fluchte leise, dann schloss er seine Augen. Er war dem schönen Geschlecht nicht abgeneigt. Das war nicht sein Problem! Aber in seiner momentanen Verfassung konnte er einfach keine Frau an seiner Seite gebrauchen. Er kam ja kaum mit sich selbst klar, geschweige denn in einer Beziehung. Doch seit, dank Miss Bishop, sein Konterfei sämtliche Titelseiten der Gazette schmückte, galt er nun einmal als einer der gefragtesten Junggesellen diesseits und jenseits des Atlantiks. Dementsprechend war es für ihn auch immer schwerer geworden, all den blond gelockten, brünetten oder rothaarigen Schönheiten, die sich, alle samt, nur ein Ziel gesetzt hatten, ihn in den Hafen der Ehe zu locken, aus dem Weg zu gehen. Und außerdem wollte er nur eine Bestimmte. Er war sich nicht sicher, ob er sie überhaupt jemals finden würde und dabei suchte er sie schon so lange. Doch, wenn es endlich so weit sein würde, dann, so viel stand für ihn fest, wüsste er auch sofort, dass sie es wäre. Und diese hier war es definitiv nicht!
Für den Rest des Fluges beschloss er deshalb zu schlafen, oder wenigstens so zu tun, denn das Risiko, dass eine der weiteren vier Flugbegleiterinnen der ersten Klasse genauso viel Aufhebens um seine Person machen würde wie die Erste war ihm definitiv zu groß. Es dauerte eine Weile, doch schließlich döste er ein.
Er befand sich in einem unwegsamen Waldgelände und hatte das Gefühl bereits seit Stunden einfach nur herumzuirren. Jetzt lag vor ihm eine Lichtung, die bis hinunter an die Ufer eines Sees reichte. Zu seinem Erstaunen konnte er jedoch keinerlei Bewegung auf der Oberfläche des Gewässers erkennen. Einzig und alleine die bleiche Scheibe des Mondes schien wie ein leuchtend weißer Ball in seiner schwarzen Tiefe zu versinken. Ein Käuzchen schrie und von Weitem hörte er das Heulen der Wölfe, die mit ihrem Gesang Luna lobpreisten, so als wollten sie sie zu sich auf die Erde rufen. Er lauschte halbherzig ihrem Gesang, während seine Gedanken weit in die Ferne schweiften. Dabei verfluchte er im Stillen sich und seine Situation. Warum hatte Hadrian ihn auch gerade hierher in dieses barbarische Land abkommandieren müssen? Der Ruf des Käuzchens schien ihn zu verspotten. Wollten ihm jetzt etwa sogar schon die Tiere sein Unvermögen vor Augen führen?
»Ja, spotte nur! Ich habe es nicht besser verdient! Ich war ein solcher Narr!« Wie, um seinen Worten beizupflichten, schrie das Käuzchen ein weiteres Mal. Ein eisiger Windhauch fuhr ihm durch sein schulterlanges Haar und er fröstelte, obwohl der See noch immer völlig reglos da lag und auch die Baumkronen keinerlei Anzeichen von einer derartigen Luftbewegung erkennen ließen. Er schlang seinen Umhang enger um seine Schultern und hob drohend seine Faust gen Himmel.
»Fortuna! Ist das hier wieder dein Werk? Benutzt du mich schon wieder als Spielball deines Treibens? Ich muss zugeben, diesmal hast du wirklich ganze Arbeit geleistet!«, murmelte er vor sich hin, während er sich auf einem alten knorrigen Baumstumpf niederließ und dabei sein Gesicht in seinen Händen vergrub. Eine Weile saß er einfach nur schweigend da. Das Gezeter der Tiere wurde lauter und es schien ihm, als wollten sie ihn mit ihrer endlosen Litanei völlig aus der Fassung bringen, als plötzlich ein leises Knacken seine Aufmerksamkeit erregte. Er hob seinen Kopf und spähte in die Richtung, aus der es kam. Doch nichts geschah! Ein Reh!, schoss es ihm durch den Kopf. Vermutlich hatte er bloß ein Reh aufgeschreckt. Er sah sich noch einmal um, konnte aber auch weiterhin nichts erkennen. Wieder ließ er seinen Kopf sinken, um sich erneut seiner Trübsinnigkeit hinzugeben, als ein weiteres Knacken ertönte. Diesmal ein wenig lauter. Irgendetwas oder Irgendjemand näherte sich ihm, so viel stand fest. Er erhob sich leise von dem Baumstumpf und drängte sich instinktiv zurück in die Büsche. Dann schob er sich tiefer in das Unterholz, immer darauf bedacht so wenig Geräusche wie nur irgend möglich zu machen, bis das dichte Blattwerk ihn vollends verschluckte. Was erwartete ihn? Ein wildes Tier, oder hatte er vielleicht ungewollt einen geheimen Versammlungsort der Barbaren gefunden? Hatte er sich, wie immer, aus purem Leichtsinn in Gefahr gebracht? Konnte es überhaupt noch schlimmer kommen? Er wartete, innerlich angespannt und zu allem bereit. Doch, was er nun zu Gesicht bekam, war alles andere nur nicht barbarisch. Es raubte ihm schier den Atem, ließ sein Herz bis zu seinem Hals schlagen und sein Blut pulsierte durch seine Adern wie die tosenden Fluten des Tibers.
Offensichtlich hatten die Wölfe mit ihrem Geheul Erfolg gehabt, denn auf der Lichtung erschien eine Göttin. Luna selbst, eingehüllt in das weiße Licht ihres himmlischen Abbildes. Nur wenige handbreit vor ihm hielt sie inne und drehte ihm den Rücken zu. Ihr weißes, wallendes Gewand, dem das weiche, silberne Licht des Mondes einen nahezu überirdischen Glanz verlieh, reichte in sanften Wellen bis hinunter auf ihre Füße. Es war ein Bild, wie aus seinen kühnsten Träumen, nur dass er diesmal anscheinend nicht träumte.
Sie schritt nun langsam auf das Ufer des Sees zu, während sie scheinbar zufällig ihr Gewand anmutig von ihren Schultern gleiten und es achtlos auf den Boden fallen ließ. Er vergaß zu atmen und starrte nur noch auf die grazile Gestalt vor seinen Augen. Bei Jupiter, Juno und allen ihm bekannten Göttern, so etwas hatte er noch nie zuvor gesehen. Ihr seidiges, dunkles Haar fiel bis hinunter zu ihren Schenkeln, so dass es viel mehr von ihr verdeckte, als ihm lieb war. Und, was noch schlimmer war, da sie ihm auch weiterhin ihren Rücken zudrehte, konnte er ihr Gesicht nicht erkennen, aber er war sich dennoch sicher, dass es von demselben überirdischen Glanz sein musste, wie auch der Rest von ihr. Sie war die menschgewordene Venus, auf die Erde gekommen, nur um ihn in ihren Bann zu ziehen.
Die junge Frau hob nun ihre Arme gen Himmel und richtete ihren Blick auf Lunas runde Scheibe, dabei verfiel sie in eine Art Singsang. Augenblicklich verstummte das Heulen der Wölfe und selbst die Schreie des Käuzchens verebbten. Einzig und allein ihre liebliche, glasklare Stimme hallte, wie der Gesang einer Sirene durch die nun ansonsten totenstille Nacht.
»Jupiter«, flüsterte er leise vor sich hin, »sag mir, dass ich träume. Das hier kann nur ein Traum sein!« Er wusste nicht, wie er reagieren sollte. Im Grunde genommen wusste er gar nichts mehr. Zunächst beobachtete er sie nur weiterhin fasziniert aus seinem Versteck heraus. Dann aber bewegte er sich so leise, wie es ihm nur irgend möglich war auf sie zu. Es geschah vollkommen unbewusst, fast so als steuerte ihn eine unsichtbare Macht. Erst als er direkt hinter ihr stand, realisierte er, was er getan hatte. Doch zurück konnte er nicht. Nicht jetzt, wo er ihr schon so nah war! Instinktiv streckte er seine Hand nach ihr aus, zog sie aber sofort zurück, als er merkte, was er im Begriff war zu tun. Er wusste, dass er gerade dabei war, die größte Dummheit seines Lebens zu begehen, aber, wie, bei allen Göttern, hätte er es verhindern können, wenn sein Verstand sich bereits bei ihrem ersten Anblick verabschiedet hatte? Er sah seine Hand, die nun zaghaft eine lange Strähne ihres Haares berührte und fluchte im Stillen. Verdammt! Es fühlte sich genauso seidig an, wie es aussah. Er wollte sein Gesicht in dieser Fülle vergraben, doch irgendetwas hielt ihn zurück, obwohl sie von all dem nichts zu bemerken schien. Noch einmal zögerte er kurz, dann aber, durch ihre scheinbare Ahnungslosigkeit angespornt, streifte er mit seinen Fingern ihren Arm und legte vorsichtig seine Hand auf ihre Schulter. Sie zuckte leicht zusammen, während er den Druck behutsam verstärkte und sie allmählich zu sich herumdrehte.
»Mister de Luca! Ich möchte ja nicht unhöflich erscheinen, aber die anderen Fluggäste haben bereits vor einer halben Stunde den Flieger verlassen. Wollen sie denn nicht gehen? Das Reinigungspersonal wartet schon!« Er brauchte einen Moment, bis er begriff, dass nicht die unbekannte Schöne aus seinem Traum, sondern die blond gelockte Flugbegleiterin vor ihm stand. Schnell sprang er auf, kramte sein Handgepäck aus dem Fach über ihm und eilte aus der Maschine. Dass er dabei fast die Flugbegleiterin umrannte, die dies mit einigen wütenden Kommentaren quittierte, nahm er in all der Eile kaum noch wahr.
Kapitel 3
Über Glasgow lag eine dichte graue Wolkendecke. Es nieselte leicht, dafür war es jedoch bedeutend wärmer als in New York. Vor dem Flughafengebäude wartete bereits Chris McKinley, einer von Professor Peters Assistenten, auf ihn. Der junge Mann war vielleicht Mitte zwanzig, hager, hatte feuerrotes Haar und eine runde Nickelbrille auf seiner Nase, die ständig bis auf seine Nasenspitze rutschte und die er deshalb von Zeit zu Zeit hektisch wieder auf ihren eigentlich dafür vorgesehenen Platz zurückdrückte. Chris McKinley wirkte im Allgemeinen äußerst hektisch, nervös und irgendwie gehetzt auf ihn. Dementsprechend zügig verstaute der junge Mann das Gepäck in dem viel zu kleinen, klapprigen, knallroten Austin Mini und verwies ihn energisch auf den Beifahrersitz. Dann startete er den Motor und brauste los, fast so als seien Scharen von, Gott weiß was, hinter ihnen her. Je länger die Fahrt dauerte, desto deutlicher wurde ihm, dass sein Chauffeur nicht gerade begeistert davon war, dass Professor Peters ausgerechnet ihn ausgewählt hatte, seinen Freund und Mäzen quer durch ganz Schottland bis hin zur „Isle of Skye“ zu kutschieren. Er war stumm wie ein Fisch und beachtete ihn kaum. Einzig und allein das Radio dudelte unentwegt vor sich hin.
Als sie Fort William passiert hatten, versuchte Simon de Luca schließlich das Schweigen zu brechen.
»Mister McKinley, sie sind einer von Benedikts Studenten, habe ich recht?«
»Hmm ...«
»Hauptgebiet keltische und piktische Geschichte nehme ich an.«
»Hmm ...«
»Sie reden nicht gerade viel, stimmt’s?«
»Hmm ...« Es war zum Mäusemelken, sein Gegenüber erstickte jede Art von Konversation bereits in ihrem Keim. Dennoch wirkte der junge Mann dabei nicht unhöflich oder gar abweisend auf ihn, sondern eher nachdenklich oder ein wenig zerstreut. Wieder folgte eine Zeit lang nichts als Schweigen, bis sein Chauffeur plötzlich das Radio leiser drehte, den Wagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen brachte und ihn eindringlich anstarrte.
»Ist 'was?«, wollte er deshalb von ihm wissen.
»Das kann man wohl sagen!« Chris McKinley betrachtete ihn nun noch abschätzender. »Ich will ja nicht neugierig erscheinen, oder vielleicht aufdringlich, aber, Mister de Luca, da gibt es etwas, was mich schon die ganze Zeit über beschäftigt und was ich Sie gerne fragen wollte.« Simon de Luca musterte nun seinerseits seinen Gegenüber, während dieser unbeirrt fortfuhr. »Wieso befasst sich ein Mann wie Sie ausgerechnet mit keltischer und piktischer Geschichte? Ihr Name ist auf keinen Fall keltischen Ursprungs, demnach sind Sie nicht wie einige ihrer gelangweilten Zeitgenossen auf der Suche nach Ihren Wurzeln. Was also ist es, das Sie antreibt? Reiner Mangel an Abwechslung? Neugier? Oder ist es noch etwas anderes? Ich weiß, Sie haben einen Haufen Kohle, doch, warum leisten Sie sich damit einen eigenen Professor? Ich will ja nichts gegen Benedikt sagen, er ist immerhin einer der fähigsten Köpfe unseres Fachbereichs, dennoch ist es ungewöhnlich, dass Sie gerade ihn mit einer Ausgrabung dieser Größenordnung betrauen. Und, wo wir schon einmal beim Thema Ausgrabungen sind, Benedikt hat beiläufig erwähnt, dass wir diesen Fund Ihnen zu verdanken haben. Wie kommt ein absoluter Laie, wie Sie, auf die Idee, dass sich in solch einer gottverlassenen Gegend, fern ab vom Festland etwas befinden könnte und noch dazu so etwas? Ich verstehe das nicht! Ich habe sämtliche uns bekannte Chroniken durchforstet, habe alte Schriften verglichen und jedwede Kultgegenstände, die ich finden konnte, auf Hinweise untersucht, jedoch alles ohne Ergebnis. Ich habe nirgendwo auch nur die leiseste Andeutung auf das gefunden, was wir entdeckt haben. Wo also haben Sie Ihre Informationen her? Und sagen Sie jetzt bloß nicht, Sie hätten das Zweite Gesicht oder irgendeinen ähnlichen Humbug, das werde ich Ihnen nämlich nicht abkaufen.«
»Ganz schön viele Fragen, für einen, der mich bis jetzt völlig ignoriert und angeschwiegen hat!«
»Ganz schön viele Ungereimtheiten, die ich mir nicht erklären kann, Mister de Luca!«
»Touché, Mister McKinley! Also gut! Wie sie vielleicht wissen, habe ich Benedikt vor einigen Jahren auf einem Symposium über keltische Geschichte ...«
»Das weiß ich bereits! Was ich jedoch nicht weiß ist, warum waren Sie dort? Was Professor Peters dort gemacht hat, steht in sämtlichen Fachblättern. Es war ja geradezu ein Skandal! Aber warum befanden Sie sich dort? Ich verstehe ja, wenn Leute sich für die Ägypter und deren Hochkultur begeistern, allein schon wegen der großen Bauwerke, die sie uns hinterlassen haben oder der Schätze, die noch immer unter dem Wüstensand vermutet werden. Aber die Kelten oder Pikten? Die meisten ihrer Bauwerke, so es sie gab, sind zerfallen. Hin und wieder werden zwar Gräber entdeckt, in denen Grabbeigaben oder kultische Gegenstände gefunden werden, aber damit war’s das dann auch. Meist hat das alles nur einen ideellen Wert. Ich will nicht sagen, dass sie unbedeutend waren, aber wissen Sie, wie die Römer sie genannt haben? Barbaren und im Grunde genommen waren sie das auch. Es heißt, sie hätten ihre Feinde verspeist, ähnlich wie die Azteken, nur dass diese uns wiederum Pyramiden und Ruinen hinterlassen haben, die so gewaltig sind, dass man von ihnen einfach fasziniert sein muss.«
»Erlauben Sie mir eine Gegenfrage?« McKinley nickte, dabei rutschte ihm seine Brille erneut auf die Nasenspitze, sodass er sie hektisch zurück an ihren Platz schob. »Warum befassen Sie sich mit den Kelten, wenn sie in Ihren Augen doch so unbedeutend sind?«
»Wer behauptet, dass sie unbedeutend waren? Ich habe nichts dergleichen gesagt. Aber bei mir ist das auch etwas anderes. Meine Wurzeln liegen in diesem Land. Generationen von McKinleys haben dieses Land bewohnt, haben in unzähligen Schlachten für dieses Land gekämpft und sind dafür gestorben. Unser Blut tränkt diese Erde, Mister de Luca. Wir haben dazu beigetragen, es zu dem zu machen, was es heute ist. Ist es dann nicht verständlich, dass ich wissen will, wie diese Vorfahren lebten, was sie dachten und womit sie sich befassten? Ist es nicht wichtig, seinen Ursprung zu kennen, um sich selbst zu verstehen?«
»Eine gesunde Einstellung für einen Mann ihres Alters!«
»Wollen Sie mich verarschen? Sie sind doch höchstens fünf Jahre älter als ich!« Simon de Luca grinste über das ganze Gesicht und zeigte dabei seine strahlend weißen Zähne. Er mochte diesen Jungen, vielleicht sogar mehr, als es ihm lieb war.
»So meinen Sie? Danke, für das Kompliment!« McKinley nickte und zum wiederholten Male verrutschte seine Brille. Diesmal ließ er sie jedoch genau dort, wo sie war, was ihm ein etwas schrulliges Aussehen verlieh.
»Sie haben meine Fragen noch nicht beantwortet, Mister de Luca!«
»Ich weiß, Mister McKinley!« Die beiden musterten sich eine Weile schweigend, so als könnte jeder den anderen mit Hilfe seines Blickes aus der Reserve locken. Dann aber erschien fast gleichzeitig ein Grinsen auf beiden Gesichtern.
»Simon! Sie können mich Simon nennen!«
»Gut, aber nur wenn Sie auch Chris zu mir sagen«, antwortete ihm sein Gegenüber, während er seine Brille zurechtrückte. »Was ist? Bekomme ich nun meine Antworten?« Der Junge war hartnäckig, aber auch das gefiel ihm an ihm.
»Also schön! Es liegt an diesem Land. Trotz all der Belagerungen, Kämpfe und Schicksalsschläge, die es in seiner langen Geschichte erdulden musste, ist es noch immer dasselbe geblieben. Ich sehe die saftigen Wiesen der Lowlands, die Hügel und Gebirgsketten der Highlands, seine zerklüftete Küste mit all den Felsen, Buchten und Stränden und frage mich, was dieses Land ausmacht. Sind es die Lochs, die Legenden und Sagen oder seine Menschen? Das alles zieht mich magisch an. Es ist noch genauso wild und ungezähmt wie vor Hunderten von Jahren und das, obwohl es belagert und unterdrückt wurde. Barbarisch? Ja, man könnte es so nennen! Aber auch faszinierend! Hat ein solches Land es nicht verdient, dass man seine Anfänge erforscht? Deshalb gebe ich mein Geld nicht für Autos oder Frauen aus, sondern für Professor Peters.« Chris musterte ihn noch eine Weile prüfend, dann jedoch startete er den Motor und brachte den Wagen zurück auf die Straße. Anscheinend genügte ihm seine Antwort, denn er machte keinerlei Anstalten die Unterhaltung fortzusetzen. Simon de Luca atmete unwillkürlich aus. Es war noch nicht an der Zeit, dass der Junge das volle Ausmaß seiner Besessenheit kennenlernte. Denn, das, was ihn antrieb, ging weit über normale Besessenheit hinaus. Sie ging so tief unter die Haut, dass sie sogar schmerzte. Und den Grund dafür? Wie hätte er dem Jungen den wahren Grund für seine Manie erklären sollen, ohne zu riskieren, dass er ihn für vollkommen verrückt hielt. Er würde es schon noch früh genug erfahren. Nur im Moment war die Zeit noch nicht reif dafür. Dennoch war er sich ziemlich sicher, dass in naher Zukunft all die Dinge an die Oberfläche gelangen würden, die er so lange in seinem Schneckenhaus vergraben hatte. Dinge, die er selbst kaum glauben konnte. Er hoffte nur, dass derjenige, mit dem er sie endlich teilen würde, auch in der Lage wäre, ihre Tragweite zu begreifen und ihn zu unterstützen. Ja, und irgendwie schien ihm der Gedanke nicht abwegig, dass Chris McKinley eben derjenige, welcher sein würde.
Den Rest der Fahrt verbrachten sie mit dem üblichen Small Talk. Dabei vermied es jeder unbewusst, erneut auf das Thema Geschichte und was damit zusammenhing, einzugehen.
Es dämmerte bereits, als sie die Brücke, die das Festland mit der „Isle of Skye“ verband, passierten. Simon de Luca rutschte aufgeregt auf seinem Sitz hin und her, während Chris McKinley dagegen mittlerweile die Ruhe selbst zu sein schien. Bei jedem Meter, den sie sich nun ihrem eigentlichen Ziel näherten, wuchs Simons innere Unruhe und seine Anspannung. Verzweifelt versuchte er seine Gefühle vor Chris zu verbergen, aber es gelang ihm nicht wirklich.
»Kennst du die Legende vom „Table Rock“, oder „McLeods Rock“, wie er auch genannt wird?«, wollte Chris auf einmal von ihm wissen. Es schien ihm, als spüre sein Begleiter das in ihm aufkeimende Gefühlschaos und wollte ihn nur ablenken, deshalb antwortete er ihm.
»Ich glaube schon.«
»Glaubst du, oder weißt du?« De Luca zuckte mit den Schultern. »Welche der beiden Geschichten, glaubst du denn, zu kennen?«
»Es gibt mehrere?« Chris nickte.
»Ja sicher! Zwei, um genau zu sein! Soll ich sie dir erzählen?«, diesmal nickte Simon. Eine willkommene Ablenkung!
»Also schön. Es geschah im frühen 16. Jahrhundert, zur Zeit König James V. Alasdair Crotach McLeod war zu diesem Zeitpunkt Clanchef der McLeods. Weißt du, was Crotach bedeutet?«, wieder nickte Simon.
»Der Bucklige, wenn ich mich nicht irre!«
»Richtig! Du verstehst also gälisch?«
»Nicht viel, um ehrlich zu sein. Aber auf Alasdair stößt man immer wieder, wenn man sich mit der Geschichte der „Isle of Skye“ befasst. Und da erfährt man zwangsläufig seinen Beinamen.«, nun nickte Chris.