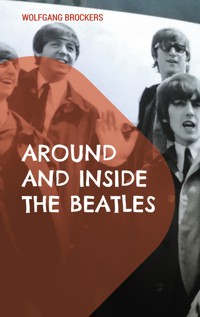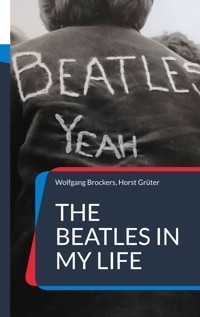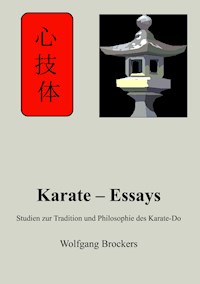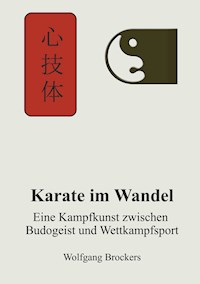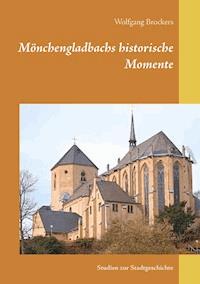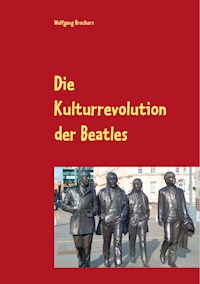
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In den 1960er Jahren machten die Beatles, vier junge Burschen aus Liverpool, eine unglaubliche musikalische Karriere. Ihr phänomenaler Erfolg stellte damals alles bis dahin Dagewesene des Musik- und Showgeschäfts in den Schatten. Sie setzten neue musikalische Maßstäbe und machten aus dem Rock'n Roll eine globale Popkultur. Auch heute, ein halbes Jahrhundert nach Trennung der Band, gelten sie noch immer als größte Rockband aller Zeiten. Die Beatles waren das herausragende kulturelle Ereignis der "Swinging Sixties" und prägten wie niemand zuvor Zeitgeist und Lebensgefühl dieser Epoche. Das vorliegende Buch zeichnet die phänomenale Entwicklung der Band nach und beleuchtet die Hintergründe ihres einzigartigen Erfolgs. Darüber hinaus beschreibt es, wie die vier Jungs Kultur und Gesellschaft ihrer und späterer Zeit veränderten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
„In den Sechzigern erlebten wir Jungs eine Revolution, und die betraf nicht nur die kleinen Leute oder bestimmte Klassen, sondern es war eine Revolution des gesamten Denkens. Die Jugend bekam das als erstes mit, danach die nächste Generation. Die Beatles waren ein Teil dieser Revolution, die in Wahrheit eine Evolution ist und bis heute andauert. Wir waren alle an Bord dieses Schiffes – eines Schiffes, das aufgebrochen war, die Neue Welt zu entdecken. Und die Beatles standen am Ausguck.“
(John Lennon)
Als die Beatles in den frühen 1960er Jahren die Musikszene betraten und eingefahrene Konventionen gewaltig durcheinander wirbelten, hatte dies wahrlich eine revolutionäre Wirkung. Sie waren nicht nur für lange Zeit außerordentlich erfolgreich, sondern setzten eine Vielzahl von Veränderungsprozessen in Gang, so dass man von einer kulturellen und sozialen Revolution sprechen kann, deren Auswirkungen man bis heute spüren kann.
„Vor 50 Jahren erschien „Love Me Do“, die erste Single der Beatles. Dieses Datum veränderte die Welt, es steht am Beginn der populären Kultur“,
so schrieb der Journalist Philipp Holstein am 29. September 2012 in einer Magazin-Beilage der Rheinischen Post. Tatsächlich markiert dieses Ereignis den Beginn einer bis dahin beispiellosen musikalischen Karriere von vier jungen Burschen aus Liverpool, die sich zur größten Rock’n Roll-Attraktion aller Zeiten entwickelten. Wie niemand zuvor prägten sie den Zeitgeist, setzten sie musikalisch neue Maßstäbe, machten aus dem Rock’n Roll eine globale Popkultur. Dazu revolutionierten sie in nicht geringem Umfang die Gesellschaft. Denn sie waren mehr als nur ein unvergleichliches Phänomen der Musik- und Unterhaltungsbranche. Sie waren die Protagonisten der „Swinging Sixties“, einem hochbrisanten Jahrzehnt, das die Welt veränderte. Durch ihre Ausnahmestellung in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts fanden sie schließlich sogar Eingang in die Geschichtsbücher. In den ersten Jahren ihres Ruhmes bestand ihre revolutionäre Wirkung primär in der Art, wie sie sich auf der Bühne benahmen und kleideten. In den späteren Jahren ergab sich diese Wirkung mehr aus ihren Texten und öffentlichen Äußerungen. Die Sechziger waren auch eine Zeit großen spirituellen Umbruchs, als in der westlichen Welt der Rationalismus und die traditionelle Religion an Bedeutung verloren. Durch ihren Einfluss öffneten die Beatles die westliche Kultur für die östliche Religion und Spiritualität, wodurch sie selbst für viele den Status von religiösen Führern gewannen. Sie waren in ihrer Zeit wohl die bekanntesten Menschen auf diesem Planeten und beeinflussten entscheidend das Lebensgefühl von Millionen Menschen, besonders der jungen Generation. Sie erschütterten die Grundfesten des vielgerühmten Konservatismus ihrer englischen Heimat und schufen durch ihre kulturüberschreitende Popularität, der „Beatlemania“, eine erste Form der Globalisierung.
Als die Beatles sich 1970, knapp acht Jahre nach ihrem ersten Plattenerfolg, trennten, war die Welt eine andere, als sie vor ihrem legendären Aufstieg war. Ein nicht geringer Anteil der in den Sechzigern ausgelösten gesellschaftlichen Veränderungsprozesse ist auf den Einfluss der Beatles zurückzuführen. Auch heute, fast fünfzig Jahre nach dem Ende der Beatles, haben sie nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Ihre Musik wirkt immer noch so frisch und dynamisch wie damals. Der englische Poet Philip Larkin schrieb einmal, dass es nur noch den Weg nach unten gäbe, wenn einmal die Spitze erreicht sei. Doch die Beatles bildeten für ihn eine Ausnahme, denn über sie schrieb er weiter, „da oben stehen sie, unerreichbar, erstarrt, fabelhaft.“ In der rückschauenden Betrachtung, mit dem Abstand von einem halben Jahrhundert, ragt die Musik der Beatles wie ein kulturhistorisches Monument hervor. Sie ist vergleichbar mit dem Werk Mozarts, dem David Michelangelos oder dem Eiffelturm von Paris. Und die Geschichte der Beatles scheint – auch so lange nach dem Ende der Gruppe – kein Ende zu finden; noch immer erscheinen neue Bücher, Filme und Tonträger über die vier Jungs, und noch immer verkaufen sich ihre alten Platten bzw. Tonträger ausgezeichnet.
Es gibt inzwischen Tausende Bücher über die Beatles und unzählige Film- bzw. Videodokumente, so dass man mit einigem Recht bezweifeln kann, ob ein weiteres Buch noch Sinn macht und noch irgendetwas Neues hervorbringen kann. Betrachtet man die vorliegende Beatles-Literatur etwas näher, stellt man unschwer fest, dass der Großteil der Bücher lediglich aus Fotodokumentationen irgendwelcher Fotografen, aus mehr oder weniger ausführlichen Darstellungen ihrer Karriere und ihres phänomenalen Erfolgs oder aus Biografien besteht. Allzu oft vergolden irgendwelche Leute ihre Bekanntschaft mit den Beatles, wenn sie eine Zeit lang als Reporter, Fotograf oder Aufnahmetechniker nahe am inneren Zirkel der Jungs waren, ihre Erinnerungen. Tiefschürfende Betrachtungen sucht man dort vergeblich. Man findet wenig Literatur, die sich eingehender mit dem Phänomen „Beatles“ befasst, etwa indem sie den sozio-kulturellen Hintergrund ihres Aufstiegs, ihre Bedeutung innerhalb der Musikgeschichte beleuchtet oder gar ihre emanzipatorische und politische Wirkung auf ihre und spätere Generationen untersucht. Eine bemerkenswerte Ausnahme stellt da Steve Turners Buch „Die Beatles – ihre Welt und ihre Botschaft“ dar. Dieses Buch untersucht Leben und Werk der Beatles. Es beschreibt ihre musikalische sowie geistig-spirituelle Entwicklung und ihre mal mehr, mal weniger verschlüsselten Botschaften für ihre Fans und den Rest der Welt.
Steve Turners Werk gab mir den Anstoß, die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung der Beatles umfassender in ihrer Vielfalt und im kulturhistorischen Kontext zu betrachten. Das ließ mich sehr schnell die Einsicht gewinnen, dass die Beatles eine gesellschaftliche und kulturelle Revolution ausgelöst hatten. Es ist nun das Anliegen meines Buches, das vielschichtige Phänomen „Beatles“ genauer zu ergründen. Dabei soll ihr nahezu unfassbarer Erfolg und Ruhm, der sie über alles bisher Dagewesene heraushob, sowie ihre revolutionäre Wirkung auf Gesellschaft und Kultur ihrer und späterer Zeit verständlich gemacht werden. Meine Arbeit erhebt keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit und auch nicht, bisher unbekannte Sachverhalte zu präsentieren. Vielmehr verfolgt dieses Buch sein Anliegen, indem es bisher Bekanntes in einem anderen Licht und in größeren Zusammenhängen präsentiert. Bei dieser Betrachtungsweise drängte sich mir der Eindruck eines durch die Beatles ausgelösten enormen kulturellen Veränderungsprozesses auf, der Züge einer Kulturrevolution trägt. Eingefleischten Beatles-Fans wird die Lektüre gewiss zu einer noch tieferen Bewunderung ihrer vier Helden Anlass geben. Lesern, die sich bisher nur beiläufig mit dieser Epoche der Musikgeschichte befasst haben, wird dieses Buch hoffentlich ein besseres Verständnis für die zeitüberdauernde Wirkung dieser vier Jungs aus Liverpool vermitteln.
Inhalt
Die Beatles - ein beispielloses Phänomen
Liverpooler Jungs und der Rock’n Roll
Mühsamer Anlauf zur großen Karriere
Beatlemania und der Aufstieg zu nationalen Helden
Die USA und die ganze Welt - globale Beatles-Hysterie
Kreative Studiomusiker - die Beatles erfinden sich neu
Das Ende der Beatles – Streit um „Apple“ und letzte Hits
Die Solokarrieren der Ex-Beatles
Bilanz nach 50 Jahren – Fixsterne am Pophimmel
Anatomie einer Weltsensation
Optimales Timing – die Beatles kamen zur richtigen Zeit
Vier Individuen in einer homogenen Gruppe
Zwei geniale Songschreiber – das Herz der Beatles
Eine neue Ära in der Geschichte der Musik
Die kulturelle Revolution
Zeitgeist und Jugendemanzipation
Die Beatles und ihre Rolle im politischen Spiel
Kritik an Christentum und Kirche
Die spirituelle Reise der Beatles
Lebensphilosophie und Songbotschaften
Liverpool und das Erbe der Beatles
ANHANG
Personen des engeren Kreises um die Beatles
Singles und Alben der Beatles
Nachwort
Quellen- und Literaturverzeichnis
Zum Verfasser
I. Die Beatles - ein beispielloses Phänomen
1. Liverpooler Jungs und der Rock’n Roll
Liverpool, die Heimatstadt der Beatles, war im 18. Jahrhundert durch den Nordamerikahandel zu einer der bedeutendsten, umschlagsstärksten Hafenstädte Europas geworden. Die aus den USA eingeführte Baumwolle wurde dazu von der Liverpooler Textilindustrie verarbeitet, so dass sich die Stadt im 19. Jahrhundert zu einer blühenden Metropole entwickelte. Bis heute zeugen eindrucksvolle Gebäude und Skulpturen von Größe und Wohlstand Liverpools in viktorianischer Zeit. Jedoch mit Beginn des 20. Jahrhunderts begann ein kontinuierlicher wirtschaftlicher Niedergang, wozu u.a. der U-Boot-Krieg des ersten Weltkriegs, der beginnende Flugverkehr, der die langwierige Seereise nach und von Nordamerika allmählich ersetzte, beitrug. Dieser Prozess wurde durch die Zerstörungen infolge deutscher Bombardements im 2. Weltkrieg noch verstärkt. Selbst in den 50er und frühen 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es noch keine Anzeichen für eine wesentliche Verbesserung der für viele Einwohner tristen Lebensverhältnisse. Sehr viele Familien waren von Arbeitslosigkeit betroffen. Ganze Stadtviertel und Straßenzüge boten einen abgewirtschafteten, trostlosen Anblick und zeugten von Niedergang und Armut. Lediglich der Hafen zeigte noch Betriebsamkeit und bot Arbeitsplätze, wenn auch auf einem niedrigen Niveau. Die meisten Arbeiterfamilien waren arm und hatten kein leichtes Leben. Aber gerade deshalb hatte man in Liverpool Sinn für Humor und Musik, und außerdem boten die beiden bekannten Liverpooler Fußballclubs, der FC Liverpool und der FC Everton, zeitweilig die Möglichkeit zur Zerstreuung. Als deren Anhänger konnte man Gemeinschaft erleben und Teil ihrer Erfolge werden. Das war das soziale Umfeld, in dem unsere vier Helden, John, Paul, George und Ringo, als Kinder aufwuchsen.
Durch den Hafen war und blieb Liverpool weltoffener und weniger spießig als die weiter landeinwärts gelegenen ‚Midlands‘. Der Hafen war die wichtigste Verbindung zum gegenüberliegenden Irland. So gab es einen starken irischkatholischen Einschlag in Liverpool, während der Rest Großbritanniens eher anglikanisch oder protestantisch geprägt war. Matrosen aus der ganzen Welt sorgten dafür, dass Liverpool einen kosmopolitischen Charakter hatte. Nach Hause heimkehrende Matrosen brachten aus den USA häufig die neuesten Schallplatten mit Blues- oder Country-&Western-Musik nach Liverpool, wodurch die dortige Musikszene mehr auf der Höhe der Zeit war als im Rest Großbritanniens. In den 1950ern dominierten amerikanische Musiker und Filme die englische Unterhaltungsbranche. Nennenswerte englische Stars oder erfolgreiche Schallplatten gab es eigentlich nicht und so hörte man aktuelle moderne Musik in erster Linie im Radio. Als ca. 1955 die ersten Rock‘n Roll-Aufnahmen in England zu hören waren, bevorzugten Intellektuelle den Jazz. Bei der Jugend war jedoch gerade Skifflemusik angesagt, eine Musik, die einfach, auch mit improvisierten Instrumenten, zu spielen war. 1956 sorgte Bill Haley auf seiner Englandtournee mit seinen Songs wie „Rock Around The Clock“ für Furore, insbesondere bei der englischen Jugend. Spätesten als die Teenager Elvis in Zeitschriften oder durch seine Platten kennenlernten, war es schlagartig mit Skiffle vorbei. Mit dem Rock’n Roll hatte die englische Jugend ihren Musikstil, ihre Idole und damit auch den Ausdruck ihres Lebensgefühls gefunden. Wenn Matrosen aus den USA nach Liverpool zurückkamen und Rock’n Roll-Platten mitbrachten, waren diese von den jungen Leuten heiß begehrt. Besonders junge Musiker wollten diese Platten haben, um sie – auf den Spuren ihre Idole – nachspielen zu können. So ging es auch jenen vier Jungs, die später als Beatles die Welt ‚rocken‘ sollten.
John Lennon
John Winston Lennon wurde am 9. Oktober 1940 geboren, als gerade deutsche Bomben auf Liverpool fielen. Seine frühen Kindheitsjahre verliefen für damalige Verhältnisse zunächst normal, bis sein Vater – Steward auf einem Schiff - abheuerte und verschwand. Wahrscheinlich wollte er dem Kriegsdienst und auch seiner kriselnden Ehe zu entfliehen. 1943 ließen sich die Eltern scheiden; Johns lebenshungrige Mutter fand einen neuen Mann und John wuchs bei seiner Tante Mary Smith, die er Tante Mimi nannte, auf. Als Johns Vater zwei Jahre später wieder auftauchte, sollte der Fünfjährige entscheiden, ob er bei Mutter oder Vater leben sollte – John fühlte, dass beide Eltern ihn nicht haben wollten und er sie nur stören würde. Das war eine traumatische Erfahrung für ihn. Darauf nahmen Tante Mimi und ihr Mann George den kleinen John zu sich, behandelten ihn wie ihr eigenes Kind und Onkel George wurde für ihn ein guter Ersatzvater. In der Grundschule erwies sich John als intelligent aber unaufmerksam. Er engagierte sich nur, wenn ihm etwas Spaß machte. Routinesachen langweilten ihn und er war daher zu kontinuierlicher Arbeit kaum fähig, ein Problem, das ihm ein Leben lang erhalten blieb. Allerdings wurde schon in der Grundschule sein Gesangstalent entdeckt und schon früh zeigte er Geschick, Zeichnungen, Karikaturen oder Collagen herzustellen. Während sich John zuhause bei Tante Mimi wie ein artiger, sensibler Junge benahm, verhielt er sich außerhalb wie ein Rüpel und war ständig in Prügeleien verwickelt, so dass kaum jemand in seiner Nachbarschaft ungeschoren blieb. Auch als John 1952 auf die Quarry Bank High School kam, blieb er weiterhin ein aggressiver Rüpel, der oft wegen Schulstreiche oder obszöner Zeichnungen vor dem Direktor erscheinen musste. 1953 starb unerwartet Onkel George, wodurch er zum zweiten Mal die Vaterfigur, eine für ihn wichtige Bezugsperson, verlor. Kurz darauf erschien auch wieder seine Mutter Julia und verhielt sich John gegenüber eher wie eine ältere Schwester. Bei Problemen spielte John beide Frauen gegeneinander aus, was deren Verhältnis sehr belastete.
Ab 1955 interessierte sich John zunehmend für Popmusik. Als dann Bill Haley mit „Rock Around The Clock“ und Elvis Presley mit „Heartbreak Hotel“ groß heraus kamen, begann der Rock’n Roll seinen triumphalen Siegeszug in Großbritannien. In Liverpool entstanden in kürzester Zeit viele Rockgruppen und Tanzlokale. Sehr bald waren nicht mehr prügelnde Gang-Anführer die Könige, sondern solche Leute, die gut mit der Gitarre umgehen konnten. Für John wurde der Rock’n Roll zum Wendepunkt seines Lebens und Elvis Presley sein Idol.
„Nachdem ich ihn gehört hatte und auf den Geschmack gekommen war, war das das Leben, es gab nichts anderes. Ich dachte an nichts anderes als an Rock’n Roll – abgesehen von Sex, Essen und Geld, aber das ist im Grunde dasselbe, wirklich (John Lennon in: Anthology, 2000, S. →).“
Seine Mutter Julia kaufte ihm seine erste Gitarre und brachte ihm die ersten Akkorde bei, bis er schließlich einen ersten Rock-Song spielen konnte. Im März 1957 gründete John mit Schulfreunden eine Skiffle-Band, die „Quarrymen“. Sie waren aber blutige Amateure, beherrschten kaum ihre Instrumente und hatten nur einige kleine Auftritte bei Schülerpartys oder Geburtstagsfeiern. In der Gruppe gab es ständig Krach, da John immer meinte, seine Rolle als Boss verteidigen zu müssen. Daher verließen in kurzer Zeit immer wieder Mitglieder die Gruppe, so dass John sich ständig nach neuen Leuten umsehen musste. Auf dem Woolton-Gemeindefest am 6.7.1957 hatten die Quarrymen einen kleinen Auftritt und danach wurde John der junge Paul McCartney vorgestellt, was sich als eine schicksalhafte, zukunftsweisende Begegnung erweisen sollte. Da Paul besser Gitarre spielen konnte, nahm John ihn in seine Band auf. Aber in der Schule gab es wegen Johns unzulänglicher Leistungen zunehmend Probleme, so dass der Schuldirektor, der Johns musisch-künstlerisches Talent immerhin richtig einschätzte, Tante Mimi empfahl, ihn auf die Kunstakademie zu schicken. So kam John auf die Kunstschule, wo sich seine Leistungen aber nur vorübergehend besserten. Bald besuchte John die Schule nur noch, um seine Tante nicht zu enttäuschen. Auf der Kunstschule lernte er den begabten jungen Maler Stuart Sutcliffe kennen, zu dem er eine enge freundschaftliche Bindung einging. Im Juli 1958 traf John ein schwerer Schlag. Seine Mutter Julia, zu der er gerade wieder eine innigere Bindung gefunden hatte, wurde von einem betrunkenen Polizisten mit dem Auto überfahren; sie war sofort tot. Der Tod seiner Mutter, zu der er eine Seelenverwandtschaft empfand, traf ihn so sehr, dass er jahrelang nicht darüber reden konnte. Viele Jahre später hat er in mehreren Songs (Julia, Mother) versucht, diesen traumatischen Verlust zu verarbeiten. Der Polizist wurde übrigens niemals für seine Todesfahrt unter Alkohol zur Rechenschaft gezogen, was in gewissem Maß Johns feindselige und aggressive Haltung gegenüber Polizisten und offiziellen Autoritäten erklärt. Da viele Mädchen den extrovertierten John attraktiv fanden, hatte er viele Affären. Nach einer Weile war er dann aber mit Cynthia Powell fest liiert. Sie war das Gegenteil von John; sie stammte von der besseren Seite des Mersey, war streng erzogen und schüchtern, aber beide fühlten sich stark zueinander hingezogen. John gab danach seinen Teddy-Boy-Look auf und kleidete sich konventioneller, während Cynthia versuchte, mit Frisur und Kleidung Brigitte Bardot zu imitieren, weil John diese toll fand. Als Cynthia dann schwanger wurde, heiraten John und Cynthia am 23.8.1962.
Paul McCartney
Am 18. Juni 1942 wurde Paul McCartney in einem Liverpooler Krankenhaus geboren. Wieder einmal fielen deutsche Bomben auf die Stadt, und Pauls Vater war gerade im Löscheinsatz. Der Vater war Baumwollverkäufer und seine Mutter Krankenschwester, wodurch sie sich eine Wohnung in einer besseren Wohngegend leisten konnten. In der Schule erwies sich Paul als sehr guter Schüler. Vater Jim McCartney war vielseitig musikalisch begabt, spielte mehrere Instrumente und leitete eine semiprofessionelle Jazzband. Da auch zuhause viel musiziert wurde, flog Paul auch eine große Musikbegabung zu. Als sein Vater ihm das Klavierspielen beibringen wollte, zeigte Paul allerdings kein Interesse an einem systematischen, fremdgesteuerten Unterricht. Dagegen entwickelte er schon als Junge ein Talent, gehörte Melodien ohne Noten und Lehrer nachspielen zu können. Als erstes Instrument erhielt er von seinem Vater eine Trompete, die er jedoch bald wieder gegen eine Gitarre eintauschte, als auch ihn das Rock’n Roll-Fieber packte. Doch beim Üben damit stieß er zunächst auf unerwartete Schwierigkeiten bis er merkte, dass diese sich daraus ergaben, dass er Linkshänder war und die Gitarren für Rechtshänder ausgelegt waren. Nachdem er begriffen hatte, dass er das Instrument ganz anders als normal spielen musste, übte er wie ein Wahnsinniger – bei jeder sich bietenden Gelegenheit, sogar zuhause auf der Toilette. So erwarb er sich autodidaktisch eine gewisse Fertigkeit, um erste Rock’n Roll Nummern spielen zu können. Als Paul 14 Jahre alt war, starb seine Mutter an Brustkrebs. Dieser Verlust ließ ihn enger mit Vater und seinem zwei Jahre jüngeren Bruder zusammenrücken und Paul übernahm auch Aufgaben im Haushalt. Das hielt ihn jedoch nicht vom Gitarre spielen und seiner zweiten Leidenschaft, Mädchen, ab. Seine Leistungen in der Schule ließen aber nach und sein Vater fürchtete, er könnte ein ‚Halbstarker‘, ein Teddy Boy, werden, zumal Paul nun auch in engen Hosen, Lederklamotten und mit einer Elvislocke herumlief. Als er an jenem denkwürdigen 6. Juli 1957 beim Woolton Gemeindefest John Lennon kennenlernte, gefiel Paul zwar Johns cooler Auftritt, aber er bemerkte , dass John auf der Gitarre nicht viel konnte. Während ihres Gesprächs zeigte Paul ihm verschiedene Gitarrenakkorde und spielte schließlich „Twenty Flight Rock“ von Eddy Cochran, was John mächtig beeindruckte, besonders dass Paul auch den Text vollständig auswendig konnte. Darauf holte John ihn in seine Gruppe, obwohl er – anerkennend, dass Paul besser war als er – sich damit einen möglichen Rivalen in seine Band holte, der seine Rolle als Boss in Frage stellen konnte. Wenige Tage später trat Paul dann schon gemeinsam mit den Quarrymen auf. Er gab John bald darauf Gitarrenunterricht und spielte ihm auch Songs vor, die er selbst geschrieben hatte. Dies weckte Johns Ehrgeiz, es ihm gleich zu tun. Daraus entstand eine freundschaftliche Rivalität, woraus sich das wohl erfolgreichste Songschreiber-Duo der Popgeschichte entwickeln sollte. Sie traten in vielen Clubs und bei kleineren Veranstaltungen auf, weshalb sie häufig spät nach Hause kamen. Dabei verdienten sie allerdings kaum mehr als ein Taschengeld. Es wurde anstrengend und die meisten Bandmitglieder stiegen bald entmutigt aus, weil zunächst nichts auf eine bevorstehende große Karriere hindeutete. John und Paul blieben zusammen und suchten nach einer Verstärkung, die ebenso musikverrückt war wie sie. Aber es bot sich nur einer an, jemand, den Paul beim Busfahren näher kennengelernt hatte.
George Harrison
George wurde am 25.2.1943 als jüngstes von vier Kindern der Familie Harrison in Liverpool geboren und wuchs als einziger Beatle unbeschwert auf. Sein Vater Harold arbeitete als Busfahrer und, da er nicht viel verdiente, verdiente seine Mutter etwas mit Näharbeiten hinzu. In der Schule hatte er jedoch keinen Ehrgeiz. George war ein Sportfan, spielte gut Fußball, konnte gut schwimmen und machte gern Leichtathletik. Als ihn dann aber die Musik packte, gab er den Sport auf. Seine Mutter kaufte ihm eine Gitarre und ein Freund seines Vaters brachte ihm die ersten Akkorde bei. George übte und übte, zuweilen bis in die Nacht und bis seine Fingerkuppen blutig waren. Seine Mutter liebte Musik und Tanz; sie ermutigte George immer wieder durchzuhalten. Mit seinen älteren Brüdern, die auch Gitarre spielten, bildete George 1955 dann eine erste Band, die „Rebels“, doch er hatte ganz eigene Ideen über das Gitarrenspiel und war nie mit sich zufrieden. Auch später, als die Beatles schon weltberühmt waren, erklärte er, es sei sein Ziel, konzertreif spielen zu können. Im Vergleich zu John oder Paul spielte er aber schon damals großartig. Hin und wieder spielte er auch mit anderen Gruppen und lernte so auch die Quarrymen kennen. Paul hatte er schon öfters beim Busfahren getroffen und, als die Quarrymen 1958 Verstärkung suchten, stellte Paul ihn bei einer nächtlichen Busfahrt John vor. George spielte ihnen den damals populären, anspruchsvollen Instrumentalhit „Raunchy“ fehlerlos vor. John war mächtig beeindruckt und nahm ihn ebenfalls in die Gruppe auf, obwohl George ihm eigentlich zu jung war. Bald machte George die nächsten Bandauftritte der Quarrymen mit. 1959 verließ George die Schule ohne Abschluss und begann eine Elektrikerlehre, die er jedoch nicht vollenden konnte, da die bald darauf beginnende Musikkarriere dafür keine Zeit mehr ließ.
Als dann Skiffle auf einmal ‚out‘ war, hatten die Quarrymen ein großes Problem. Da sie kaum über ein nennenswertes Rockrepertoire und über keinen Verstärker verfügten, hingen sie bald in der Luft und bekamen kaum noch Engagements. Weil sie keine elektrischen Verstärker hatten, wollten sie wenigstens mit einem zusätzlichen Musiker auftreten, um das fehlende Volumen auszugleichen. Johns Freund Stu Sutcliffe wollte gerne mitmachen und als Stu für eins seiner gemalten Bilder viel Geld bekommen hatte, überredeten ihn John und Paul, dafür eine teure Bassgitarre zu kaufen, damit er in der Band mitmachen konnte. So wurde Stu Sutcliffe 1960 Mitglied der Quarrymen. Allerdings gab es das Problem, dass Stu den Bass nicht spielen konnte. Zwar lernte er schnell, jedoch reichte es eigentlich nicht für Auftritte, insbesondere konnte er nicht improvisieren. Wenn Stu den Jungs auch musikalisch keine nennenswerte Hilfe war, so gab er doch einige wichtige Impulse für die Zukunft der Gruppe. So stammte die Idee, die Gruppe nach Insekten (beetles) zu benennen, von ihm, was John Lennon dann in „Beatles“ änderte, weil ihm die Doppeldeutigkeit des Wortklangs gefiel. Vorübergehend nannten sie sich „Silver Beatles“ und schließlich ab 1960 dann nur „The Beatles“. Es war auch Stu Sutcliffe, der den Kontakt zu Allan Williams, der Besitzer der ‚Jacaranda Coffee Bar‘ und Musikpromoter war, herstellte. Durch ihn erhielten sie ein erstes Engagement, um den damals in England populären Sänger Johnny Gentle als Vorband bei einer Schottland-Tournee zu begleiten. Allerdings mussten sie immer wieder mit wechselnden Drummern spielen, da sie noch keinen eigenen Schlagzeuger hatten. Bei der Tournee kamen sie zum ersten Mal mit einem sogenannten Star in näheren Kontakt, bekamen eine richtige Gage und fühlten sich schon ein wenig wie Profis. Zurück in Liverpool erlebten sie die Ernüchterung, wieder eine von vielen Bands ohne feste Verpflichtung zu sein, nachdem sie nun schon ein wenig am Showbusiness geschnuppert hatten.
2. Mühsamer Anlauf zur großen Karriere
Als Allan Williams 1960 in Hamburg auf der Reeperbahn einige Bars und Clubs besuchte, fand er die dort spielenden Bands lausig und langweilig. Dabei dachte er an die Beatles, die – zwar keineswegs die beste Band in Liverpool – hier in Hamburg die Welt auf den Kopf stellen könnten. Nach einigen mühsamen Verhandlungen mit dem Clubbesitzer Bruno Koschmider verschaffte er den Beatles ein dreimonatiges Engagement in Hamburg. Von August bis Oktober 1960 sollten sie zunächst für zwei Wochen im „Indra“ und die restliche Zeit im „Kaiserkeller“ spielen. Als die Jungs in Liverpool den Vertrag erhielten, waren sie gerade wieder einmal ohne Drummer. Da erinnerte sich Paul McCartney an Pete Best. Er war der Sohn der „Casbah Club“-Besitzerin in Liverpool, hatte gerade ein neues Schlagzeug bekommen und wollte gerne wieder in einer Gruppe spielen. Paul lud ihn ein, als Mitglied der Band mit nach Hamburg zu kommen, und er willigte ein. Nachdem Williams die Einwilligung aller Eltern, auch für den erst 17-jährigen George erhalten hatte, konnte das Abenteuer Hamburg beginnen.
Falls die Jungs Vorstellungen eines glamourösen Musikerlebens gehegt haben sollten, wurden sie jäh enttäuscht. Sie wurden in einem schäbigen Zimmer hinter einer Kinoleinwand untergebracht, das nur über Feldbetten, eine nackte Glühbirne und ein kaputtes Waschbecken verfügte. Waschen mussten sie sich auf der Kinotoilette. Das „Indra“ erwies sich als ein ehemaliger Stripteaseschuppen Als die Beatles dort zum ersten Mal auftraten, wurden sie ausgepfiffen, weil die Besucher strippende Mädchen sehen wollten. Nachdem sie dort eine Woche gespielt hatten, beschloss Koschmider, dort wieder eine Striptease-Bar zu etablieren, und die Jungs spielten danach in seinem zweiten Club, dem Kaiserkeller. Auch hier hatten sie anfangs wenig Erfolg, da andere Gruppen routinierter waren. Aber sie lernten schnell, auf die Wünsche des Publikums einzugehen. Ihre Bühnenperformance wurde immer wilder und lauter. Sie stampften mit den Füßen auf den Boden bis ein Loch im Bühnenboden war und hüpften ausgeflippt umher. Die „Schau“ kam an, aber sie mussten bis zu acht Stunden täglich spielen. Um durchzuhalten, nahmen sie Preludin-Pillen, ihre Prellis, die ihnen neue Energie gaben. Sie waren fast ständig heiser. Daher gingen sie dazu über, zu zweit oder zu dritt zu singen. Das schonte die Stimmbänder und perfektionierte allmählich ihren Chorgesang, wofür sie später gefeiert wurden. Es war eine wilde, anstrengende und aufregende Zeit. Um sich behaupten zu können, mussten sie ihr Repertoire erweitern, sich spieltechnisch verbessern und Durchhaltevermögen entwickeln. Aber auf diese Weise fanden sie allmählich ihren eigenen Stil. Dazu war das Leben auf der Reeperbahn mit käuflicher Liebe, Alkohol und regelmäßigen Schlägereien für sie als junge Burschen eine ganz neue Erfahrung.
„Ich habe eine Menge getrunken. Man konnte gar nicht anders. Die ganze Zeit schickte man uns was zu trinken herauf, und so tranken wir natürlich viel. Wir hatten eine Menge Mädchen und merkten bald, dass sie leicht aufzureißen waren. Mädchen sind Mädchen, Burschen sind Burschen. Alles besserte sich hundertprozentig. Am Anfang waren wir zahme, brave Musiker gewesen. Jetzt wurden wir ein Kraftwerk (Pete Best in: Davies, 1968, S.76).“
Obwohl sie kaum aus St. Pauli herauskamen, lernten sie doch einige interessante Leute kennen. Die Fotografin Astrid Kirchherr und ihr Freund, der Grafiker Klaus Voormann, wurden im Kaiserkeller auf die Beatles aufmerksam. Astrid machte die ersten Hamburg-Fotos von ihnen, lud sie zu sich nach Hause ein und verliebte sich in Stu Sutcliffe. Unter Astrids und Klaus‘ Einfluss gaben sie allmählich ihren Rocker-Look auf und orientierten sich äußerlich wie auch geistig mehr an die existenzialistisch geprägte Studentenszene. Eine gewisse Zeit spielte auch die damals beste Band Liverpools, „Rory Storm and the Hurricanes“, mit ihrem Drummer Ringo Starr abwechselnd mit den Beatles im Kaiserkeller. Sie verstanden sich gut und als Pete Best einmal krank war, spielte Ringo auch mal mit den Beatles. Nachdem die Beatles auch mal im „Top Ten Club“, einer Konkurrenz von Koschmiders Clubs aufgetreten waren, sorgte dieser verärgert für ein unerwartetes Ende ihres Hamburg-Engagements. Er informierte die Polizei, die dann auf seinen Hinweis den erst 17-jährigen George ausweisen ließ. Bald darauf packten auch die anderen Jungs ihre Sachen und kehrten nach Liverpool zurück, wo sie bald der aufregenden Hamburger Zeit nachtrauerten. Immerhin gaben sie im Februar 1961 ihr Debut im Cavern-Club, einem ehemaligen Jazz-Club, wo die Beatles in den Folgejahren fast 300 Mal spielen und diesen zum berühmtesten Beatclub machen sollten. Dort erlebten sie auch zum ersten Mal so etwas wie „Beatlemania“ mit kreischenden und rivalisierenden Mädchen. Im April 1961 – George war inzwischen 18 Jahre alt geworden – begannen sie ihr zweites Hamburg-Engagement, wo sie bis zum Juli ausschließlich im „Top Ten“ für eine bessere Gage spielten. Im Verlauf dieses Engagements kreierte Astrid Kirchherr auch die sogenannte Beatles-Frisur, indem sie zunächst Stu dazu brachte, die Haare nicht mehr nach hinten, sondern nach vorn in die Stirn zu kämmen und gleich lang zu schneiden. Nachdem die anderen Jungs zunächst darüber lachten, machten sie es Stu bald darauf nach. Damit waren die „Pilzköpfe“ (Moptops) der Beatles geboren. Am 22. Juni nahmen die Beatles in Hamburg als Begleitband für Tony Sheridan die Platte „My Bonnie“ auf, dem ersten akustischen Dokument ihrer wilden Hamburger Zeit. Diese Aufnahme sollte für ihre Karriere noch wichtig werden. Als die Jungs im Juli wieder nach Liverpool zurückkehrten, blieb Stu Sutcliffe jedoch in Hamburg – wegen seiner Liebe zu Astrid - und weil er dort sein Kunststudium fortsetzen wollte.
Nachdem sie sich in Hamburg schon wie Stars gefühlt hatten, waren sie zurück in Liverpool weiterhin nur eine Band von vielen. Die populärsten Bands waren damals „Rory Storm and the Hurricanes“ und „Gerry and the Pacemakers“. Aber bald wurden die Beatles im Cavern-Keller zur Hausband und jedes Mal, wenn sie in diesem muffigen Gewölbekeller mit feuchten Wänden spielten, war es rappelvoll mit begeisterten jungen Leuten. Inzwischen war in Liverpool der Beatkult ausgebrochen und im Juli 1961 erschien die erste Ausgabe des „Mersey-Beat“, einer Beatzeitung, die u.a. einen launigen Beitrag von John Lennon über den Namen „Beatles“ enthielt. In dieser Zeit stand John in einem intensiven Briefkontakt mit seinem Freund Stu in Hamburg. Ende 1961 erlitt Stu in der Hochschule einen Zusammenbruch und litt danach unter fürchterlichen Kopfschmerzen. Er starb im April 1962 an einer Gehirnblutung, sehr wahrscheinlich die Spätfolge einer Prügelei auf der Reeperbahn.
Natürlich wusste der engere Freundeskreis, dass die Beatles in Hamburg eine Schallplattenaufnahme gemacht hatten, zumal die Jungs selbst einige Exemplare ihrer Platte mit nach Liverpool gebracht hatten. Am 28. Oktober 1961 fragte ein junger Bursche namens Raymond Jones im Schallplattenladen NEMS in Whitechapel, Liverpool, nach der Platte „My Bonnie“ von den Beatles. Der Chef des Ladens, Brian Epstein, der es sich zum Geschäftsprinzip gemacht hatte, jede gewünschte Platte besorgen zu können, musste passen. Er hatte noch nie von dieser Platte und einer Gruppe, die sich „Beatles“ nannte, gehört. Brian Epstein war Spross einer reichen Kaufmannsfamilie, die im Möbelhandel erfolgreich war. 1957 hatte er ein Schallplattengeschäft eröffnet. Das Geschäft lief gut und schon zwei Jahre später verfügte er über das größte Pop-Plattensortiment im Norden. Daher konnte er ein zweites Geschäft im Zentrum Liverpools eröffnen und sein Personal stieg von zwei auf dreißig Mitarbeiter. Er war in wenigen Jahren zum führenden Mann im Schallplattengeschäft in Englands Norden geworden. Er schaltete auch Werbeanzeigen im „Mersey Beat“, so dass sein Name in der Liverpooler Beatszene ein gewisses Gewicht hatte.
Als nun wiederholt nach dieser Beatles-Platte gefragt wurde, zweifelte er verärgert an seinem Informationssystem. Aber seine Verkäuferinnen kannten sowohl die Gruppe wie auch die Platte und fanden sie gut. Sie erklärten ihrem Chef, dass die Jungs der Gruppe schon wiederholt in ihrem Geschäft gewesen wären. So erfuhr er dann auch, dass die Beatles regelmäßig in der Nähe im Cavern Club spielten. So trieb der geschäftliche Ehrgeiz Brian Epstein, der eigentlich ein Fan von Theater und klassischer Musik war, hinab in den Cavern Keller, wo er die Beatles nach ihrer Platte fragen wollte. Als die Beatles spielten, ging das junge Publikum wieder begeistert mit. Auf Brian Epstein wirkten sie ziemlich ungepflegt und ungehobelt. Aber er blieb länger als er vorgehabt hatte, denn ihr Sound, ihre Bühnenpräsens und ihr Humor hatten auch ihn fasziniert. Er bestellte darauf in Hamburg 200 der betreffenden Platten, die auch schnell vergriffen waren. Er bat die Beatles zu einem Gespräch für den 3. Dezember 1961 in sein Büro, weil er ihr Manager werden wollte. Tatsächlich einigten sie sich auf einen Vertrag, der Epstein 25% der künftigen Einnahmen sicherte. Diese so begründete Kooperation sollte Brian Epstein und die Beatles weltberühmt machen. Brian nutzte alle seine geschäftlichen Kontakte, einen Plattenvertrag für seine neuen Schützlinge zu bekommen. Schließlich konnten sie bei DECCA in London im Januar 1962 Probeaufnahmen machen. Da die Jungs nervös und unsicher waren, blieb das Ergebnis hinter ihren Erwartungen zurück und DECCA schickte nach einigen Wochen eine Absage mit der Bemerkung, die Zeit der Gitarrengruppen sei vorbei. Ihre Enttäuschung konnte auch nicht dadurch beseitigt werden, dass die Januar-Ausgabe des „Mersey Beat“ auf der Titelseite kundtat, die Beatles seien zur besten Liverpooler Gruppe gewählt worden. Als guter Geschäftsmann sorgte Brian Epstein zunächst dafür, dass die Jungs bessere Gagen bekamen. So begleitete er die Beatles als sie ihr drittes Hamburg-Engagement im neu eröffneten Star Club begannen. Durch sein Verhandlungsgeschick verdoppelte sich ihre Gage im Vergleich zum letzten dortigen Engagement. So begann mit den Beatles am 13. April 1962 die Geschichte des zeitweilig berühmtesten Rock- und Beatclubs der Welt. Brian Epstein verpasste ihnen auch neue Bühnenanzüge und verlangte von ihnen ein gepflegtes Aussehen sowie ein einstudiertes Programm für ihre Auftritte.
„Brian Epstein sagte zu uns: ‘Jungs, wenn ihr wirklich auf die großen Bretter wollt, dann müsst ihr euch ändern, ihr müsst aufhören, auf der Bühne zu essen, zu fluchen und zu rauchen.‘ (….).. er sagte einfach, dass wir nicht gepflegt aussähen und dass wir so nie an einem guten Ort auftreten könnten. (…..) Entweder wir würden es zu etwas bringen oder wir würden eben weiterhin Hühnchen auf der Bühne essen. Wir richteten uns nach ihm, wir hörten auf, Käsebrötchen und Marmeladenplunder in uns reinzustopfen, und achteten wesentlich mehr auf das, was wir taten, wir bemühten uns, pünktlich zu sein und traten gepflegter auf (John Lennon in: Anthology, 2000, S.67).“
Kaum in Hamburg angekommen, hatten sie erfahren müssen, dass ihr Freund Stu Sutcliffe einen Tag vorher gestorben war. John traf diese Nachricht besonders hart. Stu war in den letzten beiden Jahren sein bester und vertrauenswürdigster Freund gewesen und nun hatte er wiederum eine für sein seelisches Gleichgewicht wichtige Bezugsperson verloren.
Die Beatles blieben sieben Wochen in Hamburg. In dieser Zeit gelang es Brian Epstein, einen Termin für Probeaufnahmen beim Musikkonzern EMI in London zu erhalten. Per Telegramm informierte er sie und forderte sie auf, mehr neue Songs zu schreiben. Zurück in England spielten sie dann Anfang Juni unter der Leitung des Produzenten George Martin vier eigene Kompositionen ein. George Martin, ein studierter und erfahrener Musiker mit einer Vorliebe für klassische Musik, war Manager des EMI-Labels Parlophone. Aber er konnte sich durchaus auch für Jazz und Pop begeistern. Er war damals gerade auf der Suche nach etwas Neuem, einem eigenen „Cliff Richard“, dem damals erfolgreichsten englischen Musikstar.
Wie er sich später in der Film-Dokumentation „Beatles Anthology“ äußerte, war er musikalisch von den Jungs nicht besonders beeindruckt, vor allem war er mit Pete Best als Schlagzeuger unzufrieden. Dagegen fand er ihren ungewöhnlichen Bandsound und vor allem ihre Charaktere und ihr Charisma sehr interessant. Er fand sie so gewinnend, dass er glaubte, allein das würde für ihre erfolgreiche Vermarktung ausreichen.
„Ich war von ihnen als Menschen beeindruckt. Ich dachte, ich kann nichts verlieren, wenn ich sie unter Vertrag nehme. Allerdings hatte ich noch keine Ahnung, was ich mit ihnen anfangen und welche Stücke ich mit ihnen aufnehmen sollte (George Martin in: Davies, 1968, S. →).“
Nach den Probeaufnahmen traf George Martin noch keine Entscheidung. Er ließ sich damit Zeit und die Beatles mehrere Wochen auf eine Antwort warten. In dieser Zeit hatten sie zwar viele Engagements in der Region Liverpool, aber darüber hinaus fand Brian Epstein kein Engagement für sie. Ende Juli ließ George Martin dann Brian Epstein wissen, dass sie nach London kommen sollten, um einen Vertrag zu unterschreiben, jedoch sollten sie sich einen neuen Drummer besorgen. Erst mit zwei Wochen Verspätung ließ Brian Epstein in einem privaten Gespräch Pete Best wissen, dass er durch einen anderen Drummer ersetzt würde. Natürlich war Pete wenig begeistert, so kurz vor dem Durchbruch ausgebootet zu werden, aber er trug es mit Fassung. Dagegen waren viele Liverpooler Beatles-Fans empört und machten ihrem Ärger bei vielen der nächsten Auftritte der Band Luft. Es gab wiederholt Demonstrationen für Pete vor dem Cavern-Club. Als neuer Drummer kam für John, Paul und George aber nur einer in Frage, nämlich:
Ringo Starr.
Mit richtigem Namen hieß Ringo eigentlich Richard Starkey. Er wurde am 7.7.1940 als einziges Kind seiner Eltern in Liverpool geboren. Er wuchs im ‚Dingle‘, dem ärmsten und berüchtigsten Viertel der Stadt auf. Mit sechs Jahren erlitt er einen Blinddarmdurchbruch und war deswegen ein Jahr im Krankenhaus. Es folgten noch mehrere Krankheiten und eine Magenoperation. Mit 13 Jahren war er zwei Jahre wegen einer Brustfellentzündung im Krankenhaus, so dass er nur eine rudimentäre Schulbildung erhielt. Er machte verschiedene Jobs, die aber keine echte Zukunftsperspektive boten. Mit 17 Jahren erhielt er von seinem Vater ein gebrauchtes Schlagzeug. Er übte wie verrückt und fand bald Anschluss an eine Gruppe. Ringo spielte bei kleinen Veranstaltungen und landete schließlich bei Rory Storms Gruppe. Er entschied sich für eine Profilaufbahn als Musiker und legte sich den Künstlernamen ‚Ringo Starr‘ zu. Bald galt er als einer der besten Drummer in Liverpool. Als er mit Rory Storms Gruppe ein Gastspiel in Hamburg machte, lernte er auch die Beatles kennen, die sich dort schon einen Namen gemacht hatten. Als die Beatles ihn als Drummer haben wollten, musste er sich von heute auf morgen entscheiden, seine alten Bandkumpels zu verlassen. Dazu musste er seine Rockerfrisur in eine Beatles-Frisur ändern, seinen Bart abrasieren und eine Weile den Unmut der Pete Best-Anhänger ertragen.
Am 11.September 1962 sollten die Beatles zu Plattenaufnahmen nach London kommen; einen Tag vorher hatten sie Ringo aufgefordert, bei ihnen mitzumachen. Produzent George Martin wusste, dass sie mit einem neuen Drummer erscheinen würden, doch er wollte kein Risiko eingehen und hatte als Schlagzeuger den Studiomusiker Andy White eingeladen. Ringos Frustration war enorm, als er den vermeintlichen Rivalen im Studio sah und George Martin ihm den Vorzug gab. Für den Titel „Love Me Do“ wurden insgesamt 17 Aufnahmen gemacht, bei denen mal Andy White und mal Ringo trommelte. George Martin hatte ihnen vorgeschlagen, einen Song eines professionellen Songschreibers aufzunehmen, was die Beatles allerdings ablehnten. Sie wollten eigene Songs aufnehmen. So erhielt die Band „Gerry and the Pacemakers“, den Song „How Do You Do It“, den er für die Beatles vorgesehen hatte, und sie hatten damit ihren ersten Nummer 1 Hit.
„Wir waren nichts weiter als junge Burschen, die herum geschubst wurden. Wir mussten tun, was man uns befahl. Mir machte die ganze Sache keinen Spaß (Ringo Starr in: Niedergesäss, 1987, S.66).“
Als dann „Love Me Do“ am 4. Oktober 1962 in England erschien, war Ringo als Drummer der Beatles fest etabliert und niemand fragte mehr danach, wer bei dieser Aufnahme der Drummer war. Brian Epstein orderte allein für seine Läden 10.000 Kopien und viele Fans kauften sie. Am 5. Oktober reisten die Beatles zu ihrem vierten Trip nach Hamburg. Während sie im Star-Club spielten, erfuhren sie, dass „Love Me Do“ es auf den 17. Platz der nationalen Hitparade geschafft hatte. Das war mehr, als sie erwartet hatten. Sie blieben noch über den Jahreswechsel in Hamburg. Am 11. Januar 1963 erschien dann ihre zweite Single „Please, Please Me“, während sie auf einer Schottland-Tournee waren. Schon direkt, nachdem sie diesen Titel aufgenommen hatten, hatte ihnen George Martin zu ihrem ersten Nummer 1 Hit gratuliert. „Please Please Me“ mit seinem etwas frivolen Text war anders als alles bisher Dagewesene: schnell, heftig und lebendig, ein pulsierender, zwei Minuten langer Adrenalinrausch mit (….) großartigen Harmonien (vgl. Daily Mail, 2015, S.27). Dieser Titel stieg wie eine Rakete und wurde in kurzer Zeit die Nummer 1 in der englischen Hitparade. Für eine Viertel Million verkaufter Platten erhielten sie für „Please Please Me“ ihre erste „Silberne Schallplatte“. Die Beatles waren bei den Großen der Musikszene angekommen!
„Unbestritten ist, dass Martin es meisterhaft verstand, aus den oft rohen Vorlagen der Hitfabrik Lennon/McCartney den Sound zu formen, der sich seit den 60er Jahren milliardenfach auf den Plattentellern drehte und der uns auf Lebzeiten nicht mehr aus den Ohren gehen wird (Schoeler/Schmidt in: Bratfisch, 2002, S. 345).“
3. Beatlemania und der Aufstieg zu nationalen Helden
George, Ringo, Paul und John vier junge Burschen zu Beginn ihrer sagenhaften Karriere
Trotz des phänomenalen Erfolgs ihrer Single „Please Please Me“ und obwohl Jugendliche wiederholt in Hysterie und Ekstase geraten waren, reagierten die großen Zeitungen noch kaum auf die Beatles. Die Presse brauchte sehr lange, um auf die Sensation aus Liverpool einzugehen. Immerhin hatten die Beatles in Liverpool eine gute Presse, wo nun ausgiebig über ihre Platten und künftige Neuerscheinungen berichtet wurde. Die Beatles waren zwar nun eine lokale Attraktion der Mersey-Region aber im Rest des Landes noch weitgehend unbekannt. Aufgrund ihres aktuellen Erfolgs wurden sie aber nun eingeladen, als Vorband des damaligen Teenie-Stars Helen Shapiro eine Großbritannien-Tour mitzumachen. Das war für sie die Chance, sich dem Publikum im ganzen Land zu stellen und herauszufinden, ob sie auch außerhalb Liverpools die Leute begeistern konnten. Zudem förderte die Tournee den Verkaufserfolg ihres aktuellen Hits. Zu Beginn der Helen-Shapiro-Tournee erregten sie kaum sonderliches Aufsehen. Als im Verlaufe der Tournee aber „Please Please Me“ zur Nummer 1 wurde, registrierten die Popfans sie aufmerksamer und in der Londoner Zeitung „The Evening Standard“ erschien ein erster Artikel über die Beatles. Gegen Ende der Tournee war der Beifall für sie schon fast größer als der für die Hauptattraktion Helen Shapiro.