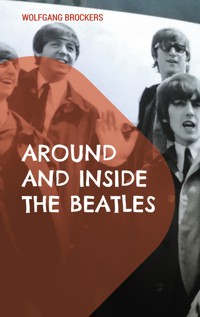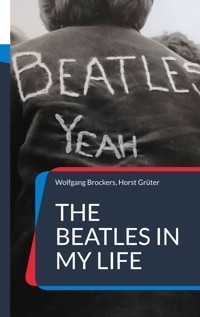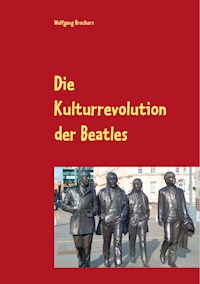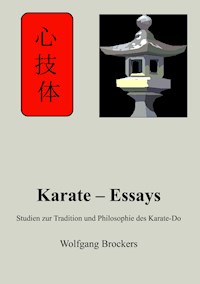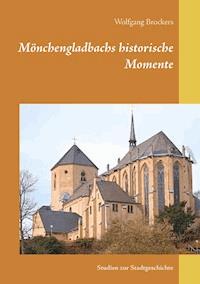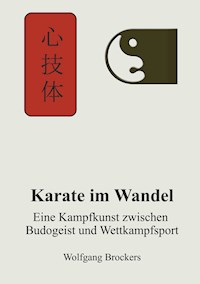
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Als Karate vor ca. 50 Jahren Eingang in die westliche Sportkultur fand, faszinierten daran zunächst die technische Seite und der Selbstverteidigungswert. Erst Jahrzehnte später begann die Auseinandersetzung mit der geistig-spirituellen Dimension der Kampfkunst Karate. Im Bemühen, zur Essenz des Karate vorzudringen, wurde jedoch häufig vernachlässigt, dass diese Kampfkunst in seiner Traditionslinie schon vielfache Veränderungen und auch Traditionsbrüche erfuhr. Sowohl die jahrhundertealte asiatische sowie die jüngste westliche Karatetradition zeigen, dass es zu keiner Zeit das Karate gab, sondern dass es – wie jedes Kulturgut – einem ständigen Veränderungsprozess unterliegt. Dieser Wandel wird im vorliegenden Band aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Brockers
Karate im Wandel
Eine Kampfkunst zwischenBudogeist und Wettkampfsport
Books on Demand
GEIST – TECHNIK – KÖRPER
Schriften zu den Hintergründen der Budokünste
herausgegeben von
Matthias v. Saldern
Band 9
Hinweise
a) Zweck der Schriftenreihe Geist – Technik – Körper besteht im Aufarbeiten der Hintergründe der Kampfkünste.
b) Zu den Hintergründen gehören historische, philosophische, systematische, theoretische und sportwissenschaftliche Arbeiten.
c) Die Schriften können Monografien ebenso wie Sammelbände sein.
d) Bitte beachten Sie die Inserenten am Ende des Bandes.
Vorwort
In der noch recht jungen Karate-Tradition lassen sich schon eine Menge Veränderungen, differenzierende Entwicklungen und sogar Traditionsbrüche feststellen. Aber wie jedes Kulturgut unterlag und unterliegt auch Karate den verändernden Einflüssen des jeweiligen Zeitgeistes und des sich stets wandelnden kulturellen Umfeldes. Dazu ist es normal, dass jede Schülergeneration unter anderen Umständen ausgebildet wird und ihre Kampfkunst unterschiedlich interpretiert. In einer Welt, die sich ständig verändert, kann auch das Erbe einer Kampfkunst wie Karate-Do keine statische Größe sein.
Während in der fachliterarischen Aufarbeitung des Phänomens Karate sehr häufig die Wurzeln und die zu bewahrende Tradition im Vordergrund standen und viele engagierte Karateka die Entwicklung zum Wettkampfsport als sehr problematisch ansehen, befasst sich die vorliegende Arbeit mit Aspekten des unübersehbaren Wandels. Karate ist inzwischen ein weltweit verbreiteter Kampfsport geworden. Gerade der Shotokan-Stil wurde auch als Wettkampfsport von Japan aus in die Welt exportiert. Da Karate eine spezielle Form der sportlichen Körperkultur darstellt, war es eine zwangsläufige Entwicklung, dass die im Westen entstandenen Karateverbände Aufnahme in die nationalen und internationalen Sportverbände suchten und fanden. Damit wurde Karate aber auch gleichzeitig Bestandteil der globalen modernen Sportkultur mit nationalen Meisterschaften und sogar Weltmeisterschaften. Dadurch erhielt der moderne Sport einen starken Einfluss auf den rein japanischen Charakter der Kampfkunst Karate. Seither wurde dann auch die Frage des Selbstverständnisses zwischen traditioneller Budokunst und modernem Sport ein Thema der Fachdiskussion.
Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Aufsätze behandeln verschiedene Aspekte der Kampfkunst Karate. Dabei spielt der Gedanke des Wandels in der Karatetradition und -auffassung, insbesondere die Auswirkungen des Wettkampfsports auf Karate, eine wichtige Rolle. Der erste Beitrag behandelt ausführlich die Entwicklung der Shotokan-Stilrichtung, die weltweit wohl die am weitesten verbreitete ist. Der zweite Aufsatz untersucht die Entstehung und den Wandel des Meisterbildes in den Budokünsten. Der dritte Teil stellt dar, wie selbst in der heutigen alltäglichen Trainingspraxis die philosophisch-spirituellen Aspekte der Budokunst Karate noch zur Geltung kommen können. Kinder-Karate, ein spätes Phänomen des Karatesports, ist das Thema des vierten Aufsatzes. Der fünfte Aufsatz rückt die moderne Sportkultur in den Mittelpunkt des Interesses und zeigt die Faktoren auf, die verändernde Wirkung auf das japanische Kulturgut Karate ausüben. Die Etablierung zahlreicher neuer Karate-Stile unter dem Dach des Deutschen Karate-Verbandes ist auch eine bemerkenswerte Entwicklung der jüngeren Zeit. Die letzte Arbeit geht dieser Entwicklung und der Berechtigung solch neuer Stile nach.
Dieses Themenspektrum soll dazu beitragen, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, dass Karate eine sich dynamisch entwickelnde Kampfkunst in der heutigen Sportkultur darstellt, die aber auch bemüht sein muss, ihre spezifischen Werte als Budokunst in einer zunehmend globalen, westlich geprägten Sportkultur zu bewahren, um ihr spezifisches Profil nicht zu verlieren. Der Anhang bietet dazu noch eine Sammlung von Grundsatzpositionen von anerkannten Meisterpersönlichkeiten sowie repräsentativer Verbände zum Karate-Do. Bei genauer Lektüre finden sich nicht nur verbindende, übereinstimmende Auffassungen von Karate, sondern auch feine, aber wesentliche Unterschiede und Abweichungen von der vorhergegangenen Traditionslinie, die damit auch den Prozess des Wandels belegen.
Meinem Kollegen Harald Blockhaus, der als Germanist meiner Arbeit den richtigen sprachlichen und grammatischen Schliff verliehen hat, danke ich an dieser Stelle ganz herzlich. Außerdem gilt mein besonderer Dank erneut meinem Karate-Kameraden Dr. Matthias von Saldern für seine Unterstützung und Ermutigung zur Veröffentlichung dieser Arbeit.
Mönchengladbach im April 2012
Inhaltsverzeichnis
Shotokan-Ryu Karate
1 Einleitung
2 Traditionslinien des Shotokan-Karate
3 Reflexionen und Bewertungen
Das Meisterbild in der Tradition des Karate-Do
1 Ursprünge in der chinesischen Frühgeschichte
2 Vom spirituell-moralischen Lehrer zum Meister der Kampfkünste
3 Der Wandel von der Kriegskunst zum Budo unter dem Einfluss des Zen
4 Meister der japanischen Budokünste im frühen 20. Jahrhundert
5 Der Sensei – das Bild des Meisters in den Budokünsten
6 Ausnahmeathleten der JKA formen ein sportliches Meisterbild
7 Die Rolle des Meisters im heutigen Karate-Sport
8 Authentische Karate-Meister von heute
9 Fazit
Östliche Spiritualität in der Karate-Alltagspraxis
1 Einleitung
2 Religion ohne Gott – Merkmale östlicher Spiritualität
3 Spiritualität in der Trainingspraxis des Karate-Do
Kinder-Karate oder Karate für Kinder
1 Einleitung
2 Kinder-Karate
3 Erkenntnisse und Bewertungen
Moderne Sportkultur und Budogeist
1 Einleitung
2 Dimensionen des modernen Sports
3 Schlussbetrachtung
Immer neue Karatestile
1 Traditionelle japanische Karatestile – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
2 Orientierungsmarken in einem Metier mit unscharfen Profilen
3 Zur Vielzahl der neuen Stile im Deutschen Karate Verband
4 Erkenntnisse und Bewertungen
Anlagen
Shotokan-Ryu Karate
Tradition und Entwicklung des Shotokan-Stils vom Ursprung bis heute
1 Einleitung
Im Deutschen Karate-Verband findet heutzutage eine Vielzahl von Stilrichtungen eine gemeinsame sportpolitische Dachorganisation. Doch hat sich dabei die Karate- und Kampfkunstszene so vielfältig ausdifferenziert und spezialisiert, dass es kaum noch möglich ist, einen Überblick zu bewahren. Zu den etwa 20 im Deutschen Karate-Verband (DKV) vertretenen Stilrichtungen gehören u.a. die vier Haupt-Karatestile Japans Shotokan, Goju- Ryu, Shito-Ryu und Wado-Ryu. Von allen ist jedoch die Stilrichtung Shotokan die mitgliedermäßig am stärksten vertretene und traditionsreichste in der deutschen Karateszene.
Aufgrund der zunehmenden sportpolitischen und wettkampfmäßigen Verflechtungen der Stilrichtungen innerhalb des DKV, aber auch wegen der insgesamt größer und vielfältiger gewordenen Karateszene scheint es so, dass das spezifische Profil der Stilrichtungen unscharf geworden ist. Aus der Sicht der Shotokanvertreter bestand bislang kaum das Bedürfnis einer Stildefinition und –interpretation, zumal Shotokan die größte Stilrichtung war und ist und dazu viele andere, neuere Richtungen darauf aufbauen bzw. davon abgeleitet sind.
Angesichts dieser Situation mit kooperierenden, aber auch konkurrierenden Stilrichtungen stellen sich nun aber doch Fragen, wie etwa: “Was macht das Besondere des Shotokanstils aus?“ oder: „Ist in der heutigen Zeit die Bewahrung einer Reinheit des Karatestils überhaupt noch möglich und überhaupt sinnvoll?“
Um auf solche Fragen eine Antwort zu finden, ist es nötig Klarheit über seinen Karatestil hinsichtlich seines Ursprungs, seines Anspruchs, seiner Entwicklung und seiner Rolle innerhalb des Sportverbandes zu gewinnen. Darum sollen nun nachfolgend die Wurzeln und die Traditionslinien des Shotokan sowie das spezifische technische Profil dieser Stilrichtung aufgezeigt und erläutert werden. Dabei wird es zwangsläufig auch um die Person Funakoshis, des Vaters und Namensgebers des Shotokan-Karate, gehen müssen, um sein Karate und um sein Verständnis seiner Kampfkunst.
2 Traditionslinien des Shotokan-Karate
2.1 Wurzeln in Okinawa
Die Wurzeln des Shotokan-Karate liegen – wie die anderer Stilrichtungen auch - in Okinawa. Seit Jahrhunderten hatte Okinawa durch politische, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen aus China Kampfkunstimpulse aus dem „Quan-fa“ erhalten, sowohl von den nördlichen „langen“ wie auch von den südlichen „kurzen“ Stilen. Diese bestanden maßgeblich in der Übermittlung verschiedener Kata. Die chinesische Kampfkunst wurde mit dem bereits auf Okinawa existierenden Verteidigungssystem „Tode“ - offenkundig eine sprachliche Modifikation der älteren Bezeichnung „tangte“ (China-Hand mit Bezug zur Tang-Dynastie), was auch auf einen chinesischen Einfluss auf die alte okinawanische Kampfkunst hinweist – verbunden. Daraus entstand das „Okinawa-te“, woraus sich Karate entwickeln sollte. Dieses Okinawa-te basierte auf einem Grundpool von 24 Kata unterschiedlichster Charakteristik und wurde verstärkt in drei Zentren, in den Orten Naha, Tomari und Shuri, im Geheimen aus-geübt und gelehrt. Daher spricht man auch vom Naha-te, das maßgeblich vom südlichen chinesischen Stil beeinflusst war und woraus sich später das Shorei-Ryu Karate ableitete, sowie vom Shuri-te und Tomari-te, die mehr der nördlichen chinesischen Linie folgten und die das Shorin-Ryu Karate bildeten. Die heute bekannten insgesamt ca. 60 Kata basieren als Abwandlungen oder Variationen, die als solche auf Okinawa entstanden, auf den ursprünglich 24 Kata. Aus diesem Basispool der Kata wählten die Lehrer einige wenige Kata – manche sogar nur eine – und machten diese zur Grundlage ihrer Lehre bzw. ihres Kampfstils. So entstanden zwar unterschiedliche Schulen innerhalb der Okinawa-te Kampfkunst, doch sahen sich diese Schulen als Teil des Gesamtsystems und nicht als eigene Stilrichtung. Da man nur heimlich übte, zunächst um den verhassten japanischen Herrschern keine Kenntnis des Okinawa-te zu geben und später aus Rivalität der Schulen untereinander, gab es nur spärliche Kontakte der Schulen untereinander und so war es unvermeidlich, dass aufgrund der unterschiedlichen Interpretationen und Lehrweisen viele Kata Veränderungen erfuhren. So gab es mindestens vier verschiedene Versionen der Kushanku-Kata (Kanku-dai), die von einem chinesischen Diplomaten gleichen Namens einst nach Okinawa gebracht wurde. Die Geheimhaltung des Okinawa-te wurde erstmals im Jahr 1901 für eine Demonstration anlässlich des Besuchs eines japanischen Schulkommissars aufgehoben. Aufgrund seines Berichts wurden von Anko Itosu die fünf Pinan (Heian) Kata als künstliche Kata aus den traditionellen Kata geschaffen und 1905 zur Körperertüchtigung an den Schulen eingeführt, was mehrere Meister Okinawas schon als Verrat ansahen und Itosu deswegen anfeindeten.
2.2 Funakoshi Gichin, Azato und Itosu
Funakoshi Gichin (1868-1957) wurde als einziger Sohn einer Samurai-Familie in Shuri geboren. Schon im Grundschulalter begegnete er Meister Anko Azato, dem inneren Schüler der Matsumura-Linie des Shuri-te, und begann bei ihm den Unterricht. Azato war ein reicher Gutsherr mit einer nahezu fürstlichen Stellung auf Okinawa. Er hatte es nicht nötig, für Geld zu unterrichten; daher hatte er keine Schule, sondern nur einzelne Privatschüler, die er abends und nachts unterrichtete. Als Nachfolger Matsumuras übte Azato wie dieser auch den Schwertstil „Jigen-Ryu“, einen äußerst dynamischen sowie körper- und kampfbetonter Stil. Funakoshi bezeichnete Azato später als den größten Karate-Experten seiner Zeit.
Abbildung 1: Funakoshi Gichin
Funakoshi wurde einer von zwei Schülern Azatos. Darüber hinaus war er oft Gastschüler von Itosu, einem brillanten Lehrer des Shuri-te, der durch viele Veränderungen und Neuinterpretationen der Kata das Shuri-te perfektionierte. Auf ihn geht das heutige Shito-Ryu Karate zurück. Auf diese Weise wurde der junge Funakoshi Gichin von zwei der bedeutendsten Meister ausgebildet. 1891 wurde er als Hauptschullehrer nach Naha versetzt, wo er mit den Meistern Aragaki und Higashionni trainierte, ohne dass sein Kontakt zu Azato und Itosu abriss. Dadurch erhielt er eine umfassende Ausbildung im Okinawa-te Karate. 1913 gab er seine Lehrertätigkeit auf und widmete sich ausschließlich den Kampfkünsten. 1921 kam es anlässlich des Besuchs des japanischen Erbprinzen, des späteren Kaisers Hirohito, zu einer Vorführung der Meister Okinawas, was eine Einladung des japanischen Kultusministeriums bewirkte, das okinawanische Karate in Tokyo vorzustellen. Diese Einladung war an die Vereinigung der Kampfkünste Okinawas ergangen. Nach langen Beratungen wurde Funakoshi für diese Aufgabe ausgewählt. Er hatte die Kampfkunst Okinawas auf hohem Niveau gemeistert, war ein Mann von hoher Bildung – er war Kenner des Konfuzianismus und des Zen, sowie ein Meister der Dichtung und Kalligrafie – und sprach japanisch. Er schien der geeignete Botschafter zu sein, die Kampfkunst Okinawas in Japan zu verbreiten und damit einen Brückenschlag zwischen den lange Zeit verfeindeten Ländern Okinawa und Japan zu leisten.
2.3 Funakoshi Gichins Shotokan Karate und die Japanisierung des Okinawa-te
Im Mai 1922 präsentierte Funakoshi anlässlich der „Ersten jährlichen Sportschau“ in Tokyo mit Demonstrationen, Bildern und Schriften die Kampfkunst Okinawas. Damit erregte er – besonders bei der japanischen Budo- Prominenz – großes Aufsehen. Selbst der legendäre Judogründer Kano wollte bei ihm Karate lernen, und wenige Tage später wurde Funakoshi von Kano ins Kodokan eingeladen und etwa einhundert ausgewählten Judokas vorgestellt.
Dazu erreichten ihn Einladungen und Aufforderungen von verschiedenen Institutionen, wie etwa der Militärakademie, der Richtervereinigung oder der Hochschule für Körpererziehung, in Tokio zu bleiben, um Vorträge zu halten und Demonstrationen zu geben. Deshalb unternahm er zu diesem Zweck viele Reisen in Japan und kehrte nicht, wie er ursprünglich geplant hatte, nach Okinawa zurück. Trotz dieser positiven Resonanz gelang es ihm erst 1924 und 1926, erste Karate-Clubs an Universitäten zu gründen; 1927 gar mehrere an verschiedenen Hochschulen. Allerdings musste Funakoshi sich mit unerwarteten Schwierigkeiten auseinandersetzen. Die Mentalität der Japaner war völlig verschieden von der der Okinawaner. Die Japaner waren seit der Öffnung zum Westen auf Vergleich, Konkurrenz, Wettkampf und Leistungssteigerung orientiert, wie dies Kano, der dem westlichen Sport und insbesondere der Erneuerung der olympischen Bewegung sehr zugetan war, mit der Versportlichung des Judo schon umgesetzt hatte. Daher fand Funakoshi bei seinen jungen japanischen Schülern für seine traditionelle Lehrweise mit Kata, Bunkai, Makiwara- und Abhärtungstraining wenig Gegenliebe. Es gab bald Interessenskonflikte und einige Schüler, die Wettkampfkonzepte verfolgten, wurden von ihm des Dojos verwiesen. Der Widerspruch zwischen den Schülerinteressen und Funakoshis Auffassung führte auch dazu, dass sein von ihm geschätzter Schüler Otsuka sich von ihm trennte und das spätere Wado-Ryu gründete. Dennoch sah sich Funakoshi gezwungen, Kompromisse einzugehen und von seiner strengen Lehrweise abzurücken, die weniger auf praktische Nutzanwendung als auf ganzheitliche Persönlichkeitsreife incl. moralischer und spiritueller Aspekte ausgelegt war. Dies belegen die Aussprüche „Karate ist die Kampfkunst der Tugendhaften“ und „Faust und Zen sind eines“ knapp aber sehr deutlich.
Funakoshis Ausbildungskonzept basierte auf den Kata gemäß der Itosu- Schule, wobei er zunächst eine Auswahl von ca. 25 Kata, die möglichst das gesamte Karate Okinawas repräsentieren sollten, vornahm. Er stellte jedoch bald fest, dass dies zu umfangreich und zu anspruchsvoll war. Darum reduzierte er die Zahl und legte schließlich einen für sein Karate klassisch gewordenen Kanon von folgenden Kata fest, nämlich
Heian (Pinan) 1 - 5
Tekki 1 -3
Empi
Jitte
Bassai-dai
Jion
Kanku-dai
Hangetsu
Gangaku
Dazu nannte er die von ihm konzipierte „Ten no Kata“ als Kumiteform, die insbesondere im Partnertraining Timing und Distanz schulen sollte.
Während die Mehrzahl der ausgewählten Kata aus der Tomari-te- bzw. Shuri-te-Schule stammten, nahm er die Tekki, Jitte, Jion und Hangetsu aus der Naha-te-Linie. Die Auswahl der Kata und ihre Charakteristika zeigen, dass er sich bemühte, das gesamte Karate Okinawas weiterhin exemplarisch zu repräsentieren und durch die Praxis dieser Kata einen Zugang zu Okinawas Gesamtsystem zu ermöglichen.
Angeregt durch Funakoshi, der das Okinawa-Karate in Japan verbreitete, folgten ihm andere Meister aus Okinawa. Allerdings gingen sie nicht nach Tokyo, weil dort schon Funakoshi lehrte, sondern nach Osaka, Kobe oder Wakayama. Zu dieser Zeit konnten Shito Ryu von Meister Mabuni und das Goju-Ryu von Meister Miyagi als eigenständige Karatestile in Japan Fuß fassen. Viele Karatelehrer aus Okinawa kamen nach Japan und ließen sich als „Stilgründer“ bezeichnen, ohne jedoch etwas substanziell Neues in der Karatekunst bieten zu können. Entsprechend negativ äußerte sich Funakoshi dazu, wenn man versuchte, sein Karate als besonderen Stil zu bezeichnen: „Ich habe dem Karate, welches ich studiere, nie einen Namen gegeben, aber einige meiner Schüler nennen es Shotokan-ryu.“ (Funakoshi, in: Karate-Do Nyumon, S. 34) Der Name Shotokan resultierte aus dem Künstler- bzw. Kosenamen „Shoto“ für Funakoshi, womit er seine Dichtungen und Kalligrafien signierte, und der Bezeichnung „kan“ für Halle, Raum, wo er lehrte.
Ein besonderes Problem hatte Funakoshi damit, sein Karate von der mächtigen halbstaatlichen Dachorganisation für japanische Kampfkünste „Butokukai“, die fest in der Hand von Politik und Militär war, anerkennen zu lassen. In jener Zeit des überschwänglichen japanischen Nationalismus und der traditionellen Feindschaft zu China konnte keine okinawanisch-chinesische Kunst Anerkennung finden. Dafür forderte man die Einführung eines Gürtelgradsystems (Funakoshi besaß keinen solchen Grad), einer Prüfungsordnung, eines Karategis, was Funakoshi alles akzeptierte. Vor allem aber wurde die Änderung des Schriftzeichens für die Bezeichnung von Funakoshis Kampfkunst gefordert, denn die alte Schreibweise wurde als „China-Hand“ gelesen. Mit der Hilfe des mit ihm befreundeten Abts Asahina Sogen des Zenklosters Engakuji änderte Funakoshi schließlich die Schreibweise für Karate so, dass sie nun als „leere Hand“ gelesen wurde. Damit wurden einerseits der Charakter der waffenlosen Kunst und andererseits der Bezug zu den Werten des Zen-Buddhismus hervorgehoben, denn der Begriff der Leere ist ein zentraler Begriff der buddhistischen Philosophie. Funakoshi begründete die Änderung auch damit, dass sein Karate-Do, wie er seine Kampfkunst seit seiner Lehrtätigkeit in Tokyo nannte, keine Ähnlichkeit mehr mit den chinesischen Künsten wie dem Shaolin-Kempo habe. Mit diesen Änderungen, die faktisch die Japanisierung des Karate bedeuteten, wurde das Shotokan-ryu Funakoshis als japanische Kampfkunst anerkannt und galt damit bald neben den anderen inzwischen etablierten Stilrichtungen wie Goju-Ryu, das sich aus der Naha-te-Schule entwickelte, Wado-Ryu und Shito-Ryu, das sich aus der Itosu-Linie entwickelte, als Hauptstilrichtung des Karate. Andere Stilrichtungen, die sich nicht den Forderungen des Butokukai unterwarfen, wurden allmählich an den Rand der Szene gedrängt.
An dieser Stelle lohnt es sich innezuhalten und festzustellen, dass, bedingt durch die äußeren Umstände, Funakoshi sein ursprüngliches Karate aus Okinawa schon erheblich verändert hatte, insbesondere was die äußere Erscheinung betraf. So ist es bemerkenswert, dass er selbst konstatierte, dass sein Karate nichts mehr mit den chinesischen Ursprüngen zu tun gehabt habe – wahrscheinlich entgegen besseren Wissens. Vielleicht ist dies aber auch der geistigen Mentalität der Japaner jener Zeit geschuldet, die negativ allem Chinesischen gegenüber eingestellt waren und aus dem gleichen Grund bis heute den Zen-Buddhismus aus Indien ableiten und nicht anerkennen wollen, dass Zen ein eindeutiges Produkt des chinesischen Geistes ist.
2.4 Shotokan-Ryu - die Veränderung des Stils durch Funakoshi Yoshitaka
1936 wurde in Tokyo Funakoshis erstes privates Dojo eröffnet. Dadurch, dass Funakoshi sich an den angesehensten Universitäten etabliert und seine Schüler sorgfältig ausgesucht hatte, genoss er in den besten Kreisen Tokyos einen guten Ruf. Inzwischen leiteten seine Meisterschüler Hironishi und Egami, insbesondere sein dritter Sohn Yoshitaka (Gigo), das Training unter seiner Aufsicht. Ab 1938 wurde Yoshitaka der Hauptausbilder. Mit der heranwachsenden dritten Meistergeneration stieg wieder der Druck in Richtung Wettkampf, so dass Funakoshi nach und nach Kumiteformen wie Gohon-, Sanbon- und Ippon-Kumite und später sogar Jyu-Kumite zuließ, aber Wettkampf weiterhin beharrlich ablehnte, weil er darin eine Gefahr für das Wesen seines Karate-Do sah: Das Streben nach Sieg und das Triumphieren über andere verkehre die inneren Werte des Do und des Zen ins Gegenteil, denn dabei suche man den Weg der Bescheidenheit und Demut bis hin zur meditativen Aufgabe des Egos, um zur Einheit mit dem „Tao“ bzw. „Do“ zu gelangen. Wie Zeitgenossen berichteten, gab es häufig Streit zwischen Vater und Sohn, weil Yoshitaka zunehmend andere, kämpferische Elemente ins Training einbrachte und damit Funakoshis Karate, das bis dahin ausschließlich der Itosu-Schule folgte, immer mehr veränderte. Zusammen mit Egami und Hironishi schuf Yoshitaka schließlich einen ganz neuen Stil, der völlig andere Bewegungsprinzipien verfolgte als die anderen bis dahin bekannten Stile. Yoshitakas Shotokan war viel körperbetonter, dynamischer und kämpferischer als das seines Vaters und ähnelt dem heutigen Shotokan sehr. Da nicht anzunehmen ist, dass Yoshitaka dieses System selbst kurzfristig entwickelt hatte, ist man sich in Fachkreisen weitgehend einig, dass er diesen Stil eigentlich nur von seinem Vater – quasi als geheime innere Lehre – gelernt haben konnte. So spricht vieles dafür, dass es sich um den Stil Azatos handelte, der stark vom Schwertstil Jigen-Ryu und vom Samuraikampf beeinflusst war und den Funakoshi Gichin nie in Japan gelehrt hatte. So war unter den Augen des alternden Meisters dessen Karate-Do durch seinen Sohn grundlegend verändert worden. (Vgl. Lind, 1995, S. 198 ff)
Folgt man Funakoshi Gichins Selbsteinschätzung, wonach er keinen eigenen Karatestil vertrat und die Namensgebung Shotokan nur auf seine Person bzw. sein Dojo bezogen war, dann muss man einräumen, dass nun durch Yoshitaka definitiv unter dieser Bezeichnung eine neue Stilrichtung entstanden war, die das bisherige Stilkonzept völlig veränderte und die man eigentlich Shotokan-Ryu nennen müsste. Über das technische Profil des veränderten Shotokan-Stils lassen sich aus dem späteren JKA-Shotokan Rückschlüsse ziehen. Ob damit auch eine Veränderung der ethisch-geistigen Ausrichtung, die seinem Vater sehr wichtig war, einherging, ist heute kaum noch zu beurteilen, solange dazu keine Quellen von Zeitzeugen vorliegen.
Yoshitaka war außerdem ein ehrgeiziger und politisch ambitionierter Mann. Aufgrund der imperialistischen, auf Krieg gerichteten Politik Japans in den 1930ern setzte das Militär die Budo-Schulen zunehmend unter Druck, dem Militär wirkungsvolle Nahkampf- und Einzelkämpfertechniken zur Verfügung zu stellen. Mit Blick auf seine politischen Ambitionen entschloss sich Yoshitaka offenkundig, dem Militär seine Kenntnisse zur Verfügung zu stellen, und so bildete er bald darauf in ehemaligen Dojos Einzelkämpfer, Kamikazepiloten und Spione aus.
Während des Weltkriegs wurde das Shotokan-Hauptdojo durch Bomben zerstört, viele Instruktoren kamen im Krieg um und Yoshitaka selbst starb 1945 an Tuberkulose, wodurch der Shotokan-Stil seinen Hauptausbilder verlor. Der alternde Funakoshi – nun 76 Jahre alt – kehrte darauf nach Kyushu zurück, wo er erstmals seit 1922 seine Frau wiedersah. Als sie 1947 starb, kehrte er nach Tokyo zurück. An zwei Universitäten traf er seine Meisterschüler Egami, Hironishi und Noguchi, die dort wieder Karate lehrten. Er beauftragte Egami damit, die Kampfkunst in seinem Namen weiterzuführen, was Egami dann auch in der Shotokai-Organisation tat, wenn auch nicht mit dem genauen Stilkonzept Funakoshis.
Abbildung 2: Funakoshi unterrichtete auch noch als 80-jähriger
2.5 Nakayama, die JKA und die Entwicklung des Shotokan zum Wettkampfsport
Nakayama Masatoshi, Spross einer alten Samurai-Familie, begann 1932 mit dem Karatetraining an der Takushoku-Universität unter Meister Funakoshi und gehörte der gleichen Schülergeneration an wie Egami und Hironishi. Nakayama blieb dort aber nur vier Jahre Schüler Funakoshis und galt zu der Zeit noch nicht als Meister. 1937 ging er nach China, wo er zunächst die Universität Peking besuchte und danach einige Jahre für die japanische Besatzungsverwaltung in der Mandschurei arbeitete. Als er 1946 zurückkehrte, hatte er von den Veränderungen, die durch Yoshitaka erfolgt waren, keine Kenntnisse. Yoshitaka lebte nicht mehr, aber inzwischen waren andere seiner Generation, nämlich Egami, Hironishi aber auch Hidetaka Nishiyama oder Obata Isao zu anerkannten Größen und Meistern des Shotokan aufgestiegen, und diese erkannten Nakayama nun nicht mehr als ihresgleichen an. Aus diesem Sachverhalt und wahrscheinlich aus der Tatsache, dass Nakayama ein sehr ehrgeiziger und machtorientierter Mann war, hatte er kein gutes Verhältnis zu diesen neuen Leitern des Shotokan-Dojos. Darum wandte er sich an die jungen Takushoku- Karateschüler, mit deren Hilfe er sich um Aneignung der Neuerungen bemühte.
Dort warb Nakayama intensiv für seine Idee, Karate in einen Wettkampfsport zu verwandeln. Die meisten Shotokan-Meister zeigten ihm jedoch zunächst die kalte Schulter. Doch es gelang ihm schließlich, Nishiyama und Isao für seinen Plan zu gewinnen. Mit diesen gründete er 1949 die Japan Karate Association (JKA) mit dem Ziel, ein Wettkampfkonzept und Regelwerk auszuarbeiten sowie Karate als Wettkampfsport zu verbreiten.
Damit einher gingen nun erneut deutliche Veränderungen des technischen Profils. Ausgehend vom Shotokan-Stil Yoshitakas zielte die Ausbildung im neuen JKA-Konzept nun weniger darauf, im Ernstfall zu überleben, sondern darauf Kämpfe durch schnelle Punkte zu gewinnen und weniger darauf im Ernstfall zu überleben. Daraus musste sich zwangsläufig eine Vernachlässigung nicht wettkampfrelevanter Techniken, des Bunkai-Trainings aber auch der geistig-ethischen Werte ergeben, denn das Siegstreben fördert den Egoismus und Individualismus. Die meisten Techniken, etwa der Kanku-dai oder Bassai-dai, sind für den Wettkampf kaum zu gebrauchen; und Zielregionen schnell und virtuos zu erreichen, ist etwas anderes, als den Gegner zerstörende Techniken einsetzen zu können, was auch ein ganz anderes Distanzverhalten erfordert. Mit der Orientierung hin zu Wettkampf und –erfolg löste sich das Techniktraining vom bisherigen Fixpunkt Kata, die mehr auf Ernstfall und Nahkampf bezogen war. Die Techniken wurden auf Distanzkampf ausgerichtet; sie wurden noch länger und dynamischer. Dabei spielten reine Angriffstechniken nun zunehmend eine Rolle. Damit wurde aber Funakoshis Leitgedanke, dass es im Karate keine erste Bewegung (also keinen Angriff) gäbe, aufgehoben und ins Gegenteil verkehrt. Auch die Kata wurde nun auf den Wettkampf ausgerichtet, zur Sportübung. Athletik und Schnelligkeit wurden wichtiger, da es für eine Bewertung der Kata, nur auf äußere Wirkung ankam. Aber womöglich wurde sie für außenstehende Betrachter sogar attraktiver. Die ursprünglichen Inhalte spielten keine Rolle mehr und wurden folgerichtig in der JKA nicht mehr speziell trainiert. Dadurch wurde die Kata instrumentalisiert, ihres Sinnes entleert und zu einer Form von Wettkampfgymnastik umfunktioniert. So ist es aus der rückschauenden Betrachtung nicht verwunderlich, dass in den ersten Jahrzehnten, in denen JKA-Ausbilder in Deutschland das Karate prägten, weder Kata-Bunkai trainiert wurde noch geistig-moralische Ziele vermittelt wurden, außer dass zuweilen einige plakative moralisierende Sätze zitiert wurden. Mit der Neu-Ausrichtung des Karate-Do durch Nakayama und die JKA wurde Karate zum Sport; Technik und körperliche Grundlagen zu optimierenden Faktoren der Leistung. Die alten inneren Werte der Kata wurden unbedeutend und waren der neuen JKA-Elite nicht mehr vertraut. Schon die enorm kurze Ausbildung Nakayamas von nur vier Jahren bei Funakoshi, legt nahe, dass er kaum tiefer in die inneren Werte der Kata eingeweiht werden konnte. So gab Nakayama dann auch in einem Gespräch mit Vertrauten kurz vor seinem Tod zu, dass er die Verbindung zu den wahren Wurzeln des Karate-Do verloren hätte (vgl. Habersetzer, 2005, S. 114)
2.5.1 Nishiyama Hidetaka
Nishiyama war ein wahrer Glücksgriff für die JKA. Er wurde für viele Jahre der Chefausbilder der JKA. Aufgrund seines Könnens ist er als einer der bedeutendsten Karate-Lehrer nach dem Krieg anzusehen. Er und seine Familie genossen in Japan großes Ansehen – sein Vater hatte an der japanischen Verfassung mitgearbeitet. Durch seine Arbeit bzw. Leistung gewann die JKA schnell an Ansehen, wozu aber auch beitrug, dass die Amerikaner als Besatzungsmacht die Budo-Künste nach dem Krieg verboten hatten, Karate aber nicht, da sie dies als eine Form von Gymnastik ansahen. So strömten viele junge Leute in die Karate-Dojos und die JKA bot ihnen nun endgültig die Gelegenheit, Wettkämpfe auszutragen.
Nishiyama arbeitete auch die Wettkampfregeln aus und rief einen Instruktorenkurs ins Leben, in dem talentierte und ehrgeizige junge Leute einem äußerst harten, professionellen Training unterzogen wurden, die dann später das JKA-Karate verbreiten sollten. Zeitweilig fanden sich sogar Gogen Yamaguchi und Hironori Otsuka bereit, dort zu unterrichten. Meister Funakoshi wurde ebenfalls gefragt; er lehnte aber jede Unterstützung der JKA ab. Nishiyama wurde die Autorität des frühen JKA-Karate und war als Lehrer Nakayama weit überlegen. Seine Arbeit trug reiche Früchte. Aus seinem Instruktorenkurs gingen Größen wie Kanazawa, Asai, Shirai oder Enoeda hervor, die auf den bald folgenden japanischen Meisterschaften, die ab 1957 ausgetragen wurden, alle Titel gewannen. Sie wurden Stars und gegen Bezahlung von der JKA an andere Clubs als Trainer ausgeliehen, wodurch diese auch erfolgreicher wurden. Das machte die JKA berühmt und immer mehr Clubs wurden von ihren jungen Mitgliedern gedrängt, der JKA ebenfalls beizutreten. Aufgrund des Ansehens und Erfolgs von Nishiyama und des Geltungsbedürfnisses und Machtbewusstseins Nakayamas bahnte sich Ende der 1950er ein Autoritätskonflikt an. Dieser führte dazu, dass Nishiyama 1960 in die USA ging bzw. entsandt wurde, um dort das Shotokan Karate der JKA zu verbreiten, und wo er einen amerikanischen Karate-Verband gründete und der sich bald von der JKA löste. Vor diesem Hintergrund ist folgender Sachverhalt interessant und vielsagend, dass Nakayama in seinem als Standardwerk gepriesenen Buch „Karate-Do, Dynamic Karate“ das Gründungsjahr der JKA mit 1955 angibt, das Jahr, in dem er die Gesamtleitung der JKA übernahm, und sich allein als Chefausbilder bezeichnet! Nishiyama wird dabei keines Wortes gewürdigt!
Abbildung 3: Hidetaka Nishiyama
2.6 Die Zersplitterung des Shotokan-Stils
Nakayama bemühte sich darum – trotz aller Veränderungen – den Eindruck zu erwecken, als stände er in der Tradition von Funakoshis Shotokan, weil dieser in Japan und in der Karateszene ein außerordentliches Ansehen genoss. Die JKA ernannte zwar Funakoshi zu ihrem „Ehrenausbilder“, doch nahm dieser die Mitgliedschaft nie an. Er blieb bis zu seinem Tod 1957 bei seiner scharfen Ablehnung des Wettkampfkarates und ließ sich nie im JKA-Zentraldojo sehen. Die Etablierung des Wettkampfkarate bedeutete auch den endgültigen Bruch Nakayamas mit Meister Funakoshi. Nakayama war sich dessen bewusst; in einem Interview von 1983 gestand er:
„Wenn ich in den Himmel komme, hoffe ich, dass ich für die Erfindung des Sport-Karate nicht von Meister Funakoshi verprügelt werde. Aber ich glaube nicht, dass er sich allzusehr darüber aufregen wird. Er wollte, dass ich Karate in der ganzen Welt verbreite, und durch das Sport-Karate ist mir dies sicher gelungen.“ (Nakayama in: Lind 1995, S. 111)
Die sportlichen Erfolge hatten Nakayama und die JKA populär und selbst-bewusst gemacht. So wurden Clubs mit Nachdruck aufgefordert, der JKA beizutreten. Karateschülern von Clubs, die sich weigerten, wurde darauf das Training bei der JKA verboten. Konnten sich bis dahin die Shotokan- Karateka noch auf einer gemeinsamen Basis sehen, stellt dieses Verbot eine erste Spaltung dar. Funakoshi ernannte Egami zu seinem Nachfolger, der in Abgrenzung zur JKA sein Karate nun mit der Bezeichnung „Shotokai“, (damit wurde ursprünglich die Gruppierung bezeichnet, die durch Zuwendungen Funakoshis Lebensunterhalt sicherte) weiterführte.