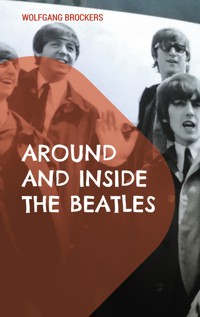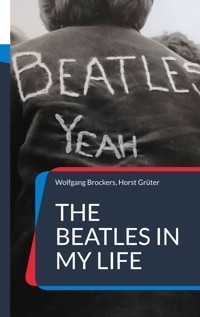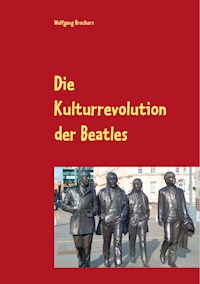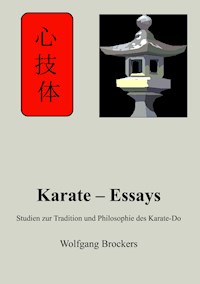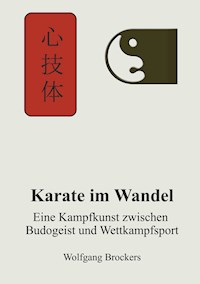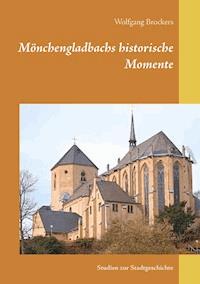
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Betrachtung der Stadtgeschichte vor dem Hintergrund und im Zusammenhang mit der großen Geschichte und Politik zeigt, dass Mönchengladbach zu bestimmten Zeiten eine herausragende historisch-politische oder kulturelle Rolle mit nationaler und internationaler Bedeutung spielte und wiederholt Schauplatz großer historischer Ereignisse war. Die vorliegende Arbeit hebt in zehn Studien – von den Anfängen im frühen Mittelalter bis zum Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts – die besondere historische Bedeutung Mönchengladbachs und die besondere Verknüpfung mit großer Politik und Kultur hervor. Dadurch ermöglicht sie ein besseres und tieferes Verständnis für die Mönchengladbacher Geschichte und erleichtert den Bürgern eine innigere Identifikation mit ihrer Stadt. Dazu wird die Lektüre dieser Studien dem interessierten und heimatverbundenen Leser so manches Aha-Erlebnis bescheren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Meine Heimatstadt Mönchengladbach erscheint heutzutage vielen Auswärtigen und auch Einwohnern etwas provinziell. Seit der Gebietsreform von 1975, wodurch Mönchengladbach mit Rheydt und Wickrath zu einer großen Stadt zusammengelegt wurde, besitzt Mönchengladbach zwar eine große Fläche und gilt mit knapp 270.000 Einwohnern als respektable Großstadt, aber es gibt innerhalb des Stadtgebietes noch viele offene Flächen, insbesondere zwischen den zusammengelegten Stadtteilen. So sind im Stadtgebiet denn auch weidende Kühe noch ein ganz normaler Anblick. Wirklich großstädtisches Flair sucht man auch im Zentrum von Mönchengladbach vergebens.
Seit dem Niedergang der hiesigen Textilindustrie ist der Strukturwandel noch nicht richtig gelungen, so dass eine immer noch recht große Arbeitslosenquote die öffentlichen Finanzen stark belastet. In den Einkaufszentren etwa von Mönchengladbach oder Rheydt wird auch schnell sichtbar, dass hier die Konsumangebote für ein wohlhabendes, begütertes Bürgertum kaum mit denen in Düsseldorf oder Köln konkurrieren können. Auch hatten unsere Stadtväter bei ihren Entscheidungen, durch bauliche Maßnahmen das Erscheinungsbild unserer Stadt aufzupolieren, nicht immer eine glückliche Hand. Aktuelle Bemühungen, Mönchengladbach als Handels- und Einkaufszentrum zu positionieren, wirken angesichts der Anziehungskraft und Konkurrenz der umgebenden Metropolen Düsseldorf und Köln etwas verspätet. Immerhin wird Mönchengladbach in jüngster Zeit doch wieder attraktiver für auswärtige Firmen, was eine wachsende Zahl von Neu-Ansiedlungen belegt.
Als gebürtigem Mönchengladbacher tut es mir immer ein wenig in der Seele weh, wenn man im Ausland oder etwa in Süddeutschland genötigt ist, Mönchengladbachs Lage durch die Nähe zu Köln, Düsseldorf und Aachen erklären zu müssen. Für Fremde ist der Name Borussia Mönchengladbach von größerem Aussagewert, dagegen können sie mit der Stadt in der Regel nichts anfangen.
Das hat Mönchengladbach nicht verdient! Abgesehen davon, dass viele Bürger hier für sich u.a. durch die zahlreichen grünen Zonen in und um Mönchengladbach eine hohe Lebensqualität entdeckt haben, gibt es weitere gute Gründe, seine Heimatstadt zu schätzen, ja sogar darauf stolz zu sein. Insbesondere beim Blick auf die mehr als 1000-jährige Geschichte der Vitusstadt erweist sich Mönchengladbach wiederholt als Schauplatz und Brennpunkt großer historischer, politischer und kultureller Ereignisse. Allein aus seiner vielfach wichtigen Rolle in der Geschichte, hat sich Mönchengladbach m.E. den Ruf einer bedeutenden Stadt verdient.
Leider sind Kenntnisse über Mönchengladbachs bedeutende historische Rolle nur noch rudimentär vorhanden und nicht mehr im Selbstverständnis der Mönchengladbacher Bürger präsent. Die nachfolgende Studie versucht nun, wesentliche Vorgänge der Stadtgeschichte vor dem Hintergrund der allgemeinen historischen und politischen Entwicklung näher zu untersuchen und damit das Verständnis für die Entwicklung Mönchengladbachs und seiner besonderen geschichtlichen Bedeutung zu verbessern. Während eine isolierte Betrachtung wichtiger Ereignisse der Mönchengladbacher Geschichte oft wenig ergiebig ist oder die besondere überregionale Bedeutung nicht ausreichend erhellen kann, bietet eine Untersuchung im Kontext mit der überregionalen Geschichte oder großen Politik oft eine klareres Bild. Dazu eröffnen sich oft auch Ansätze für Erklärungen zu Fragen, die sonst, insbesondere für die Anfänge der Stadtgeschichte, in einer Sackgasse enden. Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu liefern. Vielmehr besteht die Zielsetzung darin, auf der Grundlage vorhandenen historischen Wissens spezielle Ereignisse der Mönchengladbacher Geschichte, die von allgemeiner historischer oder überregionaler kultureller Bedeutung sind, aus der chronologischen Entwicklung herauszuheben. Für die hier vorgelegte Arbeit bot vor allem die von Wolfgang Löhr herausgegebene Stadtgeschichte „Loca Desiderata“ mit ihren mehr als 2500 Seiten in vier Bänden (der dritte wurde in zwei Teilbänden herausgegeben) einen nahezu unerschöpflichen Fundus an historischen Informationen, die hier z.T. eingearbeitet wurden. Die Einbindung besonderer Ereignisse der Stadtgeschichte in einen größeren historischkulturellen Kontext soll ein besseres Bild und Verständnis der Bedeutung Mönchengladbachs bis in die jüngere Vergangenheit hinein ermöglichen.
Wenn diese Arbeit dazu beitragen kann, dass sich Leser mehr mit Mönchengladbachs Geschichte beschäftigen oder sich mit ihrer Heimatstadt stärker identifizieren, wäre dies ein schöner Lohn meiner Arbeit.
Meiner Frau Monika und meinen ehemaligen Lehrerkollegen Marcell Heinrichs und Manfred Schmitz danke ich ganz herzlich für das zeitaufwändige Korrekturlesen, was mir sehr geholfen hat, der Arbeit den richtigen formalen Schliff zu geben. In besonderer Weise bedanke ich mich bei meinem Musikkameraden Carsten Hendricks für seine enorm zeitaufwändige Hilfe beim Layout des Textes.
Mönchengladbach im Mai 2016
Inhaltsverzeichnis
Graf Balderich und der Bau der ersten Gladbacher Kirche
Zur überlieferten Gründungsgeschichte
Der geopolitische Hintergrund – im Machtzentrum des Frankenreichs
Historische Spuren des Grafen Balderich
Zum Baujahr und zu den Reliquien der ersten Gladbacher Kirche
Die Zerstörung der Balderich-Kirche durch die Ungarn
Die Gründung der Abtei Gladbach –im Spannungsfeld kaiserlicher Politik
Lothringen – zwischen kaiserlichem Machtanspruch und Unabhängigkeitsstreben des Adels
Die Gründung der Gladbacher Abtei im Kontext der historischen Ereignisse
Sandrad – Mann der Klosterreform und Parteigänger des Kaiserhauses
Die Verlegung des Gladbacher Konvents nach Köln
Das Gladbacher Münster – ein Bauwerk von europäischem Rang
Über die Architekturstile der Romanik und Gotik
Dombauhütten und ein berühmter Baumeister
Zum Neubau der Gladbacher Abteikirche
Das Münster im Wandel der Zeiten
Der Aufstieg zur Textilmetropole dank Napoleon
Als Gladbach und der linke Niederrhein französisch wurden
Gladbachs Aufstieg zur Industriestadt und Textilmetropole
Wirtschaftsboom unter französischer Herrschaft
Industrialisierung Gladbachs unter preußischer Herrschaft
Die Hochschule Niederrhein – ein Erbe der Textilindustrie
1848/49 -eine gescheiterte Revolution und Gladbach-Rheydter Animositäten
Enttäuschte Freiheitshoffnungen und reaktionäre Politik
Das katholische Rheinland – Preußens problematische neue Provinz
Konfliktlinien
Katholische Republikaner in Gladbach und königstreue Protestanten in Rheydt
1848/49 – eine halbherzige, gescheiterte Revolution in Deutschland
Die deutsche Revolution von 1848/49
Revolutionäre Unruhen und Gladbach-Rheydter Differenzen
Mönchengladbach – Wiege und Zentrum des sozialen Katholizismus
Die Kehrseite der Medaille - Not und Armut der Arbeiter
Moderne Sklaven in der Hölle der Fabriken
Die Lage der Arbeiter im Bereich der Gladbacher Industrie
Wie soll die soziale Frage gelöst werden?
Lösungsansätze für die sozialen Missstände
Antworten auf die ‚Soziale Frage‘ aus Mönchengladbach
Christliches und bürgerliches Engagement für notleidende Mitbürger
Vorbildlicher sozialer Wohnungsbau
Franz Brandts und der Volksverein für das katholische Deutschland
Gladbach und Rheydt vereint –der schwierige Prozess und ein zweifelhafter Ehrenbürger
Erfolglose erste Initiativen
Erfolgreiche Zusammenschlüsse in der Weimarer Republik
Die kleine Lösung
Die erneute Städtetrennung und die Rolle des Ehrenbürgers Joseph Goebbels
Dr. Joseph Goebbels – ehemaliger Ehrenbürger der Stadt Rheydt
Die erneute Städtetrennung
Die Kommunale Einheit durch die Gebietsreform von 1975
Mit Hitlers Nationalsozialismus in den Abgrund
Hitler formt aus einer liberalen Demokratie eine totalitäre Diktatur
Mönchengladbach unter nationalsozialistischer Herrschaft
Radikaler Umbruch der politischen Kultur
Die Gleichschaltung des öffentlichen Lebens in Gladbach-Rheydt
Verfolgte und Opfer des NS-Regimes
Zerstörung und Verwüstung der Stadt durch Hitlers Krieg
Kriegsorientierte Außenpolitik
Der Zweite Weltkrieg, Deutschlands Niederlage und Hitlers Verrat
Krieg und Zerstörung in Mönchengladbach
Das Hauptquartier – Kommandozentrale der NATO im K. Krieg
Von der Kooperation zur Konfrontation - aus Bündnispartnern werden Gegner
Die Deutschlandpolitik der Sieger und die Entstehung des Kalten Kriegs
Währungsreform, Berliner Blockade und Luftbrücke
Die Gründung der NATO und der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland
Mönchengladbach als Baustein der NATO-Verteidigungsstrategie
Die militärischen Planungen zum Schutz Europas
Mönchengladbach als neuer NATO-Standort
Das größte Bauprojekt in der Geschichte Mönchengladbachs
Führungsstruktur und gesellschaftliches Leben im HQ
Das Ende des Kalten Kriegs und s. Auswirkungen auf das JHQ
Eine neue weltpolitische Lage nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
Abzug der Militärstäbe, Neubesetzung und Schließung des Hauptquartiers
Mit Borussias Fohlen auf die europäische Landkarte
Das Phänomen Fußball – eine Herzensangelegenheit der Deutschen
Die Fohlenelf – ein Provinzclub stürmt nach oben
Bescheidene Anfänge und erste Achtungserfolge
Die Geburt der Fohlenelf – im Sturmlauf in die Bundesliga
Borussias goldene Jahre – Rekorde und Meistertitel
Stetiger Aufstieg zur Spitze
Mythos Günter Netzer und das legendäre Pokalfinale von 1973
Nationale Dominanz – drei Meistertitel in Folge
Borussia auf europäischer Bühne – Dramen und Triumphe
Europapokal der Landesmeister
Europapokal der Pokalsieger und UEFA-Pokal
Der Mythos der Borussia - Ansporn und Bürde
Anhang 1
Anhang 2
Anhang 3
Anhang 4
Anhang 5
Literatur:
Zum Verfasser:
I. Graf Balderich und der Bau der ersten Gladbacher Kirche
Mönchengladbach kann auf eine mehr als tausendjährige bewegte Geschichte zurückschauen. Allerdings liegt manches der Entstehungsgeschichte im Dunkeln. Die Anfänge Mönchengladbachs sind lediglich durch wenige historische Quellen belegt. Zwar hat sich bei den Historikern, die sich seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts mit dem Ursprung Mönchengladbachs befassen, die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Quellen historisch weitgehend korrekt sind, doch gibt es zu manchen wichtigen Details immer noch kontroverse Auffassungen. Eine neuerliche Betrachtung solch strittiger Punkte im Zusammenhang und im Rahmen der großen politischen Geschichtsereignisse jener Zeit erlaubt dann zuweilen einen anderen Blickwinkel und eröffnet neue Interpretationsmöglichkeiten und Antworten, wie dies in jüngster Zeit der Historiker Christoph Nohn mit seiner bemerkenswerter Studie „Auftakt zur Gladbacher Geschichte“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.
In diesem ersten Teil geht es darum, die Rolle von Graf Balderich und den Bau der ersten Kirche zu erhellen sowie die Umstände der Gründung der Gladbacher Abtei, welche als Beginn der Gladbacher Stadtgeschichte gilt, zu untersuchen. Diese historischen Ereignisse des ersten Themenkreises fanden in der Zeit des karolingischen Kaisers Ludwig der Fromme, Sohn und Nachfolger Karls des Großen, und des nach ihm sich vollziehenden Zerfalls des großen Frankenreiches statt. Der zweite Themenkreis fällt in die Zeit der Entstehung des ersten deutschen Kaiserreichs der Ottonen. Deren politische Bemühungen, das Herzogtum Lothringen, in dem sich das Kerngebiet des karolingischen Reiches befand und in dem auch die Abtei Gladbach gegründet wurde, an das neue deutsche Reich zu binden, um damit die Kontrolle über die Kaiserstadt Aachen und die wichtigen Kirchenmetropolen am Rhein zu gewinnen, scheint im Zusammenhang mit der Abteigründung in Gladbach zu stehen. Darum sollen diese historischpolitischen Vorgänge zur besseren Klärung von Fragen bezüglich der Gladbacher Abteigründung herangezogen werden.
Betrachtet man die Anfänge der Gladbacher Geschichte nur aus der lokalen Brille, wirken die Vorgänge jener Zeit eher provinziell und wenig aufregend. Bei näherer Betrachtung der damaligen Zeitumstände und der politischen Lage, wird schnell deutlich, dass jeweils der lange Arm kaiserlicher Macht und Politik eine nicht unerhebliche Rolle am Anfang der Gladbacher Geschichte spielte.
1. Zur überlieferten Gründungsgeschichte
Die Entstehung der Stadt Mönchengladbach geht auf die Gründung der Benediktiner Abtei im Jahr 974 auf dem heutigen Abteiberg zurück. Unsere Informationen darüber basieren einerseits auf einem urkundlichen Rechtsdokument aus dem Jahr 1085 und andererseits aus der literarischen Quelle der christlichen Tradition „Sermo in inventione reliqquiarum sanctorum Viti, Cornelii, Cypriani et aliorum in Gladebach“, einer Art Predigt oder Lesung, die wohl um 1090 erstmals durch einen anonymen Autor niedergeschrieben wurde und jahrhundertelang jeweils am 12. Juli, dem Tag der Wiederauffindung der Vitus-Reliquien, im Klosterkonvent vorgelesen oder vorgetragen wurde (vgl. Kasten in: Loca Desidirata Bd. 1, S. 278). Diese Quelle enthält die wesentlichen Informationen über die Gründung der Gladbacher Abtei und wird darum heutzutage auch einfach „Gründungsgeschichte“ genannt. Außerdem bietet das Totengedächtnisbuch der Abtei Informationen über die Gründungspersönlichkeit des Balderich, der dort ausdrücklich als Graf und als einer der Vornehmen des Reiches bezeichnet wird, und dessen Frau, deren Name Hitta gewesen sei.
Der literarischen Quelle (Sermo) zufolge hatte der Kölner Erzbischof Gero einen göttlichen Auftrag erhalten, auf einem bewaldeten Hügel in der Nähe eines Baches ein Kloster zu Ehren des Hl. St. Vitus zu gründen. Gero und der als Abt designierte Mönch Sandrad glaubten zunächst, rechtsrheinisch in Leichlingen an der Wupper den richtigen Ort gefunden zu haben. Während der Vorbereitungen zur Klostergründung erschienen dort aber zwei Boten des neuen Kaisers Otto II., die vom Erzbischof mit einem Mahl bewirtet wurden. Dabei sei dann ein Streit zwischen den beiden Gästen ausgebrochen, wobei der Geistliche leicht verwundet wurde und sofort daran verstorben sei. Gero habe darin ein göttliches Zeichen erkannt, dass dies nicht der richtige Ort sei, und habe darauf weiter nach einem passenden Ort gesucht, bis er schließlich im linksrheinischen Mülgau einen unbewirtschafteten, bewaldeten Hügel fand, auf dem noch einige Ruinen einer alten Kirche und anderer Gebäude zu finden waren. Dort lebende ältere Leute hätten Gero und Sandrad bei ihrer Ankunft erzählt, zur Zeit Karls des Großen hätte dort ein gewisser Balderich aus dem Kreis der Vornehmen des Reiches eine Kirche gegründet und sie mit kostbaren Reliquien und reichen Einkünften ausgestattet. Diese sei aber im 19. Jahr der Regierung Kaiser Ottos I. von Ungarn zerstört worden. Den Hütern der Kirche sei es allerdings noch vor dem Überfall gelungen, die Reliquien in einem ausgehöhlten Stein zu verstecken und zu vergraben. Am unterhalb des Hügels fließenden Bach habe Sandrad dann erkannt, dass es sich um den gewünschten Ort aus Geros Traumbild handelte. Beim ersten Spatenstich der folgenden Klostergründung habe man den dort vergrabenen hohlen Stein mit den Reliquien der Heiligen Vitus, Cornelius, Cyprianus, Chrysantus und Barbara (Daria) gefunden. Gero habe dann Mönche zusammengerufen, Sandrad zum Abt der neuen Klostergemeinschaft gemacht und das Kloster mit reichen Einkünften ausgestattet. Das Kloster soll zunächst einen großen Aufschwung genommen haben, aber nach Geros Tod habe dessen Nachfolger Warin den Abt Sandrad vertrieben, weil Sandrad angeblich dem Bischof von Lüttich gegenüber, in dessen Diözese die Abtei damals lag, ergebener gewesen sei als ihm. Sandrad sei demnach zur Kaiserin Adelheid geflüchtet und später durch göttlichen Willen und durch die Fürsprache der Kaiserin Adelheid wieder als Abt in der Gladbacher Abtei eingesetzt worden. Aber in der Zwischenzeit seien der Konvent gesprengt und die Reliquien sowie das Vermögen verschleudert worden, so dass der Abt und sein zurückkehrender Konvent in größter Armut hätten leben müssen.
Dies ist in verkürzter Form der wesentliche Inhalt der Gründungsgeschichte. Sie enthält konkrete historische Fakten, aber auch christlichreligiöse Elemente. Dort, wo von göttlichem Willen oder göttlicher Eingebung die Rede ist, tut man wohl gut daran, eine gesunde Skepsis walten zu lassen und eine rationalere Erklärung zu suchen. Gemäß den Sachinformationen gab es offenkundig schon vor der Abteigründung auf dem Abteiberg eine Ansiedlung und eine angeblich von Graf Balderich gestiftete Kirche. Doch dieser Balderich und seine Kirchengründung, seine Frau Hitta aber auch der genannte Ungarnüberfall werden von vielen Historikern noch oft in Frage gestellt, obwohl der Gründungsgeschichte eine weitgehend historische Korrektheit zugebilligt wird. So schreibt B. Kasten „Die Person des Kirchenerbauers Balderich ist historisch nicht nachweisbar“ (Kasten in: Loca Desidirata, Bd. 1, S. 280) und bei W. Löhr, dem anerkannten Experten für die Gladbacher Geschichte, heißt es: „Wer nach Balderich sucht, findet niemanden dieses Namens in der Umgebung des Frankenkaisers“ (Löhr, 2009, S. 18). Dagegen deutete N.A. Holtschoppen 2008 immerhin die Möglichkeit einer Verwandtschaft des Gladbacher Balderichs mit den Lütticher Bischöfen gleichen Namens aus dem 11. Jahrhundert an und verwies auf eine wiederholte Nennung des Namens Balderich und einer Hitta im Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau im Bodensee (vgl. Nohn, 2011, S. 122). C. Nohn zeigt in seiner Studie sogar eine erstaunliche Indizienkette auf, die einen Grafen Balderich als prominente und herausragende historische Persönlichkeit aus dem engeren Machtzirkel von Karl dem Großen und seines Nachfolgers Ludwig dem Frommen aus dem Dunkel der Geschichte hervortreten lässt.
Nachfolgend soll nun versucht werden, die historische Person des Balderich aus dem Dunkel der Geschichte mehr ans Licht zu heben und Fragen bzgl. der Reliquien und des ersten Kirchenbaus sowie seiner Zerstörung im historischen Kontext zu untersuchen. Um mehr Klarheit über den Beginn der Gladbacher Stadtgeschichte und der dabei beteiligten Personen zu erhalten, erscheint es lohnenswert, die erwähnten historischen Fakten im Zusammenhang mit der Gladbacher Geschichte näher zu betrachten.
2. Der geopolitische Hintergrund – im Machtzentrum des Frankenreichs
Die Mönchengladbacher Gegend war in jener Zeit unter dem Namen „Mülgau“ bekannt und war schon Teil des Frankenreichs vor dessen Expansion zu der europäischen Großmacht. Der Mülgau gehörte zum merowingischen Großgau „Hattuaria“ und war im Westen durch das Maas- und Rurtal, im Osten durch die Niers und im Süden begrenzt. Mülfort markiert etwa die südlich Grenze, während die nördliche unklar ist (vgl. Löhr, 2009, S. 22). Die Bedeutung der Bezeichnung „Mülgau“ ist bis heute nicht geklärt; der Begriff „comitatus Moilla“ (Grafschaftsbezirk Moilla) tritt erstmals in der Reichsteilungsurkunde des Kaisers Ludwigs des Frommen aus dem Jahr 837 auf. Erklärungsversuche des Namens beziehen sich etwa auf das Vorhandensein vieler Mühlen an den hiesigen Flüssen und Bächen oder auf den seit römischer Zeit wichtigen Niersübergang von Mülfort. Es ist auch möglich, dass „Moilla“ die alte römische Bezeichnung für die Niers oder die Niersgegend war, dann wäre die Bezeichnung Mülfort wohl auch als „Niersfurt“ zu verstehen.
Seit dem 6. Jahrhundert war das Frankenreich unter der Herrschaft der Merowingerkönige trotz ständiger interner Intrigen und Machtkämpfe zum Großreich und zur führenden Macht Europas aufgestiegen. Die Führung der Staatsgeschäfte überließen die Merowingerkönige schon früh einem höchsten Beamten, dem Hausmeier (majordomus), so dass die Hausmeier die faktische Herrschaft ausübten. Das Amt des Hausmeiers war seit Mitte des 7. Jahrhunderts erblicher Besitz der Pippinidensippe geworden. Durch die Heirat Pippins des Mittleren mit der später als Heiligen verehrten Irmina gelang dieser Sippe ein enormer Landgewinn von der Mosel durch die Eifel bis an die untere Maas und an den Niederrhein. Damit verbesserte sie ihre Macht- und Besitzbasis ganz entscheidend.
„Ihre (der Heirat) für das Rheinland wichtigste Folge war, dass die frühen Karolinger bis hin zu Ludwig dem Frommen sich hier zuhause fühlten und das Gebiet zwischen Mosel, Maas und Rhein zur Achse ihres fast das ganze Abendland umspannenden Reiches machten. Niemals zuvor und niemals mehr nachher hat dieser Raum solchermaßen im Zentrum des politischen Kräftespiels und Gestaltungswillens gelegen“ (Janssen, 1997, S.46).
Nachdem Karl Martell 719 Friesland für das Frankenreich erobert hatte, haben die dort ansässigen Eliten, sofern sie Parteigänger der Franken waren, höchstwahrscheinlich davon in der Form profitiert, dass sie als Getreue Gebietszuwachs erhielten. Für die künftige Sicherung der fränkischen Macht spielten fortan das neue kirchliche Zentrum Utrecht und auch die Handelsniederlassung Dorestad eine wichtige Rolle. Durch diese Vorgänge wurde das mittlere Rhein-Maas-Gebiet an das niederländische Flussgebiet angekoppelt. Im Jahr 751 setzte der Hausmeier Pippin der Jüngere, der Vater Karls des Großen, mit Zustimmung des Papstes den schwachen Merowingerkönig ab, machte sich selbst zum Frankenkönig und begründete damit das Karolinger-Reich. Das Gebiet zwischen Mosel, Maas und Rhein, wozu auch der Gladbacher Mülgau gehörte, wurde somit zum Machtzentrum des fast ganz Europa umfassenden Reichs Karls des Großen.
In der Folge wandelten sich die hier ansässigen Adelsfamilien, auf die sich das neue Königsgeschlecht bisher schon gestützt hatte, zu einer neuen Reichsaristokratie. Sie besetzten darauf – auch weit über ihre Stammgebiete hinaus – die wichtigsten Machtpositionen im Reich, um die Interessen der Könige und ihre eigenen zu vertreten. Diese Familien hoben sich nun durch weit ausgedehnten und gestreuten Besitz vom alten landschaftsgebundenen Adel ab und bildeten nun neben dem Königtum die zweite aristokratische Komponente des fränkischen Reiches, woraus dann später die großen europäischen Dynastenfamilien des Mittelalters hervorgehen sollten (vgl. Janssen, 1997, S.47).
In Anlehnung der Verwaltung der Merowingerzeit wurde das Reich in Grafschaften eingeteilt, innerhalb derer die Grafen (comites) die Rechte des Königs auf militärischem, jurisdiktionellem und polizeilichem Gebiet wahrnahmen. Ein Graf verfügte so über große Machtbefugnisse; er hielt die öffentliche Ordnung aufrecht, zog Abgaben und Bußgelder ein und leitete die Gerichtsversammlung. Zur Zeit Karls des Großen gab es ca. 300 Grafschaften, doch ist es unwahrscheinlich, dass das gesamte Reich lückenlos in Grafschaften gegliedert war, und es ist fraglich, ob alle Grafen die gleichen Machtbefugnisse hatten. So sind für das Gebiet des Niederrheins der Gill- und Mülgau bezeugt; für das fast menschenleere Bergische Land ist dagegen kein Gau bekannt. Eine Sonderstellung nahmen die Markgrafen ein, die mit besonderen Befugnissen ausgestattet in umkämpften Grenzgebieten des Reiches eingesetzt wurden. Bei der Ernennung der Grafen, konnten die Könige anfangs frei entscheiden. Später mussten sie Grafen aus dem ortsansässigen Adel wählen. Die daraus resultierende Regionalisierung hatte schon König Chlothar II. im Jahr 614 in einem Edikt anerkennen müssen (vgl. Janssen, 1997, S.40 f.). Das Amt des Grafen war sehr begehrt und so war der Adel bemüht, möglichst viele Grafschaften in die Hand der Familie zu bekommen. Seit dem 9. Jahrhundert sind auch Bemühungen um eine Vererbbarkeit zu beobachten. Diese Tendenz versuchte Karl der Große aber nach Kräften einzudämmen. Grundsätzlich konnte der König einen Grafen bei schlechter Amtsführung auch abberufen, was aber recht selten geschah.
Mit der Herrschaft und den Eroberungen Karls des Großen (768-814) erreichte das Frankenreich seine größte Ausdehnung und Macht. Unter seinem Nachfolger Ludwig dem Frommen konnte zwar die Einheit des Reiches noch bewahrt werden, doch begannen trotz bester Absichten unter seiner Herrschaft schon Niedergang und Zerfall, was maßgeblich mit seiner Wankelmütigkeit in seiner Erbfolgeregelung zu tun hatte. Dies führte zu einer Palastrevolte und einer Rebellion der unzufriedenen Söhne, wobei Ludwig 833 sogar zwischenzeitlich abgesetzt wurde. Außerdem wurde das Frankenreich während seiner Herrschaft von slawischen Stämmen im Osten bedroht, im Süden wurde die Grenzmark Kärntens von Slawen und Bulgaren angegriffen. Im Norden gab es Kämpfe gegen die Dänen und außerdem verwüsteten die seeräuberischen Wikinger Gebiete in Friesland und an der Atlantikküste. Zeitweilig griffen sie gezielt die christlichen Zentren wie Klöster und Kirchen an, womit sie die karolingische Herrschaft regional vorübergehend zu Fall brachten. Sie profitierten von der Krise des Reiches. Dem setzte Kaiser Ludwig hauptsächlich Missionstätigkeit entgegen, was u.a. immerhin dazu führte, dass im Rahmen der Dänenmission das Bistum Hamburg gegründet wurde, der dänische König Harald sich taufen ließ und Ludwigs Gefolgsmann wurde (vgl. Riché, 1997, S. 193). Überhaupt ging es Ludwig vorrangig um eine stärkere Christianisierung der Reichsvölker, was er als wichtigstes Mittel zur politischen Integration ansah. Nach dem Tod Ludwigs des Frommen versank das Reich in äußerst brutalen und blutigen Machtkämpfen zwischen Ludwigs Söhnen Lothar, Ludwig und Karl. Die gewaltige und überaus verlustreiche Schlacht von Fontenoy-en-Puisage, in der Kaiser Lothar den anderen Söhnen Ludwigs des Frommen unterlag und in der die Blüte des fränkischen Adels dahinsank, markiert schließlich den Niedergang des Karolingerreiches.
„ In dieser Schlacht wurden die Streitkräfte der Franken so aufgerieben und ihre glorreiche Heldenkraft so sehr geschwächt, dass sie in Zukunft nicht mehr imstande waren, die eigenen Grenzen zu schützen, geschweige denn zu erweitern“ (Chronist Regino von Prüm in: Schreiber 1984, S. 279).
Schließlich kam es 843 in Verdun zu einer vertraglichen Einigung, wodurch das Reich in drei Teile geteilt wurde. Der älteste Sohn Lothar erhielt das Mittelreich (Lotharingien), ein lang gestrecktes Gebiet, das von der Nordsee bis zur Küste der Provence reichte sowie Nord- und Mittelitalien umfasste, wodurch die alten karolingischen Kerngebiete mit der Kaiserstadt Aachen und auch Rom zu seinem Reich gehörten. Ludwig (der Deutsche) erhielt das Ostfrankenreich östlich des Rheins, woraus das erste deutsche Kaiserreich entstehen sollte, während Karl (der Kahle) das Westfrankenreich bekam, was den Beginn Frankreichs markierte. Als schließlich Lothar 855 starb, teilten seine drei Söhne das Mittelreich unter sich auf, woraus die Königreiche Italien und Burgund sowie das Herzogtum Lotharingien hervorgingen. Lotharingien, zu dessen Gebiet auch der Mönchengladbacher Mülgau gehörte, wurde darauf lange Zeit zum Spielball der Machtinteressen des Ost- und Westfrankenreiches sowie des lotharingischen Adels. König Arnulf hatte Lothringen seinem Sohn Zwentibold als fast selbständiges Königreich übertragen, doch konnte sich dieser nicht gegen die einheimischen Grafen durchsetzen. 910 gewann einer der lotharingischen Adligen, Reginar, die Herzogswürde und unterstellte das Land dem westfränkischen König (vgl. Weber/Baldanus, S. 156).
Der Herrscher des Ostfrankenreiches und erste deutsche König Heinrich I. schaffte es 925, Lotharingien an das Westfrankenreich zu binden. Jedoch war diese Bindung nicht sehr fest, zumal der Adel Lotharingiens noch bis zur Jahrtausendwende eine Hinwendung zum Westfrankenreich oder gar eine Unabhängigkeit in sein Machtkalkül einbezog. So blieb dieses Kernland des fränkischen Reiches lange Zeit zwischen Ost- und Westreich umstritten. Der aus dem sächsischen Herrscherhaus stammende Otto I., Sohn König Heinrichs I. und spätere Begründer des deutschen Kaisertums, hat sich 936 bewusst in fränkischer Tracht in lotharingischen Aachen zum König krönen lassen, um sich als Nachfolger Karls des Großen zu präsentieren. Für Otto I. war die Herrschaft über Lotharingien nicht nur aus Traditionsgründen von Bedeutung. Hier gab es mit dem geballten Reichsgut auch eine solide materielle Machtbasis zu sichern und die hier ansässigen großen Reichskirchen boten der sakral begründeten Königsherrschaft eine willkommene Stütze gegen den immer selbstbewusster gewordenen, aus der Reicharistokratie hervorgegangen dortigen Stammesadel Lotharingiens (vgl. Janssen 1997, S. 64). Um Lothringen (von nun an soll diese vertrautere Bezeichnung verwendet werden) enger an sich zu binden, gab Otto I. dem lothringischen Herzog Giselbert seine Schwester Gerbera zur Frau. Giselbert verfolgte aber wohl noch das Ziel eines unabhängigen Lothringens und beteiligte sich 939 an einer Fürstenverschwörung gegen König Otto I., woran sich auch Ottos jüngerer Bruder Heinrich und der Frankenherzog Eberhard beteiligten. Die Aufständischen wurden jedoch noch im gleichen Jahr bei Andernach geschlagen, wobei Giselbert und Eberhard den Tod fanden. Danach verlagerte der übrige lothringische Adel seine Machtstützpunkte mehr nach Westen zum westfränkischen Reich hin, während gleichzeitig das entstehende Machtvakuum nahe des Rheins immer mehr durch die rheinischen Kirchenfürsten gefüllt wurde. König Otto I. machte 953 seinen jüngeren Bruder Brun, der schon als 15-jähriger das Amt des Kanzlers am Königshof Ottos übernommen hatte, zum Erzbischof von Köln und übertrug ihm gleichzeitig die lothringische Herzogswürde.
„Brun verkörperte in früher und in signifikanter Weise den Typ des ‚politischen Bischofs‘ , der von jetzt an in immer ausgeprägterem Maße die rheinische Geschichte beherrschen sollte“ (Janssen, 1997, S. 67).
Der Trierer Erzbischof Ruotbert war ein Onkel Ottos I., und das Erzbistum Mainz erhielt Ottos unehelicher Sohn Wilhelm, wodurch die drei großen rheinischen Erzbistümer in der Hand der ottonischen Königsfamilie waren. Sie sollten auch als Stützen der Königsmacht in Lothringen fungieren. Die Herrschaft Ottos wurde aber durch weitere Revolten und äußere Angriffe bedroht. Nach dem Tod seiner Frau Edgith hatte er 946 seinen damals 16-jährigen Sohn Liudolf testamentarisch zum Nachfolger bestimmt. Otto heiratete nach dem Tod seiner ersten Frau bald darauf Adelheid von Burgund, eine machtbewusste Frau. Liudolf sah darauf seinen Herrschaftseinfluss immer mehr schwinden. Insbesondere als Adelheid einen Sohn, den späteren Otto II., gebar, sah Liudolf - wohl zu Recht – seine Stellung als Thronerbe bedroht, was ihn 953 zu einer offenen Empörung gegen seinen Vater und König trieb. Dieser Empörung schloss sich auch der vom König zuvor gedemütigte damalige Herzog von Lothringen Konrad an. Dabei kam es über längere Zeit zu Kämpfen im ganzen Reich, die nicht zuletzt wegen der klugen und festen Haltung des Erzbischofs von Köln Brun zugunsten des Königs mit der Unterwerfung Liudolfs endeten. In dieser Zeit der inneren Unruhen griffen die Ungarn wiederholt das Reichsgebiet an und verbreiteten durch ihre Raubzüge Angst und Schrecken. Als die Ungarn 954 im Süden einfielen, erreichte Liudolf durch Tributzahlungen, dass die Ungarn sein Gebiet verschonten, und gab ihnen sogar Führer mit, damit sie ins königstreue Lothringen einfallen sollten. In Worms wurden sie am 19. März 954 vom Mitverschwörer Konrad empfangen, der sie mit Gold und Silber dafür bezahlte, damit sie gegen seine Feinde in Lothringen, den königstreuen Erzbischof Brun und die Grafenfamilie der Reginare, ziehen sollen. Auf diese Weise sollen die Ungarn, eine Spur von Blut hinter sich lassend, bis Maastricht gekommen sein (vgl. Wies, 1991, S. 158f). Doch die schrecklichen Erfahrungen des ungarischen Raubzuges bewirkten einen positiven Schock. Die Meinung im Reich schlug zuungunsten der Empörer Liudolf und Konrad um, zumal sich die Meinung verbreitete, sie hätten die Ungarn ins Reich gerufen. Die Ungarn wurden zunächst durch ein Heer König Ottos zum Rückzug gezwungen. Im Jahr 955 wurden sie durch das königliche Reichsheer, das aus Kriegern aller Stämme zusammengesetzt war, bei Augsburg entscheidend besiegt, wodurch Otto I. seine Herrschaft endgültig festigen konnte.
Im Rahmen dieses historischen und geografischen Hintergrunds gilt es nun, die Ursprünge Mönchengladbachs nach Möglichkeit klarer herauszustellen. Wenn, wie die Gründungsgeschichte erzählt, ein Graf namens Balderich aus dem vornehmen Umfeld des Kaisers Stifter der ersten Kirche in Mönchengladbach gewesen sein soll, muss er im obigen Zeitrahmen und bei den bezeichneten wichtigen Ereignissen eine Rolle gespielt haben. Darum geht es nachfolgend zunächst darum herauszufinden, ob es einen prominenten Graf Balderich in jener Zeit gab, der Gründer der ersten Kirche auf dem Abteiberg gewesen sein könnte.
3. Historische Spuren des Grafen Balderich
Wie schon oben erwähnt gibt und gab es namhafte Fachleute, welche die Existenz des Kirchengründers Balderich in Frage stellen, weil keine eindeutigen historischen Zeugnisse darüber vorliegen. Jene erklären die Nennung des Balderichs im Totenbuch des Gladbacher Klosters in diesem Zusammenhang durch fehlerhafte Übertragungen und falsche Identifikationen mit späteren Personen dieses Namens durch den Verfasser (vgl. Kasten in: Loca Desidirata Bd. 1, 1994, S.280). Löhr bestreitet sogar die Existenz eines Balderichs im Umfeld des Frankenkaisers. Dagegen hatte der Historiker Peter Norrenberger schon 1889 festgestellt, dass die Balderiche in der Hattuarier-Grafschaft (frühmittelalterliche Bezeichnung des linken Niederrheingebiets) eine große Rolle gespielt hätten. Er hielt es für durchaus möglich, dass der Stifter der Gladbacher Kirche der Mülgauer Gaugraf war (vgl. Norrenberg in: Nohn 2001, S. 121). Es ist vielleicht doch etwas vorschnell geurteilt und die Nennung von Graf Balderich als Kirchenstifter einfach als Übertragungsfehler abgetan worden. So weist nun auch die Studie von C. Nohn „Auftakt zur Gladbacher Geschichte“ nach, dass sich doch sehr wohl ein solcher Graf aus dem Umfeld des Kaisers ausfindig machen lässt, wenn man die historischen Ereignisse jener Zeit mit Blick auf das ganze Reich großräumiger betrachtet.
Vor der nun folgenden ‚Spurensuche‘, die sich weitgehend an den Erkenntnissen der Studie von C. Nohn orientiert, soll vorab schon bemerkt werden, dass auch damals „ Balderich“ ein eher seltener Name war, so dass ein Auftreten eines Adligen dieses Namens in Quellen jener Zeit für unsere Fragen relevant sein kann. So findet sich der Name „Balderich“ auch in einer Liste der führenden karolingischen Reichsaristokratie, die der Historiker Tellenbach 1939 veröffentlichte und die auf den Reichsannalen des Fränkischen Reiches basiert. Der Name taucht dort am Ende der Liste als 42. auf, wohl weil er keinem der Stämme des Frankenreichs zugeordnet werden konnte. Doch gibt die Liste noch die weiteren aufschlussreichen Informationen „Balderich von Friaul, Graf an der sächsischen Grenze, 819 in Friaul “ (vgl. Nohn, 2011, S. 123), wodurch sich ein konkreter Ansatz für die Suche ergibt. In den Reichsannalen des Fränkischen Reiches ist für das Jahr 819 vermerkt, dass ein Balderich Nachfolger des Herzogs Cadolah als Markgraf von Friaul geworden sei und dass er als solcher an der Südostgrenze gegen Slawen und Awaren gekämpft habe. Für das Jahr 826 wird er dort als ‚Wächter des avarischen Grenzbezirks‘ und ‚Befehlshaber in der pannonischen Mark‘ (das war die Grenzregion zu Ungarn) bezeichnet. Offenbar vermochte er die Sicherheit der Reichsgrenze doch nicht zu gewährleisten, so dass gemäß der Reichsannalen Balderich von Friaul seiner Ämter enthoben und die Grenzmark, die er allein verwaltet hatte, nun unter vier Grafen aufgeteilt wurde. Sein Nachfolger in Friaul wurde übrigens der Unruochinger Eberhard, von dem bekannt ist, dass er auch Güter im Mülgau besaß (vgl. Nohn, ebda. S. 124), was ein interessanter Hinweis ist. Dieser Balderich vereint aber schon alle Kriterien, die für den Gladbacher Kirchenstifter genannt werden, und er käme als Kirchenstifter in Frage, wäre sein Betätigungsfeld nicht so weit weg gewesen. Doch die Reichsannalen bieten weitere Aufschlüsse, welche Balderich auch im Gladbacher Mülgau verorten lassen. Diese nennen für das Jahr 815 einen Balderich, der als Gesandter des Kaisers Ludwigs des Frommen, dessen Vater Karl der Große ein Jahr zuvor gestorben war, den Auftrag hatte, mit anderen sächsischen Grafen und einem Heer gegen die Dänen zu ziehen, um deren ständigen Angriffen im Norden und den dortigen Küsten des Reiches ein Ende zu bereiten. Dies geht auch aus der Lebensbeschreibung Ludwigs des Frommen hervor (vgl. ebda. S. 126). Der entscheidende Kampf gegen die Dänen fand an der Eider statt und hatte wohl den gewünschten Erfolg, denn er kehrte nach Stellung von vierzig dänischen Geiseln an den kaiserlichen Hof zurück. Dies muss für Graf Balderich zu einem Gewinn an Ansehen und zu einem Karrieresprung am kaiserlichen Hof geführt haben. Die Tatsache, dass man sich in der historischen Forschung weitgehend einig ist, dass der Balderich von 815 identisch mit dem Markgrafen von Friaul ist, ergibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, in ihm den Kirchenstifter zu erkennen.
Statue des Balderich von Emil Hollweg (1882-1943)
An dieser Stelle unseres Gedankenganges scheint es angebracht, innezuhalten und die soeben bezeichneten ‚Puzzleteile‘ mit weiter oben skizzierten Sachverhalten zu einem vorläufigen Bild zusammenzusetzen. Dieses stellt sich nun so dar: Graf Balderich, wahrscheinlich um 780/785 geboren, gehörte als Angehöriger der hohen Reichsaristokratie zum Umfeld des kaiserlichen Hofes. Da er im Jahr 815 – ein Jahr nach dem Tod Karls des Großen – mit der Führung einer großen Militäraktion zum Schutz der nördlichen Reichsgrenze betraut wurde, spricht dies dafür, dass die karolingische Herrscherfamilie ihn kannte und ihm vertraute. Es spricht weiterhin dafür, dass seine Familie ihren Stammsitz im Gebiet Maas-Niederrhein und Frieslands besaß. Bekanntlich ernannten die fränkischen Herrscher zur Reichsverwaltung vorzugsweise lokale Adlige zu Grafen. So war es für Kaiser Ludwig den Frommen naheliegend, diesen Balderich mit der Militäraktion gegen die Dänen bzw. Wikinger zu betrauen, da dieser gut mit dem Gebiet und Gelände vertraut sein und dazu ein starkes Eigeninteresse haben musste, auch seine eigenen, im zu verteidigendem Gebiet liegenden Güter zu beschützen. Seine erfolgreiche Mission an der Eider gegen die Dänen hat ihn für Kaiser Ludwig den Frommen wohl für den ungleich heikleren Einsatz in Friaul zur Abwehr von Slawen, Awaren und Bulgaren empfohlen. Dieser Aufgabe war er jedoch nicht gewachsen und sein Misserfolg dürfte sein Karriereende gewesen sein. Wenn Balderich bei seinem Einsatz gegen die Dänen in der Quelle nur als Balderich – und nicht ausdrücklich als Graf – bezeichnet wurde, muss man das wohl so verstehen, dass damit eben jener Balderich gemeint war, den jeder kannte. Außerdem sei daran erinnert, dass der Name Balderich ein seltener Name war. Auch die zeitliche Nähe zu Karl dem Großen erweist sich als realistisch, und weil man in jener Zeit als umso vornehmer angesehen wurde, je näher man der Herrscherfamilie stand, treffen auch diese Merkmale der Gründungsgeschichte auf diesen Balderich zu. Diese Erkenntnisse sprechen dafür, dass die Angaben der Gründungsgeschichte über den Kirchenstifter Balderich wohl historisch korrekt sind. Allerdings muss man einräumen, dass alle aufgezeigten Sachverhalte nur Indizien – wenn auch starke – darstellen. Aber es gibt noch weitere Hinweise, welche für diesen Balderich als Kirchengründer sprechen.
C. Nohn weist in seiner bezeichneten Studie nach, dass der Name Balderich auch noch in vielsagenden zeitgenössischen Urkunden auftaucht, die geeignet sind, das bisherige Bild zu ergänzen. Mit einer Urkunde aus dem Jahr 850 bestätigte der Bischof Luidger von Utrecht, dass ein Balderich die Domäne Wadenoijen mit einem Gotteshaus der Kirche von Utrecht übertrug. Dafür erhielt Balderich im Gegenzug Güter aus dem Besitz des friesischen Bistums zur Nutzung für sich und seine Familie. Weiterhin wurde u.a. darin festgelegt, dass die Geistlichen der Kirche von Wadenoijen für das Totengedenken für Balderich und seine Familien zu halten hatten (vgl. Nohn, 2011, S. 127). Eine weitere Schenkungsurkunde aus jener Zeit findet sich im Kloster Lorsch, womit ein Balderich verschiedene zwischen Maas und Schelde gelegene Güter an das Kloster abtritt. Aber warum hätte Balderich das am Oberrhein im fränkischen Kerngebiet liegende Kloster Lorsch beschenken sollen? Dieses Kloster, aus der auch die älteste Handschrift der Reichsannalen stammt, galt als das zentrale Kloster der fränkischen Königsdynastie. So kann diese Schenkung als Hinweis für die Nähe Balderichs zur Herrscherfamilie verstanden werden. Die historische Forschung sieht die in beiden bezeichneten Urkunden genannten Balderiche als identisch an, weil sie zeitnah Güter aus ein- und derselben Region verschenkten (vgl. Nohn, ebda, S. 128). Weil aber der vermutete Gladbacher Kirchenstifter eben dort seine Hausgüter besaß, verweisen diese Urkunden auf die Möglichkeit, dass es sich bei dieser Person um den Kämpfer gegen die Dänen und den Markgraf von Friaul handelt. Da es sich bei den in den Urkunden verschenkten Gebieten jeweils um Streubesitz handelte, weist dies außerdem darauf hin, dass die Schenkenden zu einer sehr kleinen Schicht von Großgrundbesitzern gehörten, denn Streubesitz ist ein Indiz für alteingesessenen Adelsbesitz, der durch häufige Erbteilungen zersplittert wurde. Schließlich gibt es noch einen weiteren, sehr aufschlussreichen Hinweis auf unseren mutmaßlichen Kirchenstifter. Im Jahr 843 übertrug ein gewisser „Paldricus“ bei Verdun, wo die Söhne Ludwigs des Frommen den Teilungsvertrag aushandelten, seinen Besitz in Bayern gegen 250 Pfund an die Kirche von Freising zur Nutzung an den Bischof Erchanbert und seinen Neffen Reginpert. Als Zeugen werden 77 Männer aus Bayern und – das ist wieder bzgl. unseres Kirchenstifters interessant – sieben friesische Vasallen des ‘ Paldrich‘ genannt (vgl. Nohn, 2011, S. 133). Die zunächst etwas irritierende Schreibweise lässt sich leicht über die Dialekte erklären. In jener Zeit des Mittelalters wurde das im Fränkischen üblich „b“ im Bairischen und Alemannischen oft durch ein „p“ ersetzt. Außerdem wird im weiteren Verlauf des Urkundentextes auch die fränkische Namensform „Baldricus“ verwendet. Offenkundig ist „Paldricus“ unser Balderich.
Die Urkunde von 843 für das Bistum Freising rundet das Bild über Balderich ab. Er muss ein Angehöriger der führenden Schicht im Frankenreich gewesen sein, der Spuren im ganzen Reich hinterlassen hat und der, wie der karolingische Reichsadel überhaupt, aus dem Kernraum des Reiches zwischen Maas und Mosel entstammte. Es scheint, dass Balderich ein Mann war, der sich gegen Ende seines Lebens um sein Seelenheil sorgte und durch Schenkungen ein dauerhaftes Gedenken durch Gebet für sich erbat und wohl hoffte, Gottes Gnade im Jenseits zu finden. Die Stiftung einer ersten Gladbacher Kirche und deren reiche Ausstattung im damals entlegenen Mülgau passen gut zu einer solchen Geisteshaltung, wie sie durch seine anderen Schenkungen erkennbar wird.
Die urkundlichen Erwähnungen des Namens Balderich bieten starke Indizien dafür, dass es sich immer um die gleiche Person handelt und die mit größter Wahrscheinlichkeit mit Balderich von Friaul identisch ist, auch wenn es keinen unmittelbaren Beweis gibt. Bezüglich des Gladbacher Kirchenstifters muss man aber in jedem Fall festhalten, dass auf ihn alle Personenmerkmale, die in der Gründungsgeschichte der Abtei und in deren Totenbuch genannt werden, zutreffen. Jedenfalls tritt in den historischen Quellen keine andere Person dieses Namens auf – auch nicht ansatzweise -, die diese Kriterien erfüllen könnte. Insofern kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Balderich von Friaul der Stifter der ersten Gladbacher Kirche ist und dass die Gründungsgeschichte historisch korrekte Angaben macht.
4. Zum Baujahr und zu den Reliquien der ersten Gladbacher Kirche
Die bisherigen Ausführungen und Erkenntnisse bieten zusätzliche Argumente für die Annahme, dass die Angaben der Gründungsgeschichte auch bzgl. der Stifterpersönlichkeit Balderich der historischen Wahrheit entsprechen. Allerdings bieten sie keinen konkreteren Hinweis auf das Gründungsjahr der ersten Kirche; lediglich das Jahr der Zerstörung ist bekannt, nämlich 954, also 20 Jahre vor der Abteigründung. Für das Baujahr bietet sich nur die Lebenszeit von Graf Balderich als Orientierungshilfe an. Aufgrund der bisherigen Ausführungen verfügen wir aber schon über einige Fixpunkte seiner Vita, wobei hier nun vorausgesetzt wird, dass alle ihn betreffenden Quellenhinweise tatsächlich dieselbe Persönlichkeit bezeichnen. Dazu sei noch einmal in Erinnerung gerufen: Wahrscheinlich gehörte er als junger Aristokrat schon zum engeren Umfeld Karls des Großen und wurde ein Jahr nach dessen Tod 815 vom neuen Kaiser Ludwig den Frommen mit der Leitung einer großen Militäraktion betraut, so dass wir sein Geburtsjahr um 780-785 ansetzen können. 819 wurde er als Markgraf von Friaul zur Verteidigung an die Südostgrenze des Reiches versetzt, von dort dann aber 828 wieder abberufen. Er wäre dann ein Mann in den Vierzigern gewesen. Die von ihm ausgestellten Schenkungsurkunden geben als weitere konkrete Daten die Jahre 843 und 850 an. Mit Blick auf die letzte Urkunde wäre Balderich bei deren Ausfertigung dann 65 bis 70 Jahre alt gewesen, was für die damalige Zeit hohes, aber nicht ungewöhnlich hohes Alter darstellt, besonders nicht für einen Angehörigen der höchsten Reichsaristokratie. Die Schenkungen Balderichs an Kirchen und Klöster im fortgeschrittenen Alter lassen den Schluss zu, dass er damit für sein Seelenheil nach seinem Tod vorsorgen wollte. Zu einer solchen für die damalige Zeit normale Geisteshaltung passt dann auch die Vorstellung sehr gut, dass er eben auch die erste Gladbacher Kirche gestiftet hat. Auch wenn es dafür keine genauere Zeitangabe gibt, muss man wohl eher eine spätere Lebensphase von Balderich in Betracht ziehen.
In der Gründungsgeschichte der Gladbacher Abtei wird u.a. auch berichtet, Balderich habe die von ihm gestiftete Kirche reich ausgestattet. In diesem Zusammenhang verdient die Ausstattung mit Reliquien, insbesondere solche vom Hl. Vitus, eine genauere Betrachtung. Dies könnte weitere Erkenntnisse zu Balderich und zu der von ihm gestifteten Kirche eröffnen. Im Zusammenhang mit der Abteigründung berichtet die Gründungsgeschichte davon, dass Erzbischof Gero und Sandrad die versteckten Reliquien (Knochenpartikel) der Heiligen Chrysantus, Daria, Cornelius und Cyprianus sowie des Hl. Vitus wiederfanden. Betrachtungen zur Herkunft dieser Reliquien können weitere Aufschlüsse über das Baujahr der Balderich-Kirche ermöglichen.
Seit dem 4. Jahrhundert lässt sich im abendländischen Christentum ein Trend feststellen, Kirchen mit den Reliquien des Heiligen auszustatten, dem die Kirche geweiht wurde. Darüber hinaus gab es gerade zur Zeit Karls des Großen einen regelrechten Verehrungskult römischer Heiliger bzw. stadtrömischer Märtyrer im Frankenreich (vgl. Nohn, 2011, S. 153). Jedoch waren Reliquien nicht so einfach zu bekommen und deren Übertragung von einem Ort zum anderen war ein sehr sensibler Vorgang, der wahrscheinlich nur mit Zustimmung einer Bischofssynode oder des Fürsten möglich war. Wenn Balderich seine in Gladbach gestiftete Kirche tatsächlich mit solchen „Schätzen“ ausgestattet hat, muss er zu den höchsten Kreisen des Reiches gezählt haben. Bezüglich der Reliquien der Heiligen Chrysantus und Daria gibt es Quellen, die deren Übertragung aus Rom auf Veranlassung des Abtes Markward vom Kloster Prüm für das Jahr 844 und deren anschließende Beisetzung in Münstereifel belegen. Das bedeutet für die Gladbacher Kirche, dass deren Reliquien nicht eher in Besitz der Gladbacher Kirche gelangt sein können. Falls die Reliquien dieser beiden Heiligen zur Gründungsausstattung der Gladbacher Kirche gehörten, kann der Bau demnach erst nach 844 erfolgt sein. Es ist aber auch denkbar, dass die Reliquien erst sukzessive in den Besitz der Gladbacher Kirche kamen, so dass der Bau auch schon eher erfolgt sein kann. Darum soll nun, im Bemühen den Bezugsrahmen zu vergrößern, die Herkunft der Vitusreliquien etwas näher betrachtet werden.
Den Stadtpatron Vitus muss man jener Welle römischer Kulte zuordnen, die im 9. Jahrhundert das Frankenreich bewegte. Die Gebeine des Hl. Vitus wurden 756 vom neuen fränkischen König Pippin, dem ersten Herrscher aus dem Haus der Karolinger, in eines der wichtigsten Klöster des Frankenreiches, St. Denis bei Paris, gebracht. Acht Jahrzehnte später wurden sie dann wahrscheinlich nach Corvey an der Weser transferiert (vgl. Nohn, 2011, S. 160). Dieser Transfer ist vor dem Hintergrund interessant, dass Corvey, heute zu Westfalen zählend, damals noch zum sächsischen Stammesgebiet gehörte, das von Karl dem Großen erst nach einem 30-jährigen Krieg mit Zwangschristianisierung erobert wurde. Die Sachsen waren der letzte heidnische Germanenstamm gewesen, weswegen eine rasche Christianisierung auch in Hinsicht der fränkischen Herrschaftssicherung von Bedeutung war. Der Transfer der Vitus-Reliquien hatte somit auch unterstützenden politischen Charakter. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Karolinger eine enge Beziehung zum Kloster Corvey hatten und Kaiser Ludwig der Fromme ihm besonders nahe stand. Balderich, von dessen Zugehörigkeit zum engeren Umfeld des Kaisers wir wohl ausgehen können, hätte die Zustimmung zum Transfer der Vitus-Reliquien von Corvey nach Gladbach demnach auch direkt vom Kaiser erhalten haben können. Dieser Transfer nach Gladbach wäre dann zeitlich nach 836 einzuordnen. Mit Sicherheit kann die Herkunft der Vitus-Gebeine für die Kirche des Balderich jedoch nicht bestimmt werden; möglich wäre auch die direkte Übertragung aus St. Denis, doch ist der Weg über die Weser-Abtei Corvey der wahrscheinlichere Ansatz (vgl. Nohn, 2011, S.162).
Diese Ausführungen über die Gladbacher Reliquien geben zwar noch keine Gewissheit über das Baujahr der ersten Gladbacher Kirche, bieten aber zwei mögliche konkrete Zeitangaben, nämlich nach 836 und nach 844. Genaueres ist wohl zurzeit nicht festzustellen, aber beide mögliche Angaben betreffen die späte Lebensphase des Kirchenstifters Balderich und passen somit ins Gesamtbild, das die Gründungsgeschichte vermittelt.