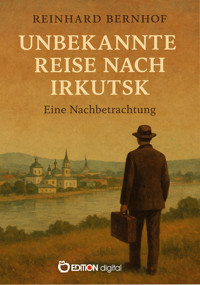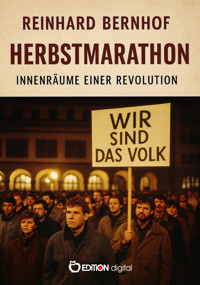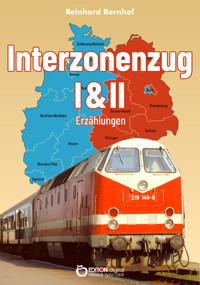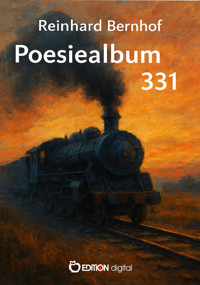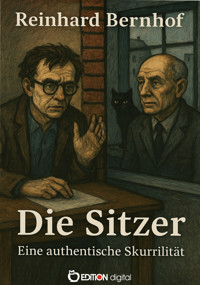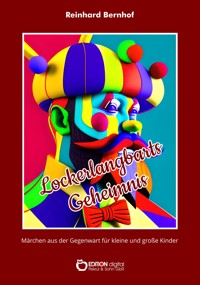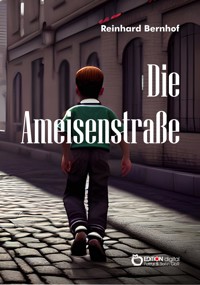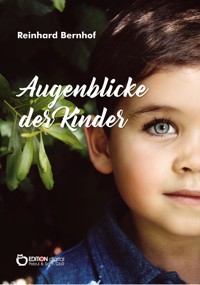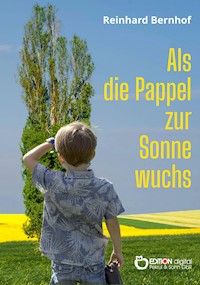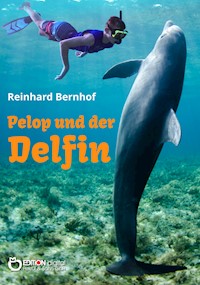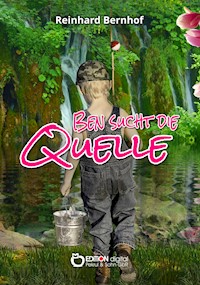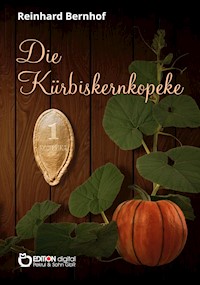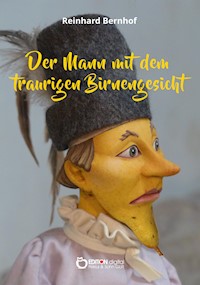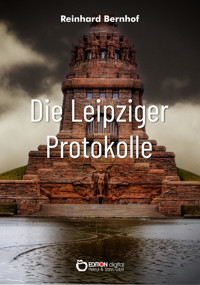
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reinhard Bernhof beschreibt in seinem Buch den Umbruch 89, der in Leipzig seinen Anfang nahm. Seine Texte leben überwiegend von der persönlichen Teilnahme an den Aktivitäten vor und in der Bürgerbewegung, in einer Zeit realer Gefahr, als die sich überstürzende Entwicklung noch keine Richtungen erkennbar werden ließ: Angst, Staunen, Mitgerissensein bis zum Mitdenken und Handeln. – Sie beginnen bei den noch voreinander verborgenen ersten Schritten von Leipzigern, die in geheimgehaltenen Wohnungen erregt Veränderungen einforderten – und sie führen Schritt für Schritt zur Begegnung mit dem eigenen Bedürfnis nach Freiheit und dem entfremdeten Mit-Bürger. – Da Bernhof einer der allerersten Kontaktmänner des Neuen Forums war, konnte er seine Beobachtungen in der direkten Begegnung mit den verängstigten und doch aufbrechenden Menschen deutlich erkennen. Die Texte schildern Starre, zögernde Öffnung, Lebendigkeit der unter Gefahr aufgesuchten und für eine demokratische Wandlung geworbenen Menschen aller sozialen Schichten und geben damit einen so differenziert noch nicht erfassten Querschnitt des tatsächlichen Verhaltens und Befindens zu diesem Zeitpunkt. Eine wesentlich mit vorbereitete Kundgebung des Anspruchs auf Legalität wird beschrieben, ebenso wie die zahlreichen „Kontaktstunden“, zu denen Bernhof seine Wohnung den bald anstürmenden Leipzigern öffnete. Weitere Texte sind der Versieglung der Staatssicherheit und von Objekten weiter bestehender Sondertruppen gewidmet, z. B. in „Rauchzeichen.“ Auch diese beschriebene Aktion ist in der Öffentlichkeit bis heute so gut wie unbekannt geblieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Reinhard Bernhof
Die Leipziger Protokolle
ISBN 978-3-96521-962-5 (E-Book)
Das Buch erschien 2004 im projekte verlag Halle.
Covergestaltung: Ernst Franta
© 2025 EDITION digitalPekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Vorbemerkungen
Leipziger Protokolle, unbekannte Innenräume einer sanften und abgewickelten Revolution teilen bisher noch nicht beschriebene authentische Erfahrungen mit. Sie wenden sich gegen unzulässige Verfestigungen und würdigen Bürger, die unter Gefahr den Aufbruch mit initiiert haben und heute hinter den gängigen Heldenattrappen verschwunden sind. Die Beobachtung der Entwicklung erlaubt dabei Erkenntnisse über einen gesellschaftlichen Grundvorgang: den Wechsel vom Zusammenfall einer nur aus herrschenden Sätzen bestehenden Partei- und Staatsführung, die ihre Ideale längst verraten hatte, bis zum hoffnungsvollen Neubeginn in einem vereinten Deutschland für mehr Demokratie und Emanzipation, aber auch zu andersartigen Macht-Ergreifungen, zum erneuten Umkippen in opportunistische Anpassungshaltung, zu Massenspaß und Massenarbeitslosigkeit …
Reinhard Bernhof beschreibt in seinem Buch den Umbruch 89, der in Leipzig seinen Anfang nahm. Seine Texte leben überwiegend von der persönlichen Teilnahme an den Aktivitäten vor und in der Bürgerbewegung, in einer Zeit realer Gefahr, als die sich überstürzende Entwicklung noch keine Richtungen erkennbar werden ließ: Angst, Staunen, Mitgerissensein bis zum Mitdenken und Handeln. – Sie beginnen bei den noch voreinander verborgenen ersten Schritten von Leipzigern, die in geheimgehaltenen Wohnungen erregt Veränderungen einforderten – und sie führen Schritt für Schritt zur Begegnung mit dem eigenen Bedürfnis nach Freiheit und dem entfremdeten Mit-Bürger. – Da Bernhof einer der allerersten Kontaktmänner des Neuen Forums war, konnte er seine Beobachtungen in der direkten Begegnung mit den verängstigten und doch aufbrechenden Menschen deutlich erkennen. Die Texte schildern Starre, zögernde Öffnung, Lebendigkeit der unter Gefahr aufgesuchten und für eine demokratische Wandlung geworbenen Menschen aller sozialen Schichten und geben damit einen so differenziert noch nicht erfassten Querschnitt des tatsächlichen Verhaltens und Befindens zu diesem Zeitpunkt. Eine wesentlich mit vorbereitete Kundgebung des Anspruchs auf Legalität wird beschrieben, ebenso wie die zahlreichen „Kontaktstunden“, zu denen Bernhof seine Wohnung den bald anstürmenden Leipzigern öffnete. Weitere Texte sind der Versieglung der Staatssicherheit und von Objekten weiter bestehender Sondertruppen gewidmet, z. B. in „Rauchzeichen.“ Auch diese beschriebene Aktion ist in der Öffentlichkeit bis heute so gut wie unbekannt geblieben …
Bei allen Texten handelt es sich nicht um eine politikferne, nur beobachtende Autorensicht, sondern um die ganzzeitliche Teilnahme an gesellschaftlich chancenreichen Vorgängen, trotz der Ahnung auch des möglichen Scheiterns oder zumindest ungenügenden Wandels der Gesellschaft und aller ihrer Bürger.
hasloe fockeberg
Dieses Buch ist frei von Zensur einer Stiftung, ohne Förderung eines Ministeriums unabhängig geschrieben worden. Deswegen danke ich Ulla, Inka und Benjamin für ihre Unterstützung, Geduld und Nachsicht. Und immer, wie für jedes Buch, in Gedenken an Tim.
Reinhard Bernhof
I
DIE ERSTEN UNTERSCHRIFTEN
(Ab 12. Sept. 1989)
Im August 1989 bot mir der Schriftstellerverband der DDR eine Studienreise an. Jahr für Jahr hatte ich die anderen fahren sehen, die „Reisekader“. Nun sollte ich augenblicklich entscheiden, ob ich meinen Horizont in einem anderen Kulturkreis erweitern wollte, in der Volksrepublik Kongo, Brazzaville. Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet Afrika, während die DDR den größten Massenexodus ihrer Geschichte erlebte. Die Jugend floh nach Prag und Warschau und besetzte bundesdeutsche Botschaften, sie durchquerte Ungarn und schlug sich durch den löchrig gewordenen Zaun nach Österreich, floh, rannte davon. Unwille überkam mich, ich spürte stechend, dass die DDR mit ihrer gebetsmühlenhaften Fortschrittsmetaphysik immer weiter hinter den Menschen zurückblieb.
Eine Mitarbeiterin, zuständig für Auslandsreisen, hatte aus Berlin angerufen. Schon einmal – neun Jahre zuvor – hatte es einen kurzen Kontakt zwischen uns gegeben. Damals konfrontierte ich sie mit einer Einladung von VOICES, der ältesten literarisch-kulturellen Institution der englischen Gewerkschaftsbewegung, die in Manchester ihren Sitz hatte. Sie bat um Rückruf wenige Tage später und teilte mir dann mit, dass ich natürlich nicht fahren dürfe und mich so zu entschuldigen habe, dass ich aus rein persönlichen Gründen der Einladung nicht Folge leisten könne. Ich antwortete, dass ich nicht dressiert genug sei, um aus Abhängigkeit zu heucheln, und warf den Hörer auf.
Mitte September besuchte mich Dieter Mucke aus Halle. Er brachte den Aufruf der eben in Grünheide bei Berlin auf Robert Havemanns Grundstück gegründeten Bürgerinitiative mit, den er von Heidi Bohley, einer Verwandten Bärbel Bohleys, bekommen hatte. „Aufbruch 89 – Neues Forum“. Ich könne mich mit Michael Arnold, einem Mitunterzeichner aus Leipzig, in Verbindung setzen. Die Adresse war angegeben.
Endlich ein Weg. Das Gefühl, an der bleiernen Realität des Landes zu ersticken, war in Mucke und mir gleichermaßen bedrückend. Wir kannten das zermürbende Ringen um elementare Rechte und strapazierten uns gegenseitig zuweilen bis zur Zerreißprobe. Und da wir nicht in Berlin wohnten, hatten wir auch kaum die Möglichkeit, in die sich anbietenden Mikrofone fremder Sender zu sprechen. Aber wollten wir denn die DDR von außen anbellen? In den Bezirken blieb man ausgeschlossen, so dass wir uns stets wie in einer Kapsel vorkamen, ohne die Hoffnung aufzugeben, dass darin eines Tages doch ein menschlicherer Sozialismus keimen könnte.
Manchmal, wenn wir uns bei Freunden trafen, las uns Mucke einen Text vor, ein Gedicht oder eine Eingabe, ein Protestschreiben oder eine politische Reflexion über eine Partei – weniger links als mehr nur eine staatstragend kleinbürgerliche –, deren meiste Mitglieder nicht einer Überzeugung dienten, sondern einer autoritären Hierarchie, die nur Apathie, Unbeweglichkeit und Angst produzierte und sich längst von den Idealen der Arbeiterbewegung verabschiedet hatte. Muckes Statements waren Notsignale, nicht für den Westen bestimmt, sondern beharrlich an sein Umfeld gerichtet.
Nun dieser Aufruf. „Die gestörte Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft lähmt die schöpferischen Potenzen unserer Gesellschaft und behindert die Lösung der anstehenden lokalen und globalen Aufgaben. Wir verzetteln uns in übel gelaunter Passivität und hätten doch Wichtigeres zu tun für unser Leben, unser Land und die Menschheit.“
Die Erhaltung von Bewährtem und doch Platz für Erneuerung. Für öffentlichen Dialog, gegen Meinungsunterdrückung durch Zensoren, Büttel, Spitzel …
Der Aufruf kam mir vor wie eine Brücke hin zu den Basisgruppen, die zunehmend in Kirchenräumen zusammenkamen. Dies, obwohl er ein wenig zu sehr nach schöner Menschengemeinschaft klang, mir der Glaube an das Gerechtigkeitsversprechen des DDR-Sozialismus längst abhanden gekommen war.
Am nächsten Tag parkte ich meinen Lada weitab von der angegebenen Adresse und näherte mich der Zweinaundorfer Straße. Nichts, das verdächtig erschien. Nirgends ein Fahrzeug, in dem sich Männer befanden, Radio hörten oder Zeitung lasen. Ich erreichte ein größeres gepflastertes Hofgelände, in dem sich eine KFZ-Werkstatt ausgebreitet hatte. Das Gewitterlicht eines Schweißgerätes flackerte hinter der Werkstattfensterscheibe, Hammerschläge waren zu hören, als ich vor dem dunkelblauen Hausnummernschild des Hintergebäudes stand: 20a. Die Tür nur angelehnt. Ein muffiger Geruch schlug mir entgegen, nach Ungelüftetem und Verfaultem. Die Wände des Toreingangs fantasiebemalt: graue, weiße, gelbe, rote Konturen. Die Briefkästen in grellem Blau, darunter rot tropfende Bögen auf weißem Unterton. Auf dem Treppenaufgang ungeleerte Mülleimer und alte Kompottgläser, Flaschen, strohblumengemusterte Tellerscherben. An der Wand Infos und ein Aufruf des Neuen Forums, hektografiert. In der ersten Etage der grau-braun-weiße Stamm eines Baumes, grüne Verästelungen und Blätter, ausgemalt bis zur Decke. Ich klopfte an eine angelehnte Korridortür. Öffnete sie vorsichtig, rief hinein. Die schmale Küche, die von einer Fensterluke nicht genügend Licht erhielt, um ihre Armseligkeit ganz preiszugeben. Ein uralter Kachelofen darin. Eine Stellage mit schmutziggrauem Vorhang, der mitten im Raum auf dem Boden lag.
Schnell verließ ich die Wohnung, klopfte an der gegenüberliegenden Tür. Auch sie nur leicht angelehnt. Ist da jemand? Das leere Geviert mit drei Bettgestellen, ein Stuhl und ein Schrank, der aufklaffte, weil er nur noch drei Füße hatte und beide Türen vornüberhingen. Ein Brodem aus Abfall und Nässe stieg auf. Vorsichtig verließ ich die Wohnung. In der dritten Etage endlich ein Türschild. Der angegebene Name. Die Klingel zum Drehen, kaputt. Klopfen. Eine junge Frau, groß und schlank, ein Baby im Arm, öffnete. Sie ließ mich ohne Misstrauen herein und bot mir in der Küche, wo sie mit dem Baby beschäftigt war, Platz an. Mischa müsste bald wieder zurück sein, sagte sie.
Bald darauf ein Knarren im Hausflur. Schlüsselgeräusche. Ein junger Mann, groß gewachsen, Dreitagebart, begrüßte mich neugierig. Wir sprachen sogleich über den Aufruf. Er müsse hektografiert und anderweitig vervielfältigt werden, sagte er. Unter die Leute bringen. Unterschriften zusammenholen, damit wir was in den Händen hätten und als Bürgerinitiative zugelassen würden. Je mehr Unterschriften, umso mehr Druck könnten wir machen.
Mit den wenigen Blicken, die wir getauscht hatten, schien alles gesagt. Was wusste ich von ihm? Was er von mir?
Ich ging mit den Unterschriftenlisten. Drehte mich im Hof noch mehrere Male um, überquerte die Zweinaundorfer und erreichte wieder die Sellerhäuser Straße, wo mein Auto stand. Langsam fuhr ich durch die Stadt, auf Umwegen in Richtung Gohlis ins Heinrich-Budde-Haus, in dem meine Frau zu dieser Zeit arbeitete. Sie war sofort bereit, den Aufruf und die Listen zu vervielfältigen.
Unerwartet trat der Klubhausleiter hinzu, Erwin Bergel, und warf einen kurzen Blick auf das Papier. Meine Frau lenkte ihn sofort ab. Die Gewerkschaftsleitung habe angerufen und warte auf Rückmeldung. Schnurstracks verließ er den Raum. Spätabends kam meine Frau mit einem Packen Aufrufe, Unterschriftenlisten und mehreren Unterschriften nach Hause.
Am Morgen darauf erhielt ich ein Telegramm aus Berlin. Der Schriftstellerverband drängte auf einen Rückruf. Ich ließ mir Zeit, hatte mich längst entschieden, nicht in den Kongo zu fliegen. Eine Zusage jetzt, wo endlich eine große und langersehnte Hoffnung zu keimen begann, wäre mir wie Verrat vorgekommen. Mit der DDR assoziierte ich nur noch Ödnis, Tristesse und Verlogenheit, die mit dem Sozialismus gar nichts mehr zu tun hatte. Obwohl ich in sechzehnjähriger Mitgliedschaft im Schriftstellerverband nur einmal – und zwar nach Sibirien – hatte reisen dürfen, wollte ich diesen Flug in den Kongo nicht antreten.
Mittags lief mir in der Innenstadt Gerolf über den Weg. Wir begrüßten uns mit Handschlag. Er war Philosophieprofessor. Wir hatten uns viele Jahre nicht mehr gesehen. Ich fragte ihn, was denn der alte Bartmann aus Trier, wenn er noch lebte, über die Ausreisewelle und Botschaftsbesetzungen sagen würde. Gespielt nachdenklich sah Gerolf über mich hinweg, so wie ich ihn früher bei seinen Seminaren erlebt hatte, über die Köpfe der Studenten hinwegblickend, wenn ihm eine unangenehme Frage gestellt wurde. Diesmal aber benötigte er besonders viel Zeit, ehe er zu einer Antwort kam: Sieht nicht gut aus … Seine Stirn runzelte sich. Die meisten gehen doch den Verlockungen aus dem Westen auf den Leim.
Ich gab ihm den Aufruf. Zum stärkeren Gebrauch der eigenen Gedanken. Und ob er denn nicht mitbekommen habe, wie alles um ihn herum veralte?
Während er auf das Papier starrte, sagte er: Manchmal hatte ich natürlich auch meine Zweifel. Aber hast du eine bessere Idee? Ohne bessere Idee versiegt der Wille zur Neuorientierung und Selbstbestimmung, und es könnte zur vollständigen Vereinnahmung durch das andere System kommen.
Aber auch des alten!
Dennoch, historisch gesehen werden wir recht behalten. Wenn wir auch augenblicklich in die Bredouille geraten sind, sagte er.
Gerolf faltete den Aufruf zusammen und steckte ihn in seine Brusttasche, sah mich stirnrunzelnd an, als hätte ich damals, bei seinen Seminaren, nicht richtig aufgepasst. Eindringlich sagte er: Alles, was sich jetzt so langsam anbahnt, könnte wieder in die alte Ordnung münden, glaub mir das, in das alte Mietkaufleben, das, was hinlänglich abgezahlt werden muss, in dem letztendlich die Diktatur des Geldes herrscht. Ich müsse es doch wissen, der ich doch einst von der anderen Seite gekommen sei.
Meine Haltung war damals durchaus „revolutionär“ gewesen, sagte ich, aber auch völlig illusorisch. Ich wollte den Alltag und die alten Begriffe verändern. Ich wollte meine Sprache mit neuen Gedanken verbinden. Gleichzeitig aber war ich überzeugter Pazifist. Dass man mit Gewaltanwendung überhaupt nichts erreicht, das war doch schon damals, vor über zwanzig Jahren, für viele Kulturfunktionäre das große „ideologische Problem“ mit mir gewesen.
Nein, mit Pazifismus oder mit einem „dritten Weg“ kann man keinen Sozialismus verwirklichen, allerdings, warf er hin.
Ich merkte, es tat ihm weh, mir begegnet zu sein. Er sagte, er habe einen Termin. Flüchtig verabschiedeten wir uns. Irgendwann wollten wir uns weiter unterhalten. Ja, irgendwann …
Für den nächsten Tag hatte ich mir vorgenommen, einige Freunde und Bekannte aufzusuchen, um von ihnen, wie naiv auch immer die Erwartung sein mochte, eine Unterschrift zu bekommen. Es bedürfte nur eines Anstoßes, glaubte ich, um eine Einheit für mehr Zivilcourage zu schaffen. Doch schon der erste, ein Diplomingenieur, den ich gut zu kennen glaubte, von dem ich wusste, dass er Gedichte von Reiner Kunze und dessen Buch „Die wunderbaren Jahre“ las, sagte mir, er stehe zu diesem Aufruf, möge ihn aber nicht unterschreiben. Endlich, seit einem Monat, führe er eine eigene Abteilung in Espenhain, diese Position – erreicht trotz Parteilosigkeit – wolle er um nichts in der Welt aufs Spiel setzen. Und sogleich beeilte er sich zu erwähnen, dass seine Frau in der Stadt auf ihn warte.
Ohne mir große Hoffnungen zu machen, besuchte ich als nächsten einen befreundeten Grafiker, Lehrkraft an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Er fragte mich lebhaft, wie es mir gehe und was ich mache. Ironisch sagte ich, dass es mir erstaunlich gut gehe angesichts der augenblicklichen Lage. Dabei zog ich den Aufruf heraus und sagte lapidar: Ich sammle Unterschriften.
Er überflog die Zeilen und befand: Ziemlich banal.
Ist nun mal keine Lithografie, sagte ich. Diese Banalität künstlerisch umzusetzen kommt einer Revolution gleich, die die siebzigjährige Oktoberrevolution und die vierzigjährige DDR überholen würde, ohne sie einzuholen, flachste ich.
Er lächelte, nicht mehr so gleichgültig wie eben noch vor Sekunden.
Er könne niemals so ein Stück Papier irgendwohin tragen und gar Unterschriften einfordern. Machen wir lieber gute Kunst …
Für spätnachmittags hatte ich mich bei einer Familie angemeldet, deren Sohn mit meiner Tochter in den christlichen Kindergarten ging. Das schöne Grundstück, auf dem das villenähnliche, efeuumwachsene Zweifamilienhaus stand, strahlte Bürgerlichkeit aus. Im Flur Teppiche und große Amphoren. Der Hausherr bat mich ins Wohnzimmer: alte Möbel, schwere Vorhänge, Bilder in dicken Goldrahmen, als wäre nicht allzu viel Leben im Raum, als gelangte es von draußen nicht hinein.
Der Mann war Physiker, trug Vollbart und eine Stahlrandbrille. Seine Frau machte einen warmherzigen Eindruck, sie brachte auf einem Tablett Kaffee und Cognac. Sie huschte dicht an mir vorbei, und ein Luftschwall ihres Parfüms umfing uns. Sie hatte sommersprossige Hände und rotbemalte Fingernägel. Ich legte den Aufruf auf den Tisch, und wir sprachen zunächst über die allgemeine politische Lage, über die vielen Ausgereisten und dass wir gemeinsame Bekannte hatten, die längst nicht mehr in der DDR waren. Nein, ausreisen würden sie nie und nimmer. Ich dachte an ihr schönes Haus, den Garten. Ich erinnerte an den Aufruf, beide begannen zu lesen und ließen sich sehr viel Zeit, während ich auf die Rücken der Bücher sah: Christa Wolf und Günter Grass, viele Reclam-Bücher. Edition Neue Texte des Aufbau Verlages.
Ja, von diesem Aufruf hätten sie in den Westmedien gehört. Wer nicht ausreist, der sollte etwas tun, sagte ich.
Obwohl er die beigelegte Liste, auf der noch kein Name stand, nicht übersehen konnte, fragte Herr S.: Was denn? Er hege keine Hoffnung, etwas verändern zu können. Trotz Glasnost und Perestroika.
Jedes Gramm russische Freiheit ist ein halbes Gramm DDR-Freiheit, sagte ich, und für dieses halbe Gramm müssen wir hier kämpfen.
Ich will schon etwas verändern, sagte er, nur bin ich mehr für die langsame Methode. Zwar langweilig und bescheiden meine Philosophie … Einerseits steht es mir nicht zu, zu glänzen mit einer Unterschrift, andererseits … die Familie, das Haus … Hört sich ein bisschen kleinkariert an. Nicht wahr?
Macht nichts.
Wir diskutierten noch über Kindererziehung und Schulprobleme, bis ich mich reichlich spät verabschiedete.
Zwei Tage später besuchte ich einen Schriftstellerkollegen in seiner Wohnung. Ich kannte ihn über fünfzehn Jahre, ich hoffte auf eine Unterschrift. Er publizierte überwiegend historische Romane und Übersetzungen. Ein gut erhaltenes Jugendstilhaus, mit Elsterglanz polierte Messingschilder, Stille im Hausflur.
Es missfalle ihm, Aufrufe zu unterschreiben, sagte er sofort, von oben herab.
Dem Nutzeffekt müsse die Gefährdung gegenübergestellt werden. Für ihn sei der Boxkampf im geistigen Ring Literatur das Entscheidende. Die Schwächen des Gegners studieren, ihn stellen, klar treffen und so Punkt um Punkt sammeln, bis die eigene Waagschale die schwerere werde.
Ich sagte: In der augenblicklichen Lage, wo die Jugend eines Landes höher auf der Höhe der Zeit steht als wir, sind deine Gedanken nur Ausflucht.
Ausflucht? Auch mit historischen Stoffen kann man Widerstandspotenzial wecken, sagte er. Von deinen Bürgerinitiativen, wie du sie vertrittst, halte ich wenig, die Aufrufer wohnen doch ganz in der Nähe der akkreditierten westlichen Journalisten in Berlin. Keine Woche vergeht ohne einen Auftritt bei ARD oder im Deutschlandfunk! Tun wir dagegen etwas im Bezirk, kräht kein Hahn danach, werden wir sofort blockiert. Es gibt doch nichts Schlimmeres für einen Oppositionellen oder für einen Reformer, als unbekannt zu bleiben.
Dennoch müssen wir uns engagieren. Keine Eitelkeiten. Du schreibst Buch um Buch, zitierst alle möglichen Gelehrten, visionierst glückliche Zeiten. Und plötzlich – klick – muss man die Worte doch beweisen? Oder was meinst du?
Er sah mich an mit großen geblendeten Augen, als wäre er nach langer, langer Zeit wieder einmal unter einem dicken Stein hervorgekommen. Sagte nichts mehr. Wortlos gingen wir auseinander.
Auch bei Henriette, die Theologie studierte und Gedichte schrieb, fand ich mit dem Aufruf keinen Anklang. Ich hatte ihr früher einige kritische Texte von mir zu lesen gegeben, von denen sie danach schwärmte. Ja, so ist es, genau so! hatte sie immer wieder gerufen. Wie sie sagte, hatte sie sich Auszüge aus meinen Manuskripten „Im Schatten der Kolossalfiguren“ und aus „Kerbholz“ gemacht und sie auch ihrem Freund gegeben, der lernte fast alles auswendig, um Wendungen und Sätze parat zu haben.
Aber andererseits … Alles in Grenzen. Mein Weg sei ihr zu aufregend. In manchen Texten sei ich ihr zu absolut. Der Alltag war voll von all den Dingen, über die ich schrieb, ja, aber sie sei mehr für die praktische Variante. Sie betonte, dass sie in einer Umweltgruppe mitarbeite und übers Wochenende in einem Braunkohle-Rekultivierungsgebiet Bäume pflanzen fahre, obwohl sie unentwegt rauchte wie eine russisch-revolutionäre Kommissarin. Sie lachte. Wir tranken Rotwein und Mokka, bevor ich ging.
Am nächsten Tag kam meine Frau mit Unterschriften von der Arbeit nach Hause. Immerhin, nicht alle, aber ein paar hatten es gewagt. Eine kulturpolitische Mitarbeiterin, ein junges Mädchen aus der Bibliothek. Der Hausmeister. Ermutigt davon ging ich noch am gleichen Abend zu einer Sportlehrerin im Viertel, mit der wir befreundet waren, Heike Trapp, unsere Kinder besuchten dieselbe Schulklasse. Sie unterschrieb sofort, obwohl sie durchaus Konsequenzen in der Schule zu befürchten hatte. Eine Tante von ihr lebt in Schottland, vielleicht hatte sie deshalb ein ausgeprägteres Selbstbewusstsein.
Sie bot mir an, mir zu einer weiteren Unterschrift zu verhelfen. Eine Kollegin, die in der Schule immer wieder aufmuckte, Leiterin einer siebenten Klasse.
Wir fuhren auf der Stelle in die Ernst-Thälmann-Straße im Leipziger Osten. Die Lehrerin war zu Hause. Vom Neuen Forum hatte sie gehört, sie nickte ungeduldig. Ohne den Aufruf durchzulesen, gab sie ihre Unterschrift. Sofort begann sie erregt über die Schule zu schimpfen, vor allem über die Nachwuchsgewinnung für die NVA. Sie lachte spöttisch und erbittert, nahm ihre Brille ab und putzte die sehr dicken Gläser. Zu Anfang des neuen Schuljahres musste ich Fragebögen ausgeben, für Berufsunteroffiziersbewerber und Berufsoffiziersbewerber – BUB und BOB –, sagte sie und griff sich an den Kopf. Innerhalb des ersten Halbjahres waren sie abzuarbeiten, mit den persönlichen Angaben der Schüler, ob sie zur Arbeiterklasse gehörten oder nicht, mit den Personenkennzahlen der Eltern, mit den Zensuren in den Hauptfächern. Meine Direktorin, erzählte sie, hat Samstag für Samstag Gespräche mit den Eltern geführt: „Stabü“ (Staatsbürgerkunde) und Wehrerziehung, versuchte sie ihnen klarzumachen, gehörten zur Volksbildung. Eine Weisung von Margot Honecker. Ein geworbener Schüler durfte sich von nun an nicht mehr schulisch verschlechtern, musste die Noten, die auf dem Fragebogen eingetragen waren, bis zur zehnten Klasse „halten“. Dafür hatte sie zu sorgen. Auch im Klassenbuch mussten alle Schüler besonders gekennzeichnet werden, die sich für BUB oder BOB entschieden hatten oder dazu überredet worden waren. Eine Verschlechterung dieser Schüler musste ich zunächst bei meiner Direktorin verantworten und dann vor dem Stadtbezirks-Schulrat. Er hatte bei der letzten Direktorenkonferenz ausdrücklich erklärt, dass es für eine Verschlechterung der Zensuren der Bewerber keinerlei Rechtfertigung gebe. Es sei etwas, das einfach nicht vorkommen dürfe. Nun können sich die betroffenen Schüler auf den Lorbeeren des siebenten Schuljahres ausruhen – wie soll ich das mit meinem Gewissen vereinbaren?
Als wir uns von ihr verabschiedeten, fragte sie aufgewühlt: Wie geht es weiter? Ich ließ ihr eine Unterschriftenliste und den Aufruf da. Gleichgesinnte ansprechen. Eine pädagogische Gruppe anstreben, mit ähnlichen Auffassungen … Wir beschlossen, in Verbindung zu bleiben.
Sollte ich die Leute in meinem Haus ebenfalls ansprechen? Ich zögerte, fühlte mich befangen. Die einzige Ausnahme war Hans-Joachim Walch, Grafiker und Buchgestalter, bei dem stets viele Autoren und Künstler verkehrten. Er bat mich sofort in sein chaotisch schönes Arbeitszimmer, in dem sich die Bücher auf dem Fußboden stapelten und an dessenWänden Originalgrafiken von Max Schwimmer und Miniaturen von Albert Ebert hingen. Er hatte selbst schon einiges über die Bürgerinitiative gehört und ließ sich alles haarklein erzählen. Nachdenklich fasste er sich ans Kinn und bat sich ein paar Tage Bedenkzeit aus. Er bedachte es nicht allzu lange. Am übernächsten Tag kam er mit seiner Unterschrift und der seiner Frau Ursula. Hoffentlich geht alles gut, sagte er.
Auch das zweite Grafiker-Ehepaar, Ino und Paul Zimmermann, das für einen christlichen Verlag arbeitete, unterschrieb. Die Genossen im Haus hingegen hatte ich noch nicht angesprochen, ein Professor, ein Sportwissenschaftler. Einer Arztfamilie, die stets selbstbewusst in die benachbarte katholische Kirche ging, war ich zu forsch aufgetreten. Sie ging mir plötzlich aus dem Weg.
Nachmittags besuchte mich ein junger Mann, FDJ-Sekretär in einem Betrieb, wie er betonte, so als wollte er mich schockieren. Er hatte von meiner Unterschriftensammelaktion gehört. Seine Augen strahlten, es wurde noch verstärkt durch die nostalgische Nickelbrille. Wie ein FDJ-Sekretär sah er nicht aus. Er habe Missstände auf vollkommen legale Weise zu beseitigen versucht, es gebe aber jedes Mal Zoff mit der Stadtleitung. Freie Äußerungen würden lächerlich gemacht, Reformvorstellungen im Keim erstickt. Seine tatsächliche Meinung spreche keiner mehr aus. Die Partei schiebe alle Probleme hinaus und löse keines.
Ich fragte ihn, ob er in der SED sei. Er bejahte.
Ich reichte ihm den Aufruf, er nickte. Wo soll ich unterschreiben?
Abends kam mein Hauselektriker, Herr Seidel war SED-Mitglied und hatte früher im Bezirkstag Leipzigs gesessen. Er wollte einen Zusatzstecker für die halb automatische Foron-Waschmaschine, die wir dem Handel hatten entreißen können, installieren. Auf den Aufruf hin sagte er, dass er bald aus der SED austreten wolle. Ich bin damals nur eingetreten, weil ich Arbeiter war und aus allerkleinsten Verhältnissen kam. Das war vor vierzig Jahren. Und in dieser Partei kam ich mir – ehrlich gesagt – ein bisschen geadelt vor. Das stimmt schon. Vorteile hatte ich keine, ich bin immer Elektriker geblieben. Als mich die Partei auf Schulung schicken wollte, lehnte ich ab. Fragen Sie mich nicht, wie viele Verbesserungsvorschläge ich gemacht habe, ohne dabei an Geld zu denken.
Dann sind Sie ja ein echter Kommunist, sagte ich.
Wenn Sie so wollen, bin ich einer. Ich habe vor allem immer das Gemeinwohl im Auge gehabt.
Unversehens zeigte er auf seine Hände. Die Innenflächen waren zerkerbt und vernarbt. Er bewegte sie hin und her. – Als ich damals in die Partei eintrat, fing er wieder zu reden an, dachte ich, als denkender Mensch musst du nach all dem Leid und Elend in Deutschland einfach mitwirken. Sie erschien mir wie … Atemluft, oder wie Brot, die Wahrheit der Arbeiter und Bauern. Heute kann ich darüber nur lachen … Diese Partei! Einst war sie gegen Privilegien, heute werden genau die von wenigen einzigartigen Idioten mit aller Macht aufrechterhalten: Extrawälder, Extrainseln, Sonderstrände!
Er begann aufgebracht zu rauchen, fragte mich nach einer Weile, ob ich es gestatte. Er nahm den Aufruf und unterschrieb schnell und nachdrücklich.
Wider Erwarten waren doch ein paar Unterschriften zusammengekommen. Einige sogar von Leuten, denen ich es nicht zugetraut hätte. In solchen Momenten ging ich oftmals sofort noch einmal aus dem Haus, erleichtert und neugierig, doch auch befangener, in einer sonderbaren Aufregung allein.
Mischa Seymer wohnte zwei Häuser von mir entfernt. Er hatte vier Kinder und reparierte nach Feierabend für fast alle Leute im Rondell Rosslauer Straße Trabants, Wartburgs und Ladas. Man konnte kommen, wann immer man wollte, Mischa lag meistens unter den aufgebockten Fahrzeugen, neben Lampen und Scheinwerfern, die die Anwohner geduldig hielten, und hörte sich ihre Probleme, Beschwernisse und Verzweiflungen mit den Autos an. Tagsüber arbeitete er als Hubschrauber-Techniker auf dem Mockauer AGRA-Flughafen. Seine Frau war zu Hause und kümmerte sich um die Kinder. Als ich ihn ansprach, lud er mich in seine Wohnung ein und sagte: Darauf habe ich schon lange gewartet! Ich unterschreibe sofort! Dabei rief er nach seiner Frau: Christine, du auch! Unterschreib!
Ich hätte auch ohne Befehl unterschrieben, zwinkerte sie mir zu.
Auch Karl-Georg, der im Schichtdienst bei der Deutschen Post Pakete karrte, war sofort bereit. Gib her, sagte er, wenn du was zu unterschreiben hast. Ich scheu’ mich nicht, dafür meine Handschrift zu geben.
Ich fragte ihn, ob er denn mit seiner Qualifikation als Diplomphilosoph keine ihm gemäße Arbeit verrichten könne. Empört und vorwurfsvoll sah er mich an. Etwa in einem Betrieb? Einer Institution? Das habe ich mir längst abgeschminkt. Mag sein, dass die Philosophen ursprünglich einmal angetreten sind, die Welt zu verändern – ich sag nur: Feuerbach-Thesen. Wir können damit doch gar nichts mehr anfangen, in diesem Theoriegebäude sind ja kaum noch Veränderungen möglich. Wo denn? Wenn hier dennoch ein Philosoph Lohn und Brot hat, dann nur, um dafür zu sorgen, dass der Partei keine Probleme entstehen. Er hat nicht die Rolle des Schöpfers, neue Ideen zu verbreiten, sondern die des Aufpassers, er soll für Ruhe und Ordnung sorgen. Alles Neue würde nur den routinemäßigen Ablauf stören. Tagtägliches Gequatsche von einem Traumziel, wo es materielle und geistige Reichtümer geben soll, ohne sich dem auch nur einen Schritt anzunähern. Denkende werden zum Schweigen gebracht. Mein Beruf, wenn ich ihn ausüben könnte, ist dazu verurteilt, alles zu rechtfertigen, was der Wahrheit und wissenschaftlicher Analyse nicht standhält. Hierzulande hat die Philosophie sich von der Philosophie verabschiedet.
Warum hast du sie erst studiert?
Sie hat mich immer beschäftigt. Wer weiß, vielleicht neige ich aber mehr dazu, sie zu praktizieren. Lieber eines Tages unterm Kanaldeckel als diese Breitärschigkeit von Oebisfelde bis Kamtschatka.
Ich ließ ihm noch ein paar Listen da und sagte: Mach die erst einmal voll, bevor wir in der Kanalisation oder im Gulag verschwinden.
Zu Hause wartete Peter Hinke auf mich, ein junger Buchhändler, der in einem staatlichen Antiquariat in der Karl-Liebknecht-Straße arbeitete. Er brachte mir seine Zeitschrift „Sno'Boy“ Nummer 2, Mai 89 mit, darin Fotos deprimierender Industrie-Landschaften eingelegt waren und dazwischen Texte u. a. von Holger Jackisch, Thomas Böhme und Uwe Romanski. Auch von mir wollte er ein paar Underground-Gedichte in die nächste Ausgabe mit aufnehmen. Ich fragte ihn, ob er vom Neuen Forum wisse, von dem Aufruf. Er war sofort bereit zu unterschreiben.
Spät rief Jürgen Zumpe an, Meister für Straßenbahnwartung in Taucha. Er hatte bereits zwölf Adressen mit Unterschriften gesammelt, gab die Liste einem Schlosser mit, der auch seine Frau unterschreiben lassen wollte. Am nächsten Tag fragte Zumpe danach. Der Schlosser hatte Angst bekommen und die Liste zerrissen.
Ich hatte vierzehn Unterschriften mit Adressen zusammen. Es war aufwendig, jedes Mal überraschend, aber auch eine neuartige Anspannung. Allmählich wuchs etwas wie Zuversicht. Es war September 1989. Die meisten Angesprochenen befürchteten, sich auf einen Akt der Illegalität einzulassen und blieben zögerlich oder voller Angst. Ich versuchte, sie zu überzeugen, dass es doch im Gegenteil ein Akt zur Herstellung von Legalität war. Sie nickten und schwiegen für sich.
Michael Arnold sah mich ruhig an, lächelte, als ich die Unterschriften brachte. Es sah aus, als hätte er nicht geglaubt,
Dass ich, einer der Älteren, es ernst gemeint hatte. Seine Frau bettete das Kind zum Mittagsschlaf ins Wohnzimmer und setzte sich zu uns an den Küchentisch. Sie sagte: Wenn die Leute doch einfach mehr Mut hätten.
Und sich nicht scharenweise in den Westen davonschleichen würden …
Angst als das Hauptprodukt des Sozialismus …
Je mehr wir werden, um so weniger sind wir Gefangene irgendeiner Angst, sagte Arnold. Wir verstehen sie, die Ausgereisten, und fühlen uns dennoch verraten, weil wir hier etwas verändern wollen. Er blickte zur Uhr, stand auf. Er müsse zum Telefondienst in die Nikolaikirche. Aber am Mittwoch, neunzehn Uhr. Erster Koordinierungstreff. Hier in der Zweinaundorfer. Im Parterre, rechts, okay?
Als ich nach Hause fuhr, sah ich öfter als sonst in den Rückspiegel. Verfolgungswahn? Immer nach bestimmten Besuchen bei gleichgesinnten Freunden und Bekannten hatte ich das Gefühl gehabt, verfolgt zu werden, sprach aber nie darüber, um nicht paranoid zu erscheinen.
Jetzt verdrängte die Freude, nun doch etwas mit zu bewegen, den untergründig ängstlichen Druck in der Magengegend. Der Durchbruch zu etwas Neuem schien für mich unaufhaltbar zu sein, ohne dass ich meiner sozialistischen Utopie abgeschworen hätte, die mit den Betonköpfen und Schleimern an der Regierung und mit den Massen von Mitläufern in der SED, mit den Adepten der Blockfreunde nichts gemein hatte. Die Vorstellung, etwas zu verändern, das Alte und Verkrustete aufzubrechen, hatte Farbe und Intensität, einen greifbaren Sinn bekommen. Ich fühlte mich nicht mehr ohnmächtig, sondern unversehens stark und kämpferisch.
In einem heißeren Kontinent sollte ich mich eigentlich befinden. Urplötzlich befand sich das unbekannte Land unter meinen Füßen.
KONTAKTSTUNDEN
(Ab 26. Sept. 1989)
Für den 26. September 1989 war ich zu einer Lesung in die Alte Handelsbörse eingeladen, die innerhalb einer gemeinsamen Reihe des Komponisten- und Schriftstellerverbandes der DDR stattfand: „Musik und Lyrik“. Ich war von der ersten Minute an hier und zugleich an einem anderen Ort. Für denselben Abend war kurzfristig ein Koordinierungstreffen des Neuen Forums festgelegt worden, zu dem ich erwartet wurde.
„Drei Lieder für Sopran, Violoncello und Klavier“ gingen in aufreizend getragenen Tempi über das Publikum in der halbgefüllten Börse hin. Die Zuhörer wirkten still, abwartend. Niemand von ihnen schien Unruhe zu verspüren. Kurt Drawert las Gedichte, nervös, ein Geschütteltsein, Frösteln nicht verbergend. Mit wachsender Ungeduld hörte ich auf die darauffolgende Komposition „Und manchmal flüstern die Tropfen …" und wartete auf meinen Auftritt. Ich las Gedichte über den selbstverständlich hingenommenen, von der „Parteiführung“ mit unglaublicher Arroganz ignorierten Verfall eines Leipziger Stadtteils wie Gohlis und blickte zwischendurch in die Gesichter der Zuhörer. Ein konzentriertes Interesse schien da zu sein, ohne Räuspern und Schnauben, es fiel mir auf. Ich dachte an die unsichtbaren Risse in den zementierten Gedanken, die die einzige Hoffnung blieben.
Ich verließ die Veranstaltung während des folgenden Liedzyklus und fuhr in den Leipziger Osten. Mich beherrschte die heimliche Erwartung von etwas Unvermitteltem, alles Erschütterndem und befremdete mich im nächsten Augenblick selbst, wie ein Überschwang, dem nur Ernüchterung folgen konnte. Hin und wieder war von kleinen Gruppen zu hören, die sich nach dem Gottesdienst in der Nikolaikirche in die Innenstadt begaben und dort manchmal auch im Chor nach Demokratie riefen, aber Beachtung fand es kaum bei der Mehrheit der Leipziger. Zu schnell, zu gewaltsam wurde jede noch so spontane Bewegung erstickt.
Diffuses Licht flackerte mir entgegen, als ich in die öde Wohnung in der Zweinaundorfer Straße kam. Ich war schon ein paarmal hiergewesen. Zwei, drei verwaiste Räume im Erdgeschoss, in denen nichts weiter stand als ein länglicher Tisch und ein paar Stühle. Keine Lampe, der Strom abgeschaltet. Zu meiner Überraschung waren nur wenige gekommen, sie saßen bei Kerzenlicht und gaben harte Umrisse auf den kahlen Wänden ab. Aus diesem kleinen Kreis sollten an diesem Tag die Kontaktleute des Neuen Forums hervorgehen, ihre Namen würden danach in allen Kirchen und Hochschulen der Stadt bekanntgemacht. Ich war betroffen. Wo waren die anderen, die bei den vorangegangenen Zusammenkünften dagewesen waren? Entmutigt? Zerstreut? Herrmann Schein, ein Theaterregisseur nickte mir zu. Michael Arnold, vorher bereits der inoffizielle Kontaktmann des Neuen Forums, der den Grünheider Erstaufruf mit unterschrieben hatte, vier, fünf andere, die ich nicht kannte, mehr nicht.