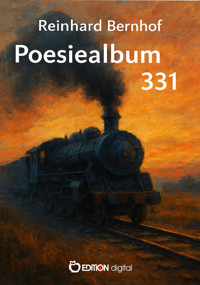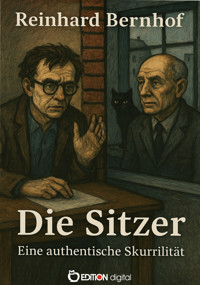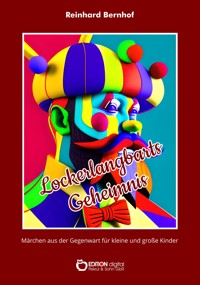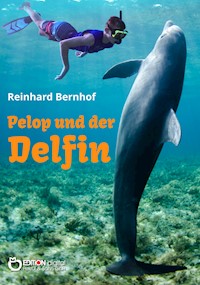6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
In 29 Kurzgeschichten beschreibt der Autor seine Erlebnisse als Kind bei der langen gefährlichen Flucht aus Breslau, den ersten Kontakt mit Amerikanern und Russen, die Ausgrenzung in der neuen Heimat, aber auch die Begegnung mit hilfsbereiten Menschen. Der ewige Hunger des Heranwachsenden in der Nachkriegszeit und die teilweise krummen Wege, um ihn etwas zu stillen, und das erste aus Schrott zusammengebaute Fahrrad sowie sich langsam entwickelnde Freundschaften lassen ihn in der neuen Heimat ankommen. Das Buch richtet sich an Kinder ab 12 Jahren und weckt ihr Interesse für Geschichte, Abenteuer und die Bedeutung von Freundschaft und Mitgefühl in schwierigen Zeiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Reinhard Bernhof
Fluchtkind
oder
Die langen Schatten der toten Lokomotiven
Roman in Folgen
ISBN 978-3-96521-960-1 (E-Book)
Das Buch erschien 2006 im Leipziger Literaturverlag, Edition Erata.
© 2023 EDITION digitalPekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
In Erinnerung an Tim
Für Inka und Benjamin
Mein Dank gilt dem Deutschen Literaturfonds Darmstadt; er hat dieses Buch gefördert.
Zum Geleit
Woher stamme ich?
Ich stamme aus meiner Kindheit wie aus einem Land.
Antoine de Saint-Exupéry
Der Junge, der ich einmal war, einer von vier, fünf Millionen Schlesiern, die ihre Heimat verloren haben, verfolgt mich noch immer, lässt mich nicht los. Bilder der Evakuierung, der Flucht, der Trecks tauchen auf. Wir wohnten in einem Dorf bei Breslau. Die Stadt war zur Festung erklärt worden.
Zehntausende Menschen begannen, um die Stadt herum Gräben zu schachten. Deswegen mussten wir Hals über Kopf unser Haus verlassen. Bei schneidender Kälte, bei zwanzig Grad unter Null begann auf einem offenen Wehrmachtslaster unsere Evakuierung. Die Straßen waren mit Pferdefuhrwerken und Panjewagen verstopft; dazwischen Frauen, Kinder und Greise, die Korbwagen schoben und Handwagen zogen. Flakgeschütze waren zu hören. An den Straßenrändern lagen Menschen, die zusammengebrochen und erfroren waren: Leichen über Leichen. Nach etwa dreißig Kilometern wurden wir in Liegnitz abgesetzt. Auf dem Marktplatz und an den Chausseebäumen schaukelten Erhängte. Junge Deserteure im Wehrmachtsmantel mit den dunklen grottenähnlichen Ärmelöffnungen; angeheftetes Schild im Chor: WEIL ICH MEINEN FÜHRER VERRIET. VOLKSVERRÄTER. Diese Schilder haben sich für alle Zeiten in mein Gedächtnis gekerbt.
Die vielen Stationen, bis wir in einem Planwagen die Neiße erreichten. Görlitz. (Täglich kamen dort 70000 Menschen an und wurden zwei, drei Tage später wieder weitergeleitet.) Wir übernachteten in einem Kino, lagen auf Stroh. Die Leute erzählten sich, dass die „Wilhelm Gustloff" mit etwa 6000 Flüchtlingen an Bord auf der Ostsee gesunken sei. – In einem Viehwaggon ging es weiter in Richtung Dresden. Kurz davor wurden wir umgeleitet. Dresden werde bombardiert, hieß es. Und überall auf verschiedenen Schienensträngen sah ich die vielen ausgebrannten Waggons und die langen Schatten der toten Lokomotiven.
In Nixdorf, Sudetenland, etwa 45 Kilometer von Dresden entfernt, stiegen wir nachts auf einen Berg und sahen das Inferno. Der Horizont war dunkelrot und zwischendurch wieder etwas heller. Die Leute, die mit uns auf den Berg gegangen waren, sagten: Dresden geht unter. Meine Mutter sagte: Ein Glück, dass wir rechtzeitig umgeleitet worden sind. Ich dagegen dachte: Was würde ich wohl machen, wenn wir wirklich nach Dresden gekommen wären? Ich würde mir Holzstücke und Balken nehmen und mir einen Hohlraum bauen, um mich darin zu schützen. – Später dachte ich: Der Mensch ist nicht imstande, sich den Tod vorzustellen. Er sieht sich immer in einem Hohlraum, in einer Kapsel, wo er überleben kann; er kann sich den Tod nicht vorstellen.
Vom Sudetenland bis nach Bayern kamen wir, von Bayern wieder zurück nach Schlesien, von Schlesien erneut nach Sachsen, von Sachsen ins Weserbergland, vom Weserbergland ins Ruhrgebiet, von Lager zu Lager, von Notquartier zu Notquartier.
Viele Jahrzehnte sind inzwischen vergangen – und erst jetzt beginne ich, Erlebnisbruchstücke und dramatische Aspekte meines kindlichen Daseins zu verarbeiten, und empfinde sie als Schlüssel zu meinem heutigen Leben. Aber hatte ich das Geschriebene wirklich alles im Kopf gespeichert? Wie oft hatte mir meine Mutter aus den Schriften ihrer Körperzellen – wie eine Bibliothek in ihr – vorgelesen? Hundertmal? Tausendmal? Es gab nach dem Krieg keine anderen Gedanken mehr für sie als diese Fluchtsituationen; alles, was sie erzählte, wob und rankte sie um diese Odyssee durch Deutschland. Sie hat für mich zu keiner Zeit ihre magische Kraft, ihr geheimnisvolles Dunkel und ihre Dramatik verloren. Auf einmal ist etwas da, was für immer in meinem Gedächtnis begraben zu sein schien: Details tauchen auf, Assoziationsketten entstehen. Und während ich schrieb, probierte ich Erinnerungsbruchstücke nach ihren vorhandenen Möglichkeiten für eine Geschichte aus.
Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. (Christa Wolf)
Heute erscheint es mir fast schon unglaubwürdig, dass ich dieser Junge aus Schlesien bin und noch aus dem Krieg komme. Aber die Erinnerungen an die große Flucht und an das Leinensäckel voll Ähren, mit dem ich durch die Öffnung am weißen Horizont ging, wird immer lebendiger, je älter ich werde.
Hohes Gras und die Löwen
Draußen wurde alles für die Heumahd vorbereitet. An den mächtigen Leiterwagen standen Bäuerinnen und tauschten mit ihren Vätern Sprossen und Streben aus. Bis auf wenige Bauern waren fast alle Männer im Krieg, so dass auch die Gefangenen, Elsässer und Franzosen, die am Rande des Dorfes in einer abgesperrten Scheune wohnten, zur Ernte abkommandiert wurden.
Pierre, einer der Elsässer, hatte mir einmal ein Flugzeug geschnitzt, mit einem Propeller, der sich an einem Nagel drehte. Nun dengelte er gerade neben dem Leiterwagen die Sense und hielt anschließend die Schneiden über einen Schleifstein, auf den aus einem kleinen Kübel immerfort Wasser lief.
Zuerst sollte das Gras hinter Großmutters Garten gemäht werden. Als ich dies hörte, legte ich bei Großmutter sofort Protest ein, denn im hohen Gras hatte ich eine neue Welt gefunden, voller Wunder, besonders wenn die Sonne heiß vom Himmel strahlte und aus den Gräsern und Blüten ein intensives Parfüm aufstieg; dann ging ständig ein Summen und Rauschen durch die Gräser, und es war für mich die schönste Musik, die ich je gehört hatte. Unterdessen konnte ich ganz still nach Insekten forschen, die auf den Pflanzen leben, winzige Wesen im Schattengrün beschäftigt. Man sieht sie nur, wenn man lange auf ein und dieselbe Stelle blickt. Einmal versuchte ein kleiner Käfer, an einem Grashalm in die Höhe zu klettern. Ich musste über ihn lachen, da er so rastlos und unermüdlich seine Kletterei fortsetzte.
Nun sollte das Gras gehauen werden, und ich erschrak, als ich erneut den scharfen Ton des Dengelns hörte, während ich mich schon wieder im Gras tummelte und einen Grashüpfer mit grünem Kiefer beobachtete, der gleich mit einem Sprung verschwunden sein würde.
Im Frühjahr schon hatte der Garten mein Interesse geweckt. Ich war des Öfteren am Zaun entlanggestrichen, hatte nach den Maulwurfshügeln geschaut und das vertrocknete Gras und die vorjährige Schafgarbe auseinandergebogen. Mit dem Pflanzendolch hatte ich Sonnenblumenkerne tief in die Erde gesteckt. Es konnte ja nichts schaden, hatte ich meiner Großmutter gesagt, ein paar würden aufgehen, ein paar nicht. Aber keine einzige hatte sich durchgesetzt. Ich hatte wohl alle zu tief in der Erde versenkt.
Auf einmal kam Norbert. Ich versteckte mich im hohen Gras an einem Himbeerstrauch und machte mich lang wie eine Eidechse.
Hab' dich schon entdeckt! rief er und versuchte, einen Schmetterling einzufangen; die Leidenschaft trieb ihn, dieses flimmernde Fleckchen, das sich im Zickzack hin und her bewegte, diesen weißgelben Zitronenfalter einzufangen, ohne dass es ihm gelang.
Plötzlich näherte sich Pierre mit der geschärften Sense. Groß und steil stand er vor uns und sagte, dass er Großmutter gesprochen und dass sie eingewilligt habe, das hohe Gras stehen zu lassen, wenn wir versprächen, das gehauene Gras im Straßengraben, wenn es zu Heu geworden ist, einzufahren für ihre Kaninchen. Wir versprachen es.
Nun hatten wir es ganz für uns, dieses Fleckchen Erde am Gartenrand mit all seinen Gräsern, Blumen und Kräutern. Fast jeder Halm trug Früchte, an den Stängeln hingen zwischen den Blättern Ähren. Wir entdeckten würzige Blätter, kleine körnige Erdbeeren. Wir liefen mit Pusteblumen um die Wette: In jede Hand nahmen wir eine Blume und stellten uns auf. Norbert zählte bis drei, und das Wettrennen ging los. Wer als erster am Schuppen anlangte, hatte gewonnen, aber nur, wenn der Flaum noch an der Blume haftete; waren die Köpfchen am Ziel gerupft oder gar kahl, hatte man verloren.
Das Spiel war sehr spannend, weil es viele Möglichkeiten bot und keiner wissen konnte, wie es für einen ausgehen würde und wodurch man womöglich seinen Sieg aufs Spiel setzte. Ich kam zwar in der Regel als erster ins Ziel, meine Pusteblumen erloschen aber durch die rasche Bewegung. Mehrere Male wiederholten wir dieses Spiel; doch meistens gewann Norbert, weil er nicht so schnell wie ich rannte.
Norbert lag neben mir auf der Seite, stützte sich auf die Faust, so wie ich mich auf meine stützte, riss ein Büschel Gras und Kräuter aus, begann zu zählen und kostete vom Sauerampfer.
Warum haben einige Pflanzen ihre Blätter verloren, andere besaßen nur noch eines, und warum waren andere angenagt oder abgebissen bis zur Mittelrispe, fragten wir uns. Da entdeckten wir die Ungeheuer, die das getan hatten: rehbraune und fuchsrote Schnecken, nackt und ohne Haus – und andere doppelt und dreifach so lang. Satt und träge zogen sie im Schatten der Gräser dahin. An einer Pflanze hatte sich so ein Untier immer noch nicht zur Genüge gesättigt, sagte unversehens die Großmutter, die auf einmal vor der Sonne stand. Aber ihr Blick schweifte über uns hinweg zu den Wiesen hinüber, eine Hand schattete ihre Augen ab, dann sagte sie: Wenn ich mich nicht irre, spaziert dort ein Storch.
Ja, ein Storch, riefen wir und wollten sofort zu ihm laufen. Lasst ihn, sonst fliegt er weg, sagte Großmutter. Vielleicht hat er ein Kind gebracht. Wir prusteten vor Lachen.
Grausam und schön können Störche sein, wie eben die Natur so ist, schön und grausam, fing Großmutter an zu erzählen. Wir hatten Gerste gemäht und eingefahren, nicht viel. Gleich darauf machte sich Großvater ans Pflügen. Die Störche sammelten sich überall auf den Wiesen zum Abflug, als er das letzte Stück hinterm Garten beackerte. Seltsame Vögel, sie klapperten in einem fort, dann begannen sie aneinander mit den Schnäbeln zu zupfen, und zuletzt guckten sie sich einen aus und hackten auf ihn ein. Sie werden ihn noch zu Tode hacken, dachte Großvater und rannte hin, seine Gürtelschnalle aus dem Hosenbund ziehend. Aber ehe er bei ihnen war, stiegen alle Störche in die Luft und flogen zu den anderen Wiesen. Der Storch, auf den sie eingehackt hatten, folgte ihnen. Wo sollte er sonst hinfliegen? Und sie hackten ihn zu Tode. Am nächsten Tag fand ihn ein Schäfer.
Ist das wirklich wahr, fragten wir bange. Das soll es geben, sagte Großmutter, dass sich Artgenossen gegenseitig umbringen. Bei den Menschen ist es doch oftmals auch so. Sogar normal. Plötzlich meinte sie: Wisst ihr, dass ihr beide die gleichen Augen habt, blau wie die Kornblumen am Zaunrand? So waren auch mal die Augen von Großvater. Ich hatte ihn bereits als kleines Kind gekannt.
Wie alt warst du da? fragte ich.
Vielleicht vier, fünf. Als Großvater später aus dem Frankreich-Krieg zurückkam, war ich so erschrocken, weil er plötzlich keine blauen Augen mehr hatte.
Ich sah in Norberts Augen, er in meine.
Mit den Jahren werden sie trüb, sagte Großmutter, und wenn sie viele Tote und Verwundete sehen, werden sie langsam graublau. – Oder zu gläsernen Fühlern bei Untersuchungsführern oder Wachsoldaten. Oder zu stählernen Soldatenaugen, die immer nur Land erobern wollen. Nur selten behalten Augen die Farbe aus der Kindheit. – Eure Väter sind auch im Krieg. Was suchen sie in Russland, in Polen? Im Krieg verwandeln sich die Augen der meisten Menschen. Ach, wie ich diesen Krieg hasse. Kinder, werdet niemals Soldaten!
Großmutter erhob sich langsam und ging wieder zu den Franzosen, die vor dem Grundstück am Straßenrand das Gras mähten.
Wir liefen zu den Kornblumen und stellten fest, dass unsere Augen doch nicht so blau waren wie sie.
Ich spielte auf einer Mundharmonika. Das Metall schmeckte salzig. Aber da ich keine erkennbare Melodie hervorbrachte, sagte Norbert: So oder ähnlich wird Musik geboren.
Da hörten wir ein Hahnenkrähen. Hier sind doch keine Hühner in der Nähe. Wir standen auf und glaubten, wir wären in der Nähe eines Bauernhofs, denn immerfort krähte ein Hahn.
Das Krähen kam von der Straße, dort, wo Großmutter mit den Franzosen stand. Einer von ihnen konnte viele Tiere imitieren, fiel mir ein, darüber hinaus Vogelstimmen und Flügelgeräusche. Er hatte schon des Öfteren die Dorfbewohner und Wachhabenden durch seine unnachahmlichen Laute überrascht.
Wir liefen hin. Aber auch die anderen Franzosen krächzten plötzlich vor Übermut wie bei Sonnenuntergang über den verblauten Himmel dahinfliegende Krähen. Die Franzosen waren in der letzten Zeit besonders ausgelassen und übermütig, sagte Großmutter, als sie wieder bei uns war.
Je näher die Russen, desto übermütiger die Franzosen. Sie stehen ja nicht auf unserer Seite, sagte Norbert. Dann nahm er mir die Mundharmonika aus der Hand und ich folgte ihm ans Ende der Wiese. Lass mich, rief er und spielte „Alle meine Entchen".
Ich hielt mir die Ohren zu. So ein Kindergartenwatschellied!
Da warf er die Mundharmonika in weitem Bogen fort. Ich holte sie mir.
Norbert pflückte Löwen und Pusteblumen, drehte sie nachdenklich zwischen Daumen und Zeigefinger. Nach einer Weile blies ich hinein. Wie Fallschirme, sagte ich. Wir blickten ihnen nach, wie sie langsam dahinschwebten und nach unten sanken.
Da sah ich, dass Norbert nur vor sich hinstarrte, ohne auf die Fallschirme zu sehen. Leise sagte er: Einmal mit Papa im Gras liegen und mit den Löwen spielen. Aber der ist ja in Russland vermisst.
Der Verdunkelungspolizist
Ich sah, wie meine Mutter in wütender Hast Stoff oder dickes, schwarzes Papier gegen das Fenster drückte, dicht, noch dichter, bevor sie die Jalousie herunterzog. Nirgends darf von draußen ein Lichtspalt zu sehen sein, sobald die Sonne untergegangen ist, sagte meine Mutter. Sonst könnte es die Piloten in den Flugzeugen, die ja schon des Öfteren über unsere Häuser geflogen sind, veranlassen, ihre Bomben auszuklinken.
Manchmal ging ich abends noch hinaus, um mich zu überzeugen, ob auch wirklich alle Fenster verdunkelt waren. Entdeckte ich eins, das nicht ganz abgedichtet war, klingelte ich bei den Leuten und machte sie auf die Gefahr, in der sie sich befanden, aufmerksam. Sogleich beeilten sie sich, ihre Fenster noch einmal zu untersuchen. Einige kannten mich und sagten: Ah, unser Verdunkelungspolizist. Als ich nach Hause kam, durfte das Licht der Diele nicht angeschaltet werden, weil sich innen vor der Tür kein Vorhang befand. Deshalb tastete ich mich schon seit Monaten im Dunkeln durch die Diele und die Treppen hinauf und hinunter. Eine gute Übung, sagte meine Oma, die parterre wohnte. Das Land verwandelt sich langsam in ein Königreich der Blinden.
Draußen löschte die Finsternis, wenn nicht Mond und Sterne schienen, jedes Lebenszeichen von Stadt und Land aus.
Wie viele Millionen Hände es wohl sind, die täglich ihre Häuser verdunkeln? fragte einmal meine Mutter.
Mir kamen die Fenster im Haus wie Sarglöcher vor. Ja, wie Sarglöcher, unterstrich meine Oma, wenn sie immer von neuem zusammen mit meiner Mutter das begräbnishafte Umfrieden der Fenster anging.
Einmal hatte ich mir einen Stock genommen, um besser den Weg ertasten zu können. Zwischendurch blieb ich stehen und versuchte, die Dunkelheit zu durchdringen, blickte nach vorn und zurück, konnte aber nicht das kleinste Lichtzeichen entdecken. Die Häuser ringsum blieben gespenstisch und stumm, sie schwiegen und warteten. Einmal erschrak ich über einen roten Punkt in einem Hauseingang, wie er aufglühte und dann langsam herabsank. Gott sei Dank, nur ein Zigarettenraucher, dachte ich.
Es gab auch Leute, die auf der anderen Straßenseite leise und wie auf Filzsohlen nach Hause huschten, als ob ihre unverhüllt lauten Schritte den Feind auf den Gedanken bringen könnten, dass eine Ortschaft in der Nähe war. Darüber wunderte ich mich, und ich trat unversehens ebenso leise auf wie sie und fragte mich, ob meine Schritte auch aufwärtsdringen und einem in der Luft lauernden Flugzeug etwas verraten könnten.
Auf einmal fuhr ein Auto vorbei, das sich mühsam einen Weg suchte; ein winziger Schein aus einer der Vorderlampen gab seiner Fahrt eine gewisse, unzureichende Sicherung. Seine Lampen im Inneren waren verhüllt, die Fensterscheiben purpurblau angestrichen; wie ein dicker unheimlicher Schatten bewegte es sich.
Noch ist keine Kanone zu hören, keine Flak, dachte ich. Noch waren keine Suchscheinwerfer am Himmel, keine feindlichen Geräusche mit durchdringendem Gebrumm zu hören; zuweilen stiegen nur lustige rote oder grüne Kugeln auf, die wie Silvesterraketen bald wieder erloschen.
Einmal reckten sich über der Gegend drei blaue Scheinwerfersäulen auf und kreuzten sich. Ich war wie hypnotisiert und schaute hoch. Die Strahlen lösten sich voneinander und tasteten den Himmel ab, ohne in ihren Schnittpunkten ein Flugzeug festzuschweißen. Nichts war zu sehen, zu hören. Ich lief noch lange durch den Abend, suchend, ob noch irgendwo ein Lichtspalt festzustellen war. Aber ich konnte nirgends einen entdecken. Plötzlich war mir, als hätte ich noch nie Sterne gesehen, silbern, kalt kamen sie mir vor. Ich suchte den großen Wagen, weil mir meine Oma prophezeit hatte, ich würde bald mit ihm, davor vier Pferdchen, oder auf einem offenen Wehrmachtslaster Schlesien verlassen. Da erblickte ich den großen Wagen, er hing gerade über dem höchsten Geäst eines Baumes. Steil aufwärts stand die Deichsel. Himmelhoch fuhr der Sternenwagen in die Wolkenferne.
Als ich wieder vor unserem Haus stand, schaute ich noch lange auf das Küchenfenster und entdeckte doch noch ein winziges Lichtpünktchen. Da wusste ich, dass ich das Küchenfenster am nächsten Tag noch einmal untersuchen und die durchlässige Stelle mit einem Brei aus schwarzem Papier endgültig auslöschen würde.
Im Keller
Meine Mutter hatte für mich den kleinen Koffer gepackt und neben die Korridortür gestellt. Er war der Luftschutzkoffer. Darin befanden sich Anziehsachen, etwas Brot, zwei Feldflaschen voll Wasser und eine Gasmaske. Wenn Fliegeralarm kommt, dann schnappst du dir den Luftschutzkoffer und läufst schnellstens in den Keller. Du weißt doch, in jenen Raum, nach dem die gelben Pfeile zeigen, sagte sie.
Ich befand mich schon im Bett, und meine Mutter wollte sich gerade hinlegen, als plötzlich das Geheul der Sirenenwölfe zu hören war.
Los auf! Schnell in den Keller! Bevor die Bomben fallen! rief meine Mutter.
Die Fenster im Keller waren mit Sandsäcken zugestopft. Der Raum wurde gestützt von breiten Holzpfeilern; an den Wänden lehnten Schrubber mit Scheuerlappen, die als Feuerpatschen neben Eimern voll Wasser und voll Sand gegen Phosphor und Brandbomben bereitstanden. Eine Petroleumlampe blakte, und der Ruß senkte sich langsam auf die Gesichter der Hausbewohner, die sich inzwischen eingefunden hatten.
Mir kommt es vor, als befände ich mich in einem Bergwerk, sagte jemand. – Vielleicht werden wir selbst bald Kohle sein inmitten des Brikettberges hier.
Ich starrte auf die abgeblätterten Wände, die mit Spinnweben wie mit Trauerflor behängt waren. Auch die übrigen Hausbewohner starrten gebannt vor sich hin, und ich bemerkte, dass sich die Petroleumlampe in ihren Augen spiegelte.
Auf einmal sagte Frau Kloska, die erst vor wenigen Wochen aus Hindenburg geflüchtet war, dass noch die alte Frau Erasmus fehle. Erschrocken stand meine Mutter auf, um sie zu holen. Da klopfte es laut hinter der Eisentür. Als meine Mutter den schweren Riegelgriff nach oben drückte und die Tür nach innenaufging, lächelte ihr ganz ruhig Frau Erasmus mit einem Veilchenstrauß in der Hand entgegen. Wollt mich wohl nicht reinlassen! rief sie, ohne dass es vorwurfsvoll klang, und hielt sich den Strauß an die Nase. Die Frau war sehr alt, und sie hatte ein Gesicht wie eine Gasmaske, weil sie eine Brille mit starken Gläsern trug. Ich war fast unten, stammelte sie außer Atem, als ich merkte, dass ich meinen Veilchenstrauß vergessen hatte … Schnell schloss meine Mutter die schwere Tür hinter ihr wieder zu.
Ob das was nützt, sagte Frau Erasmus, halb protestierend. Im Falle eines Treffers ist es doch ganz gleich, wo ich mich befinde: auf dem Boden, im Haus oder darunter. Und für den Bruchteil einer Sekunde spürte ich den winzigen Hauch des Veilchenduftes.
In diesem Augenblick ertönte das gedehnte Heulen einer Bombe, ganz nah. Ich zitterte und dachte: Gleich wird sie einschlagen. Ein ungeheures Krachen und Donnern in unmittelbarer Nähe; das Petroleumflämmchen flackerte in der Lampe, die Kellerwände vibrierten. Und die Furcht in mir war so stark, dass ich spürte, dass meine Ohren glühten, als hätte sie jemand mit Schnee eingerieben. Eine Frau wurde ohnmächtig, meine Mutter gab ihr Salmiakgeist zu riechen.
Der Einschlag war noch weit hinter der Brücke, sagte eine andere Frau. Ich kenn' mich aus mit diesen Geräuschen. Wenn das Haus wankt und wir schon glauben, dass die Bombe neben unserem Haus explodiert sei, ist sie erst ein ganzes Stück weiter niedergegangen.
Ich starrte vor Angst an die Decke und fragte mich, ob die Balken, die sicherheitshalber angebracht wurden, um die Decke abzustützen, falls das Haus getroffen würde, den ganzen Schutt aufhalten könnten. Und ob die Stahltür hinterher noch zu bewegen wäre.
Ich befand mich nicht zum ersten Mal im Luftschutzkeller. Noch vor Wochen wurden alle Einwohner bei Fliegeralarm in einem Bunker, der sich nur wenige hundert Meter entfernt von unserer Wohnung befand, abgezählt. Wer nicht erschienen war, wurde vom Luftschutzwart geholt. Er trug eine Armbinde, den schwarzen Luftschutzhelm und das Parteiabzeichen mit der Hakenkreuzspinne. Im Falle eines Alarms haben sich alle Bürger unverzüglich in die nächstliegenden Bunker zu begeben! verkündete er. Im Falle eines Alarms wird der Strom ohne vorherige Ankündigung abgeschaltet, um einen Kurzschluss und somit größere Schäden zu verhindern!
Einmal übte der Luftschutzwart mit den Leuten Gasalarm. Er verteilte Gasmasken, die jeder aufsetzen musste, da auch mit Gas zu rechnen sei. Gas, das zum Erblinden oder Ersticken führe.
Daumen unter das Band, das Kinn fest in den Sack hineingepresst und über den Kopf ziehen! rief er. – Ihr müsst das üben. Seht, ich trage sie am Band über der Schulter wie ein winziges Akkordeon. Eine Wehrmachtsgasmaske, nicht besser als eure.
Ich schwitzte unter dem engen Gerät, bekam sogar Angst zu ersticken, und die Hausbewohner um mich herum kamen mir vor wie haarlose Ungeheuer mit riesigen Trichternasen und großen Froschaugen.
Aber nun befand ich mich im Keller des Hauses, in dem ich wohnte, und wusste, dass wirklich bombardiert wurde, nicht nur vereinzelt mal hier und mal dort, sondern dass man es diesmal ganz auf diese Stadt abgesehen hatte.
Eine Frau schlug ein Kreuz. Immer lauter heulten die Motoren. Gott hab Erbarmen mit uns! flüsterte sie. Die Mutter eines Babys beugte sich über den Wäschekorb, darin ihr Kind lag, sie schien zu glauben, ihre Arme aus Fleisch seien geeignete Stützpfeiler gegen herniederfallende Steine.
Jetzt sind die Flugzeuge mitten über uns, sagte ich zu meiner Mutter. Sie sah ganz ruhig aus und zeigte keine Spur von Angst; auch ein älterer Junge und die übrigen Hausbewohner ließen sich keine Angst anmerken. Frau Erasmus wurde sogar vom Schlaf überwältigt, denn sie nickte so entschieden ein, dass ihr der Kopf nach hinten sackte und ihr offener Mund wie eineschwarze Höhle aussah. Niemand sprach, alle horchten. Ich ahnte, dass ein Volltreffer einen einzigen blutigen Brei aus uns machen würde.
Unterdessen dachte ich an die Phosphor- und Brandbomben, die die Menschen zusammenschrumpfen ließen. Dann lieber unter einem Baum, hinter einer Hecke oder auf der Landstraße sterben, als in so einem muffigen Asselkeller. Und wenn das Haus unter den Explosionen entfernt eingeschlagener Bomben abermals vibrierte, drückte ich mich noch enger an meine Mutter, spannte all meine Nerven an und hatte das Gefühl, tief unten in der Erde verschwunden zu sein.
Die Nachricht
Meine Mutter kam ins Zimmer, in der Hand hielt sie das Telegramm. Sie blickte nicht auf, weinte und murmelte, als meine Großmutter fragte.
Zwei Tage zuvor noch stand ich am Bahnsteig. Schneeregen hatte eingesetzt. Es war kalt und stürmisch, ein scharfer Wind ließ die Wartenden frösteln. Ich zog meine Skimütze tiefer, hustete ein paarmal. – Freust du dich? fragte meine Mutter und schaute mich an. Ein helles, großes Licht war in ihren Augen. Das weißt du doch, sagte ich, so was brauchst du doch nicht zu fragen. Ihr Gesicht wurde wieder ernst. Wenn ich doch nur wüsste, ob er kommt, sagte sie. Vielleicht – hat er geschrieben. Vielleicht werde ich kommen. Das hängt nicht von mir ab … Aber wenn ich komme, bin ich zum Weihnachtsfest zu Hause.
Das wäre schön, wenn er kommt und den Tannenbaum mit den Strohsternen sieht, sagte ich.
Aus der Ferne war das Geräusch des fahrenden Zuges zu hören, zwei gelbe Lichtpunkte jagten die Dunkelheit vor sich her und über das Waldesdickicht hinweg, wurden größer und glitten vorbei. Dann hielt der Zug. Die Türen sprangen auf, wenige Soldaten stiegen aus. Ich ging meiner Mutter hinterher, die aufgeregt an den Wagen entlanglief. Sie blieb stehen, schaute nach rechts, nach links. Schnell verloren sich die wenigen Ausgestiegenen. Bald war der Bahnsteig wieder verlassen. Türen wurden zugeschlagen. Ein schriller Pfiff ertönte. Langsam setzte sich die Wagenkette in Bewegung.