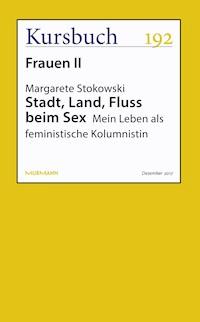9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit 2011 schreibt die Spiegel-Online-Kolumnistin Margarete Stokowski Essays, Kolumnen und Debattenbeiträge. Die besten und wichtigsten Texte versammelt dieses Buch, leicht überarbeitet und kommentiert. Die Autorin analysiert den Umgang mit Macht, Sex und Körpern, die #metoo-Debatte und Rechtspopulismus, sie schreibt über Feminismus, Frauenkörper und wie sie kommentiert werden, über Pornos, Unisextoiletten und die Frage, warum sich Feminismus und Rassismus ausschließen. Stokowskis Texte machen Mut, helfen, wütend zu bleiben, Haltung zu zeigen und doch den Humor nicht zu verlieren und sie zeigen, dass es noch einiges zu tun gibt auf dem Weg zu einer gleichberechtigen Gesellschaft. Wer fragt, ob wir den Feminismus noch brauchen oder ob die Revolution bereits geschafft ist, dem liefert Margarete Stokowski eindeutige Antworten. «Im Großen und Ganzen versuche ich, da Staub aufzuwirbeln, wo es eh schon dreckig ist. Also ungefähr das Gegenteil von dem, was von einer Polin in Deutschland erwartet wird, Zwinkersmiley.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Margarete Stokowski
Die letzten Tage des Patriarchats
Über dieses Buch
Warum wir mehr Feminismus brauchen
Dürfen Männer nach der feministischen Revolution Frauen noch die Tür aufhalten? Und sind Komplimente erlaubt? Die Gesellschaft scheint verunsichert. Zwar wehren sich überall auf der Welt Menschen gegen Sexismus und Belästigung. Doch Frauen verdienen immer noch weniger als Männer, dafür putzen und pflegen sie mehr und sterben am Ende ärmer. Margarete Stokowski legt den Finger in Wunden, die viele lieber ignorieren würden, denn Resignation ist für sie keine Lösung. Sie schreibt über Ungerechtigkeiten, an die wir uns längst gewöhnt haben, weil sie so alltäglich sind. Dabei geht es um Frauenkörper und wie sie kommentiert werden, um Pornos und Unisextoiletten, um #MeToo- und #Aufschrei-Debatten, aber auch um Rechtsextremismus und die Frage, warum sich Feminismus und Rassismus ausschließen. Margarete Stokowski ist eine der wichtigsten Stimmen des gegenwärtigen Feminismus. Ihre Texte machen Mut. Sie helfen, wütend zu bleiben, Haltung zu zeigen und doch den Humor nicht zu verlieren. Margarete Stokowski versammelt und kommentiert in diesem Buch die besten Essays und Kolumnen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 2018 by Margarete Stokowski
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-00198-5
Anmerkung: Die Seitenzahlen im Text beziehen sich auf die entsprechenden Seiten der Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Motto
Vorwort
Kapitel eins Flirten und Vögeln und Liebe
Dem Windhund so nah
Die Liebe und der Sechs
Guckt mehr Lesbenpornos!
Bei Zeus, warum nie Männer?
Sich schön in die Fleischtheke legen
Deine Mutter hält die Klappe
Dieser Hut kann weg
Das Aroma verfaulender Äpfel
Kapitel zwei Feminismus
Niemand muss lecken müssen
Der Abgrenzungs-Fetisch
«Hamse jedient im Genderkrieg?»
Ein Blumenstrauß voller Einwände
Der Bullshit-Feminismus
Die Gender-Allergie
Ist der Feminismus zu weit gegangen?
Kapitel drei Bekloppte Zustände
Wie verrucht, wie aufregend!
Ist das dieses «Wir schaffen es nicht»?
Kein Ruhm für Stalker
Die Revolution – für nur 550 Euro
Nicht alles, was brennt, ist Anarchie
Sind Männer nicht auch hübsch?
Keine Frage des Zusammenreißens
Runter kommt man immer
Kapitel vier Männer
Ich will ein alter, dicker Mann sein
Schwimmt, Männer, schwimmt!
Es ist ein Junge
Mittelalter! Weißer! Mann!
Untenrum breit
Weg mit den Pimmelwitzen!
Bitte die Hoden behalten
Der Reichsbürger der #MeToo-Bewegung
Kapitel fünf Bauch, Beine, Po
Sofort aufs Maul
Emanzen, die nackt tanzen
Mein Körper ist ’ne Demo
Kampfplatz mit Brüsten
Ein Laster voller Mädchenkotze
Geil, Brüste
Sie hat gepopelt!
Mehr dicke Mädchen in Leggings!
Fürchtet euch ruhig
Kapitel sechs Gewalt
Frauen sind gar keine Rudeltiere
Des Rudels Kern
Wer lacht, gibt Macht
Eine Epidemie der Gewalt
Es könnte etwas lauter werden
Frauen können das auch
Lieber nicht kopulieren als falsch
Hexen, überall Hexen?
Kapitel sieben Für Rechte
Es ist nicht die magische Mumu
Klos für alle
Nimm die Hand aus der Hose, wenn ich mit dir rede
Wäre die Vagina doch ein Auto
Was heißt Nein?
Ein bisschen homophob gibt es nicht
Alle gewinnen
Untenrum unfrei
Kapitel acht Gegen Rechte
Die Trottel hören zu
Eine andere Art von Notwendigkeit
Diese laschen Hobbymärtyrer
Andere Sprache, derselbe Hass
Antifaschismus muss Alltag werden
Frauen, rechte
Kapitel neun Medien und Diskurs
Wie man mit der Mistgabel argumentiert
Wer nicht zuhören will
Das gefühlte Zeitalter
Die Tollen sind selten laut
Eine Frau ist kein Hulk
Chico, Spiegel der menschlichen Seele
Kapitel zehn Für die Zukunft
Wrumm wrumm wrrrummm
Simone, wo bist du?
Geil, Resignation!
Körperhass will gelernt sein
Ruhen für Frieden
DNA-Esoterik zum Sonderpreis
Quellen
«Die Antifeministen halten die allmählich sich entbindenden, der Dekadence heilend entgegenwirkenden Intelligenzkräfte der Frau für eine Art geistiger Brunnenvergiftung, und sie schlügen die Rädelsführerinnen am liebsten – wenigstens mundtot. Hülfe ihnen nichts. Die Welt ist ein Riesenphonograph. Ideen, die einmal hineingesprochen, bleiben unauslöschlich darin haften. Sie klingen wieder, klingen wieder.»
Hedwig Dohm: Die Antifeministen, 1902
Vorwort
Dieses Buch versammelt ausgewählte und überarbeitete Kolumnen und Essays aus den Jahren 2011 bis 2018. Gute Zeiten, um nicht nur den Zerfall des Patriarchats zu beobachten, sondern auch sein letztes Aufbäumen; die vielen Backlash-Bewegungen und die immer und immer wieder vorgebrachten Forderungen, dass es doch jetzt endlich mal genug sei mit dem Feminismus.
Es ist nicht genug. Feminist*innen mussten sich zu jedem Zeitpunkt der Geschichte anhören, dass eigentlich längst alles okay wäre – wenn sie sich nur nicht so anstellen würden! Doch ein großer Teil unserer heutigen Freiheit ist den Kämpfen derer zu verdanken, die darauf bestanden haben, dass noch nicht alles gut ist, und die sich nicht einschüchtern ließen von Leuten, die ihnen erzählten, sie seien zu verbittert, zu naiv oder komplett verrückt.
Wer vom Patriarchat spricht, handelt sich schnell den Vorwurf ein, Frauen nur zu Opfern zu machen. Es kann passieren, dass man als Feminist*in frauenfeindlich genannt wird, weil man angeblich die vielen Fortschritte nicht sieht, die Frauen erreicht haben. Frauen können heute viele mächtige Posten bekleiden, die lange nur Männern vorbehalten waren. Sie können reich und berühmt werden, sie gewinnen Preise, fliegen ins All und fahren Monstertrucks.
Manchmal hört man auch, Frauen seien heute nicht nur bereits gleichberechtigt, sondern hätten es in Wirklichkeit besser als Männer: Frauen leben länger und bekommen eigene Quoten und Parkplätze und Frauenschwimmtage im Hallenbad; viele Länder haben ein Frauen-, aber kein Männerministerium; und dort, wo es eine Wehrpflicht gibt, gilt sie bis auf wenige Ausnahmen nur für Männer. Das stimmt alles. Aber die Tatsache, dass es um die Lebenssituationen und Machtoptionen von Frauen heute besser steht als zu Zeiten, als die bloße Forderung nach gleichen Rechten mit dem Tod bestraft wurde, heißt nicht, dass alles gut ist.
Frauen haben immer noch weniger Geld als Männer, sie arbeiten seltener in Führungspositionen, sie erledigen die meiste Familienarbeit, und nicht wenige erleben sexualisierte Gewalt. Im Deutschen Bundestag sind im Jahr 2018 nicht mal ein Drittel der Abgeordneten Frauen. Frauen müssen in vielen Ländern für grundlegende Rechte kämpfen, und selbst dort, wo sie das nicht müssen, hören sie in den verrücktesten Situationen dämliche Kommentare über ihren Körper. Immer noch reden Leute davon, Frauen seien während ihrer Menstruation nicht ganz zurechnungsfähig oder sie könnten zwar beruflich viel erreichen, aber letztlich doch nur als Mutter glücklich werden. Als Mutter, die stillt und lange zu Hause bleibt und die jede beliebige Ansammlung von Schlafmangel durch die Glückshormone ausgleicht, die in ihr entstehen, während sie Möhrenbrei vom Küchenboden wischt.
Nun gibt es immer auch Leute, die denken, Feminist*innen würden den ganzen Unfug einfach umdrehen wollen und Männer so diskriminieren, wie es bisher mit Frauen passierte: Wer das Patriarchat abschaffen will, so die Idee, kann doch nichts anderes wollen, als ein Matriarchat zu errichten, nach denselben Regeln, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Das ist falsch. Viel zu viel Arbeit! Nein, Scherz. Es ist tatsächlich Quatsch, weil Feminismus nicht die Umkehrung von Unterdrückungsverhältnissen will, sondern ihre Abschaffung. «Patriarchat» hieß zudem noch nie, dass es allen Frauen schlecht geht und allen Männern gut. Es bedeutet auch nicht, dass alle Frauen die Klappe halten müssen – und auch nicht, dass alle Männer etwas zu melden haben.
Der Begriff des Patriarchats lässt sich mit «Herrschaft der Väter» übersetzen (πατήρ/patér ist altgriechisch für «Vater», αρχη/arché heißt «Macht, Herrschaft» oder «Anfang»). Die Übersetzung hilft erst mal nicht viel, denn Patriarchat bedeutet nicht, dass alle Väter – oder nur Väter – besonders mächtig sind. Aber es lohnt zu gucken, wer der «pater» früher war: Im antiken Griechenland und Rom gab es Hausherren, in deren Machtbereich alle standen, die zu einem Haushalt gehörten. Das konnten Frauen, Kinder oder auch andere Männer sein: Söhne, Bedienstete, Sklaven.
Männer können im Patriarchat – auch heute noch – ganz oben und ganz unten stehen. Sie werden häufiger gewalttätig als Frauen, aber auch häufiger Opfer von Gewalt. Sie leben kürzer, sind öfter obdachlos und begehen öfter Suizid.
Und doch verbinden wir Macht eher mit Männern als mit Frauen. Es gibt Frauen mit sehr viel Macht, aber es gibt auch Ungleichheiten, die nicht einfach durch Zufälle entstanden sind und fortdauern – allerdings auch nicht durch eine geheime böse Kraft, die Frauen auf ewig unten halten will. Sondern durch alltägliches Handeln von Menschen aller Geschlechter und durch die Ideen, die uns in den Sinn kommen, wenn wir uns fragen, wer den Lauf der Welt bestimmt. Die Historikerin Mary Beard schreibt, dass unsere allgemeine Vorstellung einer mächtigen Persönlichkeit immer noch männlich ist:
«Wenn wir die Augen schließen und versuchen, uns das Bild eines Präsidenten oder (…) eines Professors vorzustellen [beide Wörter, ‹president› und ‹professor›, sind im Englischen geschlechtsneutral], sehen die meisten von uns keine Frau. Und das ist sogar dann der Fall, wenn man selbst Professorin ist: Das kulturelle Stereotyp ist so stark, dass es mir bei jenen Phantasien mit geschlossenen Augen immer noch schwerfällt, mir mich oder jemanden wie mich in dieser Rolle vorzustellen.»[1]
Wir sind immer noch viel zu sehr mit der Idee vertraut, dass die Macht normalerweise in den Händen von Männern liegt und dass Männer definieren, was vernünftig ist, welche Arbeit wertgeschätzt und wer angebetet wird.
Es ist nicht leicht, diese Stereotype loszuwerden. Im Gegenteil: Viele, die anfangen, sich mit Gleichberechtigung zu beschäftigen, denken zu Beginn, sie wüssten schon, wo die Ungleichheiten liegen – um bald festzustellen, dass sie sich an viel größere Mengen von Scheiße gewöhnt hatten, als sie zuvor ahnten.
Das Gute ist: Man ist heute nicht mehr alleine. Allerspätestens seit #metoo ist klar, wie viel Gewalt Frauen im Alltag noch immer erleben. Viele Menschen haben durch #metoo ein neues Bewusstsein dafür bekommen, was man sich nicht bieten lassen muss, wie laut man gemeinsam mit anderen werden kann oder auch welche Ungerechtigkeiten ihnen bisher entgangen sind.
Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die behaupten, der Feminismus sei nun endgültig übergeschnappt. Es gibt diese Menschen, aber es gab sie auch schon vor über 100 Jahren, als Frauen für das Wahlrecht kämpften. Und schon damals schrieb die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm: «Man kommt sich auf dem Gebiete der Frauenfrage immer wie ein Wiederkäuer vor.»[2]
Feminist*innen kämpfen heute für andere Dinge als damals, aber immer noch für viele grundlegende Freiheiten. Je weiter wir als Gesellschaft kommen, desto größer ist die Herausforderung, bestehende Schieflagen nicht nur auf individuelle Schwächen und Pech zu schieben, sondern strukturelle Probleme zu erkennen: Probleme, die sich wiederholen, weil manche Menschen mehr Macht und Privilegien haben als andere.
Schön allerdings, dass sich dennoch auch in kurzen Zeiträumen Dinge ändern können. Schon in den sieben Jahren, aus denen die Texte in diesem Buch stammen, hat sich einiges verbessert. In Deutschland wurden Lücken im Sexualstrafrecht geschlossen, die Ehe für alle ist eingeführt, die Pille danach rezeptfrei erhältlich. Bald werden «weiblich» und «männlich» nicht mehr die einzigen Geschlechter sein, die im Geburtenregister stehen können. Opfern von sexualisierter Gewalt wird eher zugehört als noch vor wenigen Jahren, es gibt riesige feministische Demos, und langsam setzt sich auch in Deutschland die Idee durch, dass eine Gesellschaft mehr als eine bekannte Feministin aushalten kann, ja dass ihr das sogar außerordentlich guttut. Gleichzeitig sind in anderen Bereichen und anderen Ländern viele erkämpfte Rechte in Gefahr, nicht zuletzt durch den Erfolg von Rechtspopulist*innen und Rechtsextremen, die immer auch ein verschärftes Interesse daran haben, Geschlechterrollen und sexuelle Freiheit zu beschränken, auch wenn sie vermeintlich für «starke Frauen» kämpfen oder Frauen und Kinder «schützen» wollen.
Die hier vorliegenden Texte habe ich für die Buchausgabe überarbeitet und kommentiert. Aus über 200 Kolumnen (ein Drittel bei der taz, der Rest bei Spiegel Online) und vielen Essays habe ich eine Auswahl von 75 Texten getroffen, die diverse Themen – nicht nur, aber vor allem feministische – abdecken.
Teilweise fühlte sich das an, wie die eigenen Tagebücher von früher zu lesen, was immer interessant, manchmal lustig und manchmal beschämend ist. Von den schlechten Texten habe ich ehrlichkeitshalber einen kurzen ausgewählt, damit man sehen kann, wo es mal angefangen hat (der erste im ersten Kapitel).
An den ausgewählten Texten selbst sind viele Kleinigkeiten geändert: Ich habe Erklärungen eingefügt, wo vielleicht nicht jede*r die Debatte noch im Kopf hat oder wo sich Dinge inzwischen geändert haben. Für bessere Lesbarkeit ist die Art zu gendern vereinheitlicht und in den zitierten Leser*innen-Kommentaren die Rechtschreibung angepasst.
Drei der häufigsten Fragen, die mir auf Lesungen gestellt werden, sind diese: Wie kommt man zum Kolumnenschreiben? Wer legt die Themen fest und (wie viel) wird in den Texten zensiert? Wie ist es mit den Hasskommentaren oder Onlinekommentaren im Allgemeinen?
Hier die Antworten: Eine Kolumne bekommt man üblicherweise, indem man gefragt wird. Das war bei mir auch so, mehr oder weniger. Meine allerersten Texte schrieb ich aus sehr pragmatischen Gründen. Mein damaliger Freund hatte sich von mir getrennt, ich war erst traurig und dann bockig und wollte mich mit etwas ablenken, von dem ich ahnte, dass es gutgehen könnte. Ich fing bei einer Unizeitung an und stellte fest, dass man mit Pressekarten kostenlos ins Theater gehen kann, wenn man hinterher das Stück bespricht. Machte ich dann gern und viel. Im Sommer 2009 fing ich an, als freie Autorin für die taz und andere Zeitungen zu schreiben. (Grüße nach Wien! Produktivste Trennung ever.)
In meiner Erinnerung war es so, dass die taz mich irgendwann fragte, ob ich eine eigene Kolumne schreiben will. Stimmt aber nicht ganz. Jetzt, wo ich in meinen Mails nachgelesen habe, muss ich sagen: Ich habe mich offenbar nicht ganz subtil angeboten. Es waren traurige Umstände, denn ein Kollege war gestorben. Klaus-Peter Klingelschmitt, Kürzel kpk, war taz-Korrespondent in Frankfurt und schrieb die Kolumne «Älter werden», bis er im November 2011 einem Herzinfarkt erlag.
Zwei Wochen später hörte ich, dass der Kolumnenplatz noch unbesetzt sei, und schrieb dem damaligen Ressortleiter Daniel Schulz: «Hallo Daniel, ist das so, braucht ihr noch ne kpk-Nachfolge-Kolumne? Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, nehmt einfach mich. Liebe Grüße, Margarete» – Das Gerücht, dass es keinen Nachfolger gab, stimmte nicht ganz, es gab einen: Deniz Yücel, der aber erst in ein paar Wochen anfangen sollte. Ich durfte die Zeit bis dahin überbrücken mit einer Kolumne, die den Titel «Dazwischen» trug.
Entweder weil es in den Augen der Redaktion gut lief oder in der Hoffnung, dass das noch nicht alles gewesen sein konnte, bekam ich im Frühling 2012 eine Kolumne, die alle zwei Wochen erschien: «Luft und Liebe». Den Namen hatte ich mir ausgedacht, weil er schön hippiemäßig klang. Hätte mich jemals jemand gefragt, warum eigentlich dieser Titel, hätte ich geantwortet, dass das meine Idealvorstellung von Geschlechterverhältnissen sei. Luft im Sinne von: einander Freiheiten lassen. Und Liebe da, wo sie sich ergibt. (Hat bloß nie jemand gefragt.)
Die «Luft und Liebe»-Kolumne schrieb ich bis Herbst 2015, dazwischen außerdem noch von 2013 bis 2015 die L-Mag-Kolumne «Von Lesben lernen». Im Herbst 2015 wechselte ich mit der Kolumne von der taz zu Spiegel Online, weil ich von der Redaktion – diesmal ganz sicher – gefragt wurde. Ich liebe die taz, aber man kann von den Honoraren als freie Autorin kaum leben, und auch die Aussicht darauf, dass die Kolumnen vor Erscheinen mal redigiert würden, war attraktiv.
Die SPON-Kolumne wurde «Oben und unten» getauft und erscheint wöchentlich. Während «Luft und Liebe» oft mehr Sex-Tagebuch als politischer Kommentar war, war die Idee der SPON-Kolumne nun jede Woche eine einigermaßen seriöse Meinung zum Weltgeschehen zu vertreten. Ich schwankte zwischen «klar, gerne» und «um Himmels willen, wöchentlich», und nahm mir vor, die Sache erst mal einen Monat lang zu testen, der dann zu einem Jahr wurde und bis jetzt nicht aufgehört hat, weil es Spaß macht.
Zugegeben, nicht nur Spaß. Eine wöchentliche Kolumne fürs Internet zu schreiben ist ein lustiger, trauriger, privilegierter und manchmal abgefuckter Job. Lustig ist es, weil man (da, wo ich schreibe) fast alles machen darf, was man will. Traurig ist es, wenn man sieht, dass manchen Leuten dazu nicht mehr einfällt als Beleidigungen, Gewalt- und Morddrohungen. Privilegiert ist es – aus relativ offensichtlichen Gründen: Man bekommt Geld dafür, die eigene Meinung aufzuschreiben, die dann von sehr vielen Leuten gelesen wird. Abgefuckt ist das manchmal, weil das Internet jeden Tag geöffnet hat und es keinen Urlaub gibt, außer man schreibt vor (schaffe ich nie), und weil man auch dann dran ist, wenn einem so gar nicht danach ist. (Ich dachte am Anfang, die Kolleg*innen würden bestimmt auch mal Texte ausfallen lassen, wenn sie zu kaputt sind, aber das passiert quasi nie, und ich staune noch immer.)
Die Antwort auf die Frage, wer die Themen meiner Texte auswählt und ob darin zensiert wird, ist sehr einfach: ich und nein. Die Themen muss ich absprechen, damit klar ist, dass niemand anders in der Redaktion gerade am gleichen Thema sitzt, aber niemand gibt sie vor. Und Zensur findet in Deutschland nicht statt. Was die Leute damit manchmal meinen, ist redaktionelle Bearbeitung. Die gibt es, aber das heißt nur, dass Fehler oder schlechte Formulierungen geändert werden, und nicht, dass ich bestimmte Meinungen nicht vertreten dürfte.
So selbstverständlich mir das scheint, so häufig muss ich das immer wieder auf Nachfrage erklären. Viele Leute haben wenig Ahnung davon, wie Journalist*innen arbeiten. Das mag für andere Berufe auch zutreffen. Viele wissen nicht, was eine Kürschnerin macht oder ein Industriekletterer, aber bei Medien ist es gefährlich, weil Demokratie und freie Medien einander brauchen. In der Zeit hieß es 2017, 39 Prozent der Deutschen würden denken, Eigentümer von Medien bestimmten, was Journalist*innen in ihrem Medium schreiben dürfen.[3] Eine große Zahl dafür, dass in Deutschland Pressefreiheit ein hohes Gut ist.
Bleibt noch die Frage nach den Onlinekommentaren. Zunächst: Ich bin froh, dass es sie gibt. Es kommen nur manchmal schräge oder scheußliche Dinge dabei raus.
Ich bekomme Rückmeldungen, Anmerkungen und Fragen zu meinen Texten in den Kommentarbereichen darunter auf Twitter und Facebook, per Mail und in Briefen, bei Veranstaltungen und manchmal auf der Straße. Die Leute schicken handgeschriebene Briefe, Bücher, Gedichte (!), Gebete (!!) und selten Penisfotos. Aber auch: Wein, Champagner, Whisky, ein Telefon, einen Ring und einen Vibrator.
Ich versuche, denen zu antworten, die an einem Dialog interessiert scheinen und deren Anliegen ich verstehe – was nicht immer der Fall ist. Es gibt Leser, die ihre Mutmaßungen zu psychiatrischen Diagnosen aufschreiben oder sie schicken Beleidigungen oder Drohungen, teilweise von ihren beruflichen Mailadressen, als Ingenieur, Anwalt oder Hochschuldozent.
Die meisten Nachrichten zu meinen Texten, die direkt an mich gerichtet sind, sind positive Rückmeldungen, allerdings ist die Mehrheit der Leute, die mich nach Kommentaren fragen, eher an den krassesten Hassbeispielen interessiert als an Zustimmung und Dankbarkeit. Versteh ich schon. Es hat natürlich für andere nicht so einen hohen Unterhaltungswert, wenn Leute mir schreiben: «Bin dir dankbar für deine Stimme.» Oder: «Bitte machen Sie weiter.» Deswegen sind in diesem Buch unter den ausgewählten Leser*innen-Kommentaren kaum solche, obwohl es das Bild verzerrt, sie wegzulassen, aber ich fände es noch viel merkwürdiger, große Mengen Lob abzudrucken.
Als ich mal in einer Kolumne schrieb, dass ich die Kommentare unter meinen Texten oft nicht lese, gab es einige Leser*innen, die das nicht glaubten und fanden, ich würde nur so cool tun, aber mir in Wirklichkeit alles reinziehen. Nein. Man gewöhnt sich sehr schnell an diese Kommentare (oder man hört auf mit dem Job). Ich kenne Kolleg*innen, die nie einen einzigen Onlinekommentar lesen, weil sie glauben, das macht die Seele kaputt. Ich glaube das nicht, aber wie die meisten anderen Autor*innen habe ich neben den Kolumnen noch andere Arbeit. Am Anfang, bei der taz, habe ich die Kommentare fast immer gelesen, jetzt nur noch ab und zu.
Man gewöhnt sich daran, dass man missverstanden und falsch eingeschätzt wird. Einmal schrieb ein Leser zu einer Kolumne, die ich sehr gerne geschrieben hatte: «Irgendwie kann ich Sie mir nicht vorstellen, wie Sie lachen oder fröhlich sind.» Ein anderer schrieb: «Eine frustrierte negative Person. Sie tut mir leid. In welch abscheulicher Umgebung haust sie?» Das finde ich eher lustig. Verstörend finde ich Kommentare wie den unter einer Kolumne zu Depressionen, als jemand schrieb, ich hätte nicht erwähnt, dass Menschen oft lange auf Therapieplätze warten müssen: «Bei Frau Stokowski fällt immer wieder auf, dass sie die Realität der Normalverdiener und unteren Schichten nur vom Hörensagen kennt.»
Apropos Fehleinschätzung: Einmal habe ich nach einer Preisverleihung einen älteren Herrn getroffen, der sich als ehemaliger Chefredakteur eines großen Magazins vorstellte. Er fragte mich, warum ich bei der Veranstaltung auf der Bühne nichts gesagt hätte. Ich hatte einen dritten Platz im Bereich Kultur bekommen (es ging um die «Journalisten des Jahres»), und niemand mit einem dritten Platz hatte eine Dankesrede gehalten, nur die Erstplatzierten. Ich wäre nie darauf gekommen, mich da in den Vordergrund zu stellen, sagte ich. «Aber Sie schaffen es doch sonst immer, sich vorzudrängeln!», sagte er. Ich würde ihn ja mit meinen Beiträgen «fast täglich heimsuchen», erklärte er, aber er wundere sich, denn er habe sich mich viel größer vorgestellt, doch er komme damit klar, denn «seine Liebste» sei ja auch «so eine kleine Frau». Womit wohl viel mehr über ihn gesagt war, als ihm lieb war.
Man gewöhnt sich – als Autorin – daran, von Kommentator*innen als «Frollein», «böses Mädchen» oder «Gretchen, Sie unanständiges Mädchen» angeschrieben zu werden. Ich bin jetzt 32 und schätze, der Übergang von «jung, naiv und frech» zu «alt und verbittert» wird fließend verlaufen. Bin gespannt.
Man gewöhnt sich auch an üble Bemerkungen zum Aussehen, zur Herkunft und zur vermeintlichen Sexualbiographie. Als ich anfing, feministische Texte zu schreiben, hätte ich nicht gedacht, dass alles so klischeehaft und mitunter unverhohlen sexualisiert läuft, aber es ist leider so. Ich neige zu Melancholie und Mittagsschlaf, aber seit ich mich öffentlich als Feministin äußere, nennen Leute mich «hysterisch» oder schreiben, ich würde «rumschreien», was ich wirklich sehr selten tue. Und sie stellen nicht wenige Mutmaßungen darüber an, mit wem und wie oft ich Sex habe oder ob überhaupt. Die Klischeehaftigkeit der Kommentare ist aber vermutlich auch ein Grund, warum mich das meiste davon nicht berührt: Ich fühle mich einfach nicht besonders gut getroffen mit vielen der Einschätzungen. Natürlich versuche ich aus Kritik zu lernen, aber vieles ist nicht zum Lernen gedacht, sondern zum Einschüchtern, und das klappt nicht. Es ist eher so, dass es mich bestärkt und radikalisiert.
Man gewöhnt sich auch an die Widersprüche. In der Welt einzelner Kommentator*innen ist es möglich, dass ich potthässlich und ungevögelt bin, mich aber zugleich hochgeschlafen habe und eine Schlampe bin; dass ich nie lache und mich gleichzeitig permanent über Leute lustig mache, die keine veganen, promovierten Lesben sind.
Zynischerweise kommen die meisten Gewaltandrohungen nach Texten über Gewalt (dicht gefolgt von Migrationsthemen). Ich habe mich von diesen Nachrichten bisher nie ernsthaft bedroht gefühlt, aber es ist ein Phänomen für sich, wie sehr Leute ausrasten können, wenn man sexualisierte Gewalt thematisiert. Die allermeisten dieser Nachrichten kommen von Männern, soweit man das angesichts der Anonymität im Internet sagen kann, aber es gibt auch Frauen, die Nachrichten mit Beleidigungen oder Drohungen schreiben. Gewalt- und Mordandrohungen zeige ich an, alles andere nicht, und versuche die mitunter riesigen Mengen an Nachrichten als eine Art Materialsammlung zu betrachten. Vielleicht nicht so anders als der Schriftsteller Max Frisch, der 1967 sagte:
«Trotz einer natürlichen Dosis von Selbsthass bin ich vorerst erstaunt, wenn ich mich von jemand (ohne dass ich ihm ein Bein gestellt hätte) gehasst finde. Habe ich mit Sympathie gerechnet? Auch nicht. Was erstaunt, ist die unerwartete Intensität einer einseitigen Beziehung. Der Reflex ist nicht Gegen-Hass, aber Wachheit, vielleicht Verwirrung, jedenfalls nichts Lähmendes, sondern etwas Aufrüttelndes. Ich habe das Gefühl, er fördere mich.»[4]
Wie viel Hass auch immer bei mir ankommt, es ist immer noch ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was andere Kolleg*innen für ihre Arbeit durchmachen müssen, zum Beispiel Deniz Yücel, der von Februar 2017 bis Februar 2018 im türkischen Gefängnis saß, weil er als Journalist gearbeitet hat.
Obwohl über oder unter jeder Kolumne nur ein Name steht, gibt es immer noch weitere Menschen, ohne die diese Texte nicht zustande kämen.
Mein erster Dank gilt meiner verstorbenen Philosophielehrerin Ursula Kurth für die Idee, überhaupt mal eine Zeitung zu lesen.
Großer Dank gilt auch meiner Mutter, meiner Schwester, meiner Oma und meinem Opa für Unterstützung von Anfang an.
Ich danke Daniel Schulz, Doris Akrap, Deniz Yücel und Ulrich Gutmair für die Motivation und Begleitung bei meinen ersten Kolumnenschritten in der taz. Danke auch an Stephanie Kuhnen für die Idee der L-Mag-Kolumne. Danke an Frauke Böger, Enrico Ippolito und Barbara Hans von Spiegel Online für das Vertrauen und den Rückhalt und ans Kulturressort und die Dokumentation fürs Bearbeiten und Faktenchecken. Und ganz besonderen Dank an Stefan Kuzmany für die viele Geduld und ewige Telefonate zu unmöglichen Uhrzeiten.
Danke auch allen Leser*innen, die mir Zuspruch oder konstruktive Kritik schicken oder mir ihre Geschichten anvertrauen.
Beim Rowohlt Verlag danke ich meiner Lektorin Johanna Langmaack sowie Nora Gottschalk und Lisa Marie Paesike für die Presse- und Veranstaltungsarbeit. Danke an meine Anwältin Christina Clemm für die Unterstützung in Rechtsfragen. Meiner Agentin Barbara Wenner danke ich von Herzen für viel mehr, als ich hier aufzählen kann.
Und dann noch: tiefe, tiefe Dankbarkeit an Theresia Enzensberger, Michael Brake, Emilia Smechowski, Lucy Fricke, Julia Schramm, Karsten Kredel, David Hugendick, meine Landkommune und Jens Friebe.
Kapitel einsFlirten und Vögeln und Liebe
Dem Windhund so nah
Dezember 2011
Mit Sex fing alles an. Dieser Text war meine erste eigene taz-Kolumne. Die Texte, die ich zu Beginn schrieb, waren eher – sagen wir mal – experimentell, und es ging verhältnismäßig oft ums Vögeln. Ich finde diesen Text hier richtig schlimm, aber aus dokumentarischen Gründen habe ich mich entschieden, ihn trotzdem ins vorliegende Buch aufzunehmen.
Als ich letzte Woche meinen Job gekündigt habe, bin ich erst mal in ein Loch gefallen, unabsichtlich.[*] Ich war eigentlich sehr erleichtert, aber dann kam das Loch, alles wurde schwarz und anstrengend, es war der Horror, und dann war auch noch Nieselregen.
Außerdem wurde in unserer Landkommune gerade diskutiert, ob es okay ist, dass ich in meinen Texten über die Kommune oder das Dorf schreibe. Zwischendurch sah es so aus, als würden sie komplett gegen die Texte abstimmen. Mir wurde ganz schlecht. Dann brach die N-Taste aus meiner Tastatur, und am nächsten Tag knickte auch das C ab. Ich hatte das Gefühl, dass alle meine Arbeitsgrundlagen zerfallen. Am Arsch. Jahresende, alles Ende, die Zukunft düster.
Dann kam ein Morgen, an dem ich mit meinem Freund im Bett lag, draußen regnete es. Er wollte Sex, ich fand es viel zu früh dafür. Deswegen fragte ich, ob wir nicht nebenbei was spielen können. «Können wir Stadt-Land-Fluss spielen, während du mich fickst, dann ist mir nicht so langweilig?» Ich fing an, A, er musste «Stopp» sagen. Wer jeweils zuerst alle Wörter zusammenhatte, rief «Schluss». Ich gewann haushoch, er hatte einen Orgasmus.
Abends waren wir dann auf einem Geburtstag in einer einfachen, netten Kneipe. Alle saßen rum, rauchten und tranken, manche tanzten. Weil wir spät kamen, setzten wir uns ganz hinten hin, da, wo man durchmuss, wenn man zum Klo will. Es blieb eine kleine Lücke frei, dahinter war ein schmaler Gang zu den Toiletten.
Als ich zur Bar ging, nahm ich Streichhölzer vom Tresen mit, auf der Schachtel war ein Reh mit roten Stiefeln. Ich bestellte zwei Bier und sah neben mir einen großen weißen Windhund mit langem Fell und superschmaler Schnauze.
Als ich zurückging, folgte mir der Hund. Er blieb neben unserem Tisch stehen und schaute zögerlich auf die Lücke, die zum Klogang führte. Sein Kopf hing herab, sein Blick war so mutlos und träge, als wenn alles beschissene Leid der Welt auf seinen schmalen Hundeschultern lastete. Er traute sich nicht durch zum Gang. Armer Hund, dachte ich, wollte seinen Kopf streicheln, aber er wich mir aus. Ich schob den Tisch zur Seite, er schnüffelte, dann ging er langsam durch. Er schwang dabei mit seinem Schwanz über den Tisch und löschte mit einem Wisch alle vier Teelichter, die da brannten. Dann legte er sich ans Ende vom Klogang und sah aus wie tot.
Auf dem Nachhauseweg holte ich die Streichholzschachtel aus meiner Jackentasche. Ich schaute das weiße Reh mit den roten Stiefeln an und stellte fest: Das war gar kein Reh. Das war der Windhund, der gehört offenbar zur Kneipe, er ist da so was wie das Maskottchen. Und sie malen ihm rote Stiefel an und kleben ihn auf Streichholzschachteln. Oh Gott. Eine tiefe Traurigkeit ergriff mich. Ich fühlte mich dem Windhund so nah. Trotzdem hoffte ich, dass ich am Ende des dunklen Ganges, wenn ich wieder einen Job kriege und der Frühling kommt und so, nicht tot vor einem Kneipenklo liegen werde. Bitte nicht. Aber so hübsche rote Stiefel hätte ich auch gerne.
Es ging direkt los mit der Leser*innen-Post. Oliver M. schrieb eine Mail an die taz, weil ihn störte, dass es in dieser Ausgabe gleich zwei Texte von mir gab: «Zwei Texte von Margarete Stokowski in einer taz … bitte schmeißt die Alte doch endlich mal raus oder verkauft sie an ein Teenie-Blatt wie Neon. Diese peinlichen, spätpubertären Selbstdarstellungen nerven unendlich.» Das «Fräulein Stokowski» solle doch bitte woanders schreiben. Ich schrieb zurück, dass ich vorhatte zu bleiben, und er antwortete: «Vielen Dank für die Vorwarnung. Da hilft dann wohl nur die Kündigung des Abos.»
Traurig! Dafür schrieb Ulrich W. am selben Tag: «Liebe Margarete Stokowski, Deine Kolumnen sind seit Jahren wieder ein Grund für mich, überhaupt auf taz.de zu klicken.»
Die Liebe und der Sechs
November 2012
Mein Kumpel Lukas kommt aus Hessen und heißt dort nicht Lukas, sondern «der Luggas». Wenn wir schriftlich kommunizieren, ist alles in Ordnung. Ich mag ihn sehr gerne, finde ihn intelligent und lustig. Wenn wir aber tatsächlich verbal miteinander kommunizieren, muss ich mich immer ein bisschen zusammenreißen.
Neulich redeten wir mal wieder über alles Mögliche und machten uns über Rainer Langhans lustig. Der hat in einem Interview mit der Zeit gesagt, die «höchste Form von Kommunikation» sei die Liebe, die Piratenpartei hätte aber leider «von Liebe keine Ahnung». Ja, aber die CDU, oder was?
Lukas sagte dann noch etwas, irgendwas mit Sex. Ich hörte ihm aber nicht mehr richtig zu. Ich konnte nicht. «Lukas», unterbrach ich ihn, «apropos Kommunikation. Sag mal bitte, welche Zahl nach fünf und vor sieben kommt.» – «Sechs», sagte er. «Und jetzt sag mal das kurze Wort für Geschlechtsverkehr.» – «Sechs», sagte er wieder. «Findest du das nicht komisch?», fragte ich.
Er wusste nicht, was daran komisch sein sollte. Ich sagte, dass ich finde, man sollte die beiden Wörter nicht gleich aussprechen, sondern die Zahl mit einem weichen, summenden und die Tätigkeit lieber mit einem harten, zischenden S. Und dann machte ich einen ziemlichen Fehler, weil ich sagte: «Ich finde es total unerotisch, wie du ‹Sex› sagst.»
Das traf ihn hart. «Unerroddisch?», fragte er entsetzt. Wir übten dann eine ganze Weile den Unterschied zwischen hartem und weichem S und Lukas sagte: «Ssssssssssex. Gut so?» Aber es klang immer noch komisch. Er sagte, eine Logopädin habe schon mal versucht, ihm das beizubringen, nur leider hätte es nichts gebracht. (Wobei seine Logopädin für ihn eine «Lockopädin» war.)
Also nicht mit «Sex», aber mit anderen Wörtern. Dass aber nun mal alle aus seiner Gegend das so sagen würden und dass es ja wohl ganz normal sei und höchstens eine kleine regionale Besonderheit, dass also ja wohl alles in Ordnung sei. Ich sagte, ja, das kann schon sein, dass das normal und gut ist und alles, aber ich finde es halt unsexy, irgendwie. «Tut mir leid», sagte ich, «wirklich.»
Ich versuchte noch zu erklären, dass ich das ja nicht insgesamt auf seine Person beziehen würde und so weiter, aber das half dann auch nicht mehr viel, Lukas war beleidigt. «Dafür sagen wir blöden Berlinerinnen immer drinne und Mülch und Kürche!», sagte ich, und dass ich vielleicht nur eine engstirnige, lokalrassistische Nuss sei und halt nicht so weltgewandt und so.
«Ja», sagte Lukas, «aber wenn jemand mit dir keine Milch mehr in der Kirche trinken will, ist es nicht so schlimm, wie wenn keiner mehr mit dir Se… – ficken will.» – «Wie du ‹ficken› sagst, finde ich total super», sagte ich. «Ich bin Psychologe», sagte er, «ich kann zu den Eltern nicht sagen, die fickuelle Entwicklung Ihres Kindes ist so und so.» – «Aber für die Eltern musst du ja auch nicht sexy sein», sagte ich, «nur seriös. Und seriös bist du, sowieso, immer.»
«Aha», sagte er. «Ssssssssseriös?» – «Nee», sagte ich, «seriös.» – «Ach Scheiße noch eins!», sagte Lukas, «ich will eh ’ne richtige Hessin als Frau, die will dann auch Sechs mit mir haben.»
Guckt mehr Lesbenpornos!
Januar 2014
Kennen Sie den? Sitzen zwei Homosexuelle im Flugzeug. Sagt die eine zur anderen: «Bestimmt haben sich jetzt alle zwei Schwule vorgestellt.»
Ich hatte mir auch was vorgestellt, als ich neulich ins Kino ging. Nämlich so halbwegs in Ruhe «Blau ist eine warme Farbe» zu gucken. Das ist der mit den zwei jungen Frauen, von denen die eine blaue Haare hat, jedenfalls am Anfang des Films, und die sich lieben und miteinander schlafen, jedenfalls in der Mitte des Films. Es gibt darin mehrere Sexszenen, eine davon ist sechs oder sieben Minuten lang. Too much für meine Mitgucker*innen, links, rechts, hinter und vor mir. Ich saß noch nie, nie, nie in einem Kino, in dem so viel gekichert und getuschelt wurde.
Informierte Menschen werden jetzt sagen: «Jaha, gekichert und getuschelt, klar. Das hat doch auch Julie Maroh über den Film gesagt, also die Autorin des Comics, der als Vorlage diente. Weil sie fand, lesbischer Sex wird in dem Film total platt und aus männlicher Spannersicht gezeigt.» Hat sie gesagt, so ungefähr. War aber leider nicht das Problem in dem Kino, in dem ich saß.
«Ich schwöre, die ist in echt nicht lesbisch.» – «So hässlich, ey.» – «Okay, bisschen eklig isses schon.» – «Krass. Nee. Uäh.» Das sind keine Kommentare von Lesben, die sich falsch repräsentiert fühlen, das sind Sätze von Jugendlichen, die sich ekeln. Die noch im Abspann auf ihr Handy gucken und sagen «Alter, drei Stunden».
Zugegebenermaßen waren wir im Cinemaxx am Potsdamer Platz in Berlin. Das ist ein Kino, in dem man sich normalerweise in sternwartenmäßigen Riesensälen Dinosaurierärsche in 3-D anguckt und dabei Popcorn isst aus Eimern, von denen im Winter 1947 eine fünfköpfige Familie tagelang gelebt hätte.
Ob ich die Sexszenen mochte, fragte mich eine Freundin, die den Film auch gesehen hatte. Ich konnte ihr nicht antworten. Wie denn auch? Ich musste während der Szenen immer wieder rübergucken zu den Jugendlichen. Musste böse gucken und zischen und fauchen. Musste mich fragen, ob das Ganze für die mit Schwulen besser gegangen wäre. Ob die bei «Brokeback Mountain» auch solche Geräusche gemacht hätten.
«Es war mir sehr wichtig, das Thema Homosexualität im Film vergessen zu machen», hat der Regisseur des Films im Interview gesagt. Hätte klappen können. Hätte man statt der Sexszenen einfach Szenen aus dem «Hobbit» oder «Star Trek» eingeblendet. Natürlich kann man «Blau ist eine warme Farbe» auch als Teenie- und Selbstfindungsfilm sehen, als Film über ganz grundlegende Unsicherheit und bekloppte Künstler. Könnte man. Geht aber nicht, wenn man sich volle Lotte drauf konzentriert, sich zu ekeln. Dann wird es schwierig.
Ekel ist immer auch Angst. Vielleicht waren die Jugendlichen, die mit mir im Kino waren, gar nicht homophob, vielleicht hätten sie nur vorher üben sollen. Ganz langsam. Falls ihr das lest, ihr kleinen Nervbacken: Guckt mehr Lesbenpornos. Bitte. Nicht zwei, nicht drei, guckt viele! Checkt die Pluralität! Kommt klar! (Nicht die «Lesbenpornos» auf YouPorn mit den Haar-Extensions und den aufgeklebten langen Fingernägeln. Jo, sagt ihr, aber wieso nicht die? Vertraut mir: nicht die!) Gewöhnt euch an Lesben, weil: Es gibt sie. Wenn ihr euch nicht an sie gewöhnen wollt, guckt den «Hobbit».
Ihr habt Glück, ihr könnt das mit dem Lesbengucken im Internet üben. Tut es. Ihr werdet feststellen, dass das alles nicht so schlimm ist. Lesben, die Sex haben, sind nicht ekliger als andere Leute, die Sex haben. Sie sind nicht schmutziger als andere, im Zweifelsfall sind sie so sauber – sorry – wie geleckt.
Bei Zeus, warum nie Männer?
März 2014
Kein Sex mit Nazis – alter Spruch. In der Ukraine gibt es davon jetzt eine neue Version: Kein Sex mit Russen. Weil sie die Krim nicht an Russland abtreten wollen, haben ukrainische Frauen zum Sexstreik aufgerufen. Dazu haben sie eine Facebook-Seite gestartet: «Lass keinen Russen an dich ran» steht auf dem Plakat, zwei Hände formen darauf eine Vulva. Die Initiative ist dazu gedacht, «den Feind mit allen Mitteln zu bekämpfen». Über 2400 Menschen gefällt das.
Es ist nicht das erste Mal, dass Frauen per Sexboykott politische Ziele verfolgen. In Japan drohten Frauen im Februar auf diese Art den Unterstützern eines Wahlkandidaten, der fand, Frauen seien wegen ihrer Periode zu blöd für Politik. Im Sommer 2012 traten Frauen in Togo in einen Sexstreik aus Protest gegen den Präsidenten. In Neapel sexstreikten Frauen schon gegen Feuerwerke, in Kolumbien gegen einen Straßenbau und gegen Gewalt, in Liberia gegen den Bürgerkrieg, auf den Philippinen gegen den Kampf zweier Dörfer. Und die ukrainischen Femen forderten zum Sexstreik auf, um Frauenausbeutung anzuprangern.
Die Tradition des Sexstreiks reicht aber noch ein ganzes Stück weiter zurück. Ein berühmter Fall ist «Lysistrata», eine Komödie des griechischen Dichters Aristophanes von 411 v.Chr.: Lysistrata fordert andere Frauen auf, mit ihr in einen Sexstreik zu treten, um den Krieg zu beenden. Frauen aus Athen und Sparta geloben, sich Männern zu verweigern, bis endlich Frieden sei: «Bei Zeus, wir schwören!»
Was auffällt: Immer sind es Frauen, die in Sexstreik treten. Bei Zeus, warum nie Männer? Was für eine Form von Macht ist das, die Frauen da anwenden? Sind das die «Waffen einer Frau»? Ist das der «Geschlechterkampf»?
Streiks gibt es in vielen Varianten, meistens in Form der Niederlegung von Arbeit oder als Hungerstreik. Im einen Fall verweigert man Leistungen, die andere nicht erbringen können und ohne die irgendetwas nicht weitergeht. Im anderen Fall verzichtet man auf etwas, ohne das man auf Dauer stirbt. Ein Sexstreik scheint eher zur ersten Sorte zu gehören. Frauen entziehen Männern Sex, bis diese, wie in «Lysistrata», aufgeben, weil sie unerträglich harte Ständer kriegen: «Pflöcke, o Graus, als wollten sie Schweine dran binden!»
Nun gehört zu einem solchen Streik – ob in einer Komödie oder in der Realität – ein ganzes Arsenal von Rollen, Klischees und Mythen. Die Rollen müssen, damit ein Sexstreik von Frauen Sinn ergibt, ziemlich klar verteilt sein. Es müssen Männer sein, die rausgehen und Politik machen, die Krieg führen und damit von allein gar nicht mehr aufhören können. Und Frauen, die sich darüber ärgern und lieber Harmonie wollen.
Abgesehen davon, dass ein Sexstreik von Frauen nur wirkt, wenn man davon ausgeht, dass Männer nur durch Frauen angemessen sexuell befriedigt werden können: Warum ist Befriedigung für Männer anscheinend wichtiger als für Frauen? Warum können Frauen verzichten, Männer nicht?
Die Antwort liefert die schlimme alte These von der ungebändigten männlichen Sexualität. Wenn Frauen begehren, so der Mythos, dann hält sich das in Grenzen. Sexualität findet bei ihnen im Kopf statt. Wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Bei Männern: hui, zack, krass, kannste nicht bremsen, die Natur! Samenstau! Wenn Männer wollen, dann müssen sie.
Dieses Klischee der Schwanzsteuerung ist gefährlich. Im Zweifel lässt sich damit viel mehr begründen, als einem lieb sein kann. Zu Vergewaltigung im Krieg wird Lysistrata gefragt: «Und wenn sie uns zur Kammer ziehn mit Gewalt?», sie antwortet: «Dann hältst du dich am Pfosten!» – «Und wenn er schlägt?» – «Dann mach’s ihm, aber schlecht! Wo man Gewalt braucht, ist die Lust nicht groß!» Was für Aussichten.
Die Sache wird nicht besser dadurch, dass ein Sexstreik suggeriert, dass die Frauen nach dem Streik grundsätzlich wieder verfügbar sein werden. Kurz war die Ware weg – schwupp, wieder da. Kein schönes Bild. Es kämpft sich am Ende vielleicht gar nicht so gut als Sexobjekt.
Sich schön in die Fleischtheke legen
August 2015
Lalülala! «Das Kompliment stirbt aus», alarmiert die Süddeutsche Zeitung.[5] Der Feminismus sei zwar «eine feine Sache», habe aber dazu geführt, dass Männer sich nichts mehr trauen: Gar nichts! «Bloß nicht lächeln, bloß nichts sagen, das gilt doch gleich wieder als doofe Anmache.» Männer leben heutzutage, bis auf Rainer Brüderle und Dieter Bohlen, in «ständiger Angst», weiß die SZ: «Der Rest der deutschen Männlichkeit presst die Lippen aufeinander und guckt auf den Boden, wenn er Frauen auf der Straße oder im Büroflur begegnet.»
Diese Art von Vorwurf an den Feminismus ist nichts, was man per Eilantrag beim Patentamt anmelden müsste. Die Süddeutsche holt diese Idee jetzt pfiffigerweise im Sommer raus, weil: Im Urlaub, in Italien, da wird man «als Frau» wenigstens noch angeguckt, da – und nur da! – kriegt man noch «eine Portion Aufmerksamkeit», zu Hause nämlich nicht mehr.
Oder nur von anderen Frauen, «vielleicht, weil sie insgeheim hoffen, etwas Nettes zurückgesagt zu bekommen» (die Biester). Wenn ein Mann sich trotzdem traue, einer Frau ein Kompliment für ihre neue Frisur zu machen, dann, so hat die SZ eigenhändig recherchiert, bricht die Frau in Tränen aus: «So etwas Nettes hat noch nie jemand zu mir gesagt.»
Nun bin ich tatsächlich selten in München unterwegs und weiß nicht, was für ein eisiger Wind da weht. Wenn das keine Satire sein soll, dann hui. Sorry, liebe «Ich bin ja wirklich für Gleichberechtigung, aber man muss es doch bitte nicht übertreiben!»-Leute, es tut mir leid, ihr seid voll drauf reingefallen. Aber so richtig. Auf all die Idioten, die euch erzählen, Feministinnen seien haarige Hexen, die sehr konkret an eurem Untergang interessiert sind. Man muss sein Hirn dick in «Post von Wagner» gewickelt haben, um zu denken, Feminismus verbiete irgendwem, freundlich zu sein.
Wo soll man anfangen, bei Menschen, die so was denken? Soll man überhaupt? Was ist das für eine Form von Anerkennung, nach der eine Frau sich da sehnt? Wenn ich jemanden will, der mich anhechelt, kauf ich mir ’nen Hund. Wer sich vom Feminismus beim Flirten verunsichern lässt, war auch vorher schon zu dumm dazu. Oder zu faul. Man kann das natürlich schön finden, sich als Frau nur wie ein Stück Vorderschinken in die Auslage zu legen und zu warten, bis einer kommt. Wer auch immer. Kann man machen.
In der Wartezeit kann man ein bisschen sinnieren: Wenn man glaubt, dass ein Flirt oder auch nur ein nettes Gespräch nicht mehr zustande kommen kann, weil die Männer sich alle nicht mehr trauen anzufangen, welches Bild hat man dann von sich als Frau? Als Mensch? Ist das angenehm? Und was heißt es, wenn man glaubt, diese Form von Anerkennung exklusiv nur von Männern kriegen zu können? Wie frei fühlt sich das an? Und wie traurig ist das?
Es gibt eine einzige feministische Flirtregel, die man sich im Übrigen sehr leicht merken kann und die lautet: Sei kein Arschloch. Fertig. That’s it. Unisex übrigens. One size fits all. So praktisch. Der Rest ist ein bisschen gesunder Menschenverstand, Anarchie und Liebe, und das ist genau so schön, wie es klingt.
Deine Mutter hält die Klappe
März 2016
Man weiß nicht, was Maria dachte, als sie unten am Kreuz stand, an dem oben ihr Sohn hing. Man weiß nur, dass heute in der Wikipedia steht, der Hauptgrund für die spätere Marienverehrung seien «Marias Demut und Furcht, ihr Glaube sowie ihre vertrauensvolle Zustimmung, mit der sie sich in Gottes Plan fügt». Nun ließe sich behaupten, dass Demut und das Einfügen in Gottes Plan nicht mehr ganz aktuelle Mutterideale sind, aber möglicherweise trügt der Schein. Denn die aktuelle Diskussion um «Regretting Motherhood», also das Bereuen von Mutterschaft, bringt bisweilen Äußerungen hervor, deren einzige Botschaft an Mütter ist: Stellt euch nicht so an. Das klingt lässiger als «Seid demütig», meint aber nicht viel anderes.
«Regretting Motherhood», so heißt das Buch der israelischen Soziologin Orna Donath (ihr wissenschaftlicher Aufsatz zum Thema erschien bereits vor einem Jahr, nun gibt es das deutsche Buch dazu). Donath hat Interviews mit 23 Frauen geführt, die es bereuen, Mutter geworden zu sein. Das ist in Israel, wo die Studie durchgeführt wurde und wo eine Frau im Schnitt drei Kinder bekommt, etwas anderes als in Deutschland, wo es 1,5 Kinder sind. Trotzdem ist Deutschland das Land, in dem die Debatte besonders heftig geführt wird. Israel sei noch nicht so weit, hat Donath auf der Leipziger Buchmesse erklärt: Kein Kind zu haben sei dort für die meisten schlicht keine Option.
Die Reaktionen darauf sind bisweilen auffällig gehässig. Die Studien und Erzählungen werden als Rumgeheule abgetan, vielleicht auch, weil es den Hashtag #regrettingmotherhood gibt, und alles, was einen Hashtag hat, lässt sich geil belächeln.
In der Zeit erklärte Susanne Mayer, irgendwelche narzisstischen Muttis würden «zu viel Instagram gucken» und sich durch ihre Kinder beim «Ichsein» gestört fühlen, und: «Wurde nicht vor hundert Jahren das Wahlrecht für Frauen erkämpft, damit sie politisch handeln, statt zu jammern?»
Faz.net gönnte sich innerhalb von drei Wochen ganze drei Texte zum Phänomen «Regretting Motherhood»: eine Besprechung, die die Debatte für einen grotesken Hype hält, eine weitere, die vom «schicken Hashtag #regrettingmotherhood» spricht und davon, dass es doch auch Mutterglück gäbe (als hätte das jemand bestritten), und dann noch «Anmerkungen zur Merkwürdigkeit der Debatte» von Edo Reents, der sich so denkbar blöd dabei anstellt, das Buch von Orna Donath zu verstehen, dass es beim Lesen weh tut. Ob es jetzt Pflicht für Mütter sei, ihre Mutterschaft zu bereuen, fragt er. Nein, Mann.
Rücksichtslos, brutal und herzlos findet Reents die Frauen, die darüber sprechen, dass sie ihre Mutterschaft bereuen: «Es ist nicht erstrebenswert, dass man so etwas in der Öffentlichkeit sagen kann, selbst anonym nicht.» Die betroffenen Frauen könnten laut Reents «statt zum Psychiater auch zu einem Philosophen mit Schwerpunkt Logik gehen», der ihnen erklärt, dass Kinderkriegen nicht rückwärts geht.