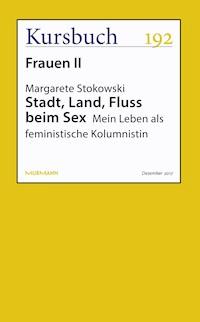9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
SEX. MACHT. SPASS. UND PROBLEME. In ihrem Debüt «Untenrum frei» schreibt die Autorin und Spiegel-Online-Kolumnistin Margarete Stokowski über die kleinen schmutzigen Dinge und über die großen Machtfragen. Es geht darum, wie die Freiheit im Kleinen mit der Freiheit im Großen zusammenhängt, und am Ende wird deutlich: Es ist dieselbe. Mit scharfsinnigem Blick auf die Details gelingt ihr ein persönliches, provokantes und befreiendes Buch. Stokowski erzählt von dem frühen Wunsch, unbedingt als Mädchen wahrgenommen zu werden, von unzulänglichem Aufklärungsunterricht, von Haaren und Enthaarung, von Gewalterlebnissen, von Sex, von Liebe und vom Feminismus. Und sie verbindet ihre wunderbar erzählten persönlichen Erlebnisse mit philosophischen, politischen und wissenschaftlichen Analysen und zeigt damit: Sie ist mit ihren Erfahrungen nicht alleine. Wir fühlen uns als freie, aufgeklärte Individuen, aber erst wenn wir Geschichte um Geschichte zusammentragen, wird die kollektive Schieflage, die strukturelle Ungleichheit sichtbar. Dennoch: «Wenn ich Geschichten aus meinem Leben erzähle, dann nicht, um langsam, aber sicher ein Bild von mir als Vollopfer aufzubauen», schreibt Stokowski – im Gegenteil. Ihr geht es um eine «Ent-Opferung». Humorvoll und klug geht sie damit der Frage nach, wie politisch das Private noch immer ist. «Der Feminismus erklärt mir nicht, warum der Bus nicht auf mich wartet. Aber er erklärt mir, warum ich mich für mein Zuspätkommen entschuldigen werde, auch wenn ich nicht schuld war, sondern der Bus zu früh gefahren ist. Er erklärt mir, warum viele der Frauen, die ich kenne, sich auch noch entschuldigen würden, wenn sie von einem Meteoriten getroffen werden.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Margarete Stokowski
Untenrum frei
Über dieses Buch
SEX. MACHT. SPASS. UND PROBLEME.
In ihrem Debüt «Untenrum frei» schreibt die Autorin und Spiegel-Online-Kolumnistin Margarete Stokowski über die kleinen schmutzigen Dinge und über die großen Machtfragen. Es geht darum, wie die Freiheit im Kleinen mit der Freiheit im Großen zusammenhängt, und am Ende wird deutlich: Es ist dieselbe. Mit scharfsinnigem Blick auf die Details gelingt ihr ein persönliches, provokantes und befreiendes Buch.
Stokowski erzählt von dem frühen Wunsch, unbedingt als Mädchen wahrgenommen zu werden, von unzulänglichem Aufklärungsunterricht, von Haaren und Enthaarung, von Gewalterlebnissen, von Sex, von Liebe und vom Feminismus. Und sie verbindet ihre wunderbar erzählten persönlichen Erlebnisse mit philosophischen, politischen und wissenschaftlichen Analysen und zeigt damit: Sie ist mit ihren Erfahrungen nicht alleine. Wir fühlen uns als freie, aufgeklärte Individuen, aber erst wenn wir Geschichte um Geschichte zusammentragen, wird die kollektive Schieflage, die strukturelle Ungleichheit sichtbar. Dennoch: «Wenn ich Geschichten aus meinem Leben erzähle, dann nicht, um langsam, aber sicher ein Bild von mir als Vollopfer aufzubauen», schreibt Stokowski – im Gegenteil. Ihr geht es um eine «Ent-Opferung». Humorvoll und klug geht sie damit der Frage nach, wie politisch das Private noch immer ist.
«Der Feminismus erklärt mir nicht, warum der Bus nicht auf mich wartet. Aber er erklärt mir, warum ich mich für mein Zuspätkommen entschuldigen werde, auch wenn ich nicht schuld war, sondern der Bus zu früh gefahren ist. Er erklärt mir, warum viele der Frauen, die ich kenne, sich auch noch entschuldigen würden, wenn sie von einem Meteoriten getroffen werden.»
Vita
Margarete Stokowski, geboren 1986 in Polen, lebt seit 1988 in Berlin und studierte Philosophie und Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie schreibt als freie Autorin unter anderem für die «taz» und «Die Zeit». Seit 2015 erscheint ihre Kolumne «Oben und unten» bei «Spiegel Online».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg Copyright © 2016 by Margarete Stokowski
Covergestaltung ZERO Media GmbH, München, nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-05611-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort zur Neuauflage
Einleitung
Kapitel eins Nicht als Prinzessin geboren
Kapitel zwei Wachsen und waxen
Kapitel drei Wissen wäre Macht
Kapitel vier Untenrum und Überbau
Kapitel fünf Weltherrschaft im Alltag
Kapitel sechs Eine Poesie des «Fuck you»
Kapitel sieben Nur mit Liebe
Literatur
Dank
Vorwort zur Neuauflage
Man würde ja meinen, wenn man ein Buch fertig geschrieben hat, dann ist man glücklich und erleichtert und vielleicht auch stolz, und man freut sich, dass es bald gedruckt wird und Menschen es lesen werden. Bei mir war es mit diesem Buch damals ein bisschen anders. Denn zwischen dem Schreiben und dem Glück lag noch eine «Was habe ich getan?»-Krise: Als das Buch so weit war, dass nur noch ein paar letzte Korrekturen anstanden, war ich so weit zu sagen, dass ich gerne mindestens die Hälfte rauskürzen würde und ferner nach der Veröffentlichung meinen Namen ändern und nie wieder irgendwas schreiben. Ich dachte nämlich, es ist ziemlich vieles ziemlich persönlich und peinlich – wer will das lesen? War das jetzt ein Buch über Feminismus und Freiheit oder ein einziges «too much information»? In welcher Höhle kann ich mich verstecken, wenn es erscheint?
Es kam dann aber zu meinem großen Erstaunen anders. Das Buch stand 200 Wochen auf der Bestsellerliste, ich hatte unzählige Lesungen: in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, Belgien und Polen. Und ehrlich gesagt brauchte ich diese Lesungen auch, um mich gewissermaßen mit dem zu versöhnen, was ich da geschrieben hatte. Weil ich merkte: Okay, ziemlich viele Menschen haben ziemlich ähnliche Erfahrungen gemacht und sind froh, damit nicht alleine zu sein. Und ursprünglich war das ja auch meine Idee gewesen: Erlebnisse aufzuschreiben, die man als Mädchen und als Frau klassischerweise hat, an denen aber irgendetwas, sagen wir, mindestens merkwürdig ist. Und an denen man sehen kann, wie viel immer noch falsch läuft – und zwar nicht falsch bei uns, weil wir irgendwas verkehrt machen, sondern falsch in der Welt, wie sie ist.
Als ich anfing, an dem Buch zu arbeiten, vor etwa zehn Jahren, fragte mich jemand, für welche Zielgruppe ich schreiben würde. Eigentlich eine normale Frage, aber sie machte mich fertig. Für wen schreibe ich? Ist das nicht ein bisschen anmaßend zu sagen: Die und die sollen das mal bitte schön lesen, die haben es nötig?
Ich wusste damals weder die Zielgruppe noch das Genre. Das Erste, was ich hatte, ganz am Anfang, war der Titel: Untenrum frei. Ich wusste nur noch nicht: Was für ein Buch sollte das werden? Ein Roman, ein Sachbuch, ein Essay? Ich wollte ein feministisches Buch schreiben, das man ohne großes Hintergrundwissen lesen kann, auch wenn man vielleicht noch zur Schule geht oder auch wenn man eigentlich nicht viel liest, aber gleichzeitig eines, das auch diejenigen lesen können, die schon im Thema drin sind. Und es sollte kein rosa Cover haben und keine Frauenkörperteile auf dem Cover. So viel wusste ich. Viel mehr eigentlich nicht.
Beim Schreiben merkte ich recht bald, dass ich gar nicht für eine bestimmte Zielgruppe schreiben kann, weil ich mich dann immer frage: Wissen die das nicht schon? Müssen die das wissen? Ich kann die Frage der Zielgruppe eigentlich jetzt erst beantworten, nachdem das Buch schon ein paar Jahre in der Welt ist: vom Alter her ungefähr 14 bis 140, Gender egal. Falls Sie ein Elternteil sind, der gerade in der Buchhandlung steht und versucht herauszufinden, ob das Buch für Ihr Kind geeignet ist: ja, sobald es in die Pubertät kommt und anfängt, sich für sexuelle Themen zu interessieren, und/oder verdächtig viel Zeit im Badezimmer verbringt.
Es war, apropos Badezimmer, für mich in den letzten Jahren sehr schön zu sehen, wie viele Menschen sich mit den peinlichen Sachen identifizieren konnten, die ich von mir aufgeschrieben habe. Sie wurden dadurch nämlich weniger peinlich. Überhaupt war es schön zu sehen, was alles mit dem Buch passiert, und dass nichts davon geeignet war, mich zu einer Namensänderung zu bewegen, wie ich vorher gedacht hatte. Im Gegenteil sozusagen: Inzwischen weiß ich von zwei Frauen, die das Buch während einer Schwangerschaft gelesen haben und dann ihr Baby mit erstem oder zweitem Namen nach mir benannt haben. Ein lesbisches Paar hat seinen Hund nach mir benannt und jemand anders ein Huhn (!). Das war nicht mein Ziel beim Schreiben, aber schön bzw. lustig ist es.
Ich weiß inzwischen auch, dass das Buch für viele ein Einstieg in feministische Literatur war und ist, und das macht mich unfassbar froh. Das Buch wird an Schulen und Unis, in Fortbildungen und Buchclubs gelesen, und das ist wesentlich mehr, als ich mir beim Schreiben hätte erträumen können. Auch: dass mir eine Frau erzählt hat, sie habe auf ihrem Onlinedating-Profil angegeben, generell nur Männer zu daten, die Untenrum frei gelesen haben. Von zwei anderen Frauen weiß ich, dass sie sich von ihren Partnern getrennt haben, nachdem sie das Buch gelesen hatten.
Zum siebenjährigen Jubiläum von Untenrum frei hatte ich meine Follower*innen auf Instagram nach ihren Erfahrungen mit diesem Buch gefragt. Es kamen so viele tolle Rückmeldungen. Eine Frau schrieb, es sei ihr erstes feministisches Buch gewesen: «Es war extrem wichtig für mich. Plötzlich ergab alles Mögliche einen Sinn, LOL. Selten hat ein Buch so viel für mich getan.» Eine andere schrieb: «Dieses Buch hat mir einen Sinn gegeben, wieder zu kämpfen.» Eine andere: «Ich habe mich vor dem Buch nicht getraut, mich Feministin zu nennen, weil ich immer das Gefühl hatte, nicht genug zu wissen.» Eine andere: «Das Buch war für mich der Anfang einer langen Reise, den Mund aufzumachen und mich zu wehren, wenn ich scheiße behandelt werde. Erst so ganz zaghaft, mittlerweile ziemlich routiniert.» Eine Frau schrieb, sie habe sich in ihrem Job auf der Baustelle weniger alleine gefühlt seit dem Lesen. Und eine andere, sie habe danach ihren Job gekündigt. Und eine weitere, das Buch habe ihr Blowjobs erleichtert – auch schön!
Eine Frau schrieb, ihr Mann habe gesagt, sie dürfe sich zum 8. März etwas wünschen: Sie wollte, dass er das Buch liest. Jemand anders: «Ein Freund, der sich auf einer Party danebenbenommen hat, musste es danach als Hausaufgabe lesen, und es hat merklich Wirkung gezeigt.» Viele schrieben, sie hätten das Buch gern früher gelesen: «Ich habe es mit Mitte 30 gelesen und getrauert, dass ich es nicht schon mit 17 lesen konnte, es hätte mir evtl. viel Mist erspart.» – Was soll ich sagen, außer: OMG, same!
Sicherlich gibt es einiges, was ich heute anders schreiben würde bzw. wozu ich mehr sagen würde, aber es sind ja auch schon fast acht Jahre vergangen seit der Veröffentlichung. Das ist vielleicht bezogen auf die Geschichte des Feminismus nicht superlang, aber trotzdem ist seitdem einiges passiert. Es gab noch kein TikTok damals, kein «Fridays for Future» und keine «Ehe für alle», die AfD saß noch nicht im Bundestag, die Anschläge von Hanau und Halle waren noch nicht passiert und die Pandemie auch nicht. Rechtsruck, Klimawandel und Kriege sind heute größere Themen als damals, und all das hat natürlich eine Bedeutung für die feministische Bewegung. Außerdem sind inzwischen Themen wie Nonbinarität und Transgeschlechtlichkeit öffentlich präsenter als damals.
Auch bei mir selbst ist logischerweise seitdem einiges passiert. Die Gewalterfahrung, die ich im dritten Kapitel beschreibe, hatte noch ein juristisches Nachspiel, das ich aber damals noch nicht beschreiben konnte, weil es schlicht noch lief, während ich schrieb, und ich wusste nicht, wie es ausgehen würde. Kurz gefasst: Ich habe gewonnen.
Und apropos Gewalt: Es gab damals auch #metoo noch nicht! Wer sich dafür interessiert: In meinem zweiten Buch, Die letzten Tage des Patriarchats, gibt es einiges dazu.
Leider ist das, was in Untenrum frei über Sexismus steht, auch Jahre nach #metoo noch lange nicht veraltet. Es ist ein klassisches feministisches Phänomen, dass man immer wieder Momente hat, in denen man denkt: Warum ändert sich alles so langsam? Man sollte sich dann aber vielleicht daran erinnern, dass wir es hier mit einer jahrhundertealten Bewegung zu tun haben. Es geht vielleicht nicht immer nur vorwärts und oft auch viel zu langsam – aber insgesamt tut sich einiges. Man ist zwar manchmal ungeduldig (und das völlig zu Recht!), aber der Feminismus hat schon einiges an Krisen in der Welt überstanden und wird das auch weiterhin tun. Und ich bin froh, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann.
Einleitung
Die Schauspielerin Maggie Gyllenhaal wurde für eine Hollywoodrolle abgelehnt, als sie 37 Jahre alt war. Es ging darum, das «love interest» eines 55-jährigen Mannes zu spielen. Gyllenhaal wurde nicht genommen – weil sie zu alt war. «Das hat mich überrascht», sagte sie in einem Interview. «Erst fühlte ich mich schlecht deswegen. Dann hat es mich wütend gemacht, und dann musste ich lachen.»[1]
Dieses Buch ist so ähnlich entstanden: Erst waren die Dinge komisch. Unangenehm. Verletzend. Dann kam die Wut. Heftige Wut auf die Ungerechtigkeit. Und dann das Lachen: Es müsste doch alles nicht so sein. Der ganze alte Scheiß ist längst am Einstürzen.
Wir können untenrum nicht frei sein, wenn wir obenrum nicht frei sind. Und andersrum. Das ist die zentrale These dieses Buches. Es geht um die kleinen, schmutzigen Dinge, über die man lieber nicht redet, weil sie peinlich werden könnten, und um die großen Machtfragen, über die man lieber auch nicht redet, weil vieles so unveränderlich scheint. Es geht darum, wie die Freiheit im Kleinen mit der Freiheit im Großen zusammenhängt, und am Ende wird sich zeigen: Es ist dieselbe. Und es geht außerdem darum, dass Freiheit für eine kleine, unter sich gleichberechtigte Avantgarde nichts wert ist, wenn es die Freiheit einiger weniger ist, die an Deck Gin Tonic trinken, während die Massen im Maschinenraum schuften.
Freiheit ist ein großes Wort. Das ist okay, denn es geht um viel. Zum Beispiel darum, allen Menschen zuzugestehen, dass sie Subjekte sind und Objekte sein können, wenn sie wollen. Das klingt abstrakt und wird am Ende doch mit Grapefruits auf Penissen und Socken in BHs zu tun haben.
Es geht um Freiheit, und trotzdem möchte dieses Buch niemanden befreien. Aus zwei Gründen: Erstens wollen einige Leute gar nicht befreit werden, und zweitens müssen alle, die frei sein möchten, sich letztlich selbst befreien. Natürlich gibt es Frauen, die gern unterwürfig sind und traditionelle Rollen mögen, und es gibt Männer, die sich wirklich, wirklich überhaupt nicht anders denken lassen denn als im Stehen pinkelnde Grillexperten. Aber: Alles ist schöner, wenn es freiwillig ist und bewusst selbst gewählt, und dazu muss man die Alternativen zumindest kennen.
Aber warum überhaupt «befreien»: Wovon denn?
Eine Frau zu sein oder ein Mann zu sein bedeutet Arbeit. Jemand zu sein, der dazwischen oder jenseits davon liegt oder von einem zum anderen wechselt, bedeutet noch mehr Arbeit. Wir stecken viel Energie in die Rollen, die wir spielen, weil wir glauben, dass alles eine Ordnung haben muss und so viel anders auch gar nicht geht. Wir geben uns Mühe, die wir oft kaum bemerken, weil sie so alltäglich geworden ist. Und auch, weil es leichter ist, sich an vorhandene Muster zu halten.
Vorgegebene Rollen vereinfachen vieles. Aber sie beschränken eben auch. Wie Leitplanken. Es ist leichter, auf der Autobahn zu bleiben, wenn links und rechts stählerne Schutzplanken stehen und dahinter sowieso nur Gras wächst. Was soll man im Gras? Man kommt da schlechter voran. Aber vielleicht wäre es schön dort. Vor allem, wenn wir lebendig ankommen und nicht durch die Leitplanke durchmüssen. Und nein, keine Angst, der Feminismus wird niemandem die Autobahnen wegnehmen.
Wir sind – und das ist eine weitere These dieses Buches – scheinbar von unglaublich viel Sex umgeben, von Nacktheit und Brüsten und Pornos und Plakaten mit Sexspielzeug: Aber das ist kein Sex. Es ist ein diffuses Versprechen einer Möglichkeit, die mit tatsächlichem Sex nur sehr wenig gemeinsam hat. Dem steht eine immer noch große Unsicherheit gegenüber, mit der siebzehnjährige Jungs in Internetforen schreiben: «Beim ersten Mal habe ich die Befürchtung nicht das richtige Loch zu finden. Wie kann ich das am besten erkennen, wohin mit dem Penis?»
Ja, wohin mit dem Penis? Diese Frage werde ich nicht beantworten, aber vielleicht ein paar andere.
Dieses Buch ist kein Manifest, weil es einen ganzen Haufen Fragen und Meinungen enthält, die als Anfang, aber nicht als Ende einer Diskussion dienen können. Es ist keine Autobiographie, weil ich mich nicht ausziehen will, oder eher: weil ich mich zwar gern ausziehe, aber darüber brauche ich kein Buch zu schreiben. Aus diesem Buch wird man nicht erfahren, ob oder wie ich als Feministin im 21. Jahrhundert Teile meines Körpers enthaare; man wird nur erfahren, dass mir egal ist, wer es bei sich tut. Wir müssen über Schönheitsnormen reden, weil sie uns einengen. Wir dürfen uns aber nicht so weit von ihnen ablenken lassen, dass wir aus den Augen verlieren, worum es im Feminismus eigentlich geht: um Macht und Autonomie.
Man wird aus diesem Buch auch nicht erfahren, ob ich mich beim Sex lieber im Bett oder auf dem Küchentisch befinde, aber man wird erfahren, dass ich weder das eine noch das andere für emanzipiert oder langweilig halte, sondern denke, dass die Qualität des Liebemachens auch davon abhängt, wer den Küchentisch am nächsten Morgen decken wird und wer die Bettwäsche wechselt.
Ich werde also eine Geschichte erzählen. Dabei werde ich mein eigenes Versuchskaninchen sein. Denn ich glaube, dass Sex und Macht so grundlegende Themen sind, dass wir viel über sie erfahren können, wenn wir unser eigenes Leben betrachten.
Ich werde Dinge erlebt haben, und ich werde mir Dinge ausgedacht haben, und es ist schwer zu sagen, was davon persönlicher ist. Alle Geschichten in diesem Buch sind passiert, aber Umstände, Namen und persönliche Informationen sind geändert, um die Anonymität und Würde von Beteiligten zu wahren.
Marcel Proust hat geschrieben:
«Toren bilden sich ein, die großen Dimensionen sozialer Erscheinungen seien eine ausgezeichnete Gelegenheit, tiefer in die menschliche Seele einzudringen; sie sollten einsehen, dass sie vielmehr durch Eindringen in eine Individualität die Möglichkeit bekommen, solche Erscheinungen zu verstehen.»[2]
Genau das werden wir tun: in die Individualität eindringen und gucken, was wir da finden. Und dann damit wieder hochsehen, in die «großen Dimensionen sozialer Erscheinungen».
Es wird um Sex gehen und um Macht, aber auch um Angst, Scham und Gewohnheit, um Spaß und Tabus. Und natürlich auch um Liebe. Und um Arbeit und Arbeit aus Liebe.
Die einzelnen Kapitel in diesem Buch sind in sich geschlossene Essays, man sollte sie einzeln lesen können, aber hintereinandergereiht ergeben sie eine Geschichte.
Das erste Kapitel zeigt, wie sich schon in unserer Kindheit Muster einschleichen können, die uns einschränken und die wir wieder loswerden müssen, sobald wir eingesehen haben, dass das Leben kein Disneyfilm ist.
Das zweite Kapitel handelt von Schönheit und von Arbeit am Körper und auch vom Rubbeln daran.
Im dritten Kapitel geht es um Sex und das Wissen davon, was guter Sex wäre, und um Zeitschriften, die uns der Sache nicht näher bringen.
Was es mit der sexuellen Revolution auf sich hat, ist die Frage des vierten Kapitels. Sind wir so frei und locker, wie wir denken?[*]
Im fünften Kapitel wird gefragt, ob feministische Weltherrschaft eine Option ist, und die Antwort ist: natürlich nicht, weil Weltherrschaft generell keine Option ist. Es geht um Gender Studies und fair bezahlte Arbeit und die Verbindung von Feminismus und Anarchismus mit einem gemeinsamen Ziel: Abschaffung von Herrschaft.
Das sechste Kapitel empfiehlt, eine eigene Poesie des «Fuck you» zu entwickeln, um sich seltener verarschen zu lassen; sei es bei Mythen über Sex oder bei der Frage nach «korrekter» Sprache.
Im letzten Kapitel geht es um die Liebe und was die eigentlich mit alldem zu tun hat: viel. Denn letztlich machen wir in politischen Bewegungen dasselbe wie in Beziehungen und beim Kinderkriegen: Wir schließen uns zusammen und werden dadurch mehr.
Wir müssten das alles nicht «Feminismus» nennen. Wir könnten auch sagen, es geht eben irgendwie um Sex und Macht und das ganze Drumherum. «Jenseits von Grabenkämpfen», wie es so schön heißt. Und es müsste gar nicht schlecht sein, das Wort «Feminismus» da rauszulassen. Als Simone de Beauvoir Das andere Geschlecht schrieb, hat sie sich auch noch nicht «Feministin» genannt. («In der Debatte über den Feminismus ist genug Tinte geflossen», so stand es auf der ersten Seite, 1949 – tja nun.) Man kann Frauen – und dem Feminismus – unglaubliche Dienste erweisen, ohne sich Feministin zu nennen. Man kann ihnen auch sehr schaden, obwohl man sich so nennt. Es ist kompliziert.
Der Begriff «Feminismus» schreckt heute immer noch viele Leute ab. Sie denken an hysterische Hexen, die alle Männer kastrieren wollen, oder lieber gleich töten, um dann anschließend hämisch lachend ums Lagerfeuer zu tanzen und BH für BH hineinzuwerfen. Oder sie denken an gestörte Ziegen, die von ihren Vätern, Brüdern oder Lovern verletzt und versetzt wurden und sich jetzt an ihnen rächen wollen, indem sie eine hinterhältige Ideologie verbreiten, in der Frauen die besseren Menschen sind, kein Mädchen mehr mit Barbies spielen darf und Nagellack verboten ist. Oder an gierige, faule Gören, die Fördergelder und Vorstandsposten kriegen wollen, obwohl sie ihr Sozialpädagogikstudium abgebrochen haben, weil sie lieber Plüschmuschis stricken wollten, und jetzt nicht wissen, von was sie die Miete zahlen sollen.
Wenn Sie von diesem Buch nur das Vorwort lesen und es danach weglegen, nehmen Sie wenigstens das mit: Alle diese Vorstellungen sind falsch. Ich schwöre bei all den Vorstandsposten, die ich nie haben wollte, und meinen BHs, die ich nicht missen möchte.
Trotzdem lege ich persönlich wenig Wert darauf, dass irgendjemand sich zum Wort Feminismus bekennt. Am Ende geht es darum, wie wir handeln und miteinander umgehen, und nicht darum, welches Etikett wir uns geben. Es mag sein, dass Leute mit anderen, die sich als feministisch bezeichnen, unangenehme Dinge erlebt haben. Nicht alles, was im Namen des Feminismus geschieht, ist gut: Es gibt Frauen, die sich Feministinnen nennen und im selben Atemzug muslimischen Frauen die Fähigkeit absprechen, für sich selbst zu entscheiden. Eine politische Einstellung, die andere Menschen bevormundet, ausgrenzt oder beleidigt, hat mit dem, was ich unter Feminismus verstehe, nichts zu tun – dasselbe gilt für die Frage, ob Frauen sich so kleiden dürfen, dass sie Männern gefallen. Natürlich dürfen sie das, denn so ziemlich alle Sätze, die mit «Im Feminismus dürfen Frauen nicht …» anfangen, sind falsch.
Für mich bedeutet Feminismus, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität und ihrem Körper dieselben Rechte und Freiheiten haben sollen. Natürlich ist das keine Frage, die man nur anhand von Kriterien wie Weiblichkeit, Männlichkeit, Hetero-, Homo- oder Bisexualität diskutieren kann. Einschränkungen von Rechten und Freiheiten haben und hatten immer schon auch mit Herkunft zu tun: im ethnischen Sinne wie auch als Klassenfrage. Eine verheiratete deutsche Managerin, die einen Vorstandsposten in einem DAX-Unternehmen will, hat andere Probleme als eine türkische Bäckerin, die nebenbei putzen gehen muss.
Deswegen ist Feminismus kein Projekt, das man unabhängig von anderen Entwicklungen für sich genommen durchziehen kann: Rassismus, Klassenunterdrückung, alles gehört zusammen – und zusammen weg.
Ein Teil dieses Buches handelt davon, dass ich es mir nicht besonders leichtgemacht habe damit, mich als Feministin zu bezeichnen. In den allermeisten Fällen gruselt es mich, mich einer Gruppe anzuschließen, und wenn ich eine ideale Gesellschaft zeichnen müsste, wäre das vor allem eine, in der ich meine Ruhe habe. Bis ich Anfang zwanzig war, waren mir fast alle Menschen, die sich politisch für etwas engagierten, das nichts mit Tieren oder Kindern zu tun hatte, ziemlich suspekt, weil ich dachte: Man weiß ja gar nicht, mit wem man sich da gemein macht, Menschen können so scheiße sein. Einzige Ausnahme waren die, die gegen Nazis kämpften, bei denen schien mir der Fall klar. Alles andere fand ich vor allem: kompliziert. Ich dachte, ich müsste Tonnen von Informationen haben, bevor ich mich auf irgendeine Seite stelle, und das schreckte mich ab.
Heute gibt es für mich gute Gründe, beim Wort «Feminismus» zu bleiben, hier seien nur drei genannt:
Erstens: Labelfindung ist ein anstrengendes und mit Pech ein endloses Unterfangen. Was am Ende rauskommen soll, muss kurz und prägnant sein, eindeutig und leicht zu merken. «Bewegung für Freiheit und Selbstbestimmung bezüglich aller Fragen, die im Zusammenhang mit Geschlecht, Körper und sexueller Orientierung stehen» würde es besser treffen, ist aber zu lang. Leider. Und egal, wie lange man sucht, man wird es nie allen recht machen mit dem richtigen Label. Wenn «-ismus» am Ende steht, wird immer jemand kommen, der sagt, «Jeder Ismus ist eine Ideologie!», und dann können wir über Journalismus, Organismus, Syllogismus und Zynismus reden, aber dann schweifen wir ab.
Zweitens: Warum sollte man sich von all denen abgrenzen, die unsere Kämpfe begonnen haben und die dafür gesorgt haben, dass wir heute wählen können, Geld verdienen und ein Bankkonto eröffnen? Sie haben unglaublich viel erreicht, und es ist nicht irgendwie blöd und unangenehm, sich mit ihnen in eine Reihe zu stellen, sondern eine Ehre und eine Würdigung ihrer Mühen.
Und drittens: Labelfindung lenkt ab. Wir haben Besseres zu tun. Feminismus ist nichts, was durch eine bessere PR ein attraktiveres Produkt wird und dann von allen einfach lässig nebenbei geschluckt wird. Es ist ein Kampf um fundamentale Gerechtigkeit. Es ist ein Kampf, der weh tun wird, weil wir einsehen müssen, an wie viel Scheiße wir uns gewöhnt haben. Wie viel Gewohnheiten wir ändern müssen, wenn wir alte Rollen zurücklassen. Es ist damit letztlich auch ein Experiment, von dem wir gar nicht genau wissen, was es am Ende mit uns machen wird. Weil wir mehr können werden. Mehr dürfen. Und mehr wollen.
Manchmal müssen wir uns daran erinnern, was wir einmal wollten und was wir verlernt haben zu wollen.
Meine Familie erzählt oft die Geschichte, als ich vier war und meine Großmutter sagte, ich soll eine Strumpfhose anziehen, damit mir nicht kalt wird. Ich wollte nicht. Ich wollte ein Kleid tragen ohne Strumpfhose drunter, ich fand es warm genug, also sagte ich «Nein, Oma» und dann einen Satz, der auf Polnisch lautet: Każdy sobą rządzi. Auf Deutsch: «Jeder bestimmt über sich selbst» oder: «Jeder regiert sich selbst», denn «rządzić» heißt auch, in politscher Hinsicht das Sagen zu haben. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte mich seit damals politisch nicht mehr so sehr entwickelt – denn genau das ist heute wieder meine Haltung. Zwischendurch hatte ich sie leider vergessen.
Um Selbstbestimmung wird es viel gehen. Denn Feminismus ist keine Bewegung, die alte Zwänge durch neue Zwänge ersetzen will oder alte Tabus durch neue. Es ist ein Kampf gegen Zwänge und für mehr freie, eigene Entscheidungen. Und zwar nicht die Entscheidung «vor oder zurück», sondern die Entscheidung: Was für ein Mensch willst du sein? Das klingt nach viel, und ja, verdammt, es ist viel.
Well, I try my best
To be just like I am
But everybody wants you
To be just like them
BOB DYLAN
Kapitel einsNicht als Prinzessin geboren
Am Anfang ist alles ein Spiel.
Ich bin vier, und das neue Fahrrad ist der Knaller. Ich liebe es. Es ist rosa-weiß und hat pinke Stützräder. Gehabt. Die ersten Male durfte ich noch mit ihnen fahren, immer hinter meinem Bruder her, das ging ganz leicht. Dann nimmt mein Vater die Stützräder an einem zunächst schönen Samstagvormittag ab und sagt: Das kannst du jetzt auch so. Also los auf den Spielplatz, auf dem abends die coolen Kinder mit ihren BMX-Rädern wilde Sachen machen. Los und rollen, fahren, nein, nicht mit den Füßen abstützen, fahren, fahren, fahren … Vater schiebt ein Stück, lässt los. Oooh, es geht gut, hui, guck, wie gut es geht, und – voll auf die Fresse.
Hingefallen.
Bei diesem Sturz passieren zwei Dinge. Erstens: Ich falle so blöd, wie es nur irgendwie möglich ist, mit den Händen in Glasscherben. Scheiße genug. Es ist Berlin-Neukölln und 1990; Flaschen auf dem Boden gehören zum Ambiente. Eine Scherbe bohrt sich in meine rechte Hand, die Stelle am Handballen sieht noch Wochen später aus wie ein Stück Schinken, nackt und rosa. Zweitens: Der Lenker rammt sich mir zwischen die Beine. Aua. Die erste Sache ist auffällig und blutet, die zweite Sache ist unauffällig, und ich sage kein einziges Wort. Wie denn auch? Wie soll ich sagen, dass ich mir an meiner … Dings weh getan habe? Dings. Wie heißt das? Mumu. Muschi. Unten. Untenrum. Aua. Soll man nicht drüber reden. Aua! Dann bin ich halt jetzt kaputt, denke ich. Besser als was sagen zu müssen. Was sagen wär peinlich.
Warum eigentlich «untenrum»? Unten sind die Füße, Mann! Das weiß ich – eigentlich.
Zu Hause verarztet meine Mutter mir die blutende Hand, und zum Trost kriege ich eine Capri-Sonne. Es tut auch bald kaum noch weh.
Warum habe ich nichts gesagt? Und warum schäme ich mich?
Gute Frage. Lange Antwort.
Das Wort «Scham» kann verschiedene Bedeutungen haben. Einerseits steht es für ein Gefühl von Verlegenheit oder Blöße: etwas Unangenehmes. Und andererseits steht es «in der gehobenen Umgangssprache [für] die äußeren Geschlechtsorgane des Menschen, insbesondere beim weiblichen Geschlecht die Vulva» – so ist es in der Wikipedia formuliert. Wir sprechen von Schamlippen und Schamhaaren, als würde sich dahinter etwas Verbotenes verbergen. Aber ist das so? Ist «die Scham» etwas, wofür sich irgendwer schämen müsste? Und müssten sich Jungs dann nicht eigentlich mehr schämen als Mädchen, weil bei den Jungs alles raushängt und bei den Mädchen alles halbwegs ordentlich drinnen liegt?
Simone de Beauvoir verwendet in ihrem Buch Das andere Geschlecht nicht wenige Seiten darauf, zu erklären, was unsere Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit damit zu tun haben, dass Jungs häufig mit ihren Pimmeln spielen und Mädchen selten mit ihrer Vagina, weil sie innen liegt. Sie beschreibt das Gefühl, das daraus erwächst, dass Mädchen ihre Geschlechtsteile nicht auf die Art «in die Hand nehmen können» wie Jungs. Es ist nicht unbedingt Neid, wie Sigmund Freud behauptet, aber doch die Feststellung, dass so ein kleines, baumelndes Ding interessant sein kann: Mit einem Penis kann man seinen eigenen Namen in den Schnee pinkeln. Also, sobald man schreiben kann. Aber dann. Und das ist sehr viel.
Wenn Beauvoir über den Penis schreibt, dann klingt das bisweilen belustigend philosophisch: «Später», schreibt sie, «wird der Knabe seine Transzendenz und seine hochmütige Unübertrefflichkeit in dem Geschlechtsorgan verkörpern.»[1] Man könnte sagen: Ähm, ja. Bisschen übertrieben, Transzendenz und Penis, was soll das? Aber tatsächlich war sich selbst Georg Wilhelm Friedrich Hegel, einer der einflussreichsten deutschen Philosophen, nicht zu fein, in seinem Hauptwerk auch übers Pullern zu schreiben. Ein Meilenstein des Idealismus. In der Phänomenologie des Geistes von 1807 schreibt Hegel im Abschnitt über die beobachtende Vernunft:
«Das Tiefe, das der Geist von innen heraus, aber nur bis in sein vorstellendes Bewusstsein treibt und es in diesem stehen lässt, – und die Unwissenheit dieses Bewusstseins, was das ist, was es sagt, ist dieselbe Verknüpfung des Hohen und Niedrigen, welche an dem Lebendigen die Natur in der Verknüpfung des Organs seiner höchsten Vollendung, des Organs der Zeugung, – und des Organs des Pissens naiv ausdrückt. – Das unendliche Urteil als unendliches wäre die Vollendung des sich selbst erfassenden Lebens, das in der Vorstellung bleibende Bewusstsein desselben aber verhält sich als Pissen.»[2]
Sie müssen das nicht noch mal lesen. Hegel vergleicht den Geist und alles, was der Geist so kann, mit dem Penis und allem, was der Penis so kann. Natürlich meint Hegel mit Vollendung nur das männliche Geschlechtsorgan und nicht das weibliche – wie sollte er auch anders, wo er an anderer Stelle erklärt, der «Unterschied zwischen Mann und Frau ist der des Tieres und der Pflanze»[3].
Es muss einiges passiert sein, bis ein großer Philosoph an sich herunterguckt und «höchste Vollendung» sieht.
Ja, es muss einiges passiert sein – und doch ist Hegel nicht so besonders damit. Manchmal denke ich, wenn alle Männer, die stolz auf ihre Penisse sind, einander Huckepack nehmen würden, einer über den anderen, dann würden sie bis zum Mars reichen und wahrscheinlich würden sie selbst dort ein kleines grünes Männchen finden, das unglaublich froh über sein kleines grünes Pimmelchen wäre. «Quatsch», sagt dann mein Freund Todd, «Männer sind so unsicher, was ihren Schwanz betrifft! Zu klein, zu groß, zu schief …» – Gut, sage ich. Allerdings lässt mich die schiere Menge an «Dick Pics», also Fotos von Penissen, die in Chats versandt werden, daran glauben, dass die Reihe zum Mars sich problemlos vollkriegen ließe, selbst wenn eine große Anzahl Jungs und Männer dabei auf der Erde bleiben würde. Warum denken Männer, sie könnten mit einem Bild ihres Gemächts eine Konversation starten, wenn nicht aus dem Gefühl heraus, dass es ein geiles Gemächt ist?
Und ist das schlecht? Sind Feministinnen nicht immer dafür, den eigenen Körper zu akzeptieren und zu lieben und für Selbstbewusstsein und all das? Ja, sind sie. Und es ist auch gar nicht schlecht, wenn Männer ihre Penisse toll finden. Alle Menschen sollten alle ihre Körperteile toll finden können, egal ob hinterm Ohr oder zwischen den Beinen. Es kann sogar sehr lustig sein. Es gibt ein Blog, das heißt «Things My Dick Does», in dem ein Penis aus San Francisco der Protagonist ist. Er betrinkt sich, versucht sich im Gewichtheben, wird geküsst und schläft selig.[4] Ein süßes Kerlchen.
Aber.
Es gibt ein kleines Ungleichgewicht. Die Penispräsenz ist sehr stark im Vergleich zur Vulvapräsenz: Wie weit muss man gehen, um die Geschlechtsorgane einer Frau zu sehen? Wie weit für die eines Mannes? In echt oder künstlich? Wenn Sie Glück haben, nur bis zum nächsten Park. Dann steht da ein Springbrunnen, wo irgendein kleiner dicker Engel Wasser strullt. Wenn Sie Pech haben, steht da ein Exhibitionist. Oder Sie gehen ins Einkaufszentrum: Da gibt es Pimmellutscher bei Nanu Nana, diesem Laden für billige Geschenke. Sie stehen neben den «Oscars» aus Plastik, wo «Bester Opa» draufsteht. Bei Amazon kann man eine Wärmflasche bestellen, die «Erotische Wärmflasche mit Pimmel» heißt. Das Pendant dazu – «Wird oft zusammen gekauft» – ist die «erotische Wärmflasche mit hübschen Brüsten». So seltsam es ist, sich eine Wärmflasche mit Plüschpimmel zu kaufen, so wenig sind Brüste das Pendant zum Penis.
Der Penis ist präsent. Die Vulva nicht. Stattdessen wird sie Vagina genannt, und viele wissen gar nicht, dass die Vagina nur innen ist, also das Loch – oder wie Wikipedia sagt: der Schlauch – und das ganze Ding drumrum Vulva heißt, also Venushügel, Schamlippen, Klitoris. Musste ich auch erst lernen. Klingt manchmal immer noch komisch für meine Ohren. Irgendwo zwischen Volvo und Pulpo.
Wenn man eine Frau beleidigen will, kann man sie «Fotze» nennen. Man beschimpft sie mit ihrem Geschlechtsorgan, so als wäre das etwas Schlechtes. Bei Männern funktioniert das nicht, zumindest nicht auf Deutsch. «Du Pimmel» – das sagt man nicht. Man kann einen Mann einen Schwanzlutscher, einen Wichser oder einen Schlappschwanz nennen, aber dann geht es eher um Dinge, die man mit einem Penis tun kann oder eben nicht, aber nicht um den Penis selbst. Der Penis scheint nicht nur präsenter, sondern auch positiver «besetzt» zu sein als die Vulva.[*]
So weit, so nicht so schön. Aber was heißt das? Was hat das mit der Geschichte von mir als Vierjähriger zu tun? Soll eine solche Anekdote als Ursprung oder das Symptom von irgendwas herhalten? Warum erinnere ich mich überhaupt daran? Und wieso schweife ich dann so weit ab, bis es um Wärmflaschen geht, die sowieso niemand kauft, außer vielleicht als Witz?
Wenn wir über Macht und Freiheit sprechen wollen, müssen wir erstens früh und zweitens im Kleinen anfangen. Früh heißt, wir müssen uns ansehen, ab wann das losgeht, dass wir uns Handlungen oder Worte entweder selbst verbieten oder sie uns von außen verwehrt werden. Und im Kleinen heißt, es kann nicht nur darum gehen, wer sich traut, Bundeskanzlerin zu werden. Auch die scheinbaren Nebensächlichkeiten zählen: Wo entscheiden wir uns, uns zu beschränken? Wo werden wir beschränkt? Wo könnten wir freier sein, als wir es heute sind? Denn Macht ist etwas, das im Kleinen und im Großen wirken kann. Wie Ibuprofen.
Macht regelt, welche Jobs wir annehmen, aber auch, welche Unterhosen wir tragen. Und überhaupt, Unterhosen: Wenn wir davon ausgehen, dass Geschlecht und Macht zusammenhängen, dann müssen wir auch über die Dinge reden, die uns banal oder peinlich vorkommen. Wir müssen verstehen, wo und warum uns als Frau oder als Mann nur bestimmte Möglichkeiten gegeben sind und andere nicht. Dabei wird es um die kleinen, nervigen Dinge gehen, aber auch um Leben und Tod.
Was heißt es denn, als Frau zu leben?
In dem bereits erwähnten Buch Das andere Geschlecht von Beauvoir steht ein Satz, den heute so ziemlich alle kennen. Der Satz fängt an mit: «Man wird nicht als Frau geboren, …» – und wie weiter? «… man wird es.» Das berühmteste Zitat aus Beauvoirs Buch ist ein Satz, der komisch klingt. «Man wird es», was soll das heißen? Und weil der Satz so merkwürdig klingt, wird er gern anders beendet: «… man wird dazu gemacht.» Im französischen Original geht der Satz so: «On ne naît pas femme: on le devient.» Das Verb devenir (werden) wird in der falschen Übersetzung von einem aktiven «werden» zu einem passiven «gemacht werden». Ein ziemlicher Unterschied.
Diese zwei Übersetzungen stehen für zwei grundverschiedene Sichtweisen davon, was es heißt, eine Frau zu werden. Wenn man sagt, man wird zur Frau gemacht, dann suggeriert das Passivität: die Frau als Opfer einer Gesamtsituation. Als würde jegliches Übel, das Mädchen und Frauen geschieht, von außen kommen, und als wäre alles besser, wenn die armen Dinger sich nur irgendwie wehren könnten. Und vor allem: als wären sie an nichts selbst schuld. Es ist dann eine Anklage an die Welt. Wenn man aber sagt, man wird zur Frau, dann ist das eine Entwicklung, an der man aktiv mitwirkt. Nicht ohne Grund stellt Beauvoir dem zweiten Band ihres Buches ein Zitat von Jean-Paul Sartre voran: «Halb Opfer, halb Mitschuldige, wie wir alle.» Wenn Beauvoir die Frau dann als unterdrückt beschreibt, ist diese Unterdrückung eine Ambivalenz, die nicht nur eine Befreiung vom Unterdrücker erfordert, sondern auch eine Trennung von der eigenen, erlernten Passivität und Fügsamkeit.
Die Geschichte des Frauwerdens ist komplex – und die des Mannwerdens natürlich auch, so wie überhaupt alle Geschichten vom Heranwachsen und Sich-in-der-Welt-Zurechtfinden, sonst würde es nicht so viele Coming-of-Age-Romane und -Filme geben. Und so merkwürdig die Formulierung «ich als Frau» immer wirkt, kann doch ich als Frau nur meine eigene Geschichte aus nächster Nähe erzählen.
Wenn Susan Sontag schreibt: «Wir müssen lernen, mehr zu sehen, mehr zu hören und mehr zu fühlen» – dann bezieht sie das auf die Interpretation von Kunst.[5] Ich glaube aber, es gilt auch für den ganzen Rest: Wenn wir lernen wollen, wie Gesellschaft funktioniert und wie wir in ihr zu denen werden, die wir sind, können wir das auf viele Arten tun. Wir können andere Gesellschaften an anderen Orten und zu anderen Zeiten mit unserer vergleichen, wir können Umfragen machen oder Studien – oder wir können versuchen, uns selbst zu fragen, unsere Erinnerungen und Erfahrungen zu durchforsten und auf diese Weise zu verstehen, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen, und nicht anders. Dazu müssen wir, wie Sontag schreibt, «unsere Sinne wiedererlangen», und das ist nicht esoterisch gemeint, sondern soll heißen, dass wir all das wahrnehmen müssen, was uns zwischendurch so selbstverständlich geworden ist. Dass es uns selbstverständlich geworden ist, hat gute Gründe, denn man will nicht den ganzen Tag staunend durch die Welt laufen, man will auch in ihr klarkommen. Wenn wir es aber schaffen, die alltäglichen Dinge, die uns so glatt und logisch erscheinen, ein Stück weit aufzubrechen, dann kann uns das helfen, unseren eigenen Standpunkt deutlicher zu sehen: Wo stehen wir? Und: Wollen wir da stehen?
Das klingt sehr abstrakt. Wir wollten nicht nur über Macht reden, sondern auch über Sex, Geschlechterrollen und all das. Wo sollen wir da anfangen, wenn nicht in der Kindheit? Beim 18. Geburtstag? Zu spät.
Also weiter.
In der Vorschule bin ich beim «Vater-Mutter-Kind»-Spielen ziemlich oft der Hund. Weil ich noch nicht besonders gut deutsch kann und überhaupt auch nicht gern rede. Verstehen kann ich ganz okay, reden geht so. Also bin ich der Hund, gelegentlich das Pony.
Ich bin neu in der Gruppe, und die eine Erzieherin, die mich noch nicht kennt, steht mit einer anderen Erzieherin am Fenster und nickt in meine Richtung. «Junge oder Mädchen?», fragt sie die andere. «Mädchen», sagt die, «Margarete, aus Polen.»
Zack. Junge oder Mädchen. Ich habe das gehört, verdammt.
Ich trage die Klamotten von meinem Bruder, weil das praktisch ist, und einen Topfhaarschnitt, weil meine Mutter will, dass ich aussehe wie Mireille Mathieu, die Sängerin. Das klappt so mittelmäßig. Ich sehe offenbar eher aus wie ein Beatle mit Bärchenpulli.
«Junge oder Mädchen» – hallo? Mädchen!
Am Wochenende darauf fährt meine Familie in den Britzer Garten. Der Britzer Garten ist wie Disneyland ohne Disney. Da war mal Bundesgartenschau, 1985, und jetzt ist da, na ja, Landschaft. Mit Wegen und Spielplätzen.