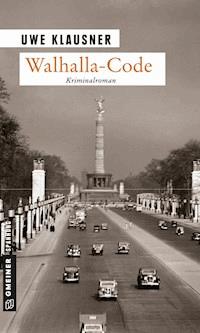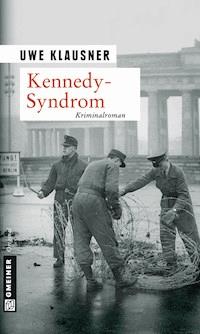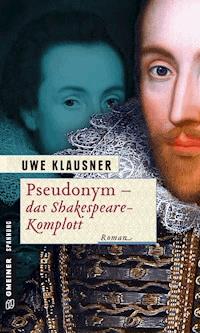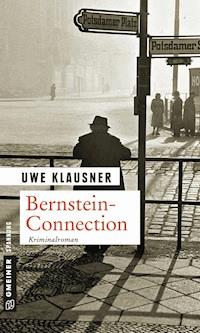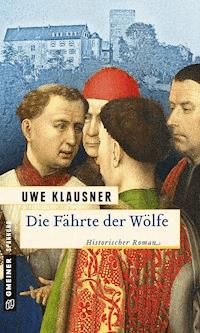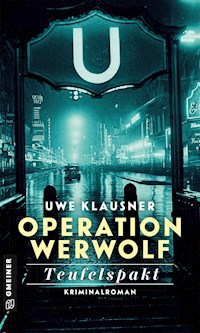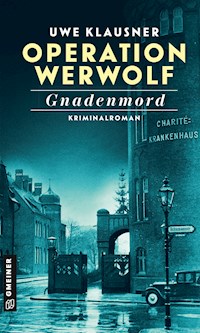Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Luzia Magdalena Riemenschneider
- Sprache: Deutsch
Würzburg, 1525. Luzia, Tochter des Bildschnitzers Tilman Riemenschneider, ist am Boden zerstört: Der Straßenmaler Wenzel ist verschollen. Als sie wenig später erfährt, dass er sich den aufrührerischen Bauern angeschlossen hat, gerät Luzia zwischen die Fronten: Hier ihr Vater, der renommierte und pazifistische Künstler, dort der Mann, zu dem sie sich hingezogen fühlt, dessen Fanatismus im Dienste der »Schwarzen Schar« sie jedoch abschreckt. Luzia steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Klausner
Die Madonna von Würzburg
Historischer Roman
Zum Buch
Zwischen Kunst und Krieg Luzia, Tochter des Bildschnitzers Tilman Riemenschneider, ist am Boden zerstört: Der Straßenmaler Wenzel, zu dem sie sich hingezogen fühlt, ist verschollen. Lange nachforschen muss sie indes nicht, stellt sich doch heraus, dass sich Wenzel den aufrührerischen Bauern angeschlossen hat. Von Grund auf verändert, hat er sich zu einem fanatischen Umstürzler entwickelt, wild entschlossen, sich am Bischof zu rächen. Von Wenzels Gesinnungswandel abgeschreckt, gerät Luzia zwischen die Fronten: Hier ihr Vater, der renommierte Bildschnitzer, von den Würzburgern ehrfurchtsvoll Meister Til genannt, entschlossen, der Gewalt einen Riegel vorzuschieben. Dort der Mann, der Gefühle in ihr weckt, Mitglied der berüchtigten »Schwarzen Schar«, die dafür bekannt ist, kein Pardon zu kennen. Inmitten des Aufruhrs muss Luzia entscheiden, auf welcher Seite sie stehen möchte.
Uwe Klausner ist in Heidelberg geboren und aufgewachsen. Sein Studium der Geschichte und Anglistik absolvierte er in Mannheim und Heidelberg, die damit verbundenen Auslandsaufenthalte an der University of Kent in Canterbury und an der University of Minnesota in Minneapolis/USA. Heute lebt Uwe Klausner mit seiner Familie in Bad Mergentheim. Neben seiner Tätigkeit als Autor hat er bereits mehrere Theaterstücke verfasst, darunter »Figaro – oder die Revolution frisst ihre Kinder«, »Prophet der letzten Tage«, »Mensch, Martin!« und erst jüngst »Anonymus«, einen Zweiakter über die Autorenschaft der Shakespeare-Dramen, der am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda uraufgeführt wurde.
Impressum
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_-_Portrait_of_Katharina_Frey_or_F%C3%BCrleger,_41_00039956.jpg und Elekes Andorhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hagyom%C3%A1nyos_vad%C3%A1szat_(29).jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riemenschneider_Madonna_Tauberbischofsheim.jpg
ISBN 978-3-7349-3394-3
Widmung
FÜR MEINE VIERERBANDE
ZWEITER TEIL TOTENTANZ
DRAMATIS PERSONAE IN TEIL I UND II (real)
Hans Bermeter († 1527 in Nürnberg), Spielmann und Agitator
Florian Geyer (*circa 1490 in Giebelstadt bei Würzburg, erschlagen am 10.6.1525 im Gramschatzer Wald), Reichsritter und Bauernführer
Götz von Berlichingen (*1480 in Jagsthausen, † am 23.7.1562 auf Burg Hornberg am Neckar), Reichsritter
Jörg Riemenschneider (*1500 - circa 1550), Bildschnitzer und Nachfolger seines Vaters
Konrad von Thüngen (*circa 1466), Fürstbischof und Herzog von Franken (1590 - 1540)
Lorenz Fries (circa 1489 - 1550), fürstbischöflicher Sekretär, Rat und Archivar
Margaretha, vierte Ehefrau von Tilman Riemenschneider, Heirat um 1520
Tilman Riemenschneider (circa 1460 - 1531), Bildschnitzer, Bildhauer und Ratsherr
DRAMATIS PERSONAE IN TEIL I UND II (fiktiv)
Äolus, Pförtner im Benediktinerkloster
Agnes Melsungen, Patriziertochter
Alexius, ehemaliger Landsknecht
Bartholomäus Häfner, Sohn des Weinhändlers
Bertradis, Luzias Amme
Clemens Fassbinder, Stadtrat
Pater Damian, Prior des Franziskanerklosters
Fidibus, Müllkärrner
Georg II., Graf von Wertheim
Helmar, Scharfrichter
Imelda, Hübschlerin
Lutz Plattner, Hauptmann der Stadtwache
Luzia Magdalena, Tochter des Bildschnitzers
Melchior, Tagelöhner
Melusine, Wahrsagerin, Heilerin und weise Frau
Raban von Stahleck, Domprobst und Geheimsekretär des Bischofs
Bruder Salvian, Infirmarius
Theophilus Häfner, Weinhändler und reichster Mann der Stadt
Tigran, Melusines Beschützer
Wenzel Lautenschläger, Straßenmaler
Wieland, Kriegsknecht
WÜRZBURG IM MITTELALTER
Angaben
TAGESEINTEILUNG1 IM MONAT APRIL
01.
05.00 - 06.10
02.
06.10 - 07.20
03.
07.20 - 08.30
04.
08.30 - 09.40
05.
09.40 - 10.50
06.
10.50 - 12.00
07.
12.00 - 13.10
08.
13.10 - 14.20
09.
14.20 - 15.30
10.
15.30 - 16.40
11.
16.40 - 17.50
12.
17.50 - 19.00
STUNDE
UHR
SONNENAUF- UND UNTERGANG IN WÜRZBURG AM 26. APRIL:
6.08 Uhr/20.29 Uhr
LÖHNE UND PREISE2
Riemenschneiders Honorare
Adam und Eva
(Marktportal der Marienkapelle)
120 Gulden
(inklusive »Aufgeld«)
Grabmal für Fürstbischof Rudolf von Scherenberg (1466 -1495)
250 Gulden
Apostelfigur an der Marienkapelle (Stückpreis)
240 Gulden
Zum Vergleich:
Preis für ein repräsentatives Bürgerhaus:
800 Gulden
Löhne (pro Tag) und Preise
Tagelöhner
12 Pfennige
Gehilfe Riemenschneiders
18 - 24 Pfennige
Fränkischer Gulden
240 Pfennige
Zum Vergleich:
Jahresgehalt eines Stadtschreibers: 100 Gulden
Eine Kuh (Marktpreis)
2 - 3 Gulden
Ein Maß Wein (ca. 1,5 Liter)
24 Pfennige
10 Pfund getrocknete Erbsen
7 Pfennige
10 Eier
6 Pfennige
Ein Pfund Fleisch
3 - 4 Pfennige
1 (http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste//grotefend/g_s.htm#Stunden)
2 Siehe Hans Steidle / Christine Weisner, Würzburg. Streifzüge durch 13 Jahrhunderte Stadtgeschichte, Würzburg (Echter) 1999, S. 77ff.
TAGESABLAUF IM MITTELALTER3(Zisterzienser)
3 https://lvrlandesmuseumbonn.files.wordpress.com/2017/07/tagesablauf_web.jpg
WÜRZBURG, ANNO DOMINI 1525
DIES IRAE
1
»Auf die Knie, Hundsfott – und keinen Mucks!«, kannte der Scharfrichter des Bischofs keine Gnade, stieß ihn zu Boden und gab ihm einen brutalen Tritt. Die Stimme kam ihm vage bekannt vor, aber das war es dann auch schon. Die Folterknechte hatten ganze Arbeit geleistet, hatten sein Gedächtnis ausgelöscht. Einmal Ketzer, immer Ketzer, so lautete die eherne Regel. Wozu sich also groß Gedanken machen, wer sich hinter der vermaledeiten Maske verbarg, sterben würde er sowieso. »Du weißt doch, jeder bekommt, was er verdient!«
Kaum noch bei sich, stieß er einen dumpfen Schmerzenslaut aus. In seinem Blickfeld zuckten grelle Blitze auf, und ihm war, als platze ihm gleich der Schädel. Die Hand an der blutverschmierten Schläfe, rang er keuchend nach Luft, riss reflexartig den Arm hoch, um den nächsten Tritt abzuwehren.
Doch nichts geschah.
»Du sagst ja nichts, endlich schlauer geworden?«
Am Boden kauernd, senkte er entmutigt den Kopf. Wie die Schinder doch einander glichen. Bestien in Menschengestalt, zu jeder nur denkbaren Schandtat bereit. Wehe all jenen, die ihre Wege kreuzten. Niemand würde ihre Schreie hören, wenn die Knochenbrecher ihr blutiges Handwerk betrieben, niemand würde sich um sie kümmern, wenn sie ums Überleben kämpften, und keiner würde einen Finger rühren, wenn ein Habenichts aus dem Heer der Namenlosen zum Krüppel wurde.
Ein Verhör nach dem anderen, rund um die Uhr, und das über mehrere Tage hinweg. Kein Mensch hielt das lange aus. Und wenn doch, dann wurde ein Wrack aus ihm, kaum mehr fähig, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Hochnotpeinliche Vernehmung – von wegen. Die Wortwahl war der blanke Hohn. Die Art und Weise, wie man mit ihm umsprang, an Arglist nicht zu überbieten.
Anklage wegen Hochverrats, Ketzerei und Aufwiegelung gegen die gottgewollte Obrigkeit: einfach lächerlich, an Perfidie mitnichten zu überbieten. Zumal das Urteil über ihn längst gesprochen war. Es sei denn, er legte ein Geständnis ab. Dies vorausgesetzt, war er fein raus, ein menschliches Wrack zwar, aber noch am Leben.
Immerhin.
Nicht mit ihm. Das hatte er sich geschworen.
Gefragt, ob er gestehen wolle, hatte er den Inquisitor nur müde angelächelt. Das zum Thema Verstocktheit. Und so hatte die Prozedur ihren Lauf genommen, ein wahrer Höllenritt, der nur ein einziges absurd anmutendes Ziel verfolgte, nämlich den Willen des Beschuldigten zu brechen. Falls nötig, mit brachialer Gewalt. Zoll um Zoll, Stück für Stück, Zug um Zug. Auf dass er sich zu einer Tat bekenne, die er nicht begangen hatte.
Zur höheren Ehre Gottes.
So es ihn denn überhaupt gab.
Gleich zu Beginn war er nackt ausgezogen und im Anschluss wie ein Schaf geschoren worden, von Kopf bis Fuß, die schulterlange Haarpracht mit dazu. Ein Teufelsmal unter der Achsel oder sonst wo am Körper, und seine Schuld wäre zweifelsfrei erwiesen gewesen. Ein Grund mehr, ihn vom Angesicht der Erde zu tilgen.
In nomine Diaboli et Papae et Episcopi.
Amen.
Das Schlimmste sollte aber noch kommen. Der Dominikanermönch, in dessen Fänge er geriet, hatte dem Ruf des Ordens alle Ehre gemacht und ihn wie Abschaum behandelt, der es nicht wert war, dass er am Leben blieb. Dabei hatte er sich strikt an die Vorschriften gehalten, als da wären: Leugnete der Beschuldigte die Tat, führte an der Tortur kein Weg vorbei. Am Anfang standen die Daumenschrauben, eine Probe aufs Exempel, was sein Durchhaltevermögen betraf. Das Anlegen der Spanischen Stiefel, mit Nägeln gespickt, um die Gelenke zu brechen, bildete den nächsten Schritt. Gefolgt von Stufe drei der perfiden Marter, dem Ausrenken der Arme mittels Seilwinde und Gerüst, eine Prozedur, die nur die Wenigsten überstanden. Wobei der Schmerz, so der Bluthund des Herrn in geschäftsmäßigem Ton, unter Hinzufügen von Gewichten noch gesteigert werden könne.
Es sei denn, der Beschuldigte nehme Vernunft an.
Summum ius, summa iniuria.
An dem Diktum war in der Tat was dran.
Wieder halbwegs klar, reckte er den Kopf, um sich umzuschauen. Die Gaffer standen dicht an dicht, beäugten ihn wie ein Tier im Käfig. Hinter den Weinbergen im Osten lugte die Frühlingssonne hervor, nicht lange, und die Dunstschleier über dem Main würden in den Äther entschweben.
Und dann trat auch schon der Gehilfe des Scharfrichters in Aktion, nahm ihm die Fesseln ab, die er an den mit Foltermalen übersäten Händen trug, beugte sich vornüber und knurrte: »Komm mir bloß nicht auf die Idee, einen auf Märtyrer zu machen. Die Masche zieht bei den Leuten nicht mehr, schmink dir das ab. Wenn du denkst, die Hornochsen hätten Mitleid mit dir, dann bist du auf dem Holzweg. Die meisten wollen nur was zu gaffen haben, mit einem wie dir haben die nichts am Hut. Also halt gefälligst die Klappe, oder es gibt was auf die Schnauze!«
Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, schob ihm der Kahlkopf einen Eichenknüppel unters Kinn, riss ihn nach oben und spie aus. Dann deutete er mit seinem Wurstfinger auf den Richtplatz, der sich unweit des Mains auf einer Anhöhe erhob. Vom nahen Kloster drang das Geläut zum Morgen herüber, und als sei dies ein Zeichen für ihn, rappelte er sich unter Mühen auf.
Tretet näher, edle Damen und Herren, fromme Brüder und Leute aus nah und fern, holde Maiden und Matronen, Honoratioren und Huren, Doctores und Domherren, Pfeffersäcke und Pfaffen, Tagelöhner und Totengräber sowie alle jene, die es nach wohlfeiler Kurzweil gelüstet.
Der Jahrmarkt des Schreckens ist eröffnet.
Mit meiner Wenigkeit als Zugpferd Nummer eins.
Der berittene Herold, in buntscheckiger Livree und mit Federhut auf dem Kopf, verlor denn auch keine Zeit, reckte sich Respekt heischend im Sattel und zog eine mit dem Bischofssiegel versehene Schriftrolle hervor, um sie mit großspuriger Attitüde zu entrollen. Ihr Text lautete wie folgt: »Wir, Konrad von Thüngen, Fürstbischof von Würzburg und Herzog von Franken, tun hiermit kund und zu wissen: Wenzel Lautenschläger, gebürtig zu Nürnberg und Straßenmaler allhier, wurde der Aufwiegelung gegen die gottgewollte Obrigkeit, des Hochverrats und der Blasphemie für schuldig befunden. Scharfrichter, waltet Eures Amtes!«
Blasphemie, dass er nicht lachte. Und das alles nur, weil er es gewagt hatte, die Muttergottes zu malen, im Gewand einer Bäuerin, die ihr Neugeborenes umschlang.
Eingehüllt in eine Decke mit dem Bundschuh darauf.
Ein Motiv wie geschaffen, um ihm einen Strick daraus zu drehen.
»Jetzt mach schon, oder bist du taub?« Wenzel atmete gepresst, nur unter Mühen imstande, das Gleichgewicht zu halten. Dann torkelte er wie ein Betrunkener auf den Richtblock zu, ließ sich auf die Knie fallen und schloss die Augen. Im Nu machte sich gespannte Ruhe breit, durchbrochen vom Gekrächze eines Rabenschwarms, der hoch droben über den Köpfen seine Kreise zog.
»Packt euch von hinnen, ihr Schafsköpfe!«, stieß Wenzel halblaut hervor, den Blick auf die dicht gedrängten Gaffer gerichtet, denen die Sensationsgier in die geröteten Fratzen geschrieben war. »Hier gibt es nichts zu glotzen, darum gehabt euch wohl!«
Die Reaktion des Vollstreckers kam prompt. »Hast du was gesagt, Pinselschwinger?«
Wenzel gab keine Antwort, auf der Suche nach einer ganz bestimmten Person. Einer Frau, deren Züge ihn auf Schritt und Tritt begleiteten. Vor einer Woche hatte er sie zuletzt gesehen, keine Stunde, in der er sie nicht vermisste. Das Beisammensein am Mainufer, als sie einander näherkamen, die Gesichter dem prasselnden Feuer zugewandt, dessen Wärme in ihrer beider Herzen drang, der Spaziergang zum Bootsschuppen, unbeobachtet vom Rest der Welt, als gehöre sie nur ihnen, die Überraschung in Luzias Gesicht, als er ihr das Marienbild mit dem Kind präsentierte – alles Dinge, die auch jetzt, da er vor dem Richtblock kniete, wie ein Tableau vor sein inneres Auge traten.
Das Bildnis der Muttergottes, deren Züge Luzia täuschend ähnlich sahen, für den Inquisitor war es ein gefundenes Fressen gewesen, für ihn dagegen der Anfang vom Ende, auf den der Sturz ins Bodenlose folgte.
Und überhaupt, Luzia. Nie zuvor hatte er eine derart berückende Frau erblickt, weder in seiner Zeit als Lehrknecht, als er sich rühmen konnte, niemand Geringerem als Albrecht Dürer zur Hand zu gehen, noch während der Zeit seiner Wanderschaft, als er von Ort zu Ort zog, um sich als Maler zu verdingen. Gewinnbringende Aufträge waren jedoch die Ausnahme gewesen, mal hier ein Altarbild in einer Dorfkirche, mal dort ein Fresko in einer Abtei, mit freier Kost und Logis als Bezahlung. Viel mehr war für ihn nicht abgefallen, von daher der Beschluss, sich als Straßenmaler zu verdingen. Der sich auf Jahrmärkten herumtrieb, um sich über Wasser zu halten. Und das mehr schlecht als recht. Ein Grund mehr, sich einem rebellischen Volkshaufen anzuschließen, der den Bundschuh auf den zerfledderten Fahnen trug. Reklamierte das Adelspack doch das Recht, die Gemeinen nach Belieben auszuplündern, ohne Rücksicht auf die grassierende Not im Land. Zuletzt hatte es ihn dann nach Würzburg verschlagen, wo sich sein Schicksal erfüllte, indem er Luzia traf, Ziehtochter von Tilman Riemenschneider, einem wahren Meister seines Fachs.
Luzia, Lichtstrahl inmitten der Finsternis. Wie geschaffen für ein Madonnenbild, mit brünetten, bis auf die Schultern herabfallenden Locken und einem Blick, der nicht nur ihn auf Anhieb in den Bann geschlagen hatte. Schmales, wie in Marmor gehauenes Gesicht, makellose Haut, ebenmäßige Züge, die der Aufmerksamkeit eines Michelangelo würdig gewesen wären, wohl proportionierte, fein geschwungene Nase, die ihren Kirschmund erst richtig zur Geltung brachte: ein Banause, der den Ausbund an Schönheit übersah.
Ein knarrendes Geräusch, und die ehernen Reifen, die sein Blut zum Stocken brachten, rasteten knirschend ein.
Die Menge hielt den Atem an.
Ein letzter Blick von hier aus ins Publikum, um die Frau zu erspähen, nach der er sich mit jeder Faser sehnte. Ohne sie hatte das Leben keinen Sinn mehr, dann lieber sterben, am besten gleich.
Dann holte er tief Luft und schloss die Augen.
»Nimm das, Ketzer!«, war das Letzte, was Wenzel hörte, bevor ihm das Richtschwert die Hand abtrennte, die ihm zum Verhängnis geworden war. »Die Tortur hast du dir redlich verdient.«
Ein kurzes Aufbäumen, gefolgt von einem markerschütternden Schrei.
Und der Gewissheit, dass der Scharfrichter kein Unbekannter für ihn war.
Dann breitete die Ohnmacht ihren Mantel über ihm aus.
MITTWOCH, 26. APRIL 1525
2
»Wir, Konrad von Thüngen, Fürstbischof von Würzburg und Herzog von Franken, tun hiermit kund und zu wissen: Wenzel Lautenschläger, gebürtig zu Nürnberg und Straßenmaler allhier, wurde der Aufwiegelung gegen die gottgewollte Obrigkeit, des Hochverrats und der Blasphemie für schuldig befunden. Scharfrichter, waltet Eures Amtes!«
Auf dem Rücken eines Schecken thronend, faltete der Herold die Verlautbarung wieder zusammen, steckte sie in sein Wams und hatte es auf einmal eilig, das Feld zu räumen.
Nichts wie weg, bevor es ernst wurde.
Schließlich wusste man ja nie.
Starr vor Entsetzen, wandte Luzia die Augen vom Richtblock ab. Im Osten graute der Morgen, und wie Ende April des Öfteren der Fall, war der Main in wallende Dunstschleier gehüllt, kalkfarben wie ein Bahrtuch, das vom Anhauch der Vergänglichkeit durchwoben war. Auf dem Schottenanger, unweit des Konvents der Benediktiner gelegen, hatte sich eine zu Hunderten zählende Menge versammelt, darunter auch zahlreiche Honoratioren, die darauf pochten, einen Ehrenplatz zu bekommen. Die Spannung, die sich auf den Gesichtern des Publikums abzeichnete, war beinahe mit Händen zu greifen, und was den in Ketten gelegten Inkulpaten betraf, hatte er die Sympathien auf seiner Seite. Dies vorausahnend hatte der Scharfrichter eine Eskorte um sich geschart, gebildet aus waffenstarrenden Reisigen, die einen Halbkreis um die uralte Richtstätte bildeten.
Und dann, unterstützt von zwei Gehilfen, die Wenzel gewaltsam in die Knie zwangen, trat der Henker auch schon in Aktion. Der Arm lag gerade an Ort und Stelle, umschlossen von Klammern aus Gusseisen, die das Blut des Delinquenten zum Stocken brachten, da packte der Vollstrecker auch schon sein Schwert, riss es in die Höhe und schnappte nach Luft.
Ein gezielter Hieb, und Wenzels Rechte fiel zu Boden.
Was folgte, war ein markerschütternder Schrei, gefolgt von lastender Stille.
Es war vorüber.
Am Boden zerstört und in Tränen aufgelöst, verharrte Luzia auf der Stelle, selbst dann noch, nachdem Wenzel zu Boden gesunken war, außerstande, das Geschehene zu begreifen.
Den Blick auf die abgetrennte Hand gerichtet, von Übelkeit und aufwallenden Schuldgefühlen übermannt.
Peinigend wie die Klinge eines Stiletts, die sich ihr mitten ins heftig klopfende Herz bohrte.
Doch dann war da auf einmal diese Hand, die sich auf ihrer Schulter niederließ, schwielig und mit zupackendem Griff.
»Komm, Luzi, ich bring dich nach Hause«, raunte ihr Lutz über die Schulter hinweg ins Ohr. »Der Infirmarius aus dem Kloster wird sich seiner annehmen, wenn er aus der Ohnmacht erwacht, komm mit mir, du kannst jetzt nichts mehr für ihn tun.«
Luzia willigte schweigend ein.
3
»Mit Dank zurück, an die Kluft könnte ich mich glatt gewöhnen«, feixte der Reiter im schwarzen Mantel, Träger einer dunklen Stoffmaske, unter der sich die entstellte Fratze verbarg. Dann zügelte er seinen Rappen, der mit geblähten Nüstern auf der Stelle stampfte, hob den Daumen und warf ihm ein verschnürtes Bündel zu. »Es geht doch nichts über einen stilvollen Mummenschanz. Der Pöbel will belogen werden, tun wir ihm also den Gefallen!«
Einen Kloß im Hals, der seine Antwort erstickte, ließ Helmar den Blick auf dem Kleiderbündel ruhen. Alles in Rottönen, vom Rock bis zu den Stiefeln aus Hirschleder, streng nach Vorschrift. Die Totengräber in Schwarz, die Dirnen in schwefelgelbem Aufputz und die Vertreter seiner Zunft in Rot, die Tradition ging den Stadtoberen über alles.
Zeig mir, wie du dich kleidest, und ich sage dir, wo du hingehörst. In einer Zeit, die dem schönen Schein huldigte, war für Außenseiter wie ihn kein Platz. Es sei denn, sie erledigten die Drecksarbeit, für dergleichen war er gut genug. »Hier, das Geld ist für dich, nun nimm schon, ehe ich es mir anders überlege!«
Die Arroganz in Person, kramte der Berittene einen ledernen Schnürbeutel hervor, ließ ihn wie ein Pendel hin und her schwingen und höhnte: »Du siehst, ich stehe zu meinem Wort. 100 fränkische Gulden, wie abgemacht. Eine erkleckliche Summe, aber gut angelegtes Geld. Welch ein Gaudium, es dem Bastard heimzuzahlen. Schade nur, dass er so glimpflich davongekommen ist. Wäre es nach mir gegangen, ich hätte ihm auch noch die Linke abgehackt. Und ihn im Anschluss aufs Rad flechten und vierteilen lassen. Der Mob will schließlich was zu gaffen haben, wer wüsste dies besser als du.« Ein hastiger Atemzug, gefolgt von raubtierhaftem Knurren. »Aber was tut man nicht alles, um Fürstbischof Konrad bei Laune zu halten. Der – Gott sei’s geklagt! – an chronischer Altersgüte leidet und sich darin gefällt, Gnade von Recht ergehen zu lassen. Eine einschlägig bekannte Giftmischerin laufen zu lassen, die im Verdacht steht, mit dem Hochverräter unter einer Decke zu stecken: Ich muss schon sagen, da gehört etwas dazu!« Abermaliges Knurren, wie eine Hyäne beim Erspähen des Opfers. »Schimpft sich Heilerin und tut so, als könne sie kein Wässerchen trüben, die Hexe käme mir gerade recht! Ab mit ihr auf den Scheiterhaufen, mehr fällt mir dazu nicht ein. Wäre da nicht unser aller Herr und Meister gewesen, der geruhte, sie auf freien Fuß zu setzen. Fragt sich, inwieweit er damit auf Gegenliebe stößt, ich persönlich habe da so meine Zweifel!«
Der Vermummte lachte schadenfroh auf. Rache um jeden Preis, nur das hatte für ihn gezählt. Der Herumtreiber hatte ihn zum Hanswurst degradiert, hatte ihm die Traumfrau vor der Nase weggeschnappt. Luzia in den Armen eines Fantasten, der im Verdacht stand, gegen den Bischof zu konspirieren. Ein ehrabschneidender Affront, an Keckheit nicht zu überbieten. Vom eigentlichen Skandal, einem Bildnis der Muttergottes in Grobleinen, nicht zu reden.
Ein Sakrileg, welches das Fass zum Überlaufen brachte.
Und ein Grund mehr für ihn, die ehrenrührige Schmach zu tilgen, nicht etwa per Handlanger, sondern so, wie es sich für einen Edelmann geziemte. Indem er tat, was getan werden musste, auf dass der Makel, der ihm anhaftete, getilgt werden möge.
Blieb nur noch, die Montur des Henkers überzustreifen, dann stand dem Racheakt nichts mehr im Wege.
Auge um Auge.
So stand es geschrieben.
»Jetzt tu doch nicht so. Einer wie du kann das Geld doch immer brauchen!«
Helmar neigte schweigend das Haupt. Im Umgang mit Personen von Stand, das hatte ihn die Erfahrung gelehrt, war es nicht ratsam, unnötige Fragen zu stellen. Scherereien konnte er keine brauchen, seine Reputation war ohnehin nicht die beste. Mit dem Henker wollte niemand etwas zu tun haben, wohin er auch kam, die Leute machten einen Bogen um ihn, bekreuzigten sich, um den bösen Blick zu bannen, den er hatte, und waren froh, wenn er grußlos seiner Wege zog. Einfach undenkbar, ihn zu berühren oder ihm gar die Hand zu schütteln, weder von Nachbar zu Nachbar noch aus Höflichkeit. Müßig zu erwähnen, dass er in der Sander Vorstadt hauste, fernab des Getriebes auf der Domstraße, wo sich all jene, die sahen und gesehen werden wollten, unters Stadtvolk zu mischen pflegten.
»Was machst du denn für ein Gesicht, ist die Handsalbe etwa nicht belebend genug?«
»Mitnichten, Herr, wo denkt Ihr hin!«, beeilte sich Helmar zu erwidern, zog seine Filzkappe vom Kopf, um Ergebenheit zu heucheln, und rang sich zu einer demutsvollen Verbeugung durch. Wie es aussah, war mit dem Maskierten nicht gut Kirschen essen, allemal ratsam, mit den Wölfen zu heulen. »Seid bedankt für den großherzigen Obolus, wenn nur alle so viel Benimm hätten wie Ihr, dann wäre die Welt wieder in Ordnung.«
»Lieber nicht, denn dann gäbe es bald keine Straßenmaler mehr«, war Helmar auf Anhieb durchschaut, was den Reiter zu einem halblauten Glucksen animierte. Von Kopf bis Fuß in schwarzer Gewandung, haftete ihm die Aura eines Untoten an, dazu verdammt, sein Dasein als wandelnder Schatten zu fristen. »Geschieht ihm recht, der Nichtsnutz hat es nicht anders verdient. Von jetzt an weht ein anderer Wind, und wenn das Pack nicht spurt, dann werde ich ihm zeigen, wo sein Platz ist. Wohlan, je früher man die Läuse zerquetscht, desto leichter lässt es sich leben. Drum merke: Erst wenn der letzte Schädling ausgetilgt ist, erst dann wird sich das Land zu neuer Größe erheben, warte nur ab, du wirst noch an mich denken!«
»Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Die Zeiten eines Barbarossa sind vorbei.«
»Findest du?« Raban von Stahleck, Domprobst, Secretarius des Bischofs und Agent für die heiklen Missionen, reckte sich gebieterisch im Sattel, die Knochenklaue um die straff gezogenen Zügel geschlungen, um den ungebärdigen Vollblüter im Zaum zu halten. Jenseits der Baumkronen, die den abgelegenen Steinbruch wie ein Schutzwall umgaben, graute bereits der Morgen, und als sei Eile dringend geboten, nahm Helmar einen scharfkantigen Spaten zur Hand. Unweit der Stelle, wo er auf den Reiter gewartet hatte, tat sich eine klaftertiefe Grube auf, was den Probst zu einem fragenden Stirnrunzeln bewog. »Was machst du denn da, dürfte man das erfahren?«
»Tote exhumieren, das sieht man doch!«, gab Helmar spitzzüngig zurück, das Kurzhaar schiefergrau, gebeugt gehend und mit Altersflecken im hohlwangigen Gesicht. Einzig die Luchsaugen, denen auch bei Dämmerlicht nichts entging, erinnerten an längst vergangene Tage. An eine Zeit, als er noch jung war und voller Tatendrang steckte. Doch dann war auf einmal alles anders gekommen, vom einen auf den anderen Tag. Mit dem Tod seines älteren Bruders, dazu bestimmt, dereinst in die Fußstapfen des Vaters zu treten, war die Reihe wie selbstverständlich an ihn gekommen. Ein Schlag, von dem er sich bis heute nicht erholt hatte. Aus der Traum von der eigenen Werkstatt, wo er sich dem Goldschmiedehandwerk widmen und von den Mitbürgern als einer der Ihren betrachtet werden würde.
Und nichts wie hinein in die Kluft des Henkers, um fortan wie ein Paria gemieden zu werden.
»Tote exhumieren, bist du toll?«
»Keineswegs!«, stieß Helmar keuchend hervor, legte die Schaufel beiseite, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, und ging neben dem Aushub auf die Knie. Aus dem Erdloch, rechteckig und von Maden und umherkriechendem Gewürm bevölkert, stieg der Odem des Todes in die morgenklare Luft, saugte sie wie ein giftgetränkter Schwamm in sich auf. »Nichts für ungut, Herr, aber die Zeit drängt. Ich muss mich sputen, sonst war alles umsonst!«
»Und wer hat dir das erlaubt?«, herrschte von Stahleck den Zeremonienmeister des Todes an, wedelte mit der Hand, um den Gifthauch zu zerstreuen, und hatte Mühe, das Würgen in seiner Kehle zu unterdrücken. »Und überhaupt, wer kommt denn auf so eine …«
»Hirnverbrannte Idee?«, nahm Helmar dem Domprobst die Worte aus dem Mund und grub mit den Händen weiter, bis er auf Knochenreste stieß. Dann kletterte er in die Grube und blickte zu ihm auf: »Ich möchte mein Gewissen erleichtern, wenn Ihr es genau wissen wollt.«
»Halte ein, du Narr, oder ich werde dich Mores lehren!«
»Einen Teufel werdet Ihr tun«, versetzte Helmar ergrimmt, barg einen Schädel aus dem Morast, der von einem Halbwüchsigen stammte, und legte ihn neben dem Grab ins Gras. »Um Euch auf die Sprünge zu helfen, edler Herr«, fuhr er mit beißender Häme fort, machte eine ausholende Handbewegung und deutete auf das überwucherte Halbrund, das sich zu Füßen des Reiters erstreckte, »Ihr befindet Euch auf dem Friedhof der Namenlosen, im Volksmund zuweilen auch Hexenbruch genannt. An einem Ort, den Ihr bisher vermutlich nur vom Hörensagen kanntet. Ist ja auch kein Wunder, denn wer kommt schon freiwillig hierher. Aber seht Euch ruhig um, so viel Zeit muss sein.«
Kalt erwischt, kam der Reiter der Aufforderung nach. Im Schein der aufgehenden Sonne, welche die Felswände mit glutroter Patina übergoss, traten die Konturen von Erdhügeln aus dem Halbdunkel hervor, von Grashalmen, Dornenzweigen und Wildblumen überwuchert, die sich wie ein fadenscheiniger Mantel an sie schmiegten. Hier und da ragte ein morsches Kreuz aus dem Gestrüpp hervor, ohne Inschrift oder Zierwerk, nur mehr ein Spielball von Wind und Wetter. Kaum ein Grab, an dem die Wildtiere keine Spuren hinterlassen hatten, vom Heißhunger gepeinigt, der sie zum Äußersten trieb.
»Na, habt Ihr jetzt genug gesehen?«, fuhr Helmar mit sarkastischem Timbre fort. »Ein ungewohnter Anblick, hab ich recht?«
Von Stahleck schnappte wütend nach Luft. »Sag mal, hast du denn überhaupt keine Angst vor mir?«
Helmar schnaubte amüsiert. »Wenn man so alt ist wie ich, kann man sich den Luxus nicht leisten.« Und kletterte mühsam aus dem Grab, die Hände mit Erde und Schlammresten bedeckt. »Ich weiß zwar nicht, wann die Reihe an mich kommt, vor den Schöpfer des Himmels und der Erde zu treten, aber wenn es so weit ist, möchte ich ein reines Gewissen haben.«
»Ein Scharfrichter mit Schuldgefühlen, das verstehe, wer will.«
»Um auf den Punkt zu kommen«, ließ sich Helmar von der Replik nicht beirren, nahm sein Sacktuch zur Hand, um sich vom Schmutz zu säubern, und hob den Schädel vom Boden auf. »Ihr könnt es zwar nicht wissen, aber als er zum Tod durch den Strang verurteilt wurde, war der Pechvogel noch ein halbes Kind.«
Hörbar amüsiert, stieß der Reiter einen gedämpften Grunzlaut aus. »Und wenn schon, Jugend schützt vor Strafe nicht. Umsonst landet niemand auf dem Schafott, gerade du müsstest das eigentlich wissen.«
»Womit wir zum Kernpunkt meines Anliegens kommen«, nahm Helmar den roten Faden wieder auf, sah den Totenschädel an, als halte er geheime Zwiesprache mit ihm, und stieß einen bekümmerten Seufzer aus. »Nur damit das klar ist, hier sind keine Kriminellen begraben. Sondern Leute wie Ihr und ich.«
Von Stahleck lachte heiser auf. »Da kommen einem glatt die Tränen, hätte ich doch nur ein Sacktuch dabei!«
»Gehängt, zu Tode gemartert, aufs Rad geflochten, geblendet, verstümmelt, enthauptet, entmannt, gevierteilt und wie ein Stück Vieh zur Schlachtbank geführt. So wie der junge Mann hier, der bezichtigt wurde, Buhlschaft mit dem Teufel getrieben zu haben.« Außer sich vor Zorn, stapfte Helmar auf den bereitstehenden Handkarren zu, nahm ein Wachstuch zur Hand, um den Schädel zu umwickeln, und verstaute ihn in einer Kiste, die sich auf der Ladefläche befand. »Nur eines von zahlreichen Vergehen, für die sich die Unglücklichen, die hier verscharrt wurden, zu rechtfertigen hatten. Als da wären: Schadenzauber, um sich beim Nachbarn für vermeintliche Kränkungen zu rächen, schwarze Magie, Ketzerei, Sektierertum und Abfall vom wahren Glauben, Herbeizaubern von Dürreperioden, Seuchen und Flutkatastrophen, Hochverrat und Anstachelung zur Rebellion gegen die Obrigkeit, in Tateinheit mit der Schmähung des Landesherrn. Reicht das, oder soll ich weitermachen?«
Die Hand auf dem Schwertknauf, stieß von Stahleck eine unflätige Verwünschung aus. »Wie redest du eigentlich mit mir, Leichenfledderer, bist du von Sinnen?«
»Keineswegs.«
»Noch ein Wort, und ich …«
»Einstweilen nur so viel, Herr von Stahleck«, fuhr Helmar dem Reiter über den Mund, über dessen Identität er sich vorab im Klaren gewesen war, dank weitreichender Kontakte, seit jeher eine Frage des Überlebens für ihn. »Wenn Ihr nur annähernd so schlau seid, wie Ihr tut, dann hütet Euch davor, mir in die Quere zu kommen. Nur dann – schreibt Euch das hinter die Ohren! – bin ich bereit, über Euren Auftritt als Scharfrichter Stillschweigen zu bewahren. Die Verschwiegenheit meines Gehilfen vorausgesetzt. Und eines Freundes, den ich ins Vertrauen zog. Es sei denn, Ihr versucht, mich aus dem Weg zu räumen. Aber seid unbesorgt, ich werde mich meiner Haut zu wehren wissen. Und was Eure Handsalbe betrifft, die steckt Euch gefälligst sonst wohin. Ich komme auch so über die Runden, macht Euch da mal keine Gedanken.« An die Ladefläche gelehnt, warf der Scharfrichter einen Blick in die Runde. Im Osten stieg die Sonne über den Baumwipfeln empor, und wie um die Artgenossen wachzurütteln, hallte der Schrei eines Habichts über das Felsrund hinweg. »Bevor ich es vergesse, Eminenz: Um den Opfern der Willkür ihre Ehre zurückzugeben, wurde Sorge getragen, ihre Gebeine in geweihter Erde zu begraben, auf pietätvolle Art und Weise, das versteht sich quasi von selbst. An welchem Ort und mit wessen Hilfe, tut nichts zur Sache. An frommen Brüdern, die das Herz am rechten Fleck haben, herrscht in der Stadt kein Mangel, auch wenn die Amtskirche alles tut, um sie mundtot zu machen. Und darum ans Werk, ich wittere Morgenluft!«
»Aber ohne Spuren zu hinterlassen, das bitte ich mir aus!«
»Wer weiß, vielleicht werden die Gräber ja noch gebraucht«, gab Helmar mit eisiger Miene zurück, packte die Schaufel und sah den Reiter an. »Ihr wisst doch, Domprobst, wir leben in unruhigen Zeiten. Was morgen geschieht – wer weiß das schon genau!«
Von Stahleck zischte: »Soll das etwa eine Drohung sein?«
»Wie könnte ich es wagen, Euch zu drohen«, parierte Helmar den Hieb, berstend vor Tatendrang, als habe er ein Bad im Jungbrunnen genommen. »Obwohl, vor Überraschungen ist niemand gefeit. All jene, die auf dem hohen Ross sitzen, mit inbegriffen. Memento mori, die alten Römer lassen grüßen!«
4
»Und, geht’s wieder?«, brach Lutz Plattner das lastende Schweigen, legte den Schwertgurt ab und ließ sich neben Luzia nieder. »Kopf hoch, auch wenn’s schwerfällt«, munterte er die 23-Jährige auf. »Der Infirmarius tut, was er kann, bei ihm ist er in guten Händen. Der Paradiesvogel kommt durch, mach dir da mal keine Gedanken. Noch mal Glück gehabt, würde ich sagen, hätte auch anders ausgehen können.«
»Glück nennst du das?«, erwiderte Luzia gepresst, die Arme um die angewinkelten Beine geschlungen, während ihr Kinn in der Vertiefung zwischen den Knien steckte. Der Schock saß tief, und obwohl sie sich wünschte, weit weg zu sein, kehrte sie in Gedanken zum Richtplatz zurück. Der festgezurrte Arm auf dem Hackblock, von Schwellungen und schwärenden Wunden übersät, das Beil des Scharfrichters, auf dessen Klinge sich das gleißende Frühlicht brach, der gramerfüllte Ausdruck auf Wenzels Gesicht, kurz bevor er in den Abgründen der Ohnmacht versank: So sehr sie auch versuchte, sie abzuschütteln, die Bilder blieben in ihr haften, eine Wunde, die nie wieder verheilen würde. »Stell dir vor, du hättest keine Schwerthand mehr, was dann?«
»Dann wäre ich übel dran, keine Frage«, lenkte der Hauptmann der Stadtwache ein, nahm einen Kieselstein und warf ihn im flachen Winkel in den Main. Kaum war er nach mehreren Hüpfern versunken, schoss ein Fischreiher aus dem brackigen Uferschilf hervor, erhob sich laut krächzend in die Lüfte und ward fortan nicht mehr gesehen. Der Himmel war nahezu wolkenlos, nicht mehr lange, und die Nachwehen des strengen Winters würden sich in Nichts auflösen. »Einen Gesetzeshüter ohne Waffe, den nimmt doch niemand mehr ernst.«
»Und warum ist das so?«
»Weil wir eine brauchen, um uns Respekt zu verschaffen«, grollte der Hüne mit der kastanienbraunen Mähne, fuhr über die Narbe auf der linken Wange, die ihm das Aussehen eines italienischen Condottiere verlieh, und rümpfte die abknickende Nase. »Kein Respekt mehr vor der Polizei, vor den Ratsdienern, vor den Mitmenschen von nebenan. Schau dich doch um, Luzi, es ist überall das Gleiche. Jeder macht, was er will, und wenn du versuchst, für Ordnung zu sorgen, dann kannst du froh sein, wenn es keine Prügel setzt. Schau mal, wenn es Stadtviertel gibt, wo Händel an der Tagesordnung sind, weil sich die Diebesbanden gegenseitig bekriegen, dann stinkt das doch wirklich zum Himmel. Zeter und Mordio zu schreien, wenn es dir an den Kragen geht, die Mühe kannst du dir sparen. Bis endlich Hilfe kommt, sind die Schnapphähne über alle Berge.« Lutz winkte verdrossen ab. »Kein Tag ohne beklaute Kilianspilger, bis aufs Hemd ausgeraubte Fernhändler oder Opfer von Messerstechereien – von wegen Stadtluft macht frei, träum weiter, das war einmal!«
Die Augen zu schmalen Schlitzen verengt, rang der Nachbarsjunge aus Kindertagen um Fassung. »Und was lernen wir daraus? Wenn keiner da ist, der dem Treiben Einhalt gebietet, dann geht es bald drunter und drüber. Ein Tipp an unsere Stadtväter, von einem Grünschnabel, der es gut mit ihnen meint: Um für Ordnung zu sorgen, sind zwei Dutzend Stadtknechte und die paar Büttel, die am Hungertuch nagen, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mit anderen Worten, ein Griff ins Stadtsäckel täte dringend Not, und zwar prestissimo, sonst schwimmen uns sämtliche Felle davon. Und wenn ich dran denke, wer sich in Würzburg so alles rumtreibt, dann frage ich mich, ob …«
»Es nicht besser wäre, keine Fremdlinge mehr in die Stadt zu lassen?«, nahm Luzia ihrem Gefährten die Worte aus dem Mund, blickte kurz auf und sagte: »Komm schon, Lutz – das meinst du doch bestimmt nicht ernst.«
»Dreh mir nicht die Worte im Mund um, Luzi. So habe ich das nicht gemeint.«
»Wie dann?«
»Damit wir uns hier nicht falsch verstehen: Einem Straßenmaler die Hand abzuhacken, nur weil einem sein Stil nicht gefällt, das ist pure Willkür. Und hat mit Gerechtigkeit, wie ich sie verstehe, nichts zu tun.«
»Na also, dann wären wir uns ja einig.« Luzia atmete ermattet aus, den Blick auf das gegenüberliegende Ufer gerichtet, wo der Hafen geräuschvoll zum Leben erwachte. Hier ein Weinfass, das über die Laufplanke eines tief liegenden Lastschiffs rumpelte, dort der Ladekran, der unter dem Gewicht von prallvollen Getreidesäcken ächzte, hier ein wild gestikulierender Fischhändler, der sich weigerte, den geforderten Preis zu zahlen, und gleich daneben ein Fuhrwerk mit Bauholz, das sich laut quietschend und knarzend in Bewegung setzte. Von Bord der Schiffe, allen voran Treidelboote, Holzflöße und Prähme, randvoll mit Butterfässern, Weidenkörben und Haushaltsgerät, hallten Kommandorufe, Wutschreie und Flüche durch die Luft, wie zu Beginn einer epischen Schlacht, als ginge es um Leben und Tod. Inmitten des Lärms, anhand der farbenfrohen Tracht schon von Weitem zu erkennen, bahnte sich der Hafenmeister einen Weg durchs Getümmel, in Begleitung des feisten Ratsschreibers, bei dessen Auftauchen die Schwarzhändler das Weite suchten.
In ihren Umhang gehüllt, um der Morgenkühle zu trotzen, ließ Luzia das Szenario auf sich wirken, wartete ab, bis die Glockenschläge verklangen, die den Beginn der dritten Stunde anzeigten, und ergriff mit Bedacht das Wort: »Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet, Lutz Plattner. Du bist ein echter Freund, wärst du nicht gewesen, dann …«
»Nicht der Rede wert, Luzi. Für mich war das selbstverständlich.«
»Und das vom obersten Ordnungshüter. Hört, hört.«
»Dazu sind Freunde ja wohl da, oder?«, wiegelte der Hüne mit Nachdruck ab, zuckte mit den Achseln und ließ die Sandkörner, die er in seiner Handfläche barg, ins Wasser rieseln. »Wir beide kennen uns schon so lange, auf wessen Seite der andere steht, das kann uns doch wirklich egal sein. Hauptsache, wir bleiben Freunde. So wie früher, als die Welt noch halbwegs in Ordnung war.«
»Das war sie ganz bestimmt nicht.«
»Ich weiß.« Plattner lächelte betrübt. »Mit uns im Reinen waren wir trotzdem, ist das etwa nichts?«
»Doch.«
»Und wo liegt dann das Problem?«
»Solange jeder Dritte hier nicht weiß, wie er über die Runden kommen soll, ohne Hunger zu leiden, solange kommt mit Sicherheit auch kein Land in Sicht. Frage an den Experten: Wie viele Bettler gibt es in der Stadt?«
»Mit Konzession oder ohne?«
»In summa, Lutz.«
»In etwa 100, würde ich sagen. An normalen Tagen.«
»Und an Kiliani?«
»Das Dreifache, grob geschätzt. Das ist ja gerade das Problem. Versuch doch mal, die schwarzen von den weißen Schafen zu trennen. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Es ist nun mal leider so: je mehr von der Sorte, desto weniger Krümel fallen vom Kuchen ab. Klar, wer möchte denn schon von der Hand in den Mund leben, die armen Teufel sind wirklich zu bedauern, in dem Punkt gebe ich dir recht.«
Luzia schnaubte leise auf. »Heute wie vor 20 Jahren, als die Welt angeblich noch in Ordnung war. «
»Also, was mich betrifft, ich wollte meine Kindheit nicht missen. Ab und an habe ich zwar ordentlich Dresche bezogen, du kennst ja meinen Alten, mit so was war er schnell bei der Hand.« Plattner winkte achselzuckend ab. »Aber was soll’s, so bekommst du wenigstens ein dickes Fell. Oder du gehst daran kaputt, je nachdem. Sei froh, dass du so einen Vater hast, an Meister Til gab es ja wohl nichts auszusetzen.«
»Wenn du meinst.«
»Ich weiß, du hörst es nicht gern: Aber die Altvorderen sitzen am längeren Hebel. Und betrachten es als ihr Recht, den Ton anzugeben. Was das betrifft, macht dein Vater keine Ausnahme. Du kennst doch den Spruch: Wie man sich bettet, so liegt man. Meister Til ist ein berühmter Mann, in der Stadt kennt ihn jedes Kind. Werke von solcher Schönheit zu schaffen, das können nur die Wenigsten. Und dann auch noch Bürgermeister, obwohl er ein Reingeschmeckter ist, Hut ab, das ist wahrhaftig aller Ehren wert.« Bei der Pointe angelangt, hielt Plattner zögerlich inne. »Ist doch klar, dass er nichts dem Zufall überlässt, insbesondere wenn es ums Einfädeln einer Heirat geht. Noch dazu, wenn es sich bei der Braut um seinen Augapfel handelt. Dem Mann kann man doch keinen Vorwurf machen, hier in Würzburg machen es alle so.«
»Er hätte mich wenigstens fragen können, aber nicht mal das hat er getan.«
»Falls es dir ein Trost ist: Meiner Schwester ging es genauso. Die wurde auch nicht gefragt. Wurde gegen ihren Willen verheiratet. Mit 15. Eine Esserin weniger, das war die Hauptsache. Das Geld reichte hinten und vorne nicht, Vater hatte keine andere Wahl.«
»Die hat man immer, Lutz.«
»Kann schon sein.« Plattner zuckte nachdenklich mit den Achseln. »Von wegen Handwerk hat goldenen Boden. Vergiss es. Reich kannst du damit nicht werden. Es sei denn, du hast Beziehungen.« Ein Atemzug, der in ein Schnauben mündete, gefolgt von betretenem Schweigen. »Ein halbes Dutzend Rangen, die dir die Haare vom Kopf fressen – und das siebte in der Obhut des Klosters, wie es sich gehört – ich sag’s ja ungern, aber je länger ich darüber nachdenke, umso mehr tut mir der Knüppelschwinger leid.«
»Und deine Mutter ja wohl auch, oder?«
Der Hüne bejahte stumm. »Sie starb, als ich fünf war, das allein war schon schlimm genug. Glück für mich, dass es unsere Bande gab, so bekam ich wieder Boden unter die Füße. Vor unseren Streichen war niemand sicher, am allerwenigsten die Nachbarn in der Franziskanergasse.« Ein verschmitztes Lächeln im Gesicht, rief Plattner längst vergangene Tage wach. »Weißt du noch, wie wir über die Klostermauer geklettert sind, um den Obstgarten zu plündern? Und wie wir so viele Kirschen in uns reingestopft haben, dass uns kotzübel davon wurde?«
»Sag mal, wovon redest du überhaupt?« Luzia lächelte verschmitzt. »Ich will ja nichts sagen, aber ich bin mir sicher, da liegt eine Verwechslung vor. Den Klostergarten zu plündern, nie im Leben hätte ich mir das getraut, so gut müsstest du mich eigentlich kennen!«
»Und ob ich dich kenne, das ist ja gerade das Malheur. Und dann erst der Schabernack, den wir mit dem Domküster getrieben haben, eine Scharade vom Allerfeinsten. Sieht man von der Abreibung ab, die ich bekam. Seinem Maultier einen Eimer mit unverdünntem Rotwein in den Trog zu schütten, sodass der Radaubruder tagelang keinen Mucks von sich gab, welch ungeheure Blasphemie, ich finde, wir beide sollten uns was schämen!«
»Du und ich uns schämen, dass ich nicht lache.«
»Und dabei hätte ich allen Grund dazu, acht Jahre als Landsknecht hinterlassen ihre Spuren.« Die Hände hinterm Kopf verschränkt, verzog Lutz das wettergegerbte Gesicht. »Die Fürsten uneins, die Straßen unsicher wie nie zuvor, die Bauern allerorten auf dem Vormarsch, eine Schneise der Verwüstung im Rücken, Hiobsbotschaften zuhauf, und das rund um die Uhr, kurzum: Mord und Totschlag, wo du hin- und rausguckst. Den möchte ich sehen, der da nicht trübsinnig wird, rette sich, wer kann, die Apokalypse naht!«
»Darüber macht man keine Witze, Lutz. Die Situation ist viel zu ernst.«
»Umso wichtiger, wenn man Freunde hat, die zu einem halten, findest du nicht auch?«
»Wohl gesprochen, Herr Hauptmann.« Luzia lächelte matt. »Wie dem auch sei, ich denke, da kommt einiges auf uns zu. Einen Vorgeschmack haben wir ja schon bekommen. Ein Funke genügt, und es ist aus mit der Friedhofsruhe im Land. Und dann gnade uns allen Gott, die Rache der Geknechteten wird schrecklich sein.«
»Niemand kann in die Zukunft blicken. Und das ist auch gut so.«
Und wenn, dann nur sehr wenige, alter Freund.
Die Gefährtin aus Kindheitstagen mit inbegriffen.
Aber davon weißt du nichts.
Und so soll es auch bleiben.
Eine Flüsterstimme im Ohr, die ihr immer dann durchs Gehirn spukte, wenn sie schwankend wurde, rang Luzia ihre Zweifel nieder. Bruder Damian, väterlicher Freund, Lehrer und Beichtvater in einem, hatte es vor Wochenfrist auf den Punkt gebracht: »Deine Gabe besteht darin, in die Zukunft blicken zu können. Das Prekäre dabei: Wer wie du das zweite Gesicht besitzt, der hüte sich davor, darüber zu sprechen. Tut er es dennoch, läuft er Gefahr, in die Fänge von Leuten zu geraten, die ihn vor ihren Karren spannen wollen. Das bedeutet, um nicht zwischen die Fronten zu geraten oder am Ende gar der Hexerei bezichtigt zu werden, tust du gut daran, dein Geheimnis für dich zu behalten. Unter allen Umständen, koste es, was es wolle. Sickert etwas davon durch oder ziehst du jemanden ins Vertrauen, der dessen nicht würdig ist, dann begibst du dich in tödliche Gefahr. Erführe die Obrigkeit davon, ich bin mir sicher, sie würde Mittel und Wege finden, dich für ihre Zwecke einzuspannen, darin sind wir uns ja wohl einig.«
Mit anderen Worten, auch Lutz gegenüber, dem sie rückhaltlos vertraute, war Stillschweigen oberste Pflicht.
Schließlich wusste man ja nie.
Die Stirn in Falten, sah Luzia ihren Begleiter aus dem Augenwinkel an. »Wenn wir gerade dabei sind, auf wessen Seite stehst du eigentlich?«
»Auf der Seite des Rechts, das versteht sich ja wohl von selbst.«
»Des Stärkeren oder auf Gleichheit vor dem Gesetz?«
»Gutes Stichwort«, rettete sich Lutz aus der Bredouille, entledigte sich des Uniformrocks, auf dem das Wappen seiner Geburtsstadt prangte, und machte einen tiefen Atemzug. »Wie gesagt: Was sich der Bischof da geleistet hat, das schreit zum Himmel. Einen Straßenmaler halb tot prügeln zu lassen, um ihn im Anschluss wie ein Stück Vieh mit dem Beil zu traktieren, für mich ist das pure Barbarei. Andererseits, hätte er nicht noch eins draufgesetzt, dann wäre ihm die Tortur erspart geblieben. Das Wickelkind Jesus mit dem Bundschuh zu bepinseln, das ist wirklich ein starkes Stück.« Den Blick auf die gekräuselten Wellen gerichtet, die sich an der nahe gelegenen Sandbank brachen, ließ Lutz den Zeigefinger über die Nase wandern, räusperte sich und fuhr fort: »Versteh mich bitte nicht falsch, Luzia, aber wie ich den Kasus sehe, ist dieser Wenzel übers Ziel …«
»Hinausgeschossen?«
Der Hauptmann deutete ein Nicken an. »Den Herrschaften auf der Festung steht das Wasser bis zum Hals. Gerade dir muss ich das nicht sagen. Wer weiß, was demnächst noch alles passiert, die Bauernhaufen rücken näher, was, wenn sie zum Sturm auf die Stadt ansetzen?«
»Das wird nicht geschehen. Da bin ich mir sicher.«
»Und wenn doch, was dann?«
Die Hände um die Kante des Stegs geschlungen, stierte Luzia in die graublauen Fluten, einen desillusionierten Zug um den Mund. »Du meinst also, hätte sich Wenzel die Provokation verkniffen und die Politik außen vor gelassen, dann wäre das alles nicht passiert. Dann hätte er noch seine Hand, könnte seiner Profession nachgehen und wäre wohlgelitten, in welche Stadt es ihn auch immer verschlagen würde.«
»Vermutlich.«
»Das zum Thema künstlerische Freiheit. Ergo: Wer es verschmäht, mit den Wölfen zu heulen, und die Obrigkeit herausfordert, wo er nur kann, der ist selbst schuld, wenn er unter die Räder kommt.«
»Jetzt mach aber mal halblang, Luzi!«, setzte sich Lutz vehement zur Wehr, schüttelte den Kopf und blickte verdrossen zur Seite. »Bitte dreh mir das Wort nicht im Mund um, so habe ich das nicht gemeint!«
»Aber gedacht.«
»Du musst es ja wissen. Gedankenlesen war ja schon immer deine Stärke.«
»Guter Plan.«
»Was soll denn das schon wieder heißen?«
»Sich aus allem rauszuhalten. Noch dazu in Zeiten wie diesen. Die Gewähr, den Kopf auch in Zukunft auf den Schultern zu tragen. Du weißt ja, jeder ist sich selbst der Nächste, wozu sich mit dem Bischof anlegen, das führt doch zu nichts. Sollen doch die anderen die Kastanien aus dem Feuer holen, Hauptsache, in bin fein raus. Willkür oder nicht, irgendwie wird es schon weitergehen, für andere den Kopf hinhalten, das fehlte noch!«
»Zu deiner Information, Luzia: Die Narbe auf meiner Wange stammt nicht aus dem Krieg.« Die Miene des Hauptmanns verdüsterte sich. »Tja, selbst schuld: Wenn sich drei Raufbolde bei der Kirchweih einen Spaß daraus machen, einen Bettler auf dem Rollbrett mit dem Messer zu bedrohen – und du so dumm bist, ihn in Schutz zu nehmen, was, wie man siehst, nicht spurlos an mir vorübergegangen ist – dann hast du verdammt noch mal schlechte Karten. Hätte ich mich rausgehalten und so getan, als bekäme ich von dem Gezänk nichts mit, mir wäre eine Menge erspart geblieben. Zwei Wochen Kerker bei Wasser und Schwarzbrot wegen Störung der öffentlichen Ordnung sind nicht so ohne, oder was meinst du dazu?«
»Lass uns aufhören zu streiten«, lenkte Luzia begütigend ein, legte die Hand auf Plattners Schulter und sagte: »Ein Unding, wenn ausgerechnet wir uns in die Haare bekämen.«
»Nichts dagegen.« Lutz setzte ein schalkhaftes Lächeln auf. »Zu zweit sind wir unbesiegbar, die Nachbarn in der Franziskanergasse konnten ein Lied davon …«
»Schau mal, da drüben!«, fiel Luzia dem Jugendfreund ins Wort, deutete auf die Mainbrücke, von der sie nur ein paar Steinwürfe trennten, raffte ihr Gewand und erhob sich von ihrem Platz. »Was ist denn da los, wo kommen denn auf einmal die vielen Leute her?«
»Das möchte ich auch wissen«, murrte Lutz, sprang auf und zog seinen Uniformrock an. Die Handkante an der Stirn, um sich gegen die Sonne abzuschirmen, kniff der Gesetzeshüter die blaugrünen Augen zusammen. Nur um Luzia mit einer Kinnbewegung zum Aufbruch zu drängen, den Schwertgurt in der Hand, den er beim Davoneilen um die Taille schlang. »Eine Zusammenrottung am Brückentor, das hat mir gerade noch gefehlt. Nichts wie hin, bevor das Gezänk aus dem Ruder läuft!«